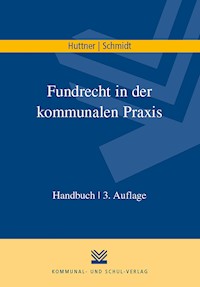
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kommunal- und Schul-Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Das Thema "Fundrecht" ist für die meisten Gemeinden eine unliebsame Pflichtaufgabe, die mit viel Aufwand verbunden ist. Die Rechtsmaterie ist der konkurrierenden Gesetzgebung zuzurechnen. Durch die Vorschriften des Fundrechts im Bürgerlichen Gesetzbuch hat der Bund von seinem Gesetzgebungsrecht Gebrauch gemacht. Die Länder haben deshalb die Möglichkeit, Regelungen zum (Verwaltungs-) Verfahren zu treffen. Dies ist in allen Bundesländern geschehen und in das Werk eingearbeitet. Aufgabe des Werks "Fundrecht in der kommunalen Praxis" ist der Praxis das tägliche Geschäft des Fundwesens durch rechtliche Hinweise, Muster und Zusammenfassungen der Thematik näher zu bringen und Hilfestellung zu geben. Änderungen des Gesetzgebers mit der Zielrichtung der Rechtsklarheit, das Fundrecht den heutigen Lebensbedingungen und Wirtschaftsverhältnissen anzupassen, sind in diesem Werk berücksichtigt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 339
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fundrecht in derkommunalen Praxis
Handbuch
von
Georg HuttnerOberamtsrat a. D.
Uwe SchmidtHauptamtlicher Dozent beimHessischen Verwaltungsverband,Verwaltungsseminar Kassel
3. Auflage
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
© Copyright 2012 Kommunal- und Schul-Verlag GmbH & Co. KG · Wiesbaden
3. Auflage 2018
Alle Rechte vorbehalten
Satz: C.H.Beck.Media.Solutions · Nördlingen
ISBN 978-3-8293-1368-1
eISBN 978-3-8293-1401-5
Inhaltsübersicht
Abkürzungsverzeichnis
Vorbemerkungen
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) – Textauszug –
Erläuterungen zu den §§ 965 bis 984 BGB
§ 965Anzeigepflicht des Finders
§ 966Verwahrungspflicht
§ 967Ablieferungspflicht
§ 968Umfang der Haftung
§ 969Herausgabe an den Verlierer
§ 970Ersatz von Aufwendungen
§ 971Finderlohn
§ 972Zurückbehaltungsrecht des Finders
§ 973Eigentumserwerb des Finders
§ 974Eigentumserwerb nach Verschweigung
§ 975Rechte des Finders nach Ablieferung
§ 976Eigentumserwerb der Gemeinde
§ 977Bereicherungsanspruch
§ 978Fund in öffentlicher Behörde oder Verkehrsanstalt
§ 979Verwertung; Verordnungsermächtigung
§ 980Öffentliche Bekanntmachung des Fundes
§ 981Empfang des Versteigerungserlöses
§ 982Ausführungsvorschriften
§ 983Unanbringbare Sachen bei Behörden
§ 984Schatzfund
Anhang
1.Ausführungs- und Zuständigkeitsvorschriften des Bundes und der Bundesländer
1.1Bund
1.2Baden-Württemberg
1.3Bayern
1.4Berlin
1.5Brandenburg
1.6Bremen
1.7Hamburg
1.8Hessen
1.9Mecklenburg-Vorpommern
1.10Niedersachsen
1.11Nordrhein-Westfalen
1.12Rheinland-Pfalz
1.13Saarland
1.14Sachsen
1.15Sachsen-Anhalt
1.16Schleswig-Holstein
1.17Thüringen
2.Muster
2.1Muster einer Fundanzeige
2.2Muster einer Empfangsbescheinigung bei Herausgabe an den Finder
2.3Muster einer Aufforderung zur Abholung des Fundes an den Finder
2.4Empfangsbescheinigung einer Fundsache durch den Empfangsberechtigten/Verlierer
2.5Muster einer Dienstanweisung für die Behandlung von Fundsachen
2.6Muster einer Vereinbarung mit einem Tierheim bezüglich dort verwahrter Tiere im Auftrag der Fundbehörde
3.Rechtsprechung
4.Begriffe aus dem Fundrecht
5.Checkliste bei der Behandlung von Fundsachen durch die Fundbehörde
6.Checkliste bei aufgefundenen Tieren
Stichwortverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
a. A.
=anderer Ansicht
ABl.
=Amtsblatt
Abs.
=Absatz
ADAC
=Allgemeiner Deutscher Automobil Club
AG
=Amtsgericht
AGBGB
=Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
AGJusG
=Ausführungsgesetz Justizgesetze
AllMBl.
=Allgemeines Ministerialblatt
AllZustVOKom
=Allgemeine Zuständigkeitsverordnung für die Gemeinden und Landkreise zur Ausführung von Bundesrecht
Amtsbl.
=Amtsblatt
Anh.
=Anhang
Anz.
ArbG
=Arbeitsgericht
Art.
=Artikel
ASOG
=Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz Berlin
Az.
Bay.
=Bayern, bayerisch
BayDSchG
=Denkmalschutzgesetz Bay.
BayRS
=Bay. Rechtssammlung
BayVGH
=Bayerischer Verwaltungsgerichtshof
Bbg
=Brandenburg
BbgDSchG
=Denkmalschutzgesetz Bbg.
BeckRS
BerlDSchG
=Denkmalschutzgesetz Berlin
BGB
=Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl.
=Bundesgesetzblatt
BGH
=Bundesgerichtshof
BGHSt
=Entscheidungen des BGH in Strafsachen
BGHZ
=Entscheidungen des BGH in Zivilsachen
BJagdG
BOKraft
=Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr
BörsenG
=Börsengesetz
BrDSchG
=Denkmalschutzgesetz Brem.
Brem.
=Bremen
BVerwG
BW
=Baden-Württemberg
BWDSchG
=Denkmalschutzgesetz BW
BWGZ
=Die Gemeinde (Zeitschrift)
bzgl.
=bezüglich
Deubner
d. h.
=das heißt
DSchG
=Denkmalschutzgesetz
DSchG RhPf
=Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz
DVBl
=Deutsches Verwaltungsblatt (Zeitschrift)
EDV
=Elektronische Datenverarbeitung
Erl.
=Erläuterungen
f., ff.
=fortfolgende(r)
FundRZustV
=Verordnung über die Zuständigkeit im Fundrecht
FundSAnw
=Fundsachenanweisung
FundV/Fund-VO
=Fundverordnung
GABl.
=Gemeinsames Amtsblatt Baden-Württemberg
GBl.
=Gesetzblatt
gem.
=gemäß
GemHVO
=Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO
GemO
=Gemeindeordnung
GG
=Grundgesetz
ggf.
=gegebenenfalls
GKZ
=Gesetz über kommunale Zusammenarbeit
GVBl., GVOBl.
=Gesetz- und Verordnungsblatt
HambgDSchG
=Denkmalschutzgesetz Hamburg
HDSchG
=Denkmalschutzgesetz Hessen
Hess./HE/H
=Hessen/hessisches
HGB
=Handelsgesetzbuch
h. M.
=herrschende Meinung
IM
inkl.
=inklusive
i. S.
=im Sinne
i. V. m.
=in Verbindung mit
Juris
KAG
=Kommunalabgabengesetz
KG
=Kammergericht
LG
=Landgericht
LSA
LSADSchG
=Denkmalschutzgesetz LSA
MABl./MBl./MinBl.
MDR
=Monatsschrift für deutsches Recht (Zeitschrift)
m. E.
=meines Erachtens
M-VDSchG
=Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern
Nds.
=Niedersachsen
NdsDSchG
=Denkmalschutzgesetz Nds.
NJW
NJW-RR
NVwZ
NVwZ-RR
Verwaltungsrecht
NZV
OLG/ObLG
=Oberlandesgericht
OVG
=Oberverwaltungsgericht
PAG
=Polizeiaufgabengesetz
PIN
=Geheimzahl für Home Banking
PolG
=Polizeigesetz
RdNr.
=Randnummer(n)
RegBl.
=Regierungsblatt
RGBl.
=Reichsgesetzblatt
s.
=siehe
S.
=Seite
SäDSchG
=Denkmalschutzgesetz Sachsen
SchlHA
=Schleswig-Holsteinischer Anzeiger
SDSchG
=Denkmalschutzgesetz Saarland
SHDSchG
=Denkmalschutzgesetz Schleswig-Holstein
SMBl.
s. o.
=siehe oben
SOG
=Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
sog.
=sogenannte(r)
SprengG
=Sprengstoffgesetz
StGB
=Strafgesetzbuch
ThürDSchG
=Denkmalschutzgesetz Thüringen
ThürStAnz.
=Thüringer Staatsanzeiger
TierSchG
u. U.
=unter Umständen
VG
=Verwaltungsgericht
VGH
=Verwaltungsgerichtshof
vgl.
=vergleiche
VO
=Verordnung
VOBlBrZ
VVG
=Versicherungsvertragsgesetz
VwGO
=Verwaltungsgerichtsordnung
VwV
=Verwaltungsvorschrift
VwVfG
=Verwaltungsverfahrensgesetz
WaffG
WaffVwV
=Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Waffengesetz
z. B.
=zum Beispiel
Ziff.
=Ziffer
ZPO
=Zivilprozessordnung
ZustVO
=Zuständigkeitsverordnung
Vorbemerkungen
Das Thema „Fundsachen“ ist den meisten Gemeinden ein Dorn im Auge, birgt es doch eine äußerst unliebsame Pflichtaufgabe, welche mit viel Aufwand verbunden ist. Aufgabe dieser Erläuterungen ist es, der Praxis dieses tägliche Geschäft des Fundwesens durch rechtliche Hinweise, Muster und Zusammenfassung der Thematik näher zu bringen und Hilfestellung zu geben.
Die Grundelemente des Fundrechts sind seit seiner Regelung durch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) vom 18.8.1896 (RGBl. S. 195) in den §§ 965 bis 984 im Wesentlichen unverändert geblieben. Dieser hundertjahrelange Rechtszustand zeugt von seiner bewährten Qualität und den soliden Rechtsgedanken. Änderungen des Gesetzgebers mit der Zielrichtung der Rechtsklarheit, die Materie den heutigen Lebensbedingungen und Wirtschaftsverhältnissen sowie der Euro-Umstellung anzupassen, sind in diesem Werk eingearbeitet.
Das Fundrecht ist gem. Art. 74 Nr. 1 GG der konkurrierenden Gesetzgebung zuzurechnen (entsprechende Regelungen enthielten auch die Reichsverfassungen von 1871 und 1919). Durch die Vorschriften des Fundrechtes im BGB hat der Bund von seinem Gesetzgebungsrecht Gebrauch gemacht. Die Länder haben deshalb nur die Möglichkeit, Regelungen zum (Verwaltungs-)Verfahren zu treffen. Dies ist in allen Bundesländern geschehen.
Vorschriften über das Fundwesen sind größtenteils dem bürgerlichen Recht (Privatrecht), teils dem öffentlichen Recht zugehörig; dem Privatrecht dort, wo sich die Rechtsverhältnisse auf gleicher Ebene abspielen (z. B. Finder – Verlierer), dem öffentlichen Recht, wo ein Über- und Unterordnungsverhältnis besteht (z. B. Verwaltungsbehörde – Finder); es herrscht also eine „Zwitterstellung“. Die §§ 965 bis 984 BGB zählen zum Sachenrecht, wo allgemein die Herrschaftsrechte oder dinglichen Rechte geregelt sind, wobei die dortige Zugehörigkeit umstritten ist, da das Fundrecht auch wesentliche schuldrechtliche Verhältnisse (Eigentümer – Finder) aufweist.
Bei Streitfällen Finder – Verlierer aus dem Fundrecht ist grundsätzlich die ordentliche Gerichtsbarkeit und nicht die Verwaltungsgerichtsbarkeit zuständig. Auch die öffentlichrechtliche Verwahrung von Fundgegenständen durch die Fundbehörde und Schadensersatzansprüche sind nach § 40 Abs. 2 VwGO der ordentlichen Gerichtsbarkeit zugewiesen. Eine Ausnahme hiervon stellt z. B. die Erhebung von Verwaltungsgebühren durch die Fundbehörden dar sowie die Anordnung der Ablieferungspflicht eines Fundgegenstandes durch Verwaltungsakt, welche nach § 40 Abs. 1 VwGO der Verwaltungsgerichtsbarkeit unterliegt.
In erster Linie dient das Fundrecht dazu, dem Verlierer sein Vermögen zu erhalten. Dieses Ziel wird vor allem durch ein gesetzliches Schuldverhältnis mit Anzeige- und Erhaltungspflichten des Finders und der Fundbehörden verwirklicht. Daneben ist Ziel, die Bereinigung der Eigentumsordnung zu erreichen. Die Fundbehörden sind durch die Fundvorschriften als „Mittler“ zwischen Finder und Empfangsberechtigten eingeschaltet.
Das Fundrecht unterscheidet in diesem Unterabschnitt des BGB zwischen „normalen“ Funden und Funden bei „Behörden- und Verkehrsanstalten – öffentlichen Funden“ sowie dem „Schatzfund“.
In diesem Buch werden teilweise auch Auffassungen vertreten, welche in der Rechtsprechung umstritten sind. Es wird diesbezüglich die Rechtsauffassung des Autors (in Kurzformat) wiedergegeben. Hauptsächlich in der Literatur bestehen über die Auslegung der Fundvorschriften teilweise stark gegensätzliche Meinungen. Diese berühren jedoch nicht in erster Linie die Vorschriften über das Tätigwerden der Fundbehörden, sondern die Rechtsbeziehungen Finder – Verlierer.
Die Literatur zu diesem Thema ist sehr vielfältig und teilweise widersprüchlich, so dass auf ein Fundstellenverzeichnis verzichtet wird. Ganz bewusst ist dieses Werk praxisorientiert für die Gemeinden als Fundbehörden ausgerichtet. Juristische Einzelauslegungen sollen hier nicht vordergründlich einfließen. Diese Erläuterungen geben einen „Überblick“ über die rechtlichen Verhältnisse zum „Fundwesen“.
Wichtig sind die Anhänge mit Ländervorschriften, Mustern und Rechtsprechung mit Leit/Orientierungssätzen. Letztere sind im Einzelfall eine Entscheidungshilfe bei Auslegung der BGB-Fund-Vorschriften. Bei den einzelnen Vorschriften wird auf die jeweilige Rechtsprechung nicht Bezug genommen, weshalb ein Nachschlagen derselben empfehlenswert ist.
Dieses Fachbuch dient in erster Linie den Praktikern bei den Gemeinden in den Fundbehörden. Es wird versucht, die Fundvorschriften praxisnah darzustellen. Bei privatrechtlichen Vorgängen im Fundrecht empfiehlt sich bei Rechtsauskünften eine Zurückhaltung der Fundbehörden.
Bei einzelnen aufgefundenen Sachen gelten bei deren Verlust oder deren Wiederauffinden besondere Vorschriften, auf welche in diesem Werk nicht eingegangen wird, z. B. die besonderen Vorschriften des Waffen- und Sprengstoffrechts, im Pass- und Personalausweisrecht, nach der Fahrerlaubnis-Verordnung, der Fahrzeug-Zulassungsverordnung.
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 738),zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2787)
– Textauszug –
§ 90Begriff der Sache
Sachen im Sinne des Gesetzes sind nur körperliche Gegenstände.
§ 90aTiere
Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.
…
§ 958Eigentumserwerb an beweglichen herrenlosen Sachen
(1) Wer eine herrenlose bewegliche Sache in Eigenbesitz nimmt, erwirbt das Eigentum an der Sache.
(2) Das Eigentum wird nicht erworben, wenn die Aneignung gesetzlich verboten ist oder wenn durch die Besitzergreifung das Aneignungsrecht eines anderen verletzt wird.
§ 959Aufgabe des Eigentums
Eine bewegliche Sache wird herrenlos, wenn der Eigentümer in der Absicht, auf das Eigentum zu verzichten, den Besitz der Sache aufgibt.
§ 960Wilde Tiere
(1) Wilde Tiere sind herrenlos, solange sie sich in der Freiheit befinden. Wilde Tiere in Tiergärten und Fische in Teichen oder anderen geschlossenen Privatgewässern sind nicht herrenlos.
(2) Erlangt ein gefangenes wildes Tier die Freiheit wieder, so wird es herrenlos, wenn nicht der Eigentümer das Tier unverzüglich verfolgt oder wenn er die Verfolgung aufgibt.
(3) Ein gezähmtes Tier wird herrenlos, wenn es die Gewohnheit ablegt, an den ihm bestimmten Ort zurückzukehren.
§ 961Eigentumsverlust bei Bienenschwärmen
Zieht ein Bienenschwarm aus, so wird er herrenlos, wenn nicht der Eigentümer ihn unverzüglich verfolgt oder wenn der Eigentümer die Verfolgung aufgibt.
§ 962Verfolgungsrecht des Eigentümers
Der Eigentümer des Bienenschwarms darf bei der Verfolgung fremde Grundstücke betreten. Ist der Schwarm in eine fremde nicht besetzte Bienenwohnung eingezogen, so darf der Eigentümer des Schwarmes zum Zwecke des Einfangens die Wohnung öffnen und die Waben herausnehmen oder herausbrechen. Er hat den entstehenden Schaden zu ersetzen.
§ 963Vereinigung von Bienenschwärmen
Vereinigen sich ausgezogene Bienenschwärme mehrerer Eigentümer, so werden die Eigentümer, welche ihre Schwärme verfolgt haben, Miteigentümer des eingefangenen Gesamtschwarms; die Anteile bestimmen sich nach der Zahl der verfolgten Schwärme.
§ 964Vermischung von Bienenschwärmen
Ist ein Bienenschwarm in eine fremde besetzte Bienenwohnung eingezogen, so erstrecken sich das Eigentum und die sonstigen Rechte an den Bienen, mit denen die Wohnung besetzt war, auf den eingezogenen Schwarm. Das Eigentum und die sonstigen Rechte an dem eingezogenen Schwarm erlöschen.
§ 965Anzeigepflicht des Finders
(1) Wer eine verlorene Sache findet und an sich nimmt, hat dem Verlierer oder dem Eigentümer oder einem sonstigen Empfangsberechtigten unverzüglich Anzeige zu machen.
(2) Kennt der Finder die Empfangsberechtigten nicht oder ist ihm ihr Aufenthalt unbekannt, so hat er den Fund und die Umstände, welche für die Ermittlung der Empfangsberechtigten erheblich sein können, unverzüglich der zuständigen Behörde anzuzeigen. Ist die Sache nicht mehr als zehn Euro wert, so bedarf es der Anzeige nicht.
§ 966Verwahrungspflicht
(1) Der Finder ist zur Verwahrung der Sache verpflichtet.
(2) Ist der Verderb der Sache zu besorgen oder ist die Aufbewahrung mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden, so hat der Finder die Sache öffentlich versteigern zu lassen.
Vor der Versteigerung ist der zuständigen Behörde Anzeige zu machen. Der Erlös tritt an die Stelle der Sache.
§ 967Ablieferungspflicht
Der Finder ist berechtigt und auf Anordnung der zuständigen Behörde verpflichtet, die Sache oder den Versteigerungserlös an die zuständige Behörde abzuliefern.
§ 968Umfang der Haftung
Der Finder hat nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten.
§ 969Herausgabe an den Verlierer
Der Finder wird durch die Herausgabe der Sache an den Verlierer auch den sonstigen Empfangsberechtigten gegenüber befreit.
§ 970Ersatz von Aufwendungen
Macht der Finder zum Zwecke der Verwahrung oder Erhaltung der Sache oder zum Zwecke der Ermittlung eines Empfangsberechtigten Aufwendungen, die er den Umständen nach für erforderlich halten darf, so kann er von dem Empfangsberechtigten Ersatz verlangen.
§ 971Finderlohn
(1) Der Finder kann von dem Empfangsberechtigten einen Finderlohn verlangen. Der Finderlohn beträgt von dem Werte der Sache bis zu 500 Euro fünf vom Hundert, von dem Mehrwert drei vom Hundert, bei Tieren drei vom Hundert. Hat die Sache nur für den Empfangsberechtigten einen Wert, so ist der Finderlohn nach billigem Ermessen zu bestimmen.
(2) Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Finder die Anzeigepflicht verletzt oder den Fund auf Nachfrage verheimlicht.
§ 972Zurückbehaltungsrecht des Finders
Auf die in den §§ 970, 971 bestimmten Ansprüche finden die für die Ansprüche des Besitzers gegen den Eigentümer wegen Verwendungen geltenden Vorschriften der §§ 1000 bis 1002 entsprechende Anwendung.
§ 973Eigentumserwerb des Finders
(1) Mit dem Ablauf von sechs Monaten nach der Anzeige des Fundes bei der zuständigen Behörde erwirbt der Finder das Eigentum an der Sache, es sei denn, dass vorher ein Empfangsberechtigter dem Finder bekannt geworden ist oder sein Recht bei der zuständigen Behörde angemeldet hat. Mit dem Erwerb des Eigentums erlöschen die sonstigen Rechte an der Sache.
(2) Ist die Sache nicht mehr als zehn Euro wert, so beginnt die sechsmonatige Frist mit dem Fund. Der Finder erwirbt das Eigentum nicht, wenn er den Fund auf Nachfrage verheimlicht. Die Anmeldung eines Rechts bei der zuständigen Behörde steht dem Erwerb des Eigentums nicht entgegen.
§ 974Eigentumserwerb nach Verschweigung
Sind vor dem Ablauf der sechsmonatigen Frist Empfangsberechtigte dem Finder bekannt geworden oder haben sie bei einer Sache, die mehr als zehn Euro wert ist, ihre Rechte bei der zuständigen Behörde rechtzeitig angemeldet, so kann der Finder die Empfangsberechtigten nach der Vorschrift des § 1003 zur Erklärung über die ihm nach den §§ 970 bis 972 zustehenden Ansprüche auffordern. Mit dem Ablauf der für die Erklärung bestimmten Frist erwirbt der Finder das Eigentum und erlöschen die sonstigen Rechte an der Sache, wenn nicht die Empfangsberechtigten sich rechtzeitig zu der Befriedigung der Ansprüche bereit erklären.
§ 975Rechte des Finders nach Ablieferung
Durch die Ablieferung der Sache oder des Versteigerungserlöses an die zuständige Behörde werden die Rechte des Finders nicht berührt. Lässt die zuständige Behörde die Sache versteigern, so tritt der Erlös an die Stelle der Sache. Die zuständige Behörde darf die Sache oder den Erlös nur mit Zustimmung des Finders einem Empfangsberechtigten herausgeben.
§ 976Eigentumserwerb der Gemeinde
(1) Verzichtet der Finder der zuständigen Behörde gegenüber auf das Recht zum Erwerb des Eigentums an der Sache, so geht sein Recht auf die Gemeinde des Fundorts über.
(2) Hat der Finder nach der Ablieferung der Sache oder des Versteigerungserlöses an die zuständige Behörde auf Grund der Vorschriften der §§ 973, 974 das Eigentum erworben, so geht es auf die Gemeinde des Fundorts über, wenn nicht der Finder vor dem Ablauf einer ihm von der zuständigen Behörde bestimmten Frist die Herausgabe verlangt.
§ 977Bereicherungsanspruch
Wer infolge der Vorschriften der §§ 973, 974, 976 einen Rechtsverlust erleidet, kann in den Fällen der §§ 973, 974 von dem Finder, in den Fällen des § 976 von der Gemeinde des Fundorts die Herausgabe des durch die Rechtsänderung Erlangten nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung fordern. Der Anspruch erlischt mit dem Ablauf von drei Jahren nach dem Übergang des Eigentums auf den Finder oder die Gemeinde, wenn nicht die gerichtliche Geltendmachung vorher erfolgt.
§ 978Fund in öffentlicher Behörde oder Verkehrsanstalt
(1) Wer eine Sache in den Geschäftsräumen oder den Beförderungsmitteln einer öffentlichen Behörde oder einer dem öffentlichen Verkehr dienenden Verkehrsanstalt findet und an sich nimmt, hat die Sache unverzüglich an die Behörde oder die Verkehrsanstalt oder an einen ihrer Angestellten abzuliefern. Die Vorschriften der §§ 965 bis 967 und 969 bis 977 finden keine Anwendung.
(2) Ist die Sache nicht weniger als 50 Euro wert, so kann der Finder von dem Empfangsberechtigten einen Finderlohn verlangen. Der Finderlohn besteht in der Hälfte des Betrags, der sich bei Anwendung des § 971 Abs. 1 Satz 2, 3 ergeben würde. Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Finder Bediensteter der Behörde oder der Verkehrsanstalt ist oder der Finder die Ablieferungspflicht verletzt. Die für die Ansprüche des Besitzers gegen den Eigentümer wegen Verwendungen geltende Vorschrift des § 1001 findet auf den Finderlohnanspruch entsprechende Anwendung. Besteht ein Anspruch auf Finderlohn, so hat die Behörde oder die Verkehrsanstalt dem Finder die Herausgabe der Sache an einen Empfangsberechtigten anzuzeigen.
(3) Fällt der Versteigerungserlös oder gefundenes Geld an den nach § 981 Abs. 1 Berechtigten, so besteht ein Anspruch auf Finderlohn nach Absatz 2 Satz 1 bis 3 gegen diesen. Der Anspruch erlischt mit dem Ablauf von drei Jahren nach seiner Entstehung gegen den in Satz 1 bezeichneten Berechtigten.
§ 979Verwertung; Verordnungsermächtigung
(1) Die Behörde oder die Verkehrsanstalt kann die an sie abgelieferte Sache öffentlich versteigern lassen. Die öffentlichen Behörden und die Verkehrsanstalten des Reichs, der Bundesstaaten und der Gemeinden können die Versteigerung durch einen ihrer Beamten vornehmen lassen.
(1a) Die Versteigerung kann nach Maßgabe der nachfolgenden Vorschriften auch als allgemein zugängliche Versteigerung im Internet erfolgen.
(1b) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates für ihren Bereich Versteigerungsplattformen zur Versteigerung von Fundsachen zu bestimmen; sie kann diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die fachlich zuständigen obersten Bundesbehörden übertragen. Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung für ihren Bereich entsprechende Regelungen zu treffen; sie können die Ermächtigung auf die fachlich zuständigen obersten Landesbehörden übertragen. Die Länder können Versteigerungsplattformen bestimmen, die sie länderübergreifend nutzen. Sie können eine Übertragung von Abwicklungsaufgaben auf die zuständige Stelle eines anderen Landes vereinbaren.
(2) Der Erlös tritt an die Stelle der Sache.
§ 980Öffentliche Bekanntmachung des Fundes
(1) Die Versteigerung ist erst zulässig, nachdem die Empfangsberechtigten in einer öffentlichen Bekanntmachung des Fundes zur Anmeldung ihrer Rechte unter Bestimmung einer Frist aufgefordert worden sind und die Frist verstrichen ist; sie ist unzulässig, wenn eine Anmeldung rechtzeitig erfolgt ist.
(2) Die Bekanntmachung ist nicht erforderlich, wenn der Verderb der Sache zu besorgen oder die Aufbewahrung mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist.
§ 981Empfang des Versteigerungserlöses
(1) Sind seit dem Ablauf der in der öffentlichen Bekanntmachung bestimmten Frist drei Jahre verstrichen, so fällt der Versteigerungserlös, wenn nicht ein Empfangsberechtigter sein Recht angemeldet hat, bei Reichsbehörden und Reichsanstalten an den Reichsfiskus, bei Landesbehörden und Landesanstalten an den Fiskus des Bundesstaates, bei Gemeindebehörden und Gemeindeanstalten an die Gemeinde, bei Verkehrsanstalten, die von einer Privatperson betrieben werden, an diese.
(2) Ist die Versteigerung ohne die öffentliche Bekanntmachung erfolgt, so beginnt die dreijährige Frist erst, nachdem die Empfangsberechtigten in einer öffentlichen Bekanntmachung des Fundes zur Anmeldung ihrer Rechte aufgefordert worden sind. Das Gleiche gilt, wenn gefundenes Geld abgeliefert worden ist.
(3) Die Kosten werden von dem herauszugebenden Betrag abgezogen.
§ 982Ausführungsvorschriften
Die in den §§ 980, 981 vorgeschriebene Bekanntmachung erfolgt bei Reichsbehörden und Reichsanstalten nach den von dem Bundesrat, in den übrigen Fällen nach den von der Zentralbehörde des Bundesstaats erlassenen Vorschriften.
Hinweis: Bekanntmachung vom 16.6.1898 (RGBl. I S. 912). Nach Art. 129 GG ist jetzt der Bundesminister des Innern zuständig.
§ 983Unanbringbare Sachen bei Behörden
Ist eine öffentliche Behörde im Besitz einer Sache, zu deren Herausgabe sie verpflichtet ist, ohne dass die Verpflichtung auf Vertrag beruht, so finden, wenn der Behörde der Empfangsberechtigte oder dessen Aufenthalt unbekannt ist, die Vorschriften der §§ 979 bis 982 entsprechende Anwendung.
§ 984Schatzfund
Wird eine Sache, die so lange verborgen gelegen hat, dass der Eigentümer nicht mehr zu ermitteln ist (Schatz), entdeckt und infolge der Entdeckung in Besitz genommen, so wird das Eigentum zur Hälfte von dem Entdecker, zur Hälfte von dem Eigentümer der Sache erworben, in welcher der Schatz verborgen war.
Erläuterungen zu den §§ 965 bis 984 BGB
(Hinweis: Siehe die Leit/Orientierungssätze der Rechtsprechungzum Fundrecht unter Anhang 3)
– Kommentar –
§ 965Anzeigepflicht des Finders
(1) Wer eine verlorene Sache findet und an sich nimmt, hat dem Verlierer oder dem Eigentümer oder einem sonstigen Empfangsberechtigten unverzüglich Anzeige zu machen.
(2) Kennt der Finder die Empfangsberechtigten nicht oder ist ihm ihr Aufenthalt unbekannt, so hat er den Fund und die Umstände, welche für die Ermittlung der Empfangsberechtigten erheblich sein können, unverzüglich der zuständigen Behörde anzuzeigen. Ist die Sache nicht mehr als zehn Euro wert, so bedarf es der Anzeige nicht.
Erläuterungen
Übersicht
1.Allgemeines
2.Zu Absatz 1
2.1Begriff „Fund“
2.2Begriff „Fundsache“
2.3Begriff „Empfangsberechtigter/Verlierer“
2.4Begriff „Finder“ und „Ansichnehmen“
2.5Der „Besitzdiener“ als Finder
2.6Begriff „verlorene Sache“
2.7Was sind „herrenlose Sachen“?
2.8Was gilt für „Tiere“?
2.9Gestohlene Sachen
2.10Die „Anzeigepflicht“ an den Empfangsberechtigten
3.Zu Absatz 2
3.1Anzeigepflicht an die Behörde
3.2Die Fundanzeige
3.3Die Gemeinde als Fundbehörde
3.4Übersicht über die zuständigen Fundbehörden
3.5Nachforschungspflicht des Finders
3.6Zusammenarbeit Fundbehörde – Polizei/Autobahnmeistereien
3.7Klein/Bagatellfunde
3.8Die Fundunterschlagung
3.9Funddiebstahl
3.10Zivilrechtliche Folgen der Verletzung der Anmeldepflicht
3.11Anwendung der Vorschrift auf den öffentlichen Fund
1.Allgemeines
Die Bestimmungen über den Fund dienen in erster Linie, dem Verlierer/Empfangsberechtigten sein Eigentum/seinen Besitz zu erhalten. Weiter beinhalten die Fundvorschriften eine besondere Art des Eigentumserwerbs.
Die Anzeigepflichten sind verflochten mit den §§ 966 und 967 BGB. Zuerst hat der Finder, soweit ersichtlich, den Empfangsberechtigten unverzüglich im Sinne des § 121 BGB (ohne schuldhaftes Verzögern) zu benachrichtigen, was ein Schuldverhältnis beinhaltet.
Ansonsten besteht eine Pflicht zur unverzüglichen (im Sinne von § 121 BGB) Anzeige bei der zuständigen Fundbehörde, also ohne schuldhaftes Verzögern.
Siehe die Leit/Orientierungssätze der Rechtsprechung zum Thema unter Anhang 3.
2.Zu Absatz 1
Der Finder hat die Fundsache oder deren Versteigerungserlöse an Empfangsberechtigte herauszugeben, wenn diese Herausgabeansprüche stellen (§§ 985, 1007 BGB).
2.1Begriff „Fund“
Unter Fund versteht man den Vorgang des Findens, d. h., die Entdeckung einer verlorenen, vollkommen besitzlosen Sache. Dieser Vorgang des Findens stellt noch kein Rechtsgeschäft dar.
2.2Begriff „Fundsache“
Fundsachen sind nur verlorene Sachen, dies sind (körperliche) Sachen, welche dem Besitzer zufällig und nicht nur vorübergehend abhanden gekommen sind, demnach also besitzlos werden. Gefunden werden können nur „bewegliche“ Sachen, also nicht z. B. ein Grundstück oder Rechte, jedoch Sachen, welche ein Recht verkörpern, z. B. Sparbücher, Aktien. Die Größe einer diesbezüglichen beweglichen Sache spielt keine Rolle. Tiere sind zwar keine Sachen, werden jedoch nach § 90a BGB diesen gleichgestellt. Personen, z. B. Vermisste, fallen nicht unter das Fundrecht. Eine Fundsache ist nur gegeben, wenn diese einem Besitzer gehörte und der Besitz an der Sache nur zufällig aufgehoben worden ist. Eine herrenlose Sache ist grundsätzlich keine Fundsache.
2.3Begriff „Empfangsberechtigter/Verlierer“
Empfangsberechtigter ist jeder, der nach den Grundsätzen des BGB Herausgabe der Sache verlangen kann, also jeder, der an der Sache vor dem Verlust unmittelbaren oder mittelbaren Besitz hatte. Dies z. B. als Mieter (§ 535 BGB), ein Entleiher (§ 598 BGB), ein Pfandleiher (§ 1205 BGB), aus dem Eigentum (§ 985 BGB), einem beschränkt dinglichen Recht (§§ 1065, 1227 BGB) oder aus früherem Besitz (§ 1007 BGB). Regelmäßig ist dies der „Verlierer“. Siehe jedoch weiter bei § 969 BGB. Ein Dieb ist z. B. nicht empfangsberechtigt (§ 1007 Abs. 3 BGB). Besitzdiener (§ 855 BGB) sind nicht Besitzer.
Verlierer ist der letzte rechtmäßige unmittelbare Besitzer der verlorenen Sache; dieser hat die Sache unfreiwillig verloren. Dies muss nicht stets auch gleichzeitig der Eigentümer sein. Der Verlust ist kein Rechtsgeschäft, so dass auch der Geschäftsunfähige eine Sache verlieren kann.
Eigentümer ist, wer die unmittelbare rechtliche Herrschaft über die Sache (also nicht über Rechte) ausübt. Eigentum bedeutet Totalherrschaft, dies jedoch wiederum nicht schrankenlos.
2.4Begriff „Finder“ und „Ansichnehmen“
Finder einer verloren gegangenen Sache ist derjenige, der sie nach ihrer Entdeckung in Besitz nimmt. Ansichnehmen bedeutet, dass der Fund einer Besitzbegründung unterliegt; der Finder erlangt die tatsächliche Gewalt, also den unmittelbaren Besitz. Finder ist also nicht derjenige, welcher den Fund findet, sondern derjenige, welcher diesen als erster in Besitz nimmt und damit die Verantwortung für den Fund übernimmt, dies als Realakt.
Beispiel:
–Wer eine verlorene Katze in seinem Grundstück regelmäßig füttert, begeht noch keine Besitzbegründung, wenn nicht weitere Merkmale der Besitzbegründung, des Willens hierzu nach § 854 Abs. 1 BGB hinzukommen.
Der Finder ist sog. „Fremdbesitzer“, d. h., er ist unmittelbarer Besitzer, der aufgrund eines Besitzmittlungsverhältnisses einen Fund als ihm nicht gehörend besitzt. Auf der Grundlage des § 965 BGB übt er die tatsächliche Gewalt aus (tatsächliches Herrschaftsverhältnis nach § 854 BGB). Durch das Finden und Ansichnehmen entsteht eine Art Geschäftsführung ohne Auftrag, welche im Gesetz besonders geregelt ist. Wo das Gesetz schweigt, müssen die allgemeinen Regeln über Geschäftsführung ohne Auftrag ergänzend herangezogen werden. Der Finder genügt seiner Verwahrungspflicht auch dann, wenn er die Sache bei einem Dritten hinterlegt. Zur ausreichenden Verwahrungspflicht gehört auch die Erhaltung der Sache (z. B. Füttern eines Tieres). Während der Verwahrungszeit ist der Finder Besitzer der Sache.
Wer eine verlorene Sache nur aufnimmt, um sie zu besichtigen, sie danach unverzüglich wieder zurücklegt, ist nicht als Finder anzusehen, er ergreift nicht den Besitz an der Sache. Erst durch den Akt des Ansichnehmens macht der Finder deutlich, dass sich die Sache nunmehr bei ihm befindet, er sich dieser annimmt, dies mit den Konsequenzen des Fundrechts.
Also ist bei mehreren „Findern“ entscheidend, wer die Fundsache in „Besitz“ nimmt und damit auch verantwortlich ist. Finden mehrere Personen eine Sache, so ist derjenige Finder, der die Sache an sich nimmt, also dann die tatsächliche Gewalt ausübt.
Im Gegensatz zum Besitz steht das Eigentum, welches der Finder u. U. gem. § 974 BGB erwerben kann. Eigentum ist die unmittelbare rechtliche Herrschaft über eine Sache (Fahrniseigentum).
Besitzer und Eigentümer haben die bürgerlichen Rechte gegen Störungen und Beeinträchtigungen inne.
Finden ist eine Tat/Realhandlung, setzt also nicht Geschäftsfähigkeit nach § 104 BGB voraus (in der Literatur umstritten). Bezüglich der Finderpflichten haften danach die gesetzlichen Vertreter des geschäftsunfähigen Finders.
2.5Der „Besitzdiener“ als Finder
Ein sog. Besitzdiener i. S. von § 855 BGB findet eine Sache für den Besitzer. Der Besitzdiener erwirbt trotz tatsächlicher Sachherrschaft keinen Besitz, wenn die Sicherstellung verlorener Sachen zu seinen Dienstpflichten gehört (so regelmäßige Rechtsprechung). Wenn ein Angestellter bei der Ablieferung einer Fundsache an den Arbeitgeber erklärt, er behalte sich die Finderrechte vor, so ist dies unmaßgebend; er ist nicht rechtlicher Finder. Wenn die Ablieferung nicht zu seinen Dienstpflichten gehört, kann nach der herrschenden Meinung auch ein Besitzdiener Finder werden. Im Einzelfall wird hierzu eine Auslegung der Vertragsverhältnisse erforderlich werden; dies ist jedoch nicht Aufgabe der Fundbehörden, sondern ggf. der Gerichte.
Siehe auch diesbezüglich die Rechtsprechung unter Anhang 3.
Beispiele:
–Findet eine Reinemachefrau im Warteraum der Arztpraxis eine liegen gebliebene Handtasche, so ist sie im Rahmen ihres Arbeitsverhältnisses als Besitzdienerin anzusehen. Finder ist der Inhaber der Arztpraxis.
–Eine Platzanweiserin, die vertraglich verpflichtet ist, den Theaterraum auf verlorene Gegenstände zu durchsuchen und Fundsachen bei der Geschäftsleitung abzugeben, erwirbt den Besitz an der Sache nicht für sich selbst, sondern als Besitzdienerin für ihren Arbeitgeber.
–Ein Fabrikarbeiter findet auf dem Betriebsgelände die Brieftasche eines Kunden. In diesem Fall ist er Finder, da er nicht mit dieser Pflicht des Findens beauftragt ist.
–Ein Bote findet in Ausübung seines Dienstes auf der Straße eine Fundsache. In diesem Fall ist er Finder, nicht sein Auftraggeber.
Polizeibedienstete, Bedienstete des Landes oder der Kommunen sind regelmäßig durch Verwaltungsvorschrift oder Dienstanweisung Besitzdiener in Ausübung ihrer Tätigkeit.
2.6Begriff „verlorene Sache“
Gefunden werden kann nur eine verlorene Sache. Im Gesetz ist dieser Begriff nicht definiert. Verloren sind solche beweglichen Sachen, die dem Besitzer zufällig und nicht nur vorübergehend abhanden gekommen sind, ohne dass ein anderer auf diesen Besitzverlust in der Weise eingewirkt hat, dass er damit für sich oder einen Dritten sofort wieder ein Besitzverhältnis begründet hat. Weiter ist Voraussetzung, dass der Verlierer (bisheriger Eigentümer oder Besitzer) nicht weiß, wo sich die verlorene Sache befindet.
Vom Besitzer versteckte oder verlegte Sachen gelten nicht als verloren. Eine versteckte Sache kann evtl. zur verlorenen Sache werden, wenn der Eigentümer sich nicht mehr an den Ort seines „Verstecks“ erinnern kann.
Die vom Besitzdiener bewusst, aber ohne Wissen und Willen des Besitzers aufgegebene Sache ist letzterem verloren; Entsprechendes gilt beim mittelbaren Besitzer.
Eine herrenlose Sache ist also keine Fundsache. Eine verlorene Sache wird durch den Finder zur Fundsache. Verloren ist eine Sache, die nach Besitzrecht besitzlos, aber nicht herrenlos ist. Die verlorene Sache wird nicht am Eigentumsrecht, sondern am Besitzrecht festgemacht. Verloren können nur bewegliche Sachen sein (§ 90 BGB) und Tiere (§ 90a BGB). Bei einer versteckten Sache kommt es darauf an, ob nach den äußeren Umständen die Rückkehr an den Belegungsort möglich ist, dass die Sachherrschaft wieder aufgenommen werden kann. Auch z. B. bei in Läden gefundenen Sachen ist ein Fundvorgang anzunehmen, da auch hier die Interessen Finder/Verlierer zu berücksichtigen sind.
Beispiele:
–Verloren ist z. B. der Schlüssel, der beim Zücken des Geldbeutels auf die Straße fällt.
–Die Sache, welche in der eigenen Wohnung verlegt wurde, ist noch nicht verloren. Sie wird erst zur verlorenen Sache, wenn die Wohnung aufgegeben wird.
–Ein von einem fünfjährigen Kind weggeworfener Geldbeutel (Dereliktion [= Besitzaufgabe] erfordert Geschäftsfähigkeit) gilt als verloren.
–Das vom Dieb weggeworfene Diebesgut ist verloren. Dies gilt auch für ein vom Dieb stehen gelassenes Fahrzeug.
–Entlaufene, verirrte bzw. verlorengegangene Tiere sind als Fundsachen zu behandeln.
–Nicht verloren ist das Buch, das der Eigentümer in seiner Bibliothek nicht mehr finden kann.
–Vergisst ein Geschäftspartner nach einer Besprechung in einer Firma seinen Geldbeutel, so wird dieser nicht besitzlos und gilt dann nicht als verloren.
–Wenn ein Gast eines Zimmers in einem Hotel eine Sache liegen lässt, verliert er sie erst, wenn er die tatsächliche Gewalt über das Zimmer aufgibt, also auszieht.
Ist ihm jedoch bewusst, dass er die Sache genau dort zurückgelassen hat und hat die Absicht, diese wieder abzuholen, liegt wohl kein Fundvorgang vor. Der Hotelbesitzer hat bis dahin eine Verwahrungspflicht. Lässt der Gast jedoch bewusst eine Sache im Hotelzimmer zurück, um den Besitz aufzugeben, so ist die Sache herrenlos und keine Fundsache.
Der Verlust einer Sache stellt kein Rechtsgeschäft dar, weshalb auch ein Minderjähriger eine Sache verlieren kann.
Zu diesem Thema haben die Bundesländer teilweise Verwaltungsvorschriften erlassen. Siehe hierzu das jeweilige Landesrecht in Anhang 1.1 ff.
2.7Was sind „herrenlose Sachen“?
Herrenlose Sachen sind nicht verloren, in niemandem Eigentum stehend und damit nicht dem Fundrecht zuzurechnen. Insofern entfällt eine Mitwirkung der Fundbehörde. Wer eine herrenlose bewegliche Sache in Besitz nimmt (okkupiert), der erwirbt gem. § 958 BGB deren Eigentum, es sei denn, die Aneignung war gesetzlich verboten (z. B. nach Naturschutzrecht, Jagdrecht, abgestellter Hausmüll oder Sperrgut) oder ein Aneignungsrecht anderer wurde verletzt. Eine bewegliche Sache wird herrenlos, wenn der Eigentümer den Besitz der Sache aufgibt (derelinquiert) in der Absicht, auf das Eigentum zu verzichten, also die Sachherrschaft zu verlieren. Der Aufgabewille des Eigentümers an der Sache muss eindeutig erkennbar sein. Herrenlos sind in aller Regel Sachen, die der Eigentümer beispielsweise auf den Gehweg stellt, damit sie bei der Schrottabfuhr mitgenommen werden. Bei diesem Beispiel überlagert jedoch die öffentlich-rechtliche Vorschrift, die Sache dem Abfallbeseitigungspflichtigen zu überlassen, das allgemeine Erwerbsrecht nach § 958 BGB.
Verlegte oder vor dem Zugriff Dritter versteckte Sachen sind regelmäßig nicht besitzlos. Vergessene Sachen sind ebenfalls (z. B. ein Regenschirm in einer Gaststätte) nicht herrenlos.
Bezüglich herrenloser Sachen in Grundstücken – Schatzfund – (z. B. Fossilien) siehe bei § 984 BGB.
Beispiele:
–Bei zur Entsorgung von Sperrmüll bereitgestellten Abfällen ist der Verzichtswille klar. In der Bereitstellung zum Sperrmüll liegt jedoch keine Eigentumsaufgabe, sondern eine Eigentumsübertragung an den Träger der Müllabfuhr vor. Weiter überlagern die abfallrechtlichen Vorschriften den Umstand der angenommenen Herrenlosigkeit, nach welchen ein Aneignungsverbot besteht.
–Pfandflaschen und Dosen unterstehen der Rücknahmepflicht nach der Verpackungsverordnung. Wer diese weggeworfenen Gegenstände einsammelt und abgibt, eignet sich dieser Gegenstände an, da diese herrenlos sind.
–Ein Unfallarzt ist hoffnungslos überschuldet, gibt deshalb seine Arztpraxis auf, die Zulassung zurück und zieht ins Ausland. Seine Patientenkartei lässt er in der Praxis zurück. Die Patientenkartei ist damit herrenlos. Die Ordnungsbehörde hat die Patientenkartei jedoch aus Gefahrenabwehrgründen zu beschlagnahmen und, wenn sich der Arzt nicht meldet und die Behörde eine konkrete, nicht gefährdende Lösung der Bedrohung der öffentlichen Sicherheit vornehmen will, die Kartei einzuziehen/zu vernichten. Die Patientenunterlagen von Ärzten sind grundsätzlich zehn Jahre sicher aufzubewahren und können danach vernichtet werden.
–Das Ablegen einer EC-Karte in einen sich in den Geschäftsräumen einer Bank befindenden Abfallbehälter zum Zwecke der späteren Leerung und Müllentsorgung stellt keine Dereliktion i. S. des § 959 BGB dar.
–Entwendete, gestohlene Sachen sind in der Regel nicht herrenlos und bei Verlust durch den Dieb als Fundsache zu behandeln.
Sachen, welche in keinem Eigentum stehen, sind herrenlose Sachen.
Weggeworfene Gegenstände werden regelmäßig herrenlos. Da es sich hierbei um ein Rechtsgeschäft handelt, ist volle Geschäftsfähigkeit erforderlich. Anders jedoch bei aufgefundenen herrenlosen Sachen; hier ist Geschäftsfähigkeit nicht erforderlich.
Beispiel:
–Herrenlosigkeit ist zu verneinen, wenn ein Kind seinen Ball wegwirft in der Absicht, diesen nicht mehr haben zu wollen.
Wer eine herrenlose Sache in Besitz nimmt (sich aneignet), erwirbt nach § 958 BGB das Eigentum an dieser.
Versteckte, verlegte und vergessene Sachen können zu einer Fundsache werden, wenn der Besitzer nicht mehr damit rechnen kann, die Sache ohne weiteres wieder zu erlangen (z. B. durch Mangel an Erinnerungsvermögen). Teilweise kann hierdurch sogar ein Schatzfund entstehen.
2.8Was gilt für „Tiere?
Allgemeines
Die Situation bei „herrenlosen“ oder Fundtieren gestaltet sich als rechtlich und praktisch äußerst schwierig und ist sowohl in der Literatur als auch in der Rechtsprechung nicht eindeutig geklärt.
Die meisten aufgefundenen Haustiere sind nicht besitz- oder herrenlos, weil sie entweder (wie z. B. Katzen) immer wieder zum Eigentümer zurückkehren oder die äußeren Umstände darauf hinweisen, dass der Eigentümer sich der Tiere entledigen will.
Zu diesem Thema haben die Bundesländer teilweise Verwaltungsvorschriften erlassen. Siehe hierzu das jeweilige Landesrecht im Anhang 1.1 ff.
Zur Abgrenzung in der Praxis hat das Land Schleswig-Holstein im „Gemeinsamen Erlass der Ministerin für Natur und Umwelt und des Innenministers“ vom 30.6.1994 ausgeführt:
„Eine klare Abgrenzung von Fundtieren zu herrenlosen Tieren ist in der Praxis äußerst problematisch. Es ist naturgemäß zunächst nicht erkennbar, ob der bisherige Eigentümer das Eigentum an dem Tier aufgegeben hat oder nicht. In der Praxis wird deshalb zunächst davon auszugehen sein, dass es sich um ein Fundtier handelt, welches von dem Finder oder von der zuständigen Behörde zu verwahren und zu versorgen ist. Dies ist auch im Einklang mit § 1 TierSchG schon aus ethischen Gründen geboten (Ethik ist unteilbar), und zwar unabhängig von der Frage bezüglich ihrer Eigenschaft als Fundtiere. Dies gilt umso mehr, als nach § 3 Abs. 3 des TierSchG es verboten ist, ein im Haus, Betrieb oder sonst in Obhut des Menschen gehaltenes Tier auszusetzen oder es zurückzulassen, um sich seiner zu entledigen. Zudem ist nach Einfügung des § 90a BGB das Tier keine Sache mehr. Somit kann der Eigentümer mit seinem Tier nur unter Beachtung der Tierschutzbestimmungen (s. § 903 Satz 2 BGB) verfahren. Die Aufgabe des Eigentums ist daher nicht durch einfachen Verzicht wie bei einer beweglichen Sache (§ 959 BGB) möglich, da diese Art der Besitzaufgabe durch § 3 Nr. 3 TierSchG i. V. m. § 903 Satz 2 BGB verboten ist.“
Die in Schleswig-Holstein getroffene Regelung wird auch im Tierschutzbericht 1997 der Bundesregierung als einer sachverständigen Äußerung zum Tierschutz zitiert (BT-Drs. 13/7016 S. 47).
Überwiegend werden solche Tiere bei der Fundbehörde abgeliefert und diese ist dann verantwortlich als Tieraufseher i. S. von § 834 BGB.
Tiere bei einer Zwangsräumung
Um Fundtiere handelt es sich bei Zwangsräumungen auf keinen Fall.
Die Unterbringung unversorgter Haustiere in der Räumungsvollstreckung ist in der Rechtsprechung und Literatur umstritten und bedarf wohl noch einer höchstrichterlichen Entscheidung. Die bekannte Rechtsprechung und Literatur sieht hierbei keine Zuständigkeit des Gerichtsvollziehers, da es sich bei Tieren um keine beweglichen Sachen handeln soll. Selbst wenn, dann wäre es möglich, Tiere in ein Pfandlokal oder in andere Verwahrung zu bringen. Weshalb Tiere gem. § 90a BGB im Räumungsverfahren nicht als bewegliche Sachen angesehen werden können, ist bislang nicht überzeugend dargelegt, da sehr wohl z. B. eine Verwahrung in einem Tierheim möglich ist, wobei die Kostenfrage diesbezüglich nicht relevant sein darf. Die Obdachlosenbehörde (Gemeinde) hat für die Unterbringung von Tieren bei einer Zwangsräumung nicht zu sorgen. Hier ist ggf. eine Zuständigkeit der Tierschutzbehörden gegeben (§ 16a TierSchG). Die Gemeinde als Obdachlosenbehörde hat nur ggf. für die Unterbringung der Personen Sorge zu tragen; Tiere können z. B. in ein Tierheim verbracht werden. Es widerspricht jeglichem Rechtsgedanken, dass bei Räumungsfällen die Unterbringung von Haustieren den Behörden und damit der Allgemeinheit „aufgebürdet“ werden soll.
Bei einer Zwangsräumung besteht also keine Gefahr aus der Zwangsvollstreckung (Tiere können untergebracht werden), auch grundsätzlich keine Gefahr nach dem Gefahrenabwehrrecht der Länder.
Es ist Aufgabe des Gerichtsvollziehers, die Räumung des Grundstücks (und damit auch von Tieren) gem. § 885 ZPO zu veranlassen. Die weitere Verwendung ist seine Angelegenheit. So auch VGH Mannheim, Beschl. vom 4.12.1996, NJW 1997 S. 1789.
Hinweis: Der Vermieter haftet bei einer eigenmächtigen Räumung (Inbesitznahme der Wohnung), welche nicht durch einen gerichtlichen Titel gedeckt ist. Dies stellt eine unerlaubte Selbsthilfe dar.
Auch, wenn z. B. ein Tierbesitzer verhaftet wird oder dieser ins Krankenhaus kommt, ist es nicht Angelegenheit der Fundbehörde für dann alleingelassene Tiere zu sorgen und diese unterzubringen. Dann kann es sich nur um eine tierschutzmäßige Aufgabe (Satzung) der Tierschutzvereine handeln, derartige Tiere unterzubringen; bei einer Gefährdung der Tiere kann eine Verpflichtung der Tierschutzbehörden bestehen. Die Gemeinde kann auch diesbezüglich allerhöchstens dann zur Verantwortung gezogen werden, wenn eine polizeirechtliche Gefahr besteht.
Herrenlose Tiere
Allgemein
Vom Besitzer ausgesetzte Tiere oder freilebende Tiere sind herrenlos, an ihnen besteht kein Eigentum. Demnach wären grundsätzlich die Gemeinden als Fundbehörden für herrenlose Tiere nicht zuständig. Dies erscheint eindeutig, da der Besitzer den Besitz an der Sache in der Absicht aufgegeben hat, auf das Eigentum zu verzichten (§ 959 BGB). Geschäftsfähigkeit und Verfügungsbefugnis ist in einem solchen Falle notwendig. Der Verzichtswille braucht nicht erklärt zu werden, er ist aber erkennbar zu betätigen, stellt einen Realakt dar. Der Finder kann sich also grundsätzlich diese herrenlose Sache aneignen und dadurch Eigentümer werden.
Aber: teilweise geht die Literatur davon aus, dass Tiere nach § 3 TierSchG nicht ausgesetzt werden dürfen (Dereliktionsverbot). Damit sei das Eigentum, da eine rechtliche Regelung dem widerspricht, nicht aufgegeben und damit nicht herrenlos. Diese tatsächliche Verzichtserklärung sei nichtig, da sie gegen § 134 BGB verstoße. Dies würde bedeuten, dass z. B. ein bei einer Autobahnraststätte ausgesetztes Tier durch diese Aussetzung nicht herrenlos, sondern zum Fundtier wird. Teilweise wird auch die Auffassung vertreten, das Fundrecht finde dann entsprechend Anwendung.
Bestehen jedoch maßgebliche Anhaltspunkte dafür, dass ein aufgefundenes Tier nicht herrenlos ist, so ist nach den allgemeinen Grundsätzen des Polizei/Ordnungsrechts vorzugehen, d. h., eine evtl. Gefahrenlage ist zu beurteilen. Ggf. Ist ein derartiges Tier (so auch teilweise die Verwaltungsvorschriften der Bundesländer) als „Anscheins-Fund“ zu beurteilen.
Teilweise sehen die Verwaltungsvorschriften der Länder (siehe im Anhang unter 1.1 ff.) vor, dass aus Gründen der Rechtssicherheit bei herrenlosen Tieren eine Anwendung des Fundrechts angezeigt ist.
Zu beachten ist bei herrenlosen Tieren auch das Naturschutzrecht, das Tierschutzrecht und das Jagdrecht.
Herrenlose Tiere und Verstoß gegen die öffentliche Sicherheit oder Ordnung
Die Ordnungsbehörde ist bei diesen ausgesetzten Tieren jedoch stets gefordert, auf Grund der General/Befugnisklausel der Landesgefahrenabwehrgesetze dann Maßnahmen zu ergreifen (Anordnungen zu treffen), wenn durch die ausgesetzten Tiere eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung besteht (dies unabhängig von den verschiedenen Rechtsauffassungen). Es kann nicht staatliche Aufgabe sein, z. B. Kleintiere aus Fuchsmäulern zu retten. Von einer Katze, einem Igel oder einem Kaninchen gehen regelmäßig keine Gefahren aus, es sei denn, diese Tiere sind krank oder es bestehen seuchenrechtliche Probleme. Eine Gefahr gegen die öffentliche Ordnung nach den Befugnisklauseln der Gefahrenabwehrgesetze der Bundesländer wird also wohl nur in seltensten Fällen bei herrenlosen Tieren anzunehmen sein.
Begriff der öffentlichen Ordnung
Die öffentliche Ordnung enthält alle Normen über Handlungen, Unterlassungen und Zustände, deren Befolgung – über die Grenzen des geltenden öffentlichen und zivilen Rechts hinaus – nach der herrschenden allgemeinen Auffassung zu den unerlässlichen Voraussetzungen eines gedeihlichen menschlichen und staatsbürgerlichen Zusammenlebens gehören.
Eine Gefahr für die öffentliche Ordnung kann bei folgendem Beispiel gegeben sein:
–





























