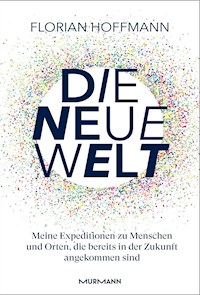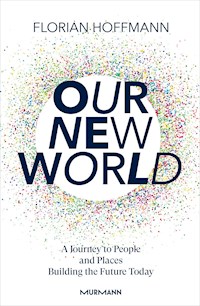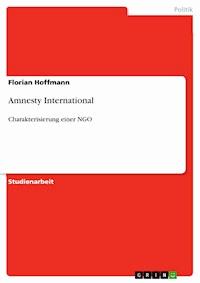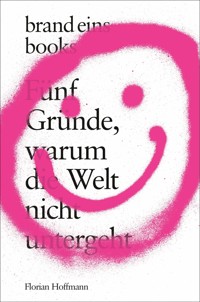
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wohin wir schauen, gibt es Probleme: Ein brennender Planet, eine Wirtschaft, die sich zu langsam verändert. Gesellschaften, die sich spalten. Und in der Mitte von alledem wir – Menschen, denen es oft zu viel wird. Dieses Buch zeigt, dass es genug Grund zur Hoffnung gibt, dass wir sogar Lust auf Zukunft haben können. Um sie mitzugestalten. Florian Hoffmann führt uns durch innovative Projekte, die weltweit Vorbilder für eine bessere Zukunft schaffen. Denn die Veränderung im Kleinen kann Vorlage für die Umbrüche im Großen sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 103
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Florian Hoffmann
Fünf Gründe, warum die Welt nicht untergeht
Über dieses Buch
Wohin wir schauen, gibt es Probleme: ein brennender Planet, eine Wirtschaft, die sich zu langsam verändert. Gesellschaften, die sich spalten. Und in der Mitte von alledem wir – Menschen, denen es oft zu viel wird. Dieses Buch zeigt, dass es genug Grund zur Hoffnung gibt, dass wir sogar Lust auf Zukunft haben können. Um sie mitzugestalten.
Florian Hoffmann führt uns durch innovative Projekte, die weltweit Vorbilder für eine bessere Zukunft schaffen. Denn die Veränderung im Kleinen kann Vorlage für die Umbrüche im Großen sein.
Vita
Florian Hoffmann ist Gründer von The DO, der globalen Plattform für eine neue Wirtschaft, die nachhaltig, innovativ und gerecht ist. The DO arbeitet international mit Sitz in Berlin, Hongkong und New York. Das Weltwirtschaftsforum zeichnete Florian für seine Arbeit als einen von 100 Young Global Leaders unter vierzig aus. Florian sitzt im Aufsichtsrat des World Future Council, ist Fellow der Tribeca Disruptive Innovation Awards und Juror beim mit einer Million Dollar dotierten Global Teacher Prize. Er studierte an der Universität Oxford, der Duke University, dem Bard College und der Humboldt-Universität. Mit seiner Frau und seiner Tochter lebt er zurzeit in Berlin.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2024
Copyright © 2024 by brand eins Verlag Verwaltungs GmbH, Hamburg
Lektorat Gabriele Fischer, Holger Volland
Faktencheck Katja Ploch
Projektmanagement Hendrik Hellige
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Covergestaltung Mike Meiré/Meiré und Meiré
ISBN 978-3-644-02103-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Zu Beginn
Januar 2024. Ich sitze in einem Konferenzraum mit 200 einflussreichen Menschen. Ein Mann nimmt sich das Mikrofon: «Wer von Ihnen glaubt, dass die Generation Ihrer Kinder es besser haben wird als Sie?» Im Raum gehen höchstens zehn Hände in die Höhe. Der Raum liegt im schweizerischen Davos, die 200 Menschen sind bedeutende Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik aus der ganzen Welt, der Mann ist einer der Leiter des jährlich stattfindenden World Economic Forums.
Die verhaltene Reaktion war wohl zu erwarten. Wohin man schaut: Probleme. Ein brennender Planet, eine Wirtschaft, die sich zu langsam verändert. Demokratien, bedroht durch Fehlinformation und Fake News, rechte Bewegungen, Kriege. Technologien, die wir nicht mehr zu kontrollieren in der Lage scheinen. Gemeinschaften, die sich zu schnell auseinanderbewegen, und in der Mitte von alldem wir Menschen, denen es oft zu viel wird. Schon seit ein paar Jahren, seit die Veränderungen so stark zunehmen, sprechen wir so oder so ähnlich über unsere Zeit.
Ich höre immer mehr Stimmen in der Öffentlichkeit und um mich herum, die sagen, dass früher vieles besser war. Deutschland war Exportweltmeister, es gab keine ernst zu nehmenden Parteien am rechten Rand, und die Welt schien halbwegs stabil, mit den USA in dominierender Rolle. Aber dann kamen viele Disruptionen auf einmal: Klima, Geopolitik, Lieferketten, Arbeitswandel, Pandemie, Krieg, KI. Kein Wunder, dass man sich zurücksehnt in eine Vergangenheit, in der ein deutsches Auto noch Wunder der Technik und Statusobjekt sein konnte und nicht Sinnbild schmerzlichen Wirtschaftswandels war.
Ich beschäftige mich seit zwanzig Jahren mit der Frage, warum wir uns mit Veränderung in unserer Gesellschaft und mit dem Umsetzen neuer Ideen oft schwertun. Warum wir veränderungsmüde werden, ausgerechnet jetzt, wo die Antwort auf die Frage, wie Veränderung gelingen kann, nie wichtiger war. Wir stehen vor gewaltigen Herausforderungen und scheinen noch keine grundsätzlichen Lösungen gefunden zu haben. Eine Erkenntnis der vergangenen Jahre ist, dass viele Menschen das Gefühl haben, festzustecken. Ausgesetzt in einer Art Niemandsland, den Blick in eine vermeintlich einfachere Vergangenheit gerichtet und sich fragend, welche Art Fortschritt eigentlich die richtige ist.
Dabei gibt es viele gute Erkenntnisse, welche individuellen Fähigkeiten uns helfen, resilienter zu sein. Aber es bleibt eine Herausforderung, mit Optimismus in die Zukunft zu blicken und diese erfolgreich mitzugestalten. Dieses Buch möchte anhand der Geschichten unterschiedlicher Menschen Wege aus dem Niemandsland zeigen. Und die wichtigste Botschaft dabei ist: Die meisten großen Herausforderungen unserer Zeit haben eines gemeinsam – sie sind menschengemacht! Und das heißt auch, dass wir Menschen es in der Hand haben, diese Herausforderungen anzunehmen und zu lösen. Schon der griechische Philosoph Epiktet soll laut Überlieferung gesagt haben: «Es geht nicht darum, was dir im Leben passiert, sondern wie du damit umgehst.» Das ist der Kern der fünf Gründe, warum unsere Welt nicht untergeht.
Ein Blick ins Niemandsland
Vor Kurzem war ich in Berlin zu einer Art Klassentreffen führender Journalistinnen und Politiker eingeladen. Einer der regierenden Politiker Deutschlands (und sicherlich einer der besten Rhetoriker) sprach in kleiner Runde davon, dass wir den Menschen die Schwierigkeit der momentanen Lage nicht verschweigen dürfen. Und dass wir auch nicht immer gleich Antworten vorgeben müssen, sondern die Herausforderungen ernst nehmen. Er wollte ehrlich sein und im Gegensatz zu den Populisten nicht mit einfachen Antworten werben. Aber weder er noch die anwesenden Journalisten sprachen darüber, wie Deutschland aussehen könnte, wenn neue, gute Lösungen für die momentanen Probleme gefunden würden. Die Stimmung im Raum war schwer, die Frage, wofür wir uns eigentlich anstrengen sollen, wohin es gehen kann, blieb bezeichnend unbeantwortet. Ich musste an ein Gespräch mit Mitgliedern der «brand eins»-Redaktion denken und an den Vergleich mit Deutschland in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Auch damals hatte das Land viele Schwierigkeiten, aber auch verschiedenste Utopien – Überzeugungen, wie eine gute Zukunft aussehen könnte, über die gestritten wurde. Heute sind wir wieder in einer Zeit großer Herausforderungen. Aber uns fehlen zu oft die Ideen, wie es morgen sein könnte. Allen Krisen gemeinsam ist, dass eine verklärte Vergangenheit auf ein unklares Zukunftsbild trifft. Wir stecken gefühlt im Niemandsland fest und wissen weder zurück noch vorwärts.
Es ist erstaunlich, wie viele Menschen ein neues, positives Bild der Vergangenheit entwickeln. Nostalgie ist in. Von der Wissenschaft bis zum Pop beziehen sich immer Betrachtungen auf das, was war. Die britisch-albanische Sängerin Dua Lipa schrieb 2020 mit Future Nostalgia eines der Hit-Alben der Pandemie. Der Wissenschaftler Tobias Becker beschreibt in seinem 2023 erschienenen Buch Yesterday sehr unterhaltsam die Geschichte des Begriffs. Der Mediziner Johannes Hofer benannte im späten 17. Jahrhundert mit Heimweh (nostos) und Schmerz (algos) eine Art pathologisches Heimweh. Heute wird Nostalgie oft als sentimentaler Schmerz über den Verlust der Vergangenheit beschrieben. Teil des öffentlichen Diskurses wurde sie vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch das Buch und den Film Future Shock. Der Futurist Alvin Toffler definierte im Jahr 1970 einen future shock als Krankheit, «ausgelöst durch immer schneller werdende Veränderungen heutzutage». Klingt nach einer passenden Beschreibung für das Seelenleben vieler im Jahr 2024, oder? Überall um uns herum fordern Menschen eine Rückkehr zu alten Tugenden, nennen Politiker Deutschland wieder den kranken Mann Europas. Nostalgie, so schreibt Tobias Becker über Toffler in seinem Buch, beschreibt die Müdigkeit mit der Menge und Schnelligkeit von Veränderungen. Wenn ich auf die momentane Diskussion blicke, lässt sich die Abkehr von der Idee des Fortschritts beschreiben:
Erstens, als Reaktion auf tatsächlich stattfindenden Fortschritt. Weil wir es mit großen Herausforderungen zu tun haben, ist so ziemlich alles in Bewegung. Einige Lösungen verändern merklich etwas, erzielen auch positive Ergebnisse. Das internationale Umweltabkommen, das seit Ende der achtziger Jahre wieder zur Regeneration der Ozonschicht führt, zum Beispiel. Aber Veränderung ist nicht immer lustig, wir Menschen müssen uns mit ihr verändern, unser Verhalten anpassen. Und es gibt auch immer wieder Verlierer. Ein großer Teil der Rufe nach der guten alten Zeit kann deshalb als Reaktion auf vorangetriebene Veränderungen verstanden werden, die unser Leben immer stärker beeinflussen. Antworten auf die Klimakrise, die Energie- und Mobilitätswende, Wandel der Arbeit und Industrie, Unsicherheit in Europa. Nostalgie entsteht hier als Gegenbewegung zu schnellen Veränderungen, selbst wenn sie notwendig sind.
Zweitens, als Zeichen von Überforderung. Gerade in besonders offenen, liberalen Gesellschaften müssen unterschiedliche Meinungen zu Veränderungen immer wieder neu ausgehandelt werden. Egal ob es um das Recht auf Abtreibung, den Wohlfahrtsstaat oder unser Steuersystem geht. Veränderung muss selbst bei den Themen immer wieder neu verhandelt werden, bei denen der Nutzen für Einzelne, die Gesellschaft und den Planeten offensichtlich erscheint. Die offene Gesellschaft ist nicht immer ihr bester eigener Freund.
Drittens, als Reaktion auf neue Herausforderungen. In unserer heutigen Zeit gibt es große, komplexe Herausforderungen, auf die es keine einfachen Antworten gibt. Selbst wenn einen der Klimawandel auf der Skipiste, im vertrockneten Garten oder durch den Wassermangel im Spanienurlaub sprichwörtlich anspringt, verschließen wir bisweilen lieber die Augen oder suchen uns alternative Wahrheiten aus. Die Menge an großen Herausforderungen, die unsere Art zu leben infrage stellen, ist vermutlich entscheidend dafür, dass sich in den Nachkriegsgenerationen viele zurücksehnen nach einem Leben, das einfacher erschien.
Aber heißt das nun, wir können unsere Probleme lösen, wenn wir nur alle mitnehmen in eine Zukunft, in der auch sie ihre Rolle finden? So einfach ist es leider nicht.
Tobias Becker beschreibt in seinem Buch eindringlich, dass wir oft die als Nostalgiker brandmarken, die nur nicht unseren eigenen Fortschrittsgedanken teilen. Und hier liegt ein bisschen die Krux. Denn der Fortschritt steckt in der Krise – und zwar nicht nur aufgrund der Anfeindungen am rechten Rand oder durch reaktionäre Kräfte. Wir wissen oft nicht mehr, welche Art von Fortschritt wir eigentlich wollen oder wollen sollen. Ich arbeite und reise rund um die Welt, auch in Zeiten von und nach Covid. Und ich nehme größer werdende Unterschiede wahr – nicht nur zwischen den auseinanderklaffenden Kontinenten, sondern auch innerhalb von Ländern, zwischen Generationen. Grob lassen sich drei Arten von Fortschrittsgedanken identifizieren:
Der erste hat seinen Ursprung im Fall der Mauer, dem Ende des Kalten Krieges. Damals wurde das Ende der Geschichte gefeiert – jetzt geht es darum, diesen Fortschritt aufrechtzuerhalten und auf der Welt zu verteilen! Ja, wir müssen uns um den Klimawandel kümmern, um den Krieg, die soziale Ungerechtigkeit. Aber wir müssen vor allem unsere existierenden Systeme gesund halten. Wirtschaftswachstum, Rendite an den Börsen, genügend Lehrerinnen in den Schulen, Pflegerinnen in den Krankenhäusern. Kurzfristige Ziele verdrängen oft große disruptive Gedanken. Die schwarze Null ist der Erfolg, den es zu verteidigen gilt. Aber auch überhaupt erst einmal einen Job zu bekommen, der erste in der Familie zu sein, der zur Schule oder Universität geht. Und in vielen Ländern geht es darum, Volkswirtschaften zu kreieren, die zum ersten Mal seit der Unabhängigkeit von Kolonialmächten und nach Jahren der Volatilität eine wachsende Mittelschicht schaffen.
Besonders bei jüngeren Menschen in Europa und zum Teil den USA existieren ganz andere Gedanken zum Fortschritt. Fortschritt kann hier degrowth bedeuten, die Einführung eines anderen Wirtschaftssystems, die Lokalisierung von Produktionsketten, die Reduzierung der Arbeit auf 80 Prozent oder weniger und die Minimierung des Konsums. Recycling, Kreislaufwirtschaft und Verantwortungseigentum statt Überproduktion und Börsenkrisen. Ein Anfang Zwanzigjähriger sagte mir vor Kurzem: «Ihr lebt, um zu arbeiten, wir arbeiten so viel wie nötig, um zu leben.»
Eine dritte Idee von Fortschritt ist besonders dort zu finden, wo die Probleme vor Ort mit Unternehmertum zusammentreffen. Dann wird klar, dass es vieler Innovationen und Lösungen bedarf, um die massiven Probleme unserer Zeit zu lösen. Und dass dies ohne große Anstrengung, harte Arbeit, Wachstum und Kapital nicht funktionieren wird. Sozialer Fortschritt und Klimakatastrophe können nicht getrennt betrachtet werden. Der Weltbank-Chef Ajay Banga sprach im Jahr seines Amtsantrittes 2023 eindringlich darüber, dass globale Armut und Klimawandel miteinander verflochten sind und nur gemeinsam gelöst werden können: «Wenn du keine saubere Luft zum Atmen hast und kein sauberes Wasser zum Trinken, dann hilft es auch nicht, die Armut zu beseitigen.» Bei dieser Idee von Fortschritt geht es darum, all die neuen Ideen und Erfindungen einzusetzen: Kreislaufwirtschaft, lokale Wirtschaft, globale Plattformen, die Bildung ermöglichen. Aber im System von Wertschöpfung, Kapitalerträgen und Profit.