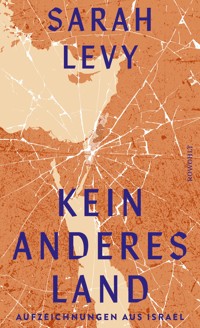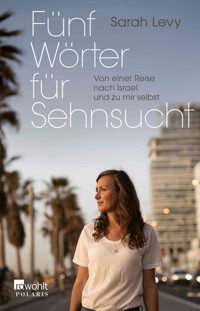
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Reise nach Tel Aviv verändert Sarah Levys Blick auf Israel – aus dem Urlaubsort ihrer Kindheit, Heimat ihrer jüdischen Familie und Konfliktschauplatz wird ein Sehnsuchtsort voller Wärme und inspirierender Begegnungen. Mit 33 entscheidet sie, ihr Leben in Hamburg hinter sich zu lassen, und zieht nach Tel Aviv. Inmitten der Corona-Pandemie durchlebt sie Mentalitätsklüfte, frustrierende Sprachlosigkeit und das liebevolle Chaos israelischer Familientreffen. Im Stadtteil Yafo begegnet sie nicht nur herzlich-warmen Israelis, die ihr ständig Tupperdosen mit Rote-Bete-Salat und dramatische Lebensgeschichten aufdrängen, sondern auch einer tief gespaltenen Gesellschaft. Eine Geschichte darüber, was Mut bedeuten kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Sarah Levy
Fünf Wörter für Sehnsucht
Von einer Reise nach Israel und zu mir selbst
Über dieses Buch
Mit 33 entscheidet Sarah Levy, ihr Leben in Hamburg hinter sich zu lassen, und zieht nach Tel Aviv. Inmitten der Corona-Pandemie durchlebt sie Mentalitätsklüfte, frustrierende Sprachlosigkeit und das liebevolle Chaos israelischer Familientreffen. Im Stadtteil Yafo begegnet sie nicht nur herzlich-warmen Israelis, die ihr ständig Tupperdosen mit Rote-Bete-Salat und dramatische Lebensgeschichten aufdrängen, sondern auch einer tief gespaltenen Gesellschaft.
Eine Geschichte darüber, was Mut bedeuten kann.
Vita
Sarah Levy, geboren 1985, besuchte die Henri-Nannen-Journalistenschule und schreibt als freie Journalistin u. a. für DIE ZEIT. Seit 2018 koordiniert sie das Projekt stopantisemitismus.de, das über Antisemitismus im Alltag aufklärt und Hilfestellung bietet, und arbeitet für diverse Stiftungen. Sie lebt mit Partner und Kind in Tel Aviv-Yafo.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juni 2022
Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Die Namen aller Personen, ihre Eigenschaften und Lebensumstände wurden zu ihrem Schutz geändert.
Hebräische/Arabische Ausdrücke und Orte wurden so geschrieben, wie sie im Deutschen ausgesprochen werden.
Covergestaltung HAUPTMANN & KOMPANIE Werbeagentur, Zürich
Coverabbildung Corinna Kern
ISBN 978-3-644-00993-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für meine Familie –für Mama, für Papa, für Jolle.Ihr seid immer bei mir.
Prolog
«Goodbye! Bye! Have a pleasant time in Israel!» Zwei Flugbegleiter der EL AL lächeln die letzten Passagiere aus dem Flugzeug. Ich schiebe mich Richtung Ausgang, bepackt mit Rucksack, Handtasche und einem roten Vileda-Wischmopp. Am Eingang der Fluggastbrücke wartet ein dünner, junger Mann im Anzug mit einem Schild: «Olim» – Neueinwanderer.
«Sarah Levy?», fragt er. Ich nicke. «Follow me.» Ich laufe hinter ihm her in den Flughafen, durch Flure und Türen, die mir bei meinen Urlaubsreisen zuvor nie aufgefallen sind, durch weitere Flure, hinein in einen Aufzug, und wieder durch einen Flur. Irgendwann fragt er, ob er mir etwas abnehmen könne. Ich drücke ihm den Wischmopp in die Hand. Er nimmt ihn, ohne eine Frage zu stellen, und eilt weiter.
An einer offenen Tür reicht er mir das Gerät zurück. «Welcome to Israel.» Dreht sich um und verschwindet. Ich sehe mich um. Der Raum vor mir erinnert mich an ein deutsches Bürgerbüro. An Schreibtischen sitzen Frauen zwischen Trennwänden und klicken auf Computermäuse. Zwei sprechen Hebräisch miteinander, mit russischem Akzent. Im Nebenraum stehen Wasserspender und Instantkaffee, in einer Ecke eine israelische Flagge.
Ich schäle mich aus meiner Jacke und versuche, den Wischmopp irgendwo anzulehnen, doch er rutscht weg und fällt scheppernd auf den gefliesten Boden. Eine Frau mit Unterlagen im Arm läuft an mir vorbei und fragt auf Hebräisch: «Mah se?» Was ist das?
Ich nehme meinen Mut zusammen und versuche, ihr auf Hebräisch zu erklären, dass ich mit einem deutschen Qualitäts-Wischmopp nach Israel einwandere. «Assiti aliyah im smartut germani.» Eine Idee, die mir – laut auf Hebräisch ausgesprochen – gar nicht mehr so einleuchtet wie vor meinem Abflug in Deutschland.
Sie macht eine Geste, die ich bei Israelis noch oft sehen werde: Eine Hand wischt durch die Luft, bis sie mit der Handfläche nach oben zeigt, dazu werden die Augen aufgerissen und die Stirn gerunzelt. Das kann alles heißen von «Na und?» bis «Wie bescheuert bist du?».
«Wir haben das», sagt die Frau, «bei IKEA.»
«Ich habe so einen noch nie gesehen», widerspricht ihr eine jüngere, blonde Frau mit eckiger Brille hinter dem ersten Schreibtisch. Auch sie hat einen russischen Akzent. Ich setze mich auf einen Stuhl, der vor ihr steht.
Die junge Frau mit der eckigen Brille lässt sich meine Unterlagen zeigen: israelisches Einwanderungsvisum im deutschen Pass, eine Erklärung der Jewish Agency, meine Flugunterlagen. Sie tippt eifrig in ihre Computertasten, fragt nach meiner internationalen Geburtsurkunde und ob der Mittelname meiner Mutter wirklich Anna Maria lautet, dann hält sie inne. «Arrival form?», fragt sie auf Englisch.
Ich habe keine Ahnung, wovon sie spricht. Ein arrival form habe ich nicht.
«You need arrival form», sagt die eckige Brille.
Mir wird heiß. Ich wühle in meinen Unterlagen. Ein Mann taucht neben ihr auf, auch er scheint hier zu arbeiten. Er sieht, wie ich hektisch ein Blatt nach dem anderen aus meinen Klarsichtfolien ziehe und wieder zurückstopfe. Er stellt sich hinter die Frau mit der eckigen Brille, blickt prüfend auf den Computerbildschirm, dann zückt er ein schwarzes, altmodisches Handy, spricht einige Sätze mit leiser Stimme hinein und legt auf. Er hebt einen Finger und bedeutet mir zu warten.
Wenige Minuten später klingelt sein Telefon. Wer auch immer am anderen Ende ist, er scheint Informationen über mich zu haben. Und plötzlich ist alles möglich: Ich erhalte eine israelische Identitätsnummer, einen temporären Personalausweis, eine Krankenversicherung, eine israelische Sim-Karte und eine Art Einwanderer-Pass für Vergünstigungen aller Art.
In 30 Minuten werde ich zur israelischen Staatsbürgerin. Auch ohne arrival form. Und meine Mutter verliert den zweiten Teil ihres Mittelnamens. Ihr kompletter Name ist zu lang für das Online-Formular des Innenministeriums, so fällt das Maria ihres Mittelnamens unter den Tisch. «It is better», sagt die Frau mit der eckigen Brille und nickt mir verschwörerisch zu.
Sie begleitet mich zur Gepäckausgabe. Meine drei Koffer kreisen einsam auf dem Band.
Nachdem sie mir geholfen hat, meine mehr als 70 Kilo Gepäck vom Band zu hieven, zögert die Frau kurz, zeigt auf meinen Wischmopp und sagt auf Hebräisch: «Kannst du mir zeigen, wie man das benutzt?»
Es gibt Momente, die sind so absurd, dass ich sofort denke: Das wird eine gute Geschichte. Für das nächste Gespräch mit Freunden, meiner Familie, für eine Kolumne. Für das, was an diesem Vormittag geendet hatte, und das, was nach vier Stunden Flug hier in Israel neu begann. Meine Geschichte.
Als ich in Schlangenlinien mit meinem Vileda-Wischmopp durch die Gepäckhalle des Ben-Gurion-Flughafens glitt und für die Mitarbeiterin des israelischen Innenministeriums so tat, als würde ich den Boden putzen, war das so ein Moment.
Mein altes Leben in Deutschland hatte ich an diesem Tag hinter mir gelassen, meine Familie, meine Freunde, meine Wohnung in Hamburg, meine Möbel, meine Bücher. Mit drei Koffern war ich nach Israel gereist, drei Koffer, die alles enthielten, von dem ich glaubte, dass ich es brauchen würde, um mich in Israel zu Hause zu fühlen.
An jenem Tag im Dezember begann für mich ein neues Leben. Ein Leben im einzigen jüdischen Staat der Welt, gerade mal so groß wie Hessen, mit einem Völkchen von etwas mehr als neun Millionen, von dem ich glaubte, es eigentlich schon ziemlich gut zu kennen. Dieser Tag war zugleich Schlusspunkt einer Reise, die früher begonnen hatte, im Jahr 2017, als ich mich in Israel verliebte, vielleicht sogar weitere dreißig Jahre zuvor, 1987, als ich das erste Mal in das Land reiste, auf dem Arm meiner Eltern.
Ich war in meinem Leben bereits unzählige Male in Israel gewesen, ich hatte in seinen Meeren gebadet, in seinen Wüsten getanzt, war über seine Märkte gewandert und hatte gefaltete Wunschzettel in die Klagemauer gestopft. Ich hatte israelische Freunde gefunden, mich in israelische Männer verliebt, war über die israelische Politik verzweifelt. Ich konnte Kaffee auf Hebräisch bestellen und sagen: Ich bin mit einem deutschen Wischmopp nach Israel eingewandert – Assiti aliyah im smartut germani.
Ich hatte trotzdem auf so vielen Ebenen keine Ahnung. Der Wischmopp, das verstand ich später, war nicht nur Symbol meiner deutschen Identität, sondern auch meiner Ahnungslosigkeit. Nicht nur deshalb, weil ich monatelang das falsche Wort dafür benutzte: smartut bedeutet Lappen, das korrekte Wort für den Stiel mit Wischfläche und praktischen Druckknöpfen in meinem Handgepäck lautet magav.
Ich hatte keine Ahnung, was ich in Israel finden sollte, in diesem Land und in seinen Menschen, die mir so nah und doch so fern waren.
Vor allem aber, was ich in mir selbst finden sollte.
Vielleicht braucht es das Fremde im Bekannten, um uns tief im Innern zu berühren. Uns zu verändern und unsere Entscheidungen zu formen. Uns mutiger zu machen, unerschrockener, auf der langen Reise zu uns selbst.
Teil 1: Tel Aviv
Stadt am Meer
Wenn es Momente gibt, die alles verändern, dann war das meine Reise nach Israel im Herbst 2017. Sie veränderte nicht nur meinen Blick auf das Land und seine Menschen auf eine Weise, die ich nicht erwartet hätte. Sie entwickelte sich zum Startpunkt einer größeren Reise, einer längeren, tiefergreifenden, deren Folgen mich veränderten und mein Bild von mir selbst. Dabei fing alles wie ein ganz normaler Urlaub an.
«Darf ich mal mit dir nach Tel Aviv?», fragt Flora per WhatsApp. Ich habe ehrlicherweise keine Lust. Das wäre das zweite Mal in einem Jahr, dass ich nach Israel fliege, und das … fünfzehnte, zwanzigste Mal in meinem Leben? Zu oft habe ich schon die Reiseführerin gespielt. Es graut mir vor dem ewig gleichen Programm: eine weitere Freundin die Strandpromenade von Tel Aviv entlangschleifen, Hummus bis zur Überblähung essen, Fotos vom immer gleichen Aussichtspunkt über der Klagemauer knipsen und im lauwarmen Glibsch des Toten Meeres dümpeln.
Flora lässt nicht locker. Sie war noch nie in Israel und will, dass ich ihr das Land zeige. Ich: die Deutsche, die seit ihrer Kindheit nach Israel fährt; die Jüdin, die Hebräisch lesen kann, wenn auch nicht wirklich verstehen. Ich, ihre gute Freundin. Und so willige ich letztlich ein. Ich stelle drei Bedingungen: kein Totes Meer, keine Klagemauer, keine 08-15-Sehenswürdigkeiten.
Ende Oktober 2017 fliegen wir, von Hamburg nach Tel Aviv. Der Himmel ist tiefblau, im Landeanflug sehen wir die ersten Palmen. Unser AirBnB liegt im Kerem HaTeimanim, dem jemenitischen Viertel rund um den Schuk haCarmel im Süden der Stadt, wo die feiernden Jungen leben und die ärmeren Alten, wo das Meer nah ist und die Luft nach Salz riecht. Meine Schwester, die regelmäßiger dort ist, hat mir die Gegend empfohlen: wenige hundert Meter vom Meer entfernt, in direkter Nachbarschaft zu Cafés, Restaurants und Bars.
Mit dem Taxi tuckern wir durch ein Mosaik aus hutzeligen Häusern mit Wellblechdächern, vorbei an Mauern mit Street-Art und Muschelschalen. An der Hauswand einer bröckelnden Hütte lese ich die Aufschrift Beit Knesset – Synagoge. Ich muss an die Synagoge in Frankfurt denken, ein prächtiger Bau mit beleuchteter Kuppel und Lüster. Im Kerem HaTeimanim ranken sich Stromkabel wie schwarze Lianen um Holzpfähle, Straßenkatzen liegen faul auf Mauervorsprüngen, in den verwinkelten Gassen blüht die Bougainvillea violett und pink. Unsere Unterkunft liegt hinter einem grau-weißen Holztor, über das lilafarbene Blüten klettern. Wir klopfen an einer weißen Tür, auf der Plastikblüten in Form eines Herzens kleben. Auch auf dem Boden hat jemand drei Herzen in den Beton gedrückt. Wir öffnen die Tür.
«Hoppaaaaa!», ruft uns eine tiefe Stimme entgegen. Auf einem Plastikstuhl in der Mitte eines blühenden Gartens sitzt unser Gastgeber Boaz, wie ein König, dem wir die Ehre erweisen. Boaz ist nicht besonders groß, über die dunkelbraune Haut seines Oberkörpers erstrecken sich Tattoos, die aussehen, als wären sie einem Tim-Burton-Film entsprungen. Durch seinen Bart ziehen sich erste graue Haare.
«Welcome, welcome, bruchot haba’ot», sagt er und mustert uns neugierig. Neben ihm sitzt ein Mann in Lederjacke, in der einen Hand ein Glas mit schwarzem Kaffee, in der anderen eine Zigarette. Er stellt sich als Or vor und wechselt schüchtern ein paar Worte in einfachem Englisch mit uns, bis Boaz uns eine Tour durch sein Reich gibt. Hinter dem Holztor vermietet er vier Apartments mit Blick auf einen grünen Innenhof, mit Sonnensegel, Gemeinschaftsküche, Hängematten, Surfbrett. Neben üppigen Blumensträuchern sprießen hier Minze, Zitronenverbene und Tomaten, und auf dem Sonnendach Cannabis. Er selbst wohnt auf der Dachterrasse, sein Freund Or wenige Straßen weiter.
Boaz gießt kochendes Wasser auf Kaffeepulver, reicht Flora und mir ein dampfendes Glas, das er mit zwei Fingern am oberen Glasrand festhält. Wir nippen zu früh an dem säuerlichen Gebräu und haben sofort Kaffeekrümel zwischen Lippen und Zähnen. Auf die Frage, was er beruflich macht, berichtet Boaz ausführlichst von einer Maschine, die er bald bauen will, die den Nährstoffgehalt in Blumenerde misst, oder so was Ähnliches. Bis es so weit ist, verdient er Geld mit seinen Apartments, die er selber gebaut und eingerichtet hat.
Unser Gastgeber reicht einen Joint herum, ein dünner langer Stängel in braunem Paper, darin Gras, so stark, dass Flora und ich uns Blicke zuwerfen und bald anfangen, unkontrolliert zu kichern. «Sarah Levy!», ruft Boaz, als er meinen Namen hört. Er setzt sich in seinem Plastikstuhl auf. «At medaberet Ivrit?» Sprichst du Hebräisch?, fragt er. Dies ist so ziemlich der einzige Satz, auf den ich immer eine Antwort habe: «Kzat», ein bisschen, sage ich und zeige mit Daumen und Zeigefinger, wie wenig. Selbst das ist heillos übertrieben. Außer unbrauchbaren Worten (koss heißt Glas, chatull Katze) ist aus dem Unterricht an meiner jüdischen Grundschule nichts hängen geblieben. Boaz legt direkt los, ein Schwall Hebräisch blubbert aus ihm heraus. Ich verziehe das Gesicht zu einer Grimasse. Verstanden habe ich nichts.
Dass ich jüdische Deutsche bin, finden die beiden unheimlich interessant. Mehrmals sprechen sie mich auf Hebräisch an, als wollten sie testen, ob ich mehr verstehe, als ich zugebe. Es überrascht mich, dass mein Name und meine Herkunft sie begeistert. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. «Witziger Typ!», sagt Flora, als wir abends zu zweit in Liegestühlen in der wenige hundert Meter entfernten Strandbar sitzen und zuschauen, wie die Sonne im Meer versinkt. «Bisschen strange, aber lustig», sage ich, «hoffentlich nervt er nicht.»
Gleich am nächsten Morgen schnippelt uns Boaz israelischen Salat aus Gurken, Tomaten und Zitronensaft und brät Rühreier. Dann führt er uns in sein Lieblingscafé. Es liegt an einer Straßenecke zwischen Carmel-Markt und Meer und ist der beste Ort, um gar nichts zu tun. Stundenlang sitzen wir dort neben schönen Menschen, die alle Zeit der Welt zu haben scheinen. Ich habe immer schon gern Menschen angeguckt. Hier sehe ich dunkle Bärte und helle Augen, Korkenzieherlocken und viel nackte Haut, sonnengebräunt. Die Leute sind schön, sie weichen meinem Blick nicht aus, sondern schauen unverwandt zurück, bis ich beschämt weggucke. Mitten im Gewimmel sitzt ein älterer Mann vor Säcken mit Nüssen auf einem Plastikstuhl und döst mit geschlossenen Augen in der Sonne.
Wie oft bin ich schon über den Carmel-Markt gelaufen, vorbei an Ständen mit bunten Kaubonbons, senffarbenem Kumin und Za’atar grün wie Moos, Richtung Meer. Ich kenne den Duft von gegrilltem Fleisch und frischgepressten Orangen. Doch bisher bin ich hier durchgelaufen wie eine überforderte Touristin, den Ellbogen über die Handtasche geklemmt, die Marktverkäufer mit Blicken und Winken abwimmelnd, stets in der Befürchtung, abgezockt zu werden. Es kommt mir vor, als beobachte ich dieses Mal bewusster und auch ein bisschen weniger ängstlich. Das liegt in erster Linie an Boaz. Wir folgen unserem Gastgeber in die Gassen, durch ein Gewirr aus Stimmen von Cafébesuchern und Marktverkäufern, wir bleiben stehen, probieren Früchte, Gebäck, Shakes, wir gucken, laden uns auf mit der Energie des Ortes.
Was heißt das? Was steht da?, fragt Flora. Oft kann ich ihre Fragen nicht beantworten, doch manchmal ergeben die hebräischen Buchstaben auf den gekrakelten Preisschildern tatsächlich ein Wort, das ich kenne: tapuz – Orange. Für meine Freundin bin ich Expertin, doch ich bin mir nicht sicher, diesen Status zu verdienen. Boaz übersetzt bereitwillig. Er führt uns zu dem Stand im Schuk, wo der Karotten-Ingwer-Saft nur fünf Schekel kostet, umgerechnet etwas mehr als ein Euro. Am nächsten Morgen steht er beim Bäcker in der Schlange, um uns das jemenitische Fladenbrot mit den Kratern im Teig zum Frühstück zu servieren: Lachuch. Er lädt die alte Nachbarin zum Tee ein, die in seinem Garten Minze und Zitronenverbene pflückt, und eine andere zum Kaffee, die für eine Zigarette vorbeikommt, um sich über die steigenden Mieten im Viertel zu beschweren. Er singt israelische Radio-Schlager mit, und erklärt uns, welcher Sänger Wurzeln im Jemen hat. Er zeigt uns seine Stammkneipe in der Nachbarschaft, wir stoßen mit ihm und Or an, während vor uns Männer und Frauen auf dem Tresen zu Misrachit tanzen, der orientalischen Musik der Juden aus arabischsprachigen Ländern, zu israelischen Klassikern mitsingen und sich gegenseitig den israelischen Anisschnaps Arak aus Flaschen direkt in die Kehle schütten.
Boaz nennt Flora und mich bald Motek, Liebling, und Chajim sheli, mein Leben. Manchmal ruft er einfach laut «Sarah Levy!» durch den Garten, und ich muss lachen. Eigentlich, so erzählt er uns offen, sei er auf der Suche nach der großen Liebe, die ihm Kinder schenkt, möglichst viele, möglichst bald. Bis es so weit ist, erleben wir, wie er versucht, jede Touristin zu verführen, die in seinen Gemeinschaftsgarten gespült wird.
Wir treffen Israelis mit Wurzeln im Jemen, in den USA, in Australien. Sie sind offen, interessiert an uns und unserem Leben, warm und herzlich. Sie erzählen von ihrem Alltag, ihren Wünschen, davon, was sie glücklich macht, was schwermütig.
Da ist der Tänzer Ovadia, der vom Tanzen nicht leben kann. Er wohnt noch bei seinen Eltern im Vorort und zeigt uns Videos seiner Großmutter auf seinem Handy, sie singt Arabisch und trägt jemenitische Tracht. Eines Morgens kommt er in Begleitung einer schönen Frau aus einer von Boaz’ Wohnungen und teilt die Teigtaschen, die seine Mutter gebacken hat.
Da ist Talya, deren Englisch sich nach ihren amerikanischen Eltern anhört. Talya träumt davon, einen Catering-Dienst zu eröffnen. Bis es so weit ist, arbeitet sie für eine Werbeagentur und kocht regelmäßig große Schabbat-Dinner in Boaz’ Garten, zu denen sie jeden einlädt, der durch das offene Tor in den Garten guckt.
Da ist die Australierin Samantha, aus deren knapper Kleidung ständig ein halber Hintern oder eine Brust blitzt. Sie hat gefühlt schon überall gelebt und ist nirgendwo richtig zu Hause. Sie arbeitet im Café an der Ecke, flirtet gern mit Or und spricht viel über ihre Zweifel, in Israel zu bleiben oder weiterzuziehen.
Or, der Motorradfahrer, rollt fast täglich in Boaz’ Garten. Bei einem Kaffee checkt er die neu angereisten Touristinnen ab, ist aber meist zu schüchtern, um sie auf Englisch anzusprechen. Am Wochenende versackt er oft in der Stammkneipe in der Nachbarschaft, zieht in der Toilette eine Line Koks nach der anderen, um dann mit starrem Blick auf dem Tresen zu tanzen. Offen erzählt er, dass er hofft, von seiner zukünftigen Braut aus diesem Teufelskreis errettet zu werden.
Manche der Israelis, die wir treffen, sprechen Hebräisch mit starkem amerikanischen, russischen, französischen Akzent, sie leben noch nicht lange im Land. Einige sprechen sogar nur Englisch. Die meisten arbeiten in zwei oder drei Jobs, führen Hunde aus, mixen Drinks hinter einem Bartresen, kellnern oder babysitten, damit sie das Leben in der teuren Stadt finanzieren können. In Boaz’ Garten kommen sie alle zusammen.
Oft sitze ich einfach nur da, höre zu und tauche ein in die Geschichten der Menschen, die mir in Boaz’ Paradies begegnen. Der Garten ist die Bühne, die Besucher die Protagonisten. Israelische Antihelden voller Sehnsüchte und Laster, Abgründe und Lässigkeit. Ich habe in meinem Leben nie viel mit Israelis zu tun gehabt, lediglich mit denen in meiner Familie, die mir stets als verlängerter Arm meiner deutschen vorkam. Unsere Gespräche kreisen meist ums Essen, den nächsten Besuch und um andere Verwandte. Boaz und seine Freunde geben mir einen kleinen Einblick, wie man als Israeli in Tel Aviv leben kann. Und obwohl das Leben im Kerem HaTeimanim nichts mit meinem zu tun hat, geben sie mir das Gefühl, dass ich etwas mit ihnen gemeinsam habe. Was, das kann ich nicht genau sagen. Aber sie laden mich, die Frau aus Deutschland, dazu ein, für einen Moment an ihrem Leben in der Stadt am Meer teilzuhaben. Und ich genieße jede Sekunde.
Tag für Tag folgen Flora und ich Boaz durch die Straßen rund um den Schuk, kaufen ein, essen, trinken, erst Kaffee, dann Alkohol, wir tanzen mit den Israelis und feiern, bis auch der letzte Verkäufer seinen Stand verbarrikadiert hat, sich Obst- und Gemüsereste in der Straßenmitte türmen und nach dem Schnaufen und Piepen der Müllabfuhr die Ruhe der Nacht beginnt. Dann herrschen die Kakerlaken in den Marktgassen, sie fräsen sich durch Müllreste und die Dunkelheit der Nacht, bis die Verkäufer wieder ihre Stände öffnen und die Marktbesucher die Gassen zurückerobern. Ebbe und Flut aus Gewusel und Ruhe faszinieren mich.
Abends sitzen Flora und ich oft am Strand und schauen in die untergehende Herbstsonne, die den Himmel in dramatische Formationen aus Orange und Rosa taucht. Wir genießen mit allen Sinnen: Im Restaurant Basta am Schuk essen wir gegrillte Paprika mit karamellisierten Walnüssen und Ysopsalat mit Kohlrabiwürfeln. Am Strand trinken wir mit meinen Cousins Cocktails und lassen uns dann von ihnen zu gegrillten Fleischspießen einladen. Im Vorort stopft uns meine Großtante mit klebrig-schokoladigem Gebäck voll. In einem Ashram in der Wüste tanzen wir zu Reggaemusik auf einem Hippie-Festival, neben uns wippen junge Eltern mit Kindern auf den Schultern zum Beat. In der Anna Loulou Bar in Yafo feiern wir neben Arabern und Juden bis zum Morgengrauen und drehen unsere Handgelenke und Hüften zu arabischer Elektromusik.
In diesen Tagen lache ich viel, manchmal, bis mir die Tränen in die Augen steigen und die Bauchmuskeln schmerzen. Meine Haare werden lockig vom Salz in der Luft, die Haut auf meinen Oberarmen ist leicht gebräunt. Ich trage Shorts, die ich in Deutschland nie angezogen hätte. Meine knubbeligen Knie sind mir plötzlich egal. Die sinnlichen Eindrücke, die Gesichter und deren Geschichten, die ich hier kennenlerne, setzen Energien in mir frei, sie stimulieren mich. Ich fühle mich frei und zufrieden. Ich strahle aus, dass ich da bin, wo ich sein will. Das merken auch die Männer um mich herum. Ich flirte, ich knutsche, ich fühle mich großartig. In der Hängematte in Boaz’ Garten frage ich mich, wann ich das letzte Mal so entspannt und glücklich gewesen bin. Ich habe das Gefühl, seit Wochen hier zu sein, zwar als Touristin, doch auch als Teil der Gemeinschaft, die er rund um seinen Garten aufgebaut hat.
An unserem letzten Abend stehen wir mit Boaz an einem der orange-blauen Lottobüdchen, die die Allenby-Straße säumen. Zu dritt füllen wir einen Lottoschein aus, unbändig kichernd, fest davon überzeugt, dass wir so glücklich nie wieder sein werden. Als die Zahlen gezogen werden, sind wir drei längst eingeschlafen, jeder in einer Hängematte, über uns die Blüten der Bougainvillea und der Nachthimmel, wenige hundert Meter entfernt das Meer.
Nach nur zehn Tagen, die mir vorkommen wie vier Wochen, sitze ich zum ersten Mal mit einem dicken Kloß im Hals im Taxi zum Flughafen. In Deutschland ist es nass und kalt, der Herbst erwartet uns. Ich will nicht zurück.
Sehnsucht
Etwas hat sich verändert auf dieser Reise. Ich spüre plötzlich eine Sehnsucht in mir, als hätte ich einen Teil von mir in Tel Aviv gelassen.
In Hamburg wird es gerade Winter, der Teil des Jahres, an dem der Himmel über Monate grau ist, die Vormittage schleppend und die Nachmittage finster. In meiner Nachbarschaft St. Pauli eilen die Menschen mit verschlossenen Mienen durch die Straßen, in dunklen Regenjacken, deren Reißverschlüsse sie bis zum Kinn gezogen haben. Wir begegnen uns höchstens beim Einkaufen, auf dem Weg zum Bäcker, nicken uns zu, rufen «Moin»; viel mehr Kontakt entsteht in diesen Wintertagen draußen nicht. Nach der Arbeit sind meine Freunde oft müde, verschieben Treffen, weil sie zu fertig sind oder schon im Pyjama vorm Fernseher sitzen. Ich sitze bis abends oft allein in meiner Wohnung und weiß nach der dreißigsten Romantic Comedy auf Netflix nicht, was ich mit mir anfangen soll.
Seit mittlerweile vier Jahren wohne ich in Hamburg, die Journalistenschule hat mich hergebracht. Ich wohne in einer gemütlichen Wohnung auf knapp 40 Quadratmetern, allein. Nach vielen Jahren in WGs mit Mitbewohnern, die sich zu trashigem Reality-TV kaputtlachten oder sich am helllichten Tag in der Badewanne eine Flasche Rotwein hinter die Binde kippten und «O sole mio» sangen, genieße ich das Alleinsein, meistens zumindest.
Als freiberufliche Journalistin kann ich im Pyjama arbeiten, von meinem Küchentisch aus. Ich schätze die Freiheit, nicht jeden Tag in einem Büro erscheinen zu müssen, dieselben Nasen zu sehen und mir ihre Beschwerden über Rücken, Arbeitslast oder den inkompetenten Kollegen anzuhören. Ich hingegen kann mitten am Tag machen, was ich will: einkaufen, wenn die Supermärkte leer sind, zu Hause sein, wenn der Paketbote kommt, schwimmen gehen, wenn nur Rentner im Becken sind. Ich genieße, dass ich mit meinem Laptop auch unter der Woche nach Frankfurt fahren kann, wo meine Familie lebt, oder über ein verlängertes Wochenende zu Freunden nach Köln oder Berlin. Objektiv gesehen geht es mir in Hamburg nicht schlecht: Ich habe eine unfassbar günstige Wohnung mit Nachbarn, die klingeln, um mir Kuchen vorbeizubringen; den leckersten Vietnamesen, Italiener, Chinesen vor meiner Haustür, die schroff-schöne Elbe und die behäbig-romantische Alster zehn Fahrradminuten entfernt. Mein Leben ist ausgewogen gefüllt mit genug Arbeit für diverse Zeitungen und Magazine, um gut leben zu können, und viel Freizeit, die ich mit Freunden, beim Yoga oder Schwimmen verbringe. Ich habe eine feste Freundesgruppe, mit der ich Ausflüge mache, in meiner Küche feiere und mich zu Wein oder Tee treffe. Ich habe Romanzen – mit einem Gesangslehrer, der mich zum Spargelessen ins Alte Land entführt und mir Bilderstreifen aus dem Fotoautomaten schenkt. Mit einem Clubbetreiber, der mit mir im Cabrio an die Küste fährt und mich zu Spaghetti-Eis einlädt. Mit einem Freund, der immer dann einspringt, wenn gerade kein anderer Mann in der Nähe ist, aber nie wirklich präsent ist.
Meist enden meine Romanzen nach einigen Wochen oder Monaten mit Sätzen wie: «Wenn du dich in mich verliebst, beende ich es» oder «Da ist nicht genug Kribbeln da». Der ein oder andere macht dann noch mal eine zweite, dritte oder siebte Runde, steht um vier Uhr morgens angetrunken vor meiner Tür oder schreibt mir Nachrichten, wenn er sich einsam fühlt – Begegnungen, mal mehr, mal weniger aufregend, mal mehr, mal weniger abstoßend.
Wenn ich ehrlich bin: Es zieht sich etwas Lähmendes durch meinen Alltag.
Schon länger habe ich das Gefühl, ich wüsste ziemlich genau, wie meine Zukunft aussehen wird. Vieles scheint vorhersehbar, etliche Male durchgespielt und erlebt: Das Jahr wird sich zu Ende neigen, wir werden wieder mit klebrigen Fingern und kalten Füßen am Glühweinstand stehen. Eine weitere Silvesterparty in meiner Wohnung, Anstoßen mit Crémant, Whiskey Sour oder Skinny Bitch aus Plastikbechern, darauf mit Edding gekrakelte Namen, Feuerwerk, Tanzen in meiner Küche und Mitgrölen zu Blümchen und den Prinzen. Vielleicht noch eine von mir organisierte Motto-Party, ein Raclette-Gelage an meinem Küchentisch, ein Wintergrillen. Draußen wird der Nieselregen die Bürgersteige vereisen, alle werden sich noch mehr verkriechen, auf ihre Couch, in ihre Partnerschaften, ihre Arbeit.
Der ein oder andere neue Mann wird voraussichtlich in mein Leben treten, vielleicht auch die ein oder andere Erweiterung meines Freundeskreises. Es wird der ein oder andere neue Auftraggeber kommen, ein neues Projekt, ein bisschen mehr Geld. Ich werde neue Kollegen auf Journalistenpartys kennenlernen, auf die man geht, um zu netzwerken und zu checken, wie erfolgreich man ist, und sich dann die Kante zu geben, wenn man feststellt, dass man es irgendwie doch nicht geschafft hat.
Irgendwann kommt dann wieder der Sommer, und mit ihm Ausflüge an den See, an den Seitenarm der Elbe, wo die Sonne über den Holzstegen untergeht, vielleicht sogar ans Meer, falls einer die Muße hat, sich den Stau Richtung Ostsee anzutun. Grillen im Park und Picknicks, vielleicht ein Kurzurlaub mit den besten Freunden oder einer Freundin, die noch Single ist.
Mein Studium, meine Zeit an der Journalistenschule, in unterbezahlten Praktika ist vorüber, ich habe fertig gelernt. Ich frage mich: War es das jetzt mit den neuen Erfahrungen, die ich für mich allein erlebe? Bin ich alle sich mir öffnenden, unbekannten Wege gegangen, die man einschlägt, weil einen ein Studium, ein Job, eine neue Aufgabe an einen neuen Platz ruft? Hamburg ist einer der Orte, in denen man leben sollte, wenn man vom Job einer freien Journalistin leben möchte, hier sitzen die Verlage, die Magazine und Wochenzeitungen, die in ganz Deutschland gelesen werden. Wenn das Leben in geregelten Bahnen verläuft, wird es zunehmend schwerer, Dinge anders zu machen, Neues zu lernen, neuen Menschen zu begegnen, neue Richtungen einzuschlagen. Vielleicht ist dieser Kreislauf aus Alltag und Ritualen Teil des Erwachsenwerdens.
Ich weiß das alles, doch es graut mir – vor der Routine der Treffen, der Arbeit, der Gespräche: Dinge, von denen ich das Gefühl habe, sie zu gut zu kennen, um sie noch aufregend, überraschend, stimulierend zu finden. Nach dieser intensiven Zeit mit neuen Gesichtern und Geschichten in Israel fällt mir plötzlich auf, wie wenig Neues, Herausforderndes, Anregendes ich in meinem Hamburger Alltag habe. Und plötzlich stört mich das.
Ich bin nicht unglücklich, aber wenn ich ehrlich bin, bin ich auch nicht wirklich glücklich. In dem endlosen Programm aus Arbeit, Hobbys, Freunde treffen verbirgt sich eine große, ziellose Leere. Etwas fehlt. Und dann ist da Tel Aviv.
Ich kann nicht aufhören, an die Stadt zu denken, an meine neuen Bekannten dort, an die Luft, das Meer. Die Lebendigkeit, die Herzlichkeit, die Wärme. Ich spüre einen Sog in mir, den ich sonst nur kenne, wenn ich eine Eingebung beim Schreiben habe, ein kreatives Kribbeln, das meine Gedanken einnimmt, eine Energie, die mich antreibt.
Es ist, als hätte ich mich verliebt, verliebt in einen Ort und die überwältigende Fülle, die ich dort gefühlt habe. Und dabei dachte ich, ich kenne Israel schon so gut.
Herzliya
Ich war 18 Monate alt, als ich das erste Mal nach Israel reiste. Auf Fotos stehe ich mit strammen Beinchen und voluminöser Windel in einem Kinderbett unter einer Dattelpalme. Aufgenommen wurde es im Frühjahr 1987 im Garten meiner Oma in Herzliya, nördlich von Tel Aviv.
Israel, das war Familienurlaub. Sand zwischen den Zehen. Das Piksen des trockenen Rasens unter den Füßen. Die Wärme auf der Haut, als würde man rundum von einem Föhn angepustet. Die kühlen Fliesen im abgedunkelten Haus meiner Oma. Die Stille, zu der sie mich und meine Schwester ermahnte, wenn sie ihre Telenovela guckte, ihre Beine auf dem Sofa ausgestreckt. Das vorwurfsvolle Zetern, wenn sie mal wieder mit meinem Vater stritt.
Zu Israel gehörten Treffen mit israelischen Cousins, deren brüchiges Deutsch nach Schwarzwald klang. Geschmäcker, Gefühle, Geräusche und Gerüche, die mir nur dort begegneten: die Graupen in der Hühnersuppe meiner Oma, zerdrückte Avocado in Pita-Brothälften, der Salat aus klitzeklein geschnittenen Tomaten und Gurken. Noch heute, wenn jemand neben mir eine Clementine schält, steigt mir der Duft des Baums in die Nase, der in Omas Garten stand.
Ihr Haus befand sich wenige Minuten Fußweg vom Strand entfernt. Viele ihrer Nachbarn sprachen Deutsch. Omas Nachbar trug eine Nummer auf dem Unterarm, die ihm in einem Konzentrationslager tätowiert worden war.
Für meine Großeltern war Israel die Rettung gewesen. In den dreißiger Jahren ließen sie ihre jeweilige Heimat – Homburg an der Saar und Wien – zurück, meine Großmutter sogar ihre Mutter. Sie fuhren mit falschen Papieren und mit der Hilfe einer britischen Untergrundorganisation, die Juden und Jüdinnen half, ein Land zu erreichen, das noch keines war: das britische Mandatsgebiet Palästina. Sie suchten Schutz vor den Nazis und fanden sich, in einem Tel Aviver Café. Mein Großvater soll meiner Großmutter ein Eis gekauft und anschließend gesagt haben: «Die heirate ich.» Sie heirateten, 1941 in Ramatayim, Hod HaSharon, nordöstlich von Tel Aviv, und bekamen zwei Töchter, meine Tanten.
Israel blieb das Zuhause meiner Großeltern, als das Land 1948 gegründet wurde, bis 1951, als mein Großvater sich entschloss, zurückzugehen nach Deutschland, in seine Heimat, die jetzt bereit war, ihm zuzugestehen, was sie ihm genommen hatte: das Geschäft der Familie, die deutschen Wälder, Reparationszahlungen – nicht für ihn selbst, sondern für seine Geschwister, die in Israel geblieben waren. Mein Vater, ihr drittes Kind, ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Und obwohl sich mein Großvater nach Deutschland sehnte: Israel hatte sich in sein Herz eingenistet. Sprach sich jemand in seiner Gegenwart gegen den jüdischen Staat aus, wurde er von ihm sofort als Antisemit beschimpft. In den Wohnzimmerregalen der Jugend meines Vaters reihte sich zionistische Literatur, Titel wie Exodus und Oh Jerusalem, Biografien des ersten Premierministers Ben Gurion, später Bildbände des Sechs-Tage-Kriegs, ein Buch über Golda Meir, Außenministerin und erste weibliche Premierministerin des Landes.
Israel war Stolz und Un-Ort für meinen Großvater, zu heiß und zu prekär, um dort dauerhaft zu leben, und doch der Ort, an den er sich sehnte, weil seine Familie dort war, Freunde, die Ähnliches erlebt hatten wie er, vor allem: viele andere Juden.
In den Sechzigern ließ es sich mein Großvater nicht nehmen, mit seinem nagelneuen Mercedes per Schiff nach Israel zu fahren, um den Verwandten zu zeigen, wie gut es ihm wirtschaftlich in Deutschland ging, und vielleicht auch, um für sich selbst zu rechtfertigen, dass er nicht in Israel geblieben war. Jeder Verwandte wurde fotografiert: auf dem Mercedes hockend, an dem Mercedes lehnend, hinter dem Steuer des Mercedes sitzend.
Israel, das war immer klar, war der Ort, an dem meine Großeltern alt werden wollten, in der Rente, in ihrem selbsterbauten Haus, in Herzliya. Inzwischen ist Israel der Ort, an dem mein Großvater begraben liegt, mehr als 3000 Kilometer entfernt vom Grab meiner Großmutter auf dem Jüdischen Friedhof in Frankfurt am Main.
Für mich, die dritte Generation nach dem Holocaust, war Israel in erster Linie ein Ferienort. Die Sehnsucht anderer Juden nach Israel, dem einzigen jüdischen Staat auf der Welt, hatten wir nicht. Auch keinen glühenden zionistischen Eifer. Meine Eltern, meine Schwester und ich fuhren nach Israel, meist einmal im Jahr, weil dort ein Teil unserer Familie lebte, ein Dutzend Cousins und Großtanten. Weil meine Oma dort ein Haus besaß. Weil es dort warm und schön war.
In meiner jüdischen Grundschule in Frankfurt war Israel ein Symbol. Wir fanden es auf den blau-weißen Flaggen mit dem Davidstern, die in den Fluren der Schule gespannt waren. Es war die Heimat unserer Lehrerinnen mit dem starken Akzent. Zwei Mal pro Woche brachten sie uns im Hebräisch-Unterricht Vokabeln bei, von Apfel – tapu’ach – bis wohnen – lagur –, und wie wir unseren Namen auf Hebräisch schreiben und aussprechen: Ssssarah mit scharfem S. Auf Schulfesten sangen wir israelische Kinderlieder, an Feiertagen die israelische Nationalhymne. In der Gemeinde sammelten wir Spenden, damit in Israel Bäume gepflanzt werden konnten.
Israel war der Ort, um den sich alles im Religionsunterricht drehte und dessen Geburtstag wir einmal im Jahr an Yom HaAtzma’ut feierten, blau-weiß gekleidet. An Pessach und Yom Kippur sagten wir im Chor: LeSchana haba’a biJeruschalaijm – nächstes Jahr in Jerusalem. Was genau damit gemeint war, wusste ich nicht.
Wir idealisierten diesen Ort, auch bei uns zu Hause. Fand man in meiner Familie eine Avocado oder eine Paprika aus Israel im Supermarkt, war es auf jeden Fall die beste Avocado, die allerbeste Paprika, die wir jemals gegessen hatten. Trafen meine Eltern an einem Frankfurter Falafel-Stand einen Israeli, so wurde er zu uns nach Hause zum Essen eingeladen. Bis heute ist es so, dass meine gesamte Familie vorm Fernseher sitzt, wenn ein in Israel produzierter Film läuft. Mein Vater hat gefühlt jede Netflix-Serie gesehen, in der auch nur ein Wort Hebräisch fällt. Doch er schaut sie mit deutschen Untertiteln, seine Eltern haben ihm Hebräisch nicht beigebracht; bei ihm zu Hause sprach man Deutsch.
Manchmal seufzte er tief, sagte, wir sollten doch mal nach einer Wohnung in Tel Aviv schauen. Doch die horrenden Immobilienpreise und seine begrenzten beruflichen Perspektiven dort haben diese Wünsche nie in ernsthafte Pläne verwandelt.
In Israel zu leben, stand in meiner Familie nie zur Diskussion. Unsere Heimat war Deutschland.
Obsession
Nach der Reise mit Flora wird Tel Aviv zu einem Fixpunkt in meinen Gedanken. Wie eine Insel im Kopf, auf die ich mich flüchte, wenn ich das Gefühl habe, in Hamburg ist alles zu grau, zu distanziert, zu routiniert. Das Land hat mich im Innersten berührt, da ist etwas Tiefes, das ich noch nicht greifen kann. Die Gedanken daran machen meinen Alltag in Hamburg etwas bunter, aufregender. Ich weiß nicht, was es genau ist, das dieses Kribbeln in meinem Bauch auslöst. Ich weiß nur, dass ich mehr von diesem Gefühl spüren will. Und dass ich mir nicht mehr einreden kann, dass alles so gut ist, wie es ist.
In diesem Winter wird Israel zur Droge für mich. Ich bin ein Junkie, der nach dem nächsten Schuss sucht: Auf Netflix schaue ich israelische Serien und Filme im Originalton mit Untertiteln. Über das Internet höre ich israelische Radiosender. Ich besuche israelische Imbisse und Restaurants, schimpfe über unfluffigen Hummus, koche Schakschuka für meine Hamburger Freunde, fruchtig-scharf gewürzte Tomaten mit eingebackenen Eiern. Ständig hänge ich am Handy und schreibe mit meinen neuen israelischen Freunden, überlege, wann ich wiederkommen kann. Ich buche den nächsten Flug. Abends vor dem Schlafengehen lese ich in dem Buch mit hebräischen Sätzen für Touristen, das Boaz mir zum Abschied geschenkt hat. Als Lesezeichen dient mir der Lottoschein, den wir gemeinsam am letzten Abend ausgefüllt haben. Ich blättere durch das Buch, prüfe, welche Wörter und Ausdrücke noch hängen geblieben sind von dem Hebräisch, das ich in der Grundschule gelernt habe. Doch mit «Ani Sarah, ani gara beGermania» – Ich bin Sarah, ich wohne in Deutschland – landet man als Touristin allerhöchstens in Boaz’ Schlafzimmer.
Wenige Monate nach meiner Reise mit Flora sitze ich in einer winzigen Küche in Hamburg-Ottensen. Die Kälte kriecht durch das schlecht isolierte Fenster, vor mir auf dem Küchentisch steht eine Tasse Kräutertee und ein Buch über hebräische Grammatik. Ich habe wieder begonnen, Hebräisch zu lernen.
«Ssssarah, Krise! Krise! Krise!», ruft Noa und stützt sich mit den Händen auf den Küchentisch. Sie greift sich mit den Händen in die schwarzen Locken. Noa ist Israelin, eine junge Künstlerin mit heller Haut und dunklem, störrischem Haar. Aufgewachsen ist sie in einem Kibbuz nördlich von Tel Aviv, in Hamburg studiert sie Kunst und Musik, nebenher gibt sie mir Unterricht. Einmal die Woche sitzen wir in ihrer zugigen Küche, sie führt mich durch die sieben Verbgruppen des Hebräischen, durch eine Milliarde Untergruppen, Sonderformen, Ausnahmen, die mich in den Wahnsinn treiben.
Noa ist geduldig mit mir und meinen Fehlern, zugleich voller ungezügelter Leidenschaft für deutsche Männer, ihre Kunst, Musik. Dann wieder ist sie kindlich ahnungslos, wie sie sich im bürokratischen Deutschland zurechtfinden soll. Ich helfe Noa beim Ausfüllen von Anträgen, Steuerformularen, Bewerbungen, sie mir mit Verbtabellen, Satzstrukturen und mit dem Finden von Eselsbrücken für die seltsamsten Vokabeln («lehitga’agea – vermissen – ist das Gaga-Wort, das ich in meiner Erinnerung vermisse»). Wir haben mit einfachen Gesprächen über unsere Familien, die Berufe meiner Eltern begonnen und uns dann zu den Geschichten unserer Großeltern, unserer Männer vorgewagt.
«Ich muss etwas verändern», sagt Noa heute. Den Satz habe ich schon öfter von ihr gehört. Meist folgt darauf eine dramatische Erklärung, womit sie nicht mehr leben kann: die schlecht bezahlte Arbeit als Musikerin, die mit dem Job als Sprachlehrerin ausgeglichen werden muss, die Faulheit ihrer Sprachschüler, die Unflexibilität deutscher Behörden, ihr alkoholkranker Nachbar, ihr feierwütiger Freund, die Frage, wo es hingeht, wenn ihr Studium fertig ist. Noa spricht stets mit viel Gefühl. Ihr Zweifel ist kein Zögern, sondern eine Lawine an unterschiedlichen Emotionseruptionen, an deren Ende meist eine feste Überzeugung steht. So auch heute.
«Ich habe meinem Freund gesagt, dass ich keine Kinder in Deutschland großziehen möchte», sagt Noa. «Das ist eine Katastrophe hier. Kinder werden als störendes Problem gesehen.» In Israel sei das anders, Kinder seien Lebensinhalt und Lebensfreude. Ich denke an die Kinder im Tel Aviver Alltag, wie sie in Cafés und Restaurants rumwuseln. An die Gelassenheit der Eltern, wenn die Kinder plötzlich losbrüllen, unter fremde Tische krabbeln oder durch die Beine der Kellner kriechen. An die Selbstverständlichkeit, mit der israelische Eltern ihre Kinder überallhin mitbringen, und sei es ein Elektrofestival in der Wüste.
Ich habe Noas Freund nur ein-, zweimal erlebt, kenne ihn in erster Linie durch ihre Geschichten. Laut Noa ist er durch und durch deutsch: aufgewachsen in einer Kleinstadt in Norddeutschland, mit stoischen Eltern, die nicht über Gefühle reden und es exotisch finden, dass er mit einer Israelin zusammen ist, die laut lacht und ihre Gefühle und Gedanken ungefiltert teilt. Er ist nicht begeistert von der Idee, mit ihr nach Israel zu gehen. Ich sehe die Sorge in Noas Gesicht.
Vielleicht wird es leichter, sage ich, wenn er etwas Hebräisch kann? «Es fällt ihm schwer», sagt sie und erzählt von dem gemeinsamen Urlaub in Israel, in dem er meist still rumsaß und nicht verstand, was alle durcheinanderredeten, wieso man dauernd alle besuchen musste und warum er nicht einfach nur am Strand liegen konnte.
Ich ahne, dass Noa zweifelt, an ihrem Freund, an der gemeinsamen Zukunft, an ihrer eigenen.
Seit ich Noa kenne, beobachte ich diese Hass-Liebe zu ihrem Heimatland. Zu teuer, zu fordernd, zu anstrengend, zu frustrierend, um dort als Künstlerin zu leben und zu überleben, sagt sie. Und am Ende doch der Ort, an dem sie eine Familie gründen will.
Noas Drama, ihr offenes Zweifeln, ihr Scheitern und Wiederaufstehen und diese unbeirrbare Überzeugung, dass sie die Dinge hinkriegt, die sie sich vornimmt, beeindrucken mich. Ihre Gefühlsachterbahnen machen es für mich leichter, meine eigenen Gefühle zu zeigen. Manchmal sitzen wir in ihrer Küche und weinen zwischen Grammatikübungen über die Männer, die wir versucht haben zu lieben, über Streitigkeiten in unseren Familien, die Aufgaben, denen wir uns nicht gewachsen fühlen, die Jobs, die wir verkackt haben. In ihrer Gegenwart fühle ich mich lebendig, verbunden mit dem Zustand, der mich in Tel Aviv so erfüllt hat. Vielleicht kann ich mich bei ihr auch einfach mehr spüren.
Israel ist plötzlich überall. Ich scheine die Israelis magisch anzuziehen: An der Kasse im Supermarkt, auf der Bierbank eines Open-Air-Konzerts, in einem Bus in Berlin – ständig meine ich Hebräisch zu hören. Sehe ich Menschen dazu wild gestikulieren und lauter reden als ihr Umfeld, habe ich meist Gewissheit. Mit einigen von ihnen freunde ich mich an. Ihr Job, ein Studium, die Aussicht auf ein Leben, das sie bezahlen können, hat sie nach Deutschland gelockt. Viele haben deutsche Wurzeln, eine Großmutter, einen Großvater, deren Schicksal in der Nazizeit ihren israelischen Enkeln einen deutschen Pass ermöglicht hat. Es sind so überraschend viele Israelis, die in Hamburg leben, dass ich mich frage, warum ich sie vorher nie wahrgenommen habe.
Das junge hübsche Paar, Neta und Ilan, ist wegen seiner Arbeit als Ingenieur nach Hamburg gekommen. Sie belegt Avocado-Brote in einem Hamburger Café, liebt das Nieselwetter und die günstigen Supermärkte, Ilan die norddeutschen Backsteinhäuser.
Der Musiker Yuval hat Israel den Rücken gekehrt, weil sein Land ihm Kopfschmerzen bereitet. Bei seiner Musterung für die Armee ist er im dicken Wintermantel aufgetaucht, um glaubhaft eine psychische Störung vorzuspielen. Er wollte kein Soldat sein, ist nicht bereit, für ein Land zu kämpfen, das ihn anwidert. In Deutschland spielt er Klavier und Akkordeon in einer Gypsy-Swing-Band und, wenn das nicht reicht, Online-Poker. Er habe weniger Kopfschmerzen hier, sagt er in perfektem Deutsch.
Die Lebensgeschichten der Israelis klingen oft wie die von Figuren einer abgedrehten Vorabendserie: ein Koch, der laut zu israelischen Klassikern mitsingt, während er in einer Speak-Easy-Bar gegrillten Tintenfisch auf den Tisch knallt. Ein Student, der durch Indien gereist ist, in Deutschland vor Ziellosigkeit depressiv wird und seinen Platz in der Welt noch nicht gefunden hat. Eine junge Tänzerin, die alle paar Wochen von WG-Zimmer zu WG-Zimmer zieht, weil sie den Untermietvertrag nicht verstanden hat.
Zu meiner Überraschung lieben die Israelis Deutschland, das oft kühle Wetter, die komplizierte, aber funktionierende Bürokratie, Aldi und die vielen Dinge, die man hier mit wenig Geld kaufen kann. Sie sorgen sich nicht darum, wie sie zurechtkommen werden, sie machen einfach. Mich beeindruckt ihr Mut, ihre Heimat hinter sich zu lassen, um in einem Land zu leben, dessen Sprache und Mentalität sie kaum verstehen. Die Sorglosigkeit, mit der sie Gänge zu Ämtern, Banken oder Vermietern navigieren. Die Zuversicht, mit der sie sich ausmalen, einen israelischen Imbiss, eine Muffin-Bäckerei zu eröffnen und reich zu werden. Für mich grenzen ihre Träumereien fast an Naivität. Vielleicht bin ich aber auch einfach zu schwarzseherisch und ängstlich. Die Israelis nicht. Ein junges Ehepaar aus Nordisrael erzählt mir davon, dass es regelmäßig Fremde auf der Straße anspricht, um sich von ihnen die Briefe des Jobcenters ins Englische übersetzen zu lassen. Treten Probleme auf, sagen sie: «Jihje beseder» – Das wird schon. Und meist haben sie recht. Sie haben eine Gelassenheit, einen Lebensmut, den ich bewundere und um den ich sie beneide. Ich komme mir spießig vor in ihrer Gegenwart, mit meinen Zukunftsängsten, Befürchtungen, meiner Meckerei über Kollegen, das Regenwetter, den lahmen Plot des letzten Tatorts.
Ich besuche Noas und Yuvals Konzerte in den Kneipen der Sternschanze. Ich zünde mit ihnen improvisierte Schabbat-Kerzen auf Untertellern an, esse Yuvals Burekas mit Pilzfüllung und bröselige Tchina-Kekse; an Rosch haSchana, dem jüdischen Neujahr, sitze ich bei Neta und Ilan bei süßem Kuchen und Granatapfelkernen am Esstisch in Altona; an Pessach singe ich mit ihnen Lieder im dröhnenden Chor, die ich schon als Kind an dem Feiertag gesungen habe: «Echad – mi jodea? Echad! Ani jodea …»
Wenn ich mit ihnen esse, feiere, ihre Musik höre, ihre Gespräche, dann fühle ich mich Israel ein wenig näher – selbst wenn die Israelis nach dem dritten Joint Hebräisch in Lichtgeschwindigkeit reden und ich gar nichts mehr verstehe. Was sie über mich denken, weiß ich nicht. Aber sie behandeln mich wie ein Familienmitglied.
Die Welt ist ein Dorf, vor allem die jüdische. An einem Schabbat-Abend in Altona finde ich heraus, dass die Großeltern des Ingenieurs Ilan direkte Nachbarn meiner Großmutter gewesen sind, in Herzliya. Meine Oma hat immer über Ilans Großvater geschimpft, der am Samstag, dem Ruhetag, zur Mittagszeit im Unterhemd den Rasen gemäht hat.
An den Abenden mit meinen neuen Freunden in Hamburg wird mir klar, dass ich, trotz meiner vielen Reisen in das Land, zuvor kaum Israelis außerhalb meiner Familie kennengelernt habe. Dass ich gerade erst herausfinde, was sie bewegt, worüber sie streiten, was sie glücklich macht. Was es heißt, Israeli zu sein.
Studienreise
«Sarah, die Reise nach Israel wäre doch auch etwas für dich», sagte mein Dozent. Wir saßen in seinem Hebräisch-Kurs, in einem stickig-stinkigen Raum eines braunen Gebäuderiegels auf dem Campus der Mainzer Uni, der sich wenige Jahre später als asbestverseucht herausstellen sollte. Es war im zweiten Semester meines Magisterstudiums, die Zeit, in der man noch glaubt, Kurse außerhalb der Standard-Curricula besuchen zu sollen, weil man eben kann.
Im Sprachkurs saßen Politikwissenschaftler, Soziologen, Theologen. Es überraschte mich, wie viele Studenten besonderes Interesse für Israel und seine Sprache hatten. Ich erinnere mich an eine Studentin, die im Unterricht ein T-Shirt trug, auf dem stand: «Jesus lebt».
Ich dachte, Hebräisch wäre für mich ein Kinderspiel, lesen und schreiben konnte ich ja schon. Doch nach wenigen Wochen Unterricht kam ich an meine Grenzen. Ich kapierte die hebräischen Verbgruppen nicht, nahm immer sporadischer und lustloser teil. Dann erzählte unser Dozent von einer Studienreise nach Israel.
Es sollte eine politische Reise sein, mit Fokus auf Israels Gesellschaft, Wirtschaft, religiöses Leben und den Nahostkonflikt mit all seinen Facetten. Obwohl ich nicht Politik studierte, meldete ich mich an. Ich hatte Lust auf Israel – seit meine Oma ihr Haus verkauft hatte, war ich nicht mehr dort gewesen.
Mittlerweile nahm ich sehr wohl wahr, dass es um Israel ging, wenn meine Eltern abends oft mit sorgenvollen Gesichtern vor der Tagesschau saßen, wenn Terroristen Busse oder Diskotheken in Tel Aviv in die Luft gesprengt hatten oder Raketen auf israelische Dörfer niedergeprasselt waren.
Das Israel, das mir in den Nachrichten präsentiert wurde, war ein anderes Israel als das meiner Kindheit. Ein unruhiger, unsicherer Ort, an dem einem das Einsteigen in einen Bus, der Partyabend im Club, der Besuch eines Restaurants zur falschen Zeit zum Verhängnis werden konnte. Ich verknüpfte diese Ereignisse nicht mit Herzliya, wo es nach Pinien und Clementinen roch, und ahnte nicht, wie stark diese Bildungsreise meinen Blick auf das Land verändern würde.
Von Haifa bis Be’er Scheva, von Ramallah bis Hebron und zurück nach Jerusalem – 13 Tage tourten wir Studenten durch das Land, das Juden und Palästinenser ihre Heimat nennen. Juden, weil sie vor mehr als 2000 Jahren in der Region lebten, erst in der Mehrheit, und dann – als Assyrer, Babylonier, Perser und schließlich Römer die Region eroberten und seine Bewohner in alle Himmelsrichtungen vertrieben – in kleinster Minderheit. Später eroberten muslimische Araber Jerusalem, der Felsendom wurde zu einem Glaubensmittelpunkt für Muslime aus der ganzen Region. Ihnen folgten die Kreuzritter, die osmanischen Türken, die Briten – unterschiedlichste Mächte, die jahrhundertelang um die Vormacht in der Region kämpften.
Mehr und mehr Juden kehrten seit Ende des 19. Jahrhunderts aus aller Welt an den Ort zurück, an dem ihr Volk seine Wurzeln hatte. Auf der Flucht vor Diskriminierung und Verfolgung, aber auch aus zionistischer Überzeugung: Für viele war das biblische Israel der einzige Ort, der für Juden als Heimat in Frage kam. Doch die frühen Siedler waren nicht allein im Land. Es lebten bereits Araber dort, die sich Palästinenser nannten. Je mehr Juden kamen, je mehr Land sie den Arabern abkauften, desto größer und gewalttätiger wurden die Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern, alteingesessenen und neueingewanderten Juden und Briten, die versuchten, das Gebiet zu verwalten.
Nach dem Schock des Holocaust überließen die Briten die Entscheidung, was mit der Gegend geschehen sollte, den Vereinten Nationen. Die stimmten darüber ab, das Land zu teilen – in zwei Staaten mit Grenzen, die die Palästinenser ablehnten, die Juden annahmen. Am 14. Mai 1948 wurde der Staat Israel ausgerufen, aber kein Staat Palästina. Einen Tag später erklärten die arabischen Nachbarländer Israel den Krieg.
Die Israelis siegten, Hunderttausende Palästinenser verließen ihre Häuser und Dörfer, teils wurden sie gewaltsam vertrieben, teils wurden sie von ihren Anführern dazu aufgefordert. Einige behielten ihre Wohnungsschlüssel, dachten, sie könnten bald zurückkommen.
Die wenigen Palästinenser, die blieben und letztlich Bürger des Staates Israel wurden, bilden heute die Bevölkerungsgruppe der «arabischen Israelis» – oder «Palästinenser mit israelischem Pass», wie sich viele selbst lieber nennen. Ihre Identität schwankt zwischen der Verbundenheit mit ihren palästinensischen Wurzeln und dem Leben in der israelischen Realität – einem Staat, dessen Gründung 1948 die Israelis Jahr für Jahr mit einem «Unabhängigkeitstag» feiern, Yom HaAtzma’ut, und die Palästinenser als Nakba – Katastrophe – betrauern. Solidarität erhalten sie von den inzwischen mehreren Millionen Nachkommen der Palästinenser auf der ganzen Welt, die damals aus ihrer Heimat flohen. Viele leben bis heute in den arabischen Nachbarländern, oft als Flüchtlinge ohne Status in Camps, die über die Jahrzehnte zu Dörfer geworden sind. Andere haben neue Leben begonnen in Europa und den USA. Viele vereint der Wunsch, irgendwann zurückzukehren, in eine Heimat, die es so nicht mehr gibt.
Die restlichen Palästinenser, die 1948 in der Region blieben, und ihre Nachkommen leben bis heute in den Gebieten des Gazastreifens und des Westjordanlands, teils in wirtschaftlicher Abhängigkeit, teils in offener Feindschaft zu ihren israelischen Nachbarn, die Teile des Westjordanlands und die Grenzen zu Gaza kontrollieren.
Dutzende kriegerische Auseinandersetzungen, Terrorattentate, Armeemanöver und rund 60 Jahre gescheiterte Verhandlungen später fuhren wir deutschen Studenten durch das Land, oft entlang meterhoher Sperranlagen, die erbaut wurden, um Israel unüberwindbar von den palästinensischen Gebieten zu trennen. Riesen aus Beton, die teilen, was sich schwer aufteilen lässt. Mauern, die für die einen Schutz bedeuten, für die anderen Gefängnis. Die es Israelis und Palästinensern unmöglich machen, im Alltag aneinander vorbeizulaufen, über den Preis von Erdbeeren zu verhandeln oder sich zumindest gegenseitig anzusehen als das, was sie sind: Menschen zweier Völker, die den gleichen Flecken Erde ihre Heimat nennen, eine nationale Heimat, eine religiöse.
Und alles lag so nah beieinander.