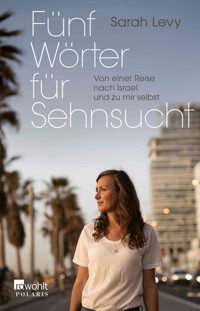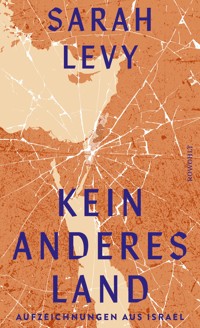
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ein eindringlicher, persönlicher Bericht aus Israel und ein Plädoyer für die Menschlichkeit auf beiden Seiten eines zerstörerischen Kriegs. Ist das noch mein Land? Diese Frage stellt sich Sarah Levy, seit sie erlebt, wie Israels rechtsnationale Regierung die israelische Gesellschaft spaltet. Dann attackiert die Hamas das Land am 7. Oktober 2023. Auf brutale Weise ändert der Krieg das Leben, das die junge Mutter in Tel Aviv führt. Sie flieht mit Partner und Kind in ihre Heimat Frankfurt und muss dort erkennen, dass Deutschland nicht mehr ihr Land ist. Doch das Israel, in das sie zurückkehrt, kämpft um seine Seele. Freunde tragen plötzlich Waffen, Verwandte wünschen Palästinensern die Auslöschung, Nachbarn unterstellen ihr, die Soldaten zu verraten. Der Kriegsalltag zwischen Schutzbunker und allgegenwärtigem Verlust führt Levy an ihre Grenzen – als Mutter und als Partnerin, aber auch als Deutsche, die jetzt verstehen muss, dass das Land, das sie zum Leben gewählt hat, die Hoffnung auf eine friedliche Zukunft mit den Palästinensern schon lange verloren hat. Wer wird mein Sohn, fragt sie sich, wenn er hier aufwächst? Sarah Levy beschreibt mit kritischem Mitgefühl, wie Radikalisierung und Polarisierung ein Land verändern – und letztlich auch sie selbst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 446
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Sarah Levy
Kein anderes Land
Aufzeichnungen aus Israel
Über dieses Buch
Ein eindringlicher, persönlicher Bericht aus Israel und ein Plädoyer für die Menschlichkeit auf beiden Seiten eines zerstörerischen Kriegs.
Ist das noch mein Land? Diese Frage stellt sich Sarah Levy, seit sie erlebt, wie Israels rechtsnationale Regierung die israelische Gesellschaft spaltet. Dann attackiert die Hamas das Land am 7. Oktober 2023. Auf brutale Weise ändert der Krieg das Leben, das die junge Mutter in Tel Aviv führt. Sie flieht mit Partner und Kind in ihre Heimat Frankfurt und muss dort erkennen, dass Deutschland nicht mehr ihr Land ist. Doch das Israel, in das sie zurückkehrt, kämpft um seine Seele. Freunde tragen plötzlich Waffen, Verwandte wünschen Palästinensern die Auslöschung, Nachbarn unterstellen ihr, die Soldaten zu verraten. Der Kriegsalltag zwischen Schutzbunker und allgegenwärtigem Verlust führt Levy an ihre Grenzen – als Mutter und als Partnerin, aber auch als Deutsche, die jetzt verstehen muss, dass das Land, das sie zum Leben gewählt hat, die Hoffnung auf eine friedliche Zukunft mit den Palästinensern schon lange verloren hat. Wer wird mein Sohn, fragt sie sich, wenn er hier aufwächst?
Sarah Levy beschreibt mit kritischem Mitgefühl, wie Radikalisierung und Polarisierung ein Land verändern – und letztlich auch sie selbst.
«Zutiefst persönlich, zutiefst politisch, zutiefst ehrlich. Ein Buch, das die große Wunde des Nahostkonflikts von allen Seiten schonungslos offenlegt. Sarah Levy beleuchtet sensibel und kenntnisreich alle Facetten eines Daseins zwischen Israel, Palästina und Deutschland.» Shelly Kupferberg
«Ein Buch für alle, die jenseits der polarisierten Nahostdebatte nach Zwischen- und Grautönen suchen.» Saba-Nur Cheema
Vita
Sarah Levy, geboren 1985, wuchs in Deutschland mit jüdischen und nicht-jüdischen Großeltern auf; 2019 wanderte sie nach Israel aus und schrieb darüber ihr erstes Buch «Fünf Wörter für Sehnsucht». Sie besuchte die Henri-Nannen-Journalistenschule und arbeitet als freie Journalistin. Seit 2018 koordiniert sie das Projekt stopantisemitismus.de und arbeitet für diverse Bildungsinitiativen. Sie lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Tel Aviv.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, August 2025
Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Jana Meier-Roberts
ISBN 978-3-644-02144-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Oz. In der Hoffnung.
Prolog
Als Oz an jenem Donnerstagnachmittag seine Arme um Marwas Hals schlingt, sein Gesicht in die Falten ihres Hijabs bohrt, mit seinen sonnenbraunen Beinen ihre Hüfte umklammert – als er sie gar nicht mehr loslassen will, obwohl ich doch gekommen bin, seine Mutter, um ihn abzuholen –, da denke ich nur: Vielleicht ist er müde. Vielleicht hätte ich seine Cousins nicht mitbringen sollen. Vielleicht überfordern ihn die vielen Menschen nach einem ganzen Tag mit den anderen Kindern in der Betreuung.
Marwa drückt meinen Sohn an sich, murmelt: «Ozi Masmosi, zeigst du Mama und Papa nochmal, wie sehr du deine Tagesmutter liebst?» Sie küsst seine Wange und seine Stirn. «Ich liebe dich auch.» Dann versucht sie, Oz in meine Arme zu übergeben. Der sträubt sich, zerrt an ihrem Kopftuch, weigert sich, sie loszulassen, und beginnt erst zu jammern, dann zu weinen.
Ich glaube nicht an Vorahnungen. Und doch muss ich später immer wieder an diesen Moment denken. Warum lief mein Sohn nicht wie sonst nach der Betreuung in meine Arme? Warum hielt er sich so verzweifelt an Marwa fest, als ob er sie nach dem Wochenende nicht wiedersehen würde? Wenn das eigene Leben sich radikal ändert, erhält Gewöhnliches plötzlich eine Bedeutung. Wird zu dem Versuch zu erklären, was sich nicht erklären lässt. Gibt dem «Zuvor» ein Gewicht, um das «Danach» begreifbarer zu machen.
Ich dachte nach dem 7. Oktober 2023 oft: Vielleicht spürte Oz, dass dies ein Abschied sein würde. Dass dieser Donnerstagnachmittag, der 5. Oktober, nicht nur der Beginn eines sonnigen Herbst-Wochenendes in Israel war. Sondern dass weniger als 48 Stunden später eine Katastrophe geschehen würde, die alles veränderte. Das Leben unserer Familie. Das Leben von Marwa. Und das Land, das wir alle unser Zuhause nennen.
Teil 1Der längste Tag
Ein Meer an Erinnerungen
Wir sind nochmal ans Meer. Nach Herzliya, an den Strand unterhalb der Dünen und der Moschee. Dort, wo ich als Kind im Urlaub in die Wellen gehüpft bin und Muscheln gesammelt habe, bis mir der Teer an den Fersen klebte und die Sonne mir blonde Strähnen ins Haar gezaubert hat. Es ist der perfekte Tag. Die Sonne scheint warm, aber nicht zu heiß vom Himmel. Ein frischer Wind kündigt den Herbst an, er bringt das Sonnensegel zum Flattern, das Itay über uns aufgespannt hat. Die Kinder spielen im nassen Sand am Wasserrand. Von unserer Bastmatte aus sehe ich Itay zu, der mit Oz an der Hand auf das Meer blickt. Oz bückt sich und versucht, mit der freien Hand Muscheln aufzuheben und gleichzeitig seinen Plastikeimer nicht fallen zu lassen.
Itays Schwager Sagie reicht mir eine von seinen Zigaretten. Er erzählt heute mehr, als er mir jemals erzählt hat. Von seiner Mutter, die ein bisschen so ist wie meine Oma, zwei Generationen, die dem Holocaust entkommen sind, aber nie wirklich glücklich wirkten. «Als ob es sie nie losgelassen hätte», sagt Sagie und schaut aufs Meer. «Ich habe das auch, diese Düsterkeit.» Ich sehe ihn überrascht an. Sagie ist sonst eher schweigsam. Oft wirkt er, als sei er gedanklich an einem anderen Ort. Einem düsteren, der ihn stets begleitet.
«Hadar sagte, du hast neue Tabletten?», frage ich vorsichtig. «Wie geht es dir damit?»
«Ich glaube, gut, du musst Hadar fragen. Sie sagt, ich sei mehr hier. Ich spräche mehr. Würde mehr teilhaben.» Ich schaue ihn weiter an. Auch ich merke die Veränderung. Das Gespräch heute, die Offenheit, mit der er erzählt und mich nach meiner Familie befragt, das ist neu. Und es ist schön. Sosehr ich Itays Familie auch liebe, so ist es doch so, dass ich manche von ihnen nicht gut kenne. Und oft, bei den wöchentlichen Familientreffen, zwischen Tellern voller Essen, überdrehten Kindern, müden Eltern, nicht weiß, wie und wann ich ein tieferes Gespräch beginnen soll.
So vieles an diesem Freitag, dem 6. Oktober, ist außergewöhnlich. Außergewöhnlich schön. Meinen Sohn zu sehen, wie er aufgeregt einige Schritte zum Wasser läuft, mit dem Hintern in den nassen Sand plumpst, weil eine Welle eben schon eine Herbstwelle ist, stärker, unbändiger, mitreißender als im Sommer. Wie er sich wieder aufrappelt und weiterstapft. Sein Kinderpopo leuchtet weiß über seinen gebräunten Beinen. Ich fotografiere ihn. Jetzt gibt es Fotos von Oz als Kind hier, genauso nackig und unbeschwert wie ich vor etwas mehr als 35 Jahren. Am selben Ort. Zu einer anderen Zeit. Bei dem Gedanken wird mir warm im Bauch.
Wie oft habe ich in den vergangenen Monaten gezweifelt, ob Israel langfristig mein Zuhause, unser Zuhause, sein wird. Wie oft habe ich mich gefragt: Ist das noch mein Land? Ist das noch der Ort, an dem ich mein Kind aufwachsen sehen will? Jetzt spüre ich: ja, bitte. Genauso wie jetzt, an diesem Freitag, dem 6. Oktober. Das Leben hier meint es gut mit mir. Hier bin ich ich. Hier saß ich als Kind im Sand, sammelte Muscheln, wie Oz das jetzt tut. Zum Aufheben. Mit nach Deutschland nehmen. Für das Muschelglas oder das Kiesbett am Haus.
Ich habe meinem Sohn ein Erinnerungs-Schatz-Glas geschenkt, so nenne ich es, denn er ist noch zu klein für solche Worte. Darin liegen bisher eine getrocknete Zitrone, eine Muschel und ein Stein. Dinge, die er selbst gefunden hat und bestaunt. Ich habe sie aufgehoben. Oz soll den Wert von Erinnerungen lernen, das ist mir wichtig. Dass uns Menschen und Orte manchmal verloren gehen, aber mit den Erinnerungen tragen wir ihre Geschichten in uns. Für den Fall, dass wir irgendwann nicht mehr hier leben werden. Der Gedanke kam mir in diesem Jahr so oft. Ich habe meine Heimat hinter mir gelassen, Deutschland. Ich entschied, in Israel zu leben. Aber die Erinnerungen an meine Kindheit, mein Aufwachsen, mein erwachsenes Leben in Deutschland – sei es durch meinen alten Teddybären, den Bettbezug mit dem Tröpfchenmuster, meine orangefarbene Lieblingstasse – kann mir niemand nehmen.
Es ist wichtig, sich zu erinnern. Viele Erinnerungen formen ein Leben. Wer sind wir ohne sie? Mein Schwiegervater erzählt stolz, er lösche Erinnerungen, die er nicht mehr brauche. Er mag das Gefühl, im Jetzt zu stehen, es sei das Einzige, was zähle. Er löscht sie aber nicht wirklich. Er verdrängt sie, bis er sie irgendwann vergisst. Was er wohl erlebt hat, das er am liebsten löschen will? «Alles nicht wichtig», sagt er. Aber wenn alles nicht wichtig ist – wozu war es dann überhaupt?
Wir essen Wassermelone und salzige Cracker, Gemüsefrikadellen vom Delikatessenladen auf der Sderot Jeruschalaim in Yafo. Als die Kinder anfangen zu streiten und Oz müde auf Itays Brust sinkt, packen wir zusammen, laufen den steilen Dünenweg hoch zum Parkplatz. Mit Oz auf dem Arm drehe ich mich nochmal um und betrachte das Meer, das wie ein blaues Dreieck zwischen Dünen und Weg klemmt. Ich atme tief ein, sauge den Duft ein, Sonnencreme, Salz, Za’atar, der auf den Dünen wächst, und Erinnerungen. Dann laufen wir Richtung Auto.
Der längste Tag
Ich werde davon wach, dass mir eine Babyflasche ins Gesicht donnert. Als ich meine Augen öffne, starren mich seine schon an, als wollten sie prüfen, ob der Schlaf endlich mein Gesicht verlassen hat. Oz sitzt im Bett neben mir und beginnt, meinen Kopf mit der Wasserflasche zu massieren. «Ima, auf. Auf.» In Oz’ Sprache, ein Mix aus deutschen und hebräischen Befehlen, bedeutet das, Mama soll aufstehen. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Ich schaue auf mein Handy. Kurz nach 6. Ich versuche, noch einige Minuten mit Oz zu kuscheln, doch der entzieht sich meiner Umarmung und hämmert ans Fensterglas. Ich seufze und setze mich auf, öffne das Fenster, drücke die schweren Holzläden nach außen und blicke hinaus. Der Himmel über Yafo ist bereits hell, aber so ganz ist der Tag noch nicht bereit zu beginnen. Wir hören ein Auto vorbeifahren, sonst ist es still. «Katze!», ruft Oz. Wir suchen die Nachbardächer unter uns ab. Aber da ist heute keine Katze.
«Abba!» Itay kommt ins Schlafzimmer. Auch er sieht müde aus. Seit unser Sohn zu groß für das Beistellbett geworden ist, schläft Oz in unserem Bett – und Itay auf dem Sofa. Für uns alle keine so schlechte Lösung, wenn wir ehrlich sind. Ich kann mit dem Kind kuscheln. Itay kann durchschlafen. In unserer neuen Wohnung wird Oz sein eigenes Zimmer haben. Bis zu unserem Umzug Ende des Jahres genieße ich noch die Wärme seines kleinen Körpers, der sich nachts an meinen schmiegt.
Itay legt sich aufs Bett, vergräbt sein Gesicht in unseren Decken und lässt Oz auf seinem Rücken reiten. Dann steht er gähnend wieder auf, hebt Oz aus dem Bett und läuft mit ihm ins andere Zimmer zur Wickelkommode. Ich bleibe liegen, lehne mich zurück und scrolle durch Instagram, ohne wirklich hinzugucken. Wenn ich lange genug warte, macht Itay Kaffee. Die Welt hinter dem Bildschirm ist noch nicht wach.
Wie lange ich dort sitze, weiß ich nicht. Dann höre ich etwas. Einen Heulton, nicht durchdringend, aber doch laut genug, dass ich aus dem Bett aufspringe. Mein Herz schlägt schneller. Ich laufe in den Flur. «Asakot!», Sirenen, rufe ich Itay zu, der gerade versucht, Oz’ Windel zu schließen. Er dreht den Kopf: «Wirklich? Ist das hier?» «Ja! Worauf wartest du? Komm.» Ich reiße meinen Bademantel von der Badezimmertür und schlüpfe hinein. Als ich mich nach Itay umdrehe, steht der immer noch an der Wickelkommode. «Wir müssen runter!», meine Stimme klingt gehetzt. Ich hatte lange Angst vor diesem Moment. Nicht vor den Sirenen und der Bedrohung, die sie bedeuten. Sondern davor, mit meinem Kind, nicht mal zwei Jahre alt, im Hausflur stehen zu müssen, während draußen die Sirenen heulen. Sirenen, die uns vor den Raketen der Terrorgruppe Hamas aus dem Gazastreifen warnen. Während das Abwehrsystem Iron Dome die Bedrohung über uns abschießt, es donnert und grollt und wir einfach nur dastehen müssen, bis es ruhig draußen ist, und zur Sicherheit noch länger. Um nicht von fallenden Raketen-Trümmerstücken erschlagen zu werden. Mit einem Kind, das noch zu klein ist, Fragen zu stellen. Zu jung, um zu erfahren, dass es Menschen gibt, die uns auslöschen wollen, oder zumindest in Angst versetzen. Wie soll man das auch erklären?
Wir haben keinen Bunkerraum in der Wohnung, mit extradicken Wänden, die den Einschlag einer Rakete aushalten sollen. Mamad, nennen die Israelis ihn, was die Abkürzung für Merchav mugan dirati ist, einen geschützten Raum innerhalb einer Wohnung. Wer keinen Mamad hat und keinen unterirdischen Bunker in direkter Nachbarschaft, dem bleibt nur das Treppenhaus – oder ein anderer Raum, der im Hausinneren liegt und damit im Falle eines Einschlags möglichst schützt. Unser Haus ist alt, im Treppenhaus bröckelt der Putz von den Wänden. Wo einst ein großes Fenster war, klafft ein gähnendes Loch in der Hauswand. Unten am Treppenabsatz, wo die Briefkästen sind, stehen wir jetzt in dem kurzen Abschnitt, der von drei Wänden umgeben ist. Zippi, unsere älteste Hausbewohnerin, sagte mal, hier sei es am sichersten. Itay trägt Oz auf dem Arm, der mit großen Augen zum Ende des Flurs schaut, wo man ein Stück Himmel sehen kann. Er trägt nur T-Shirt und Windel, in der Hand hält er den Deckel einer Trinkflasche. Sein Schnuller zuckelt in seinem Mund auf und ab.
Wir stehen einfach nur da und warten. «Na, Ozi, was ist das für eine komische Sirene?», ich imitiere den Sirenenton. «Kmo chatul», wie eine Katze, sagt Itay auf Hebräisch. «Miaauuu, Miauuu.» Ich muss daran denken, dass ich das Heulen der Sirene zuvor öfter mit dem Ruf eines leidenden Tieres verglichen habe. In diesem Moment kommt mir der Ton eher schaurig vor, wie ein Ruf aus dem Jenseits. Mein Handy hat mich diesmal gar nicht gewarnt, wundere ich mich. Dann fällt mir ein, dass ich die Warn-App vor Monaten gelöscht habe. Es war Mai, wir waren in Deutschland zu Besuch. Ich wollte nicht dauernd hochspringen, weil wieder Raketen auf Tel Aviv geschossen wurden.
Boom. Der Iron Dome hat die erste Rakete abgefangen. Boom. Die zweite. Laute Explosionen, der Boden vibriert. «Boom, Boom, Boom», sage ich zu Oz, versuche zu lächeln und streichele über sein nacktes Bein. «Bum», wiederholt Oz. Etwas in mir verkrampft sich.
Wir warten. Sirenen und Explosionen hören nicht auf. Jetzt höre ich die Nachbarn auf dem Treppenabsatz. Eine arabische Familie mit zwei kleinen Kindern, die direkt neben uns wohnt. Die Frau, Issra, sagt etwas, eine Mischung aus Arabisch und Hebräisch. «Laredet?» verstehe ich – runtergehen? Ihr Mann Ibrahim ruft ihr etwas aus der Wohnung zu. Ich höre Schritte, dann knallt die Tür wieder zu.
Die Sirenen stoppen, plötzlich ist es ruhig. Oz windet sich auf Itays Arm, will auf den Boden. «Wir warten noch ein bisschen», sage ich zu Oz, aber auch zu Itay. Diesmal hört er auf mich. Bei den letzten Raketenangriffen, die wir in Tel Aviv miterlebt haben, war Oz noch nicht geboren und Itay jedes Mal schneller zurück in die Wohnung gehastet als empfohlen. Wie anders es sich diesmal anfühlt.
Wir versuchen, unser Kind auf dem Arm noch ein paar Minuten bei Laune zu halten, dann gehen wir wieder hoch in unsere Wohnung. «Zieh ihm Hosen an, wer weiß, wann es wieder losgeht», sage ich und krame eine Dose mit Crackern aus dem Küchenschrank. Schadet nicht, die parat zu haben, mit Kind rumstehen funktioniert besser mit Snacks. Itay steht mit Oz an der Wickelkommode und kramt in der Schublade nach einer Hose. In dem Moment heulen die Sirenen erneut los. «Nimm die Hose mit», rufe ich Itay zu. «Schon wieder», sagt Itay irritiert, als wir wieder an den Briefkästen stehen. Ich gucke aufs Handy. Es ist erst 6:40 Uhr, und wir hatten schon zweimal Alarm.
Zurück in der Wohnung setzt Itay Oz auf seine Spielmatte und schaltet den Fernseher ein. Die rechte Seite des Fernsehbilds nimmt eine lange Liste orangefarbener Felder ein: die Einblendungen des Heimatfront-Kommandos. Sie zeigen, wo Israel in diesem Moment bedroht ist und die Anwohner sich in Sicherheit bringen sollen. «So viele», sagt Itay leise. Ich trete hinaus auf den Balkon. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau, wenige Wolken. Es ist still, nur die Vögel zwitschern laut. Es ist diese Stille. Wie immer, wenn es losgeht. Nach den ersten Raketen einer neuen «Runde», sevev, wie die Israelis das Hin und Her der Auseinandersetzungen mit der Terrororganisation Hamas nennen: Raketen aus Gaza, gefolgt von Vergeltungsangriffen der israelischen Luftwaffe, bis ein Waffenstillstand das gefährliche Spiel beendet. Bis zur nächsten «Runde». Die Stille, stelle ich mir vor, entsteht, weil alle Israelis kurz schweigend am Handy oder vor dem Fernseher hängen, um zu erfahren, was jetzt wieder los ist. Aber was ist heute eigentlich los?
Itay schmilzt Butter in einer Pfanne, zupft die Challah vom Vorabend in geschlagenes Ei mit etwas Milch und schüttet beides in das brutzelnde Fett. «Challah French Toast» nennen wir die Schabbat-Version von French Toast. Bedächtig schiebt sich Oz Stück für Stück der Challah in den Mund. «Deine ersten Raketen», ich streiche meinem Sohn über den Kopf. Im Hintergrund sehe ich ständig neue Einblendungen: Be’er Scheva, die Unistadt im Süden. Lod am internationalen Flughafen im Zentrum des Landes. Sa’wa-Mulada, eine beduinische Stadt in der Negev-Wüste. Netiv Ha’Assara direkt am Gazastreifen. Es scheint, als sei die Hälfte Israels unter Beschuss.
«… Sondersendung … mehr als hundert Raketen aus Gaza auf die Schfela-Region, auf die Gusch-Dan-Region, auf Rischon LeZion, Givatayim, Tel Aviv und Rechovot. Laut dem Roten Davidstern gibt es mehrere Schauplätze mit Verletzten in der Stadt Aschkelon … überraschend … die Armee hat zuvor keine Art von militärischer Operation im Gazastreifen durchgeführt, keine Eliminierung von Terroristen … Wir wissen zu dieser Zeit nicht, was zu diesem schweren Beschuss geführt hat …»
Itay wechselt den Sender, um zu sehen, ob sie anderswo mehr wissen. Auf Kanal 13 liest ein Reporter mit gerunzelter Stirn Nachrichten von seinem Handy ab: «Das Land Israel ist heute Morgen zu einer Überraschung aufgewacht … starker Beschuss … von Dutzenden oder Hunderten von Raketen …»
«Gestern vor 50 Jahren wurde Israel vom Jom-Kippur-Krieg überrascht», sagt Itay. Ich bekomme ein mulmiges Gefühl im Bauch.
In den fast vier Jahren, die ich mittlerweile in Israel lebe, kam es um den muslimischen Feiertag Ramadan öfter zu Angriffen der Hamas auf Israel. Aber Ramadan ist in diesem Jahr schon vorbei. In meinem Handy-Kalender sehe ich, dass religiöse Juden heute den Feiertag Simchat Thora feiern. Das ist der Tag im Jahr, an dem das Ende der Lektüre der gesamten Thora gefeiert wird, bevor man wieder von vorn anfängt. Wir sind nicht religiös und feiern diesen Tag nicht. Raketen am Feiertag sind an sich nichts Neues. Aber Raketen, und noch dazu viele, am 50. Jahrestag eines verhängnisvollen Überraschungsangriffs gegen Israel? Ich ziehe mich schnell an, Leggins, ein T-Shirt, Flip Flops.
«Die öffentlichen Bunker wurden geöffnet», teilt die Stadtverwaltung in der WhatsApp-Gruppe für Bewohner Tel Avivs mit. Die Stadt erinnert daran, dass das Warnsystem nach Zonen aufgeteilt ist, die Sirenen nur dort ertönen, wo es eine konkrete Warnung vor Einschlag gebe. «Wir rufen Sie dazu auf, wachsam zu bleiben und auf die Anweisungen des Heimatfront-Kommandos zu hören.» Ich suche die Warn-App im App Store. Dann stelle ich die Region ein, für die ich Benachrichtigungen erhalten will: Region Dan, Stadt Tel Aviv, Stadtteil Tel Aviv Süd – Yafo.
«Oh oh», sagt Oz, als ich wieder in die Wohnküche komme. Itay und ich gucken uns an und müssen lachen. Unser Sohn läuft zum Kühlschrank und beginnt, an der Tür zu rütteln. «Shake?» Ich habe den Bananenshake kaum in seine Trinkflasche gefüllt, da höre ich das Grollen einer Explosion. Das Iron-Dome-System. Das muss in einem anderen Teil der Stadt sein. Oder im Vorort? Wir wohnen im Süden Tel Avivs nahe der Stadtgrenze. Meine Warn-App schrillt, ein kreischender Dreiklang. Der Warnton erinnert mich an eine Szene aus einem altmodischen Horrorfilm, wenn die Kamera auf den Mörder hinter dem Vorhang schwenkt. Itay springt vom Sofa auf, ich greife mir Oz und seine Trinkflasche, gemeinsam eilen wir die Treppe runter. Ich schaue auf mein Handy. Wir sind erst seit einer Stunde auf den Beinen, der Tag kommt mir schon lang vor. Oz versucht, sich aus meinem Griff Richtung Boden zu winden. «Rega, einen Moment, wir gehen gleich wieder hoch», sage ich.
«Alles okay bei uns», schreibe ich in meine deutsche Familiengruppe. In Deutschland ist es eine Stunde früher, erst 6:38 Uhr am Samstagmorgen. Die schlafen bestimmt alle noch. Ich poste ein Update auf Instagram. Im vergangenen Jahr habe ich mir angewöhnt, Ausschnitte aus meinem Leben in Israel dort zu teilen. Auch, um meine Freunde, Verwandten und Bekannten im Ausland mitzunehmen, in diese schnelllebige, oft so dramatische Nachrichtenlage, die man außerhalb Israels kaum mitbekommt oder nachvollziehen kann. Raketen, Terror, Politik, irgendwas explodiert hier immer. Besonders im vergangenen Jahr.
Ich halte diese Momente auch für mich fest, als Notiz im Handy, als Foto, als Film. Um den ganzen Wahnsinn hier nachvollziehen und irgendwann verarbeiten zu können. Als Gedankenstütze, um darüber schreiben zu können. Ich habe heute im Hausflur sogar ein Foto von Oz’ erstem Raketenalarm gemacht. Vielleicht zeige ich ihm die Aufnahmen, wenn er älter ist. Und wir hoffentlich in einer anderen Welt leben, in der er sich diesem Irrsinn nicht stellen muss.
«Oteff Aza … Berichte von Infiltrationen von Terroristen …», liest ein Reporter stockend von seinem Handy ab. Oteff Aza, übersetzt «Gaza-Umschlag», nennen die Israelis die Region in Israel rund um den Gazastreifen. Ich klicke mich durch meine Nachrichten-Apps: «Militanten aus dem Gazastreifen ist es während des Raketenbeschusses gelungen, mit Fahrzeugen und Gleitschirmen in israelische Städte einzudringen. Der Beschuss dauert an.» Ein Soldat soll gekidnappt worden sein. Mein Atem geht schneller. Was zur Hölle geschieht da?
«Ist was passiert?», schreibt mir meine Schwester in Frankfurt in unserem Familien-Chat. Sie muss gerade aufgewacht sein.
«Raketen aus Gaza», antworte ich.
«Oh, lese gerade.»
«Und in der Grenzregion sind Terroristen nach Israel rein», füge ich hinzu. Ich denke, das kann sie verkraften. Auch das habe ich mir angewöhnt: zu überlegen, wann ich was meiner Familie schreibe. Damit sie sich nicht zu sehr sorgt, Tausende Kilometer entfernt.
«Oh Mist», schreibt mein Vater.
«Ein Soldat wurde gekidnappt», schreibe ich. Ich weiß, dass sie spätestens jetzt auch die Nachrichten einschalten. Ob sie in Deutschland darüber berichten? Bestimmt erst, wenn Israel im Gegenzug Luftangriffe auf Gaza fliegt. Meine Schwester will wissen, wie Oz auf die Sirenen reagiert hat. «Mit Kind ist das sicherlich nochmal anders», schreibt sie. Das ist es, denke ich.
Auf der rechten Seite des Bildschirms sind ohne Pause Einblendungen zu sehen. Jerusalem, die Hauptstadt. Rechovot, südöstlich von Tel Aviv. Ararara in der Negevwüste. Ich kann mich nicht erinnern, dass in den Jahren, die ich hier lebe, schon mal so viele Raketen so großflächig auf Israel geschossen wurden. Bei dem Tempo müssen der Hamas die Raketen irgendwann ausgehen. Itay wechselt erneut den Sender. Auf Kanal 12 zeigen sie Männer, die aus den Türen und von der Ladefläche eines weißen Pick-up-Trucks springen. Sie tragen Maschinengewehre und laufen in alle Richtungen. Im Hintergrund höre ich die Stimme von Tamir Steinman, dem Reporter für den Süden des Landes:
«Im Kibbuz Be’eri bitten die Bewohner darum, dass Armeekräfte zu ihnen geschickt werden. Es befinden sich mehrere Terroristen im Kibbuz. Es gibt Berichte von Verletzten. In einem weiteren Ort in der Region Chof Aschkelon, Netiv Ha’Assara, gibt es Kämpfe der Bewohner mit Terroristen. Auch hier stehen einige Gebäude in Flammen.»
Itay liegt still auf dem Sofa. Oz schiebt auf der Matte ein Spielzeugauto hin und her.
«Es gibt Verletzte auf den Straßen, der Rote Davidstern und die Erste-Hilfe-Kräfte haben Probleme, zu den Verletzten durchzukommen, während der Beschuss anhält … Wo ist die Armee? Wo ist die Armee? Wir befinden uns jetzt schon zwei Stunden in dieser Lage und die Anwohner verstehen einfach nicht: Wo ist die Armee?»
Wir warten. Worauf, wissen wir nicht genau. Dass es endet. Dass uns jemand sagt, was zu erwarten ist. Irgendeine Erklärung muss es doch geben? Von der Regierung, der Armee, was hier passiert und warum. Aber es kommt nichts. Die Journalisten im Fernsehstudio schalten jetzt Anrufer aus Netiv Ha’Assarah zu, 400 Meter von der Grenze zu Gaza entfernt.
«Wir sind hier im Mamad. Wir haben keinen Strom. Wir sind nur verbunden über WhatsApp. Wir wissen nicht mit Sicherheit, was draußen passiert. Ich möchte etwas zur Armee sagen: Was ist mit euch los? Wo seid ihr?»
Auf dem Bildschirm erscheint eine Einblendung: Die Armee ruft den Kriegszustand aus.
«Vielleicht ist es besser, wenn wir zu meiner Schwester fahren», sagt Itay, ohne von seinem Handy aufzusehen. «Ich hatte schon Angst, du willst es hier aussitzen», sage ich. Beim letzten größeren Krieg 2021 habe ich Itay irgendwann gebeten, dass wir nachts zu seinen Eltern fahren und in deren Schutzraum übernachten. Unsere Wohnung in Yafo fühlte sich damals nicht mehr sicher an. Als der Krieg dann vorbei war, hatte Itay betont, dass wir beim nächsten Angriff in Yafo bleiben sollten, in unserem Haus, in unserem Zuhause. Nicht weglaufen, sich nicht vom Feind einschüchtern lassen, ich erinnere mich, dass er so argumentiert hatte. Ich bin froh, dass er diesmal anders empfindet.
«Ich denke an Oz», sagt er. Ich nicke. «Bei meiner Schwester hat er seine Cousins, den Hund. Wenn wir schon den ganzen Tag im Haus sitzen.» «Und sie hat einen Mamad.» Dass das nicht das Erste ist, was er erwähnt.
Ich packe Wechselklamotten für Oz in einen Rucksack, Ersatz-Schnulli, Windeltasche, ein Ladekabel fürs Handy. Bei den vergangenen Raketenangriffen hatte ich eine Notfalltasche neben der Tür, mit unseren Pässen, meinem Laptop, dem Teddy meiner Kindheit. Diesmal nehme ich nur meinen Laptop mit, vielleicht komme ich ja noch zum Arbeiten heute. Itay telefoniert mit seiner Schwester. «Ja, es ist doch weniger langweilig, wenn wir alle zusammen sind», höre ich ihn sagen. Dieser Relativierer, denke ich. Immer alles schön rationalisieren. Er hat keine Angst, keine Befürchtungen. Nur Angst vor Langeweile, klar.
«Verteidigungsminister Yoav Gallant hat eine umfassende Rekrutierung von Reservekräften genehmigt … Entführung von Soldaten und Zivilisten in den Gazastreifen befürchtet … Das oberste Ziel der Armee ist derzeit, den Gazastreifen wieder zu verschließen, zu versiegeln. Wir dachten, Gaza sei versiegelt. Heute hat sich gezeigt, dass wir uns geirrt haben … Wir erhalten aus den palästinensischen WhatsApp-Gruppen und Telegram-Kanälen schreckliche Bilder … Wir werden sie hier nicht zeigen … Raketenbeschuss auf Jerusalem!»
Mein Handy klingelt. «Mah nishmah, motek?» – was geht, Liebes, höre ich Dan fragen. Mein bester Freund ruft mich bei jedem Raketenangriff an. Als würde er sich sorgen, dass ich als Neueinwanderin die Lage schlechter verkrafte als hier aufgewachsene Israelis. Vermutlich hat er Recht. «Beseder», in Ordnung, antworte ich. Ich will nicht, dass Dan sich um mich sorgt. «Wie geht es Oz?», fragt er. Ich erzähle von Oz’ «Bum» und «Oh oh». Dan schweigt länger, dann sagt er: «Er wird wie wir alle mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung aufwachsen.» Vielleicht wird Oz ja nicht hier aufwachsen, denke ich. Wir werden dieses elende, sich radikalisierende Land verlassen, wenn es hier so weitergeht wie in den vergangenen zwölf Monaten. Aber ich sage nichts. «Wie geht es dir? Bist du zu Hause?», frage ich zurück. «Ich bin zu Hause. Ich wollte eigentlich gestern auf so ein Naturfestival im Süden fahren, aber die Freundin, mit der ich fahren wollte, ist erst um drei Uhr morgens aus Tel Aviv los. Sie wollte in den Sonnenaufgang tanzen.» Ich seufze müde. Das letzte Mal, dass ich in den Sonnenaufgang getanzt habe … Ich bin sogar zu müde, um mich daran zu erinnern.
Messibat Teva, Naturparty, nennen die Israelis die Partys und Festivals in der Wüste, am Meer oder in Wäldern, auf denen zu elektronischer Musik die Nacht und der darauffolgende Tag hindurch getanzt werden. Meist sind dabei auch Drogen im Spiel. «Mir reicht es, wenn Oz mich um sechs Uhr morgens weckt», sage ich, während ich Oz’ Duplo-Kiste in eine Einkaufstasche schiebe. Mein Blick geht zum Fernseher, mit halbem Ohr höre ich Reporter Tamir Steinman zu. Der steht auf einem Balkon, sein Gesicht ist blass, das Haar klebt ihm auf der Stirn. Er hält sein Handy hoch:
«Ich lese jetzt die SMS einer Anwohnerin aus Sderot vor: ‹Tamir, bitte, die Polizei antwortet nicht. Terroristen sind in der Nachbarschaft, in unseren Häusern in der Mosche-Rabenu-Straße 101 in Sderot. Tamir, bitte bringt Polizisten her. Sie schießen auf die Gebäude!› Freunde schreiben mir gerade aus dem Kibbuz Be’eri: ‹Ruft die Polizei. Meine Freundin ist im Mamad eingeschlossen, sie kann nicht sprechen, sie hat Angst, dass sie sie entdecken.› Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so eine SMS bekomme.»
«Ich war zu müde für die Party.» Dans Stimme holt mich zurück zu unserem Telefonat. «Die Karte hätte 300 Schekel gekostet», sagt mein Freund, «und ich hatte keine Lust, Drogen zu nehmen. Da habe ich abgesagt. Lucky me.» Meine Gedanken wandern langsam vom Fernsehreporter zu Dan. «Moment», sage ich, als Dans Sätze zu mir durchdringen. «Die Party war im Süden? Da, wo jetzt Balagan ist?» Balagan bedeutet Durcheinander, Chaos. «Ja, im Oteff Aza, nahe der Grenze. Ich habe ganz kurz mit der Freundin geschrieben, die gefahren ist. Sie schrieb, sie habe Terroristen gesehen, die auf Autos geschossen hätten.» «Puh», ich räume Oz’ Teller in die Spüle, «gut, dass du nicht gefahren bist. Dan, ich muss jetzt packen, wir fahren zu Itays Schwester. Die hat einen Mamad. Das hier scheint ja ein längerer Tag zu werden.» Ich nehme Tupperboxen aus dem Kühlschrank und packe sie in unsere Kühltasche: Bananen-Pfannkuchen, Nudeln, Kartoffelbrei.
«Gut, dass ihr aus Yafo wegfahrt.»
«Ja, es ist nervig, mit Kleinkind im Flur zu stehen. Bei Itays Schwester sind wenigstens auch seine Cousins», höre ich mich sagen. Jetzt rede ich denselben Quatsch wie Itay. Dan muss ich eigentlich nichts vormachen, er kennt mich, er weiß, wann ich Angst habe, wann ich sie überspiele. «In jedem Fall ist es besser im Mamad für Oz», sagt Dan. «Tov, motek, gib Ozi und Itay einen Kuss von mir. Wir sprechen uns. Passt auf euch auf.»
«Du auch. Bye.»
«Wir haben hier Alarm. Ich renne jetzt schnell in den Mamad.» Reporter Tamir Steinman läuft aus dem Fernsehbild.
«Falls ihr etwas aus unserer Wohnung braucht, bedient euch einfach», schreibt Itays Mutter in unsere zweite Familien-WhatsApp-Gruppe. Itays Eltern sind mit einer Reisegruppe in Spanien unterwegs, sie kommen erst in wenigen Tagen zurück. «Ein Teil der Hamas ist nach Israel reingekommen», schreibt Itays Nichte Rotem. Sie ist neun Jahre alt. Ich frage mich, was sie heute schon mitbekommen hat. Itays Mutter schreibt unbeirrt weiter: «Es gibt auch Essen in den Kühltruhen.» Kühltruhen, Mehrzahl. Itays Mutter hat drei. Darin Essen für die Feiertage, manchmal Monate im Voraus gekocht und eingefroren, Essen für hungrige Enkel, Kinder, Schwiegertochter und -söhne. Essen für alle Formen von Notfall. Sie führt sogar Buch, was sich wo befindet und seit wann. Mit ihren Kühltruhen lassen sich mehrere Weltkriege überstehen, scherzen wir oft.
«Hast du denn eine Waffe bei dir?», fragt Dany Cushmaro, einer von Israels prominentesten Moderatoren auf Kanal 12. «Ja, wir haben ein Messer unter dem Bett», sagt die Stimme einer jungen Frau. Sie ruft aus ihrem Mamad im Kibbuz Be’eri im Fernsehstudio an. Im Hintergrund hört man Maschinengewehrsalven knattern. Dany Cushmaro atmet schwer. «Ich weiß nicht, was wir dir wünschen sollen.»
Die nächste Anruferin, eine Mutter aus dem Tel Aviver Vorort Cholon, erzählt, ihr Sohn sei mit Freunden auf einer Naturparty in der Nähe von Sderot im Süden gewesen, als die Raketen um 6:30 Uhr anfingen, über ihre Köpfe zu fliegen. Auf dem Rückweg sei das Auto von Terroristen beschossen worden. Er sei in ein nahe gelegenes Waldstück geflüchtet, wo er und Freunde sich seit zwei Stunden in Büschen verstecken würden. «Die Polizei weiß seit sieben Uhr Bescheid, was dort passiert, die Armee weiß Bescheid. Alle wissen es, und keiner tut etwas. Mein Mann ist vor längerer Zeit in seine Richtung gefahren. Er wurde an einer Straßenblockade der Armee aufgehalten. Sie lassen ihn nicht in die Gegend. Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Da waren 1500 bis 2000 junge Menschen auf der Party … Wenn ich eine Waffe hätte, würde ich sofort da rein. Das ist mein Kind!»
Gegen halb zehn fährt die Müllabfuhr wie gewohnt an unserem Haus vorbei. «Bist du okay, Sarush?», schreibt mir Lola. «Alles gut», antworte ich meiner besten Freundin. «Ozi sagt ‹Booom›.» Ich weiß, dass Lola versteht, was ich fühle, wenn ich das schreibe. Sie sendet einen Smiley mit Tränen in den Augen. «Wie geht es dir?», frage ich zurück. «Es ist so surreal. Ein Albtraum. Ich kann nicht fassen, dass ich direkt zu so einem Horror aufgewacht bin.» «Es wird alles gut am Ende, wie immer», schreibe ich.
«Ich verstecke mich hier in so einer Ecke eines Gebäudes auf dem Festivalgelände. Es sind Leute draußen, ich muss jetzt still sein. Hörst du sie?»
«Allahu Akbar!»
«Dany … Ich werde leben.»
«Du wirst leben.»
Itay schaltet den Fernseher aus. Ich schließe die Holzläden vor Balkontür und Fenstern. Kurz darauf sitzen wir im Auto, auf dem Weg in den Osten Tel Avivs, wo Itays Eltern und seine ältere Schwester Dalit wohnen. Außer uns sind noch andere Autos auf den Straßen. Nicht viele wie sonst an einem sonnigen Samstagvormittag, wenn das nicht-religiöse Israel zu einem Ausflug in die Natur aufbricht, aber doch mehr als erwartet. Mein Handy schweigt, aber heute wirkt diese Stille bedrohlich.
«Was machen wir, wenn jetzt Sirenen heulen?», frage ich Itay. Eigentlich kenne ich die Antwort. «Kommt drauf an, wo wir gerade sind», sagt Itay, ohne den Blick von der Straße zu nehmen. «Wir fahren rechts ran und legen uns neben das Auto auf den Boden, Hände über den Kopf, oder rennen in das nächste Haus.» «Und wie kriegen wir Oz so schnell abgeschnallt und aus seinem Sitz?» Ich höre die Angst in meiner Stimme. «Wir haben genug Zeit», sagt Itay. Das Thema ist damit für ihn erledigt. Ich klicke mich durch die Nachrichten.
«Die Armee hat begonnen, Ziele im Gazastreifen anzugreifen.»
«Das Heimatfront-Kommando empfiehlt auch der ultraorthodoxen Bevölkerung an diesem Schabbat, die Medien einzuschalten.»
«Aus den Ortschaften im Süden gibt es Berichte über aktive Hamas-Terroristen, die als IDF-Soldaten verkleidet an Türen klopfen.»
«Bilder aus arabischen Telegram-Kanälen zeigen, wie Terroristen Körper von Israelis auf weißen Pick-up-Trucks in den Gazastreifen bringen.»
Die Anwohner des Grenzgebiets werden von der Polizei gebeten, sich in den Schutzräumen ihrer Häuser zu verbarrikadieren. Der Oteff Aza rund um den Gazastreifen ist die Gegend, die am häufigsten von der Hamas beschossen wird, auch in Friedenszeiten. Manche der Kibbuzim und Ortschaften liegen in Sichtweite von palästinensischen Orten in Gaza. Die Bewohner haben nur 15 Sekunden Zeit, sich in Sicherheit zu bringen, sobald die Sirenen erklingen. Deshalb haben alle Häuser dort einen Schutzraum innerhalb der Wohnung. Aber hält der auch Terroristen stand? Kann man die Tür des Mamad überhaupt abschließen?, überlege ich während der Fahrt. Man kann sie luftdicht verriegeln, von innen, aber von außen lassen sich die Türen meist trotzdem öffnen. Gegen ein Eindringen von Terroristen wurden sie nicht konzipiert.
«Finden Flüge heute noch wie geplant statt?», fragt jemand in einer Tel Aviver Facebook-Gruppe. «Sind die Pools offen?», fragt eine andere Nutzerin. «Du verstehst schon, dass wir den Kriegszustand ausgerufen haben?!», kommentiert jemand. «Menschen wurden gekidnappt. Da laufen Terroristen mit Waffen durch Sderot, und Kinder sehen, wie sie …» Auf X werden Videos geteilt. Ich muss schlucken. Sie zeigen Massen an Männern, die durch ein großes Loch im Grenzzaun strömen, von Gaza nach Israel. Auf Trucks, auf Motorrädern, viele auch zu Fuß. Einige rufen «Allahu Akbar», Gott ist groß, in Handykameras, viele sind mit Maschinengewehren bewaffnet und tragen Kampfwesten, Hosen oder Jacken in Olive oder Tarnfarben. Andere sehen aus wie Jugendliche, die aufgeregt mit ihren Telefonen filmen, während sie durch den kaputten Zaun joggen. Allein in einem Videoclip sind es Dutzende, wenn nicht Hunderte Menschen.
Im Livestream der Nachrichten versuchen Kommentatoren, die Lage einzuordnen. Es rufen weiterhin Menschen aus den Schutzräumen ihrer Wohnungen an.
«Muezzin aus Ost-Jerusalemer Moscheen rufen dazu auf, Terroranschläge zu verüben.»
«Sie sind in unser Haus eingedrungen. Sie haben versucht, den Mamad zu öffnen. Ah Scheiße, sie sind jetzt wieder ins Haus gekommen. Bitte schickt die Polizei, damit sie uns helfen kann … Mein Mann hält den Türgriff fest. Jetzt schießen sie auf das Mamad-Fenster. Meine drei Kinder sind hier bei mir. Unsere Hunde sind draußen, sie waren im Wohnzimmer. Maybe they killed them, I don’t know. Oh! oh! Tschüss …»
Kaum betreten wir die Wohnung von Itays Schwester Dalit, heulen leise Sirenen. Meine App zeigt Alarm in den Vororten Rischon LeZion an, Cholon, Bat Yam. Es folgen Tel Aviv-Süd und Yafo. Tel Aviv-Zentrum. «Mamad!», ordnet Dalit an. Wir stürmen den Wohnungsflur entlang, vier Erwachsene, drei Kinder, in Richtung Kinderzimmer von Itays Nichte. Wie in den meisten israelischen Wohnungen liegt das Kinderzimmer im Mamad. Vor das Sicherheitsfenster sind die Stahlfensterläden geschoben, an der Decke dreht sich ein Ventilator mit eingebauter Lampe. Die Wände des Zimmers sind rosa gestrichen, über dem Schreibtisch hängt ein Poster des israelischen Popstars Noa Kirel.
«Biko!», ruft Itays Nichte. Der Hund muss noch rein. Biko schlüpft durch die Stahltür ins Zimmer, dann zieht Eran, Dalits Mann, die Tür mit Kraft zu und drückt den Türgriff nach oben. In diesem Moment hören wir draußen die dumpfen Explosionen des Iron Dome. Oz spielt auf dem Bett mit einem Panda-Plüschtier. Ich sehe meinen Sohn an. Ich habe nicht den Eindruck, dass er ahnt, dass etwas Ungewöhnliches vor sich geht. Auch die Booms scheinen ihm nichts auszumachen. Vielleicht ist das jetzt für ihn wie Gewitter, hoffe ich. Davor hat mein Sohn auch keine Angst, obwohl Gewitter in Tel Aviv Stunden andauern können und von explosionsartigem Donnern begleitet werden. Wir machen ein Selfie im Saferoom und schicken es an den Rest der Familie. Itays Vater schickt ein Foto eines spanischen Flusses zurück.
Nachdem es draußen wieder ruhig geworden ist, laufen wir aus dem Schutzraum ins Wohnzimmer. Eran erhöht die Lautstärke des Fernsehers. Ein Mann in durchgeschwitztem Polohemd redet aufgeregt in die Kamera. Er spricht Arabisch. Im Hintergrund hört man Männer auf Arabisch durcheinanderbrüllen. «Terroristen auf dem Gelände eines Kibbuz im Oteff Aza», kommentiert Moderator Dany Cushmaro. «Sie berichten live, ohne Angst. Es gibt sogar jemanden, der im Livestream filmt.» Terroristen haben ihre eigenen Journalisten aus Gaza mit nach Israel gebracht? Durch das Loch im Zaun? Um jetzt den Überfall auf die israelischen Dörfer zu dokumentieren? Ich fasse es nicht. So was hat es in Israel noch nicht gegeben.
2200 Raketen auf Israel abgeschossen, steht in einer Einblendung. Der Krieg hat jetzt auch einen Namen, «Eiserne Schwerter». Immer diese albernen Kriegsnamen, denke ich. Es hat sich noch kein Armeesprecher direkt ans Volk gewendet, um einen Überblick über die Lage zu geben, aber sie haben immerhin schon mal einen Namen gefunden. Die Armee ist damit beschäftigt, das Loch im Zaun wieder zu schließen und die Entführung weiterer Israelis nach Gaza zu verhindern, sagt der Reporter für Militärangelegenheiten. Zudem versuche man derzeit, sieben Ortschaften von Terroristen zu befreien. Sieben!
«Die Armee ist noch nicht hier angekommen», sagt ein Bewohner des Kibbuz Ein HaSchloscha am Telefon. «Wir befinden uns in Not. In Not, Not, Not! Die Armee muss jetzt kommen.» Eran schaltet den Fernseher wieder leiser und sieht die Kinder an. Itays Nichte Rotem liegt auf dem Sofa und wischt durch ihr Handy. Ihr großer Bruder Yotam sitzt auf der Sofakante und starrt mit leerem Blick auf den Fernseher. «Was wollen die hier?», fragt der Zehnjährige. Wir Erwachsenen gucken uns an, dann antwortet Itay: «Sie wollen uns Angst machen.»
«Aber was wollen die in Israel? Warum kommen die zu uns?»
Ich muss daran denken, dass die Kinder hier relativ spät die Details des Israel-Palästina-Konflikts kennenlernen – wenn überhaupt. Oft hängt die Initiative von der Lehrkraft und der Ausrichtung der jeweiligen Schule ab. Von ultra-liberal bis ultra-religiös, Israel hat etliche Schulformen. Und meist bekommen die Schüler eine «israelische» Sicht der Geschichte erzählt, die die Perspektive der Palästinenser nur andeutet. Das Verständnis und die Empathie dafür, warum auch die Palästinenser dieses Land als Heimat ansehen, wird davon geprägt, was Israelis in der Schule, in der Armee und in ihrem privaten Umfeld hören.
«Weil sie das hier als ihr Land betrachten», sagt Itay jetzt. Sein Neffe schweigt. Ich sehe seinem Gesicht an, dass es in ihm arbeitet.
Ich erinnere mich an die Ausflüge mit der Familie. Wenn der Grenzzaun zum Westjordanland in Sicht kam oder wir einen militärischen Checkpoint passiert haben, kamen jedes Mal die Fragen: Was ist hinter der Mauer? Welche Grenze ist das? Was suchen die Soldaten? «Die Palästinenser sind unsere Nachbarn», sagte Eran damals, Rotem und Yotams Vater, als wir den Checkpoint zum Toten Meer passierten. Damals waren die beiden sechs und fast acht Jahre alt. Seitdem sind drei Jahre vergangen. Die beiden Kinder haben unzählige Attentate in den Nachrichten gesehen, die von Terroristen aus dem Westjordanland gegen Israelis verübt wurden. Sie haben Raketen aus Gaza miterlebt, nicht nur einmal. Seit dem letzten Krieg gegen die Hamas 2021 schläft die neunjährige Rotem im Zimmer ihrer Eltern auf einer Matratze auf dem Boden. Sie traut sich nicht, allein in ihrem Kinderzimmer zu schlafen. «Sie wollen uns Angst machen», ergibt in der Welt, in der Rotem und Yotam aufwachsen, traurigerweise Sinn.
«Wir haben Windeln bei uns zu Hause.» Eine weitere Nachricht von Itays Mutter aus Spanien. «Wer zu uns in die Wohnung geht, sollte den Schutzraum vorbereiten, indem er die Stahlfensterläden schließt und das Sicherheitsfenster. Damit alles vorbereitet ist für jeden, der sich dort aufhält. Um die Tür zu verschließen, gibt es ein Eisenrohr, das auf den Türgriff gesteckt wird. Das Rohr liegt auf dem Boden, auf der linken Seite der Zimmertür.»
Itays Vater schickt Bilder von Mosaiktreppen in weiß gestrichenen spanischen Dörfern, von Kirchen und Tropfsteinhöhlen: «Euch ist sicher langweilig im Mamad. Hier ein paar Bilder. Granada und Frigiliana.» Keiner geht darauf ein.
Ich küsse Oz auf die Backe. Er lässt es über sich ergehen und nutzt den Moment: «Keks?» Dalit springt plötzlich auf, rennt zur Tür und verriegelt das Schloss, dann den oberen Riegel. «Es ist besser, wenn wir heute die Tür verschlossen lassen. Hört ihr, Kinder? Die Türe jetzt immer abschließen.» Ich sehe Dalit fragend an. «Pikud haOref said not to leave the house», antwortet Dalit auf Englisch, damit die Kinder sie nicht verstehen. Pikud haOref ist Hebräisch für das Heimatfront-Kommando, die militärische Einheit, die für die Sicherheit der zivilen Bevölkerung zuständig ist. Ich schaue in die Nachrichten-App. Die Anweisung gilt vom Süden Israels bis hoch in die Metropolregion Tel Aviv. Man befürchte das Vordringen von Terroristen in andere Städte.
«Es ist 11:00 Uhr. Bis jetzt wurden 2500 Raketen auf Israel geschossen.»
«Wir bitten unsere Zuschauer darum, die Bilder, die Videos von Toten, von Leichen und Verletzten, von Soldaten und Bürgern, die von den Terroristen geteilt werden, nicht weiterzuverbreiten.»
«Ich bin hier mit zwei kleinen Kindern im Mamad und mit meinem Mann. Hier ist keiner, nur die Terroristen. Sie brechen in unsere Häuser, sie bringen uns um, brennen unsere Häuser nieder. Warum kommt keiner? Niemand hilft uns … Meine Tochter hat Hunger, und ich kann sie nicht füttern … Ich muss jetzt leise sein, sie sind an meiner Tür.»
«Es gibt Bilder von Terroristen, die auf Gleitschirmen über den Zaun nach Israel eingedrungen sind.»
«Die Terrormiliz Hisbollah im Libanon hat der Hamas gratuliert.»
Um 11:35 Uhr wendet sich Premierminister Benjamin Netanyahu das erste Mal ans Volk mit einer kurzen Videobotschaft. Itay stellt den Fernseher lauter.
«Bürger Israels, wir befinden uns im Krieg. Nicht in einer militärischen Operation. Nicht in einer weiteren Runde. Im Krieg. … Ich habe in erster Linie Anweisungen gegeben, die Wohngebiete von den Terroristen zu befreien, die dort eingedrungen sind. … Parallel dazu initiiere ich eine umfassende Mobilisierung der Reservisten, um in einem Ausmaß und einer Intensität zurückzuschlagen, wie es der Feind bisher nicht erlebt hat. Der Feind wird einen beispiellosen Preis zahlen. Ich fordere die Öffentlichkeit auf, sich strikt an die Anweisungen des Militärs und des Heimatfront-Kommandos zu halten. Wir befinden uns im Krieg und werden siegen.»
«Das Ganze hat vor mehr als fünf Stunden angefangen, und jetzt spricht er zum Volk», schnaubt Itay. «Hat ihn jemand gerade aufgeweckt?» «Was erwartest du, er arbeitet seit Monaten gegen das Volk, warum sollte es jetzt anders sein?», sagt Eran von seinem Sessel auf dem Balkon, er schaut nicht mal auf den Fernseher. Im Studio rufen weiter Leute aus den Kibbuzim an.
«Ich brauche Hilfe, sie haben meinen Vater entführt.»
«Wie alt bist du?»
«23. Ich habe das Foto meines Vaters auf Telegram gesehen. Er ist in Gaza. Er ist nicht mal richtig angezogen. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Keiner aus meiner Familie antwortet. Ich habe mich in meiner Wohnung im Kibbuz Be’eri eingeschlossen im Mamad. Seit vier Stunden höre ich Schüsse draußen. Meine Oma und meine Mama antworten nicht.»
Yotam starrt auf den Fernseher. «Maybe we should stop watching the news for now», sage ich auf Englisch zu den Erwachsenen im Raum. Ich nicke in Richtung der Kinder. Dalit schaltet zum Kinderprogramm. Yotam protestiert: «Ich bin alt genug …» Als er merkt, dass es nichts bringt, verschanzt er sich hinter seinem Handy auf dem Sofa. Auf dem Fernsehbildschirm singt jetzt ein Zeichentrickschwein, kein Kind schaut hin. Oz hat eine Gießkanne gefunden und gießt Luft in die Blumen. Rotem versucht, unauffällig in dem Regal mit den Snacks zu kramen. Alle Erwachsenen starren in ihre Telefone. Dalit mit Kopfhörern auf dem Sofa, Eran und Itay in zwei Sesseln auf dem angrenzenden Balkon. Ich tigere durch die Wohnung und beantworte Nachrichten, auf WhatsApp, Facebook, in E-Mails, sogar per SMS. Es sind viele. Freunde, Kollegen, ehemalige Nachbarn fragen, wie es mir und uns geht. Die Nachrichten haben inzwischen auch das Ausland erreicht. «Uns geht es gut, alles okay … Wir sind bei der Familie mit Saferoom … Ich kann jetzt nicht telefonieren … Momentan keine Raketen auf Tel Aviv …»
«This is the first time I am really scared», sagt Dalit, als wir nebeneinander in der Küche stehen. Sie flüstert schnell. «Hostages! Have you seen the pictures? There was a girl who recognized her father in the videos from Hamas. Her father was taken to Gaza.»
«I do not think I want to see those pictures», sage ich. Ich will nicht, dass Dalit mich mit ihrer Panik ansteckt. Irgendjemand hier muss doch ansprechbar für die Kinder bleiben. Ich wärme Oz’ Kartoffelbrei in der Mikrowelle auf. Mein Handy leuchtet dauernd auf, es kommen mehr und mehr Nachrichten an. Ein Kollege aus Deutschland fragt, ob ich nicht etwas schreiben möchte, für die Zeitung. Allein der Gedanke, mich jetzt hinzusetzen und zu recherchieren, was bis Redaktionsschluss der neueste Stand sein könnte, verursacht mir Herzrasen. Nein, nicht heute, denke ich. Vielleicht in den kommenden Tagen, wenn es vorbei ist. Ich habe Kollegen, Krisen- und Kriegsreporter, die in Gefahrensituationen in Windeseile Texte recherchieren, schreiben, abliefern. Aber die haben meist keine Kinder.
Nach seinem Mittagessen lege ich Oz im Mamad ins Bett und lese ihm ein Buch vor. Er schläft sofort ein. Ich atme den Duft seines Haares ein. Ich bin so froh, dass er jetzt hier bei mir ist und es uns gut geht. Der Hund Biko schlüpft durch die angelehnte Stahltür und verkriecht sich unter dem Bett. Ich schließe die Tür bis auf einen Spalt und laufe ins Wohnzimmer. Der Kinderfilm läuft noch, Rotem liegt mit Kopfhörern auf dem Sofa, ihr Bruder ist in seinem Zimmer verschwunden. Erst jetzt spüre ich zum ersten Mal an diesem Tag, dass ich Hunger habe. Seltsam, wie so ein Körper funktioniert. Seit ich Mutter bin, sind sowieso die meisten Bedürfnisse meines Körpers unterdrückt, sobald Oz im Raum ist. Es scheint, als sei die Wachsamkeit, dass etwas passieren könnte, mit seiner Geburt Teil meines Bewusstseins geworden. Sie lässt mich weniger tief schlafen und bei jedem Husten, jedem entfernten Reifenquietschen aufwachen.
Doch es ist nicht nur das Muttersein. Die vielen Terroranschläge der vergangenen Monate haben die Wachsamkeit in mir verstärkt. Ich kann kaum noch Bahn oder Bus fahren, ohne die anderen Passagiere um mich herum auf ihr «Terror-Potenzial» zu prüfen: Schauen sie sich öfter um als andere? Haben sie eine ausgebeulte Tasche dabei, einen Rucksack, den sie verkrampft festhalten? Warum spielt der Mann dort nicht mit dem Handy wie alle anderen im Bus? Warum hat die Frau mit dem Kopftuch dort eine Gebetskette in der Hand, deren Perlen sie nervös durch die Finger gleiten lässt? Sind die beiden Männer dahinten mit den Marken-T-Shirts Gastarbeiter aus dem Westjordanland? Warum starren sie die junge Soldatin da vorne so an? Soll ich lieber aussteigen?
Ich weiß, dass diese Gedanken übertrieben sind und auch rassistisch. Ich könnte genauso gut jederzeit von einem Auto- oder Roller-Fahrer umgenietet werden, die Wahrscheinlichkeit ist sogar weitaus höher, vor allem in Yafo, wo viele Jugendliche mit Elektrorollern halsbrecherisch durch die Gassen brettern. Aber etwas ist mit mir passiert im vergangenen Dreivierteljahr. Ich spüre nicht mehr diese Leichtigkeit, diese Zuversicht, diese Sicherheit, die ich vor vier Jahren fühlte, als ich ankam, um mein Leben hier zu beginnen.
Das Israel von damals kommt mir vor wie einem Traum entsprungen. Zu schön, um wahr zu sein. Zu sonnig, zu liebevoll, zu willkommen heißend. Zu friedlich. Das Israel, das ich in den vergangenen Monaten erlebt habe, ist ein Land der Extreme. Wütend. Unversöhnlich. Ein Land kurz vor dem Bürgerkrieg. Milchemet Achim lautet der Ausdruck im Hebräischen, übersetzt heißt das «Brüderkrieg». Ich habe ihn zu oft gehört in den vergangenen Monaten. Tatsächlich ist es ein Konflikt zwischen Nachbarn, Familienmitgliedern, Freunden, zwischen Menschen, die plötzlich zu merken scheinen, dass sie entgegengesetzte Vorstellungen davon haben, wie ihre gemeinsame Heimat aussehen soll. Und die keine Toleranz für jene haben, die das anders sehen.
Radikale Politiker – und es gibt auf einmal so, so viele von ihnen – schlagen mit spaltenden Worten auf das Fundament ein, auf den Gesellschaftsvertrag dieses Landes. Sie gedeihen am Hass, am Misstrauen, an der Unvereinbarkeit. Mit vergiftenden Ideen und manipulativen Worten greifen sie das Mosaik der Gesellschaft an, das sowieso schon brüchig geworden ist. Die aufgeheizte Stimmung in diesem Jahr hat mich misstrauisch gemacht, oft Schlimmes befürchtend. Das geht über die normale Muttersorge hinaus. Ich kann das Gefühl nicht mehr abschütteln, dass Israel sich auf einen Abgrund zubewegt, und ich frage mich nicht mehr ob, sondern: Wann gehe ich, bevor ich mitgerissen werde? Doch ich treffe Entscheidungen nicht mehr für mich allein.
Ich trete hinaus auf den Balkon. Itay und Eran sitzen sich gegenüber und stieren in ihre Telefone. Es ist still draußen. Man hört nichts, kein vorbeifahrendes Auto, keine Gespräche, kein Hundebellen, kein Zuschlagen von Autotüren. In einer Nachbarschaft mit neun Stockwerke hohen Wohntürmen hört man sonst immer irgendwas. Dann knattert da ein Motorroller. Ein Essenslieferant rollt auf den Bürgersteig vorm Haus. Die arbeiten also trotz allem. Arme Fahrer.
«Veha’ikar, veha’ikar», ertönt ein Chor Männerstimmen aus einer nahen Synagoge, «lo lefached, lo lefached klal!» Ein Lied, meist gesungen an Feiertagen, wie heute für Simchat Thora. Wie so viele Lieder dieses Landes wurde es ein Hit in einem Krieg, dem Jom-Kippur-Krieg 1973. «Die ganze Welt ist eine sehr schmale Brücke. Und das Wichtigste, das Wichtigste ist es, keine Angst zu haben, überhaupt keine Angst.»
Der Schulunterricht für morgen, den Wochenbeginn in Israel, ist gestrichen, vom Süden Israels bis in die Sharon-Region nördlich von Tel Aviv. «Yesssss», ruft Rotem, «bleibt ihr dann bei uns mit Ozi?» «Mal gucken, eigentlich wollten wir später wieder nach Hause», antworte ich ausweichend. Ich schaue zu Itay auf dem Balkon. Ob er irgendwas mitbekommt? «Bitte, bitte, bitte», bettelt Rotem. «Wir können Ozi hier baden, und er kann heute Nacht in meinem Zimmer schlafen.» «Wir gucken mal, wie sich die Lage entwickelt», sage ich. Ich will mich nicht festlegen. Wir müssen doch wieder nach Hause. Ich habe kaum Wechselklamotten dabei, und hier im Kinderzimmer zu schlafen, war eigentlich nur als Notlösung gedacht, im Falle … Ja, in welchem Falle? Im Falle von Krieg, führe ich meinen Gedanken aus. Aber was heißt das? Wieder elf Tage im Haus sitzen und andauernd in den Schutzraum oder Hausflur rennen wie vor zwei Jahren? Wie soll das gehen mit Kleinkind? Mit der Arbeit? Itay ist Programmierer, er kann überall arbeiten, wo sein Laptop ist, und ich arbeite sowieso nur remote für deutsche Auftraggeber. Aber mit drei Kindern und einem Hund in einer Drei-Zimmer-Wohnung Ruhe finden zum Schreiben? Dann fällt mir ein, dass wir einen Flug nach Frankfurt gebucht haben, in acht Tagen. Ich habe Lesungen in Deutschland und sie verbunden mit einem Besuch bei meiner Familie. Ich schaue nach, ob ich eine E-Mail der Lufthansa bekommen habe. Nichts. Gut. Vielleicht hat sich bis dahin alles beruhigt.
«Gaza wird einen harten Preis zahlen. Alle Augen sind jetzt auf Israel gerichtet.»
«Gaza wird in Flammen aufgehen, kein Zweifel.»
«Es ist wichtig, dass wir die Angriffe der Luftwaffe jetzt zeigen.»
«Wir bitten die Verletzten, in ihren Häusern zu bleiben. Wer blutet, sollte die Blutung möglichst versuchen zu stoppen. Durch Druck auf die Wunde oder durch einen Verband, der nicht zu stark um die blutende Stelle gewickelt wird. Arterielle Blutungen dürfen nicht blockiert werden, achten Sie darauf, ob die Blutung mit dem Herzschlag pulsiert.»