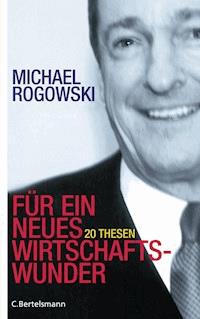
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bertelsmann, C.
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Deutschland – ein Sanierungsfall! Am Ende seiner Amtszeit als BDI-Präsident stellt Michael Rogowski 20 Thesen zur Diskussion - Vorschläge und Ideen, wie aus Deutschland wieder eine führende Industrienation werden könnte. Ein mutiges Buch von einem versierten Experten, der sich nicht scheut, auch unbequeme Lösungen für die wirtschaftliche Misere zu präsentieren. – Unter der Vielzahl der Abstiegs- und Niedergangsszenarien endlich ein positives, Mut machendes und zukunftsweisendes Buch!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2005
Ähnliche
MICHAEL ROGOWSKI
FÜR EIN NEUES WIRTSCHAFTSWUNDER
20 THESEN
In Zusammenarbeit mit Madlen Hillebrecht
Copyright
PeP eBooks erscheinen in der Verlagsgruppe Random House
Copyright © 2004 by C. Bertelsmann Verlag, München, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH
ISBN 3-89480-854-3
www.pep-ebooks.de
Inhaltsverzeichnis
1 Mut zum Risiko bringt uns voran – Keine Angst vor Freiheit2 Freiheit wagen, Verantwortung tragen – Zwei Seiten einer Medaille3 Erst Freiheit macht Soziale Marktwirtschaft möglich – Über das Feindbild des Neoliberalismus4 Wir können stolz auf unsere Unternehmer sein – Raubritter, »Vaterlandsverräter« und andere Phantome5 Eliten prägen die Gesellschaft – Der ethische Wert von Vorbildern6 Regieren heißt führen – Wir brauchen ein Gesamtkonzept7 Die vierte Gewalt ist in der Pflicht – Macht und Verantwortung der Medien8 Föderalismus darf nicht heißen: Schneckentempo – Echter Föderalismus ist Wettbewerbsföderalismus9 Belastungen runter, Wachstum rauf – Schulden, Steuern und andere Wachstumsbremsen10 Wir brauchen noch viel mehr Hartz – Die Deregulierung des Arbeitsmarktes hat begonnen11 Schluss mit dem Spuk – Über Mindestlohn und andere Gespenster12 Auch Gewerkschafter müssen Dienstleister werden – Basta mit den Blockaden13 Vorsicht vor grünen Visionen – So manche entpuppt sich als Jobkiller14 Vorsprung durch Forschung – Eine Chance für neue Arbeitsplätze15 Das kranke Gesundheitssystem zum Sprungbrett für Wachstum machen – Die vitale Gesellschaft16 Nur eine Frischzellenkur stärkt unsere Bildung – Studiengebühren, Bildungsgutscheine und mehr17 Wer wagt, gewinnt – Für Familie und Kinder18 Aufbau Ost – Auch diese Herkulesaufgabe ist lösbar19 Europa, besinne dich! – Für mehr Wettbewerb und weniger Bürokratie20 Globalisierung als Chance begreifen – Über Teufelseintreiber und andere Angstmacher21 Glück hat auf Dauer nur der Tüchtige und Beharrliche – Michael Rogowski im persönlichen Gespräch mit Madlen HillebrechtÜber das BuchÜber den AutorCopyright
Für meine geliebte Frau Gabriele in Dankbarkeit
1 Mut zum Risiko bringt uns voran
Keine Angst vor Freiheit
Es war der 28. Oktober 1969. Der vor einer Woche gewählte Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) trug seine erste Regierungserklärung vor. Wie stets mit heiserer Stimme und eindringlichem Pathos. »Wir wollen mehr Demokratie wagen. Wir fangen erst richtig an«, rief er in das Plenum. Die Abgeordneten der gerade geschmiedeten sozialliberalen Koalition im Bundestag rasten vor Begeisterung. Und mit ihnen jubelten die Menschen draußen, die ihnen die Mehrheit gebracht hatten. Nach den langen beschwerlichen Aufbaujahren der Bundesrepublik erschien dieser Bundeskanzler als mitreißender Heilsbringer. Keiner der Jubelnden ahnte damals, dass die kommenden wirtschaftspolitischen Reformen bereits den Keim des wirtschaftlichen Niedergangs in sich trugen.
»Genossen, lasst die Tassen im Schrank«, rief der angesehene Wirtschaftsprofessor Karl Schiller, Wirtschafts- und Finanzminister im Kabinett Brandt, nur drei Jahre später und trat im Juli 1972 zurück. Er war damals der Einzige, der sparen wollte. Er schlug dem Kabinett 2,5 Mrd. Einsparungen vor. Als er seine Konzeption nicht durchsetzen konnte, war das für ihn der Anlass, den Schlusspunkt zu setzen.
Warum erwähne ich diese Sätze, die beim ersten Hinhören nichts miteinander zu tun haben? Zur Erinnerung: Die Genossen fingen, wie Brandt sagte, wirklich erst »richtig« an. Sie initiierten die Ausweitung zu einem gigantischen Umverteilungs- und Versorgungsstaat, der jedem Bürger Auskommen, Sicherheit und Geborgenheit von der Wiege bis zur Bahre garantieren sollte. Flankiert wurden die Maßnahmen des Wohlfahrtsstaates von einer zunehmenden Belastung der Unternehmen: Ausweitung der Mitbestimmung, des Kündigungsschutzes, des Streikrechtes – man fesselte sie in einem dichten Netz von Regeln, Bestimmungen, Gesetzen. Damit wurden viele Unternehmen überfordert. Das Motto der SPD damals lautete, »die Belastbarkeit der Wirtschaft zu testen«. Es war gegen jede volkswirtschaftliche Vernunft. Und das Ergebnis haben wir noch jetzt, gut 30 Jahre später, auszubaden. Zumal auch die bürgerliche Regierung das Ruder nicht konsequent herumgerissen hat.
In der Rückschau war der Tarifabschluss mit dem damaligen ÖTV-Boss über elf Prozent Lohnerhöhung im Jahr 1974 ein kardinaler »Sündenfall«– es war der Anfang der Maßlosigkeit. In der Folge führten erhöhte Lohnsteigerungen, gefolgt von immer kürzeren Arbeitszeiten, in Deutschland zu den höchsten Lohnstückkosten aller relevanten Industrienationen.
Rund zehn Jahre nach Karl Schiller erkannte der damalige Wirtschaftsminister Graf Lambsdorff (FDP) in dem nach ihm benannten Lambsdorff-Papier 1982, dass die private Wirtschaft mehr Luft zum Atmen brauchte und der Staat sparen musste. Die Ausweitung der Sozialleistungen bei verkürzter Arbeitszeit, Subventionen und die Kosten für den aufgeblähten öffentlichen Dienst müssten zurückgefahren werden. Sonst, so warnte Lambsdorff, »würde die frühere Eigendynamik und das Selbstvertrauen der deutschen Wirtschaft geschwächt.«
Die SPD ging Monate später in die Opposition; CDU/CSU und FDP bildeten unter Kohl und Genscher eine bürgerlichliberale Koalition. Der damalige Finanzminister Gerhard Stoltenberg legte ein »Dringlichkeitsprogramm« vor, das vielversprechende Ansätze zum Schuldenabbau enthielt. Wirtschaft und Finanzen erholten sich vorübergehend. Doch zum notwendigen nachhaltigen Abbau staatlicher Wohltaten fehlte auch Kohl und Genscher die Kraft. Das Prinzip der Parteien, mit staatlichen Wohltaten Wählerstimmen zu »kaufen«, wurde auch damals durchgängig praktiziert.
Was haben sich Politiker dabei gedacht, Berechnungen zu ignorieren, die besagten, dass die Kassen eines Tages leer sein würden? Ein kluger Kenner der Politikszene sagte mir kürzlich auf diese Frage: »Nichts. Denn sie sind so sehr mit ihrem Machterhalt, mit politischen Ränkespielen beschäftigt, dass sie ihre Verantwortung für unser Land nur unzureichend wahrnehmen können.« Ich dagegen meine: Viele von ihnen haben schlichtweg geglaubt oder gehofft, es würde schon gut gehen; kein Bürger würde merken, wie es wirklich um unsere Staatskassen bestellt ist.
Hat Sozialminister Norbert Blüm insgeheim Stoßgebete gen Himmel geschickt, wenn er sagte »Die Rente ist sicher«? Das kommende Desaster war absehbar. Seit den 1970er-Jahren warnten Experten vor den Folgen der drohenden Überalterung für die Sozialkassen. Dennoch sattelte der Gesetzgeber mit der Einführung der Pflegeversicherung vor zwölf Jahren ein weiteres Umlagesystem drauf. Wirtschaftliches Wachstum würde es schon richten – so glaubten viele.
Wie zu befürchten war, rutschte das System jedoch innerhalb kurzer Zeit ins Defizit. Das Wachstum ist ausgeblieben, seit vielen Jahren ist es – von einzelnen Ausnahmen abgesehen – viel zu niedrig. Hinzu kommt die demografische Entwicklung: Es werden zu wenig Kinder geboren, immer weniger Beitragszahler müssen immer älter werdenden Menschen die Rente und die Krankenversicherung bezahlen. Dass wir älter werden, ist natürlich ein glücklicher Umstand. Nur: Durch weniger Geburten wird das »Altern« unserer Gesellschaft ein Problem, auf das wir reagieren müssen.
Kanzleramtsminister Steinmeier sagte unlängst in einem Cicero-Interview zu dem Vorwurf, die Regierung hätte mit der Agenda 2010 die Strukturreformen viel zu spät angepackt: »Ich glaube, unsere Analyse war geschärft durch den Blick auf die demografische Situation, aber nicht genügend geschärft, was das langfristig bedeutet, wenn infolge mehrjähriger Stagnation politische Gestaltungsspielräume zusammengeschnürt werden.«
Das heißt mit anderen Worten: Die rotgrüne Regierung, aber auch schon die schwarzgelbe Vorgängerregierung haben nicht bedacht, dass sie durch ihre Untätigkeit, durch ihr Versäumnis, die richtigen Reformen anzupacken, kein Geld mehr für notwendige Investitionen haben würden. Dadurch gingen viele Jahre verloren.
In der Weltrangliste des Pro-Kopf-Einkommens sind wir unübersehbar abgestiegen. So haben wir jetzt die Situation, dass der Staat seine Wohltaten abbauen muss. Denn wenn wir so weitermachen, dann wird dieser Staat Pleite gehen. Er wird nicht mehr in der Lage sein, die Renten zu bezahlen, die Krankenkosten zu bestreiten, den Arbeitslosen zu helfen usw. Ab dem Jahr 2010 wird sich die Situation zunehmend verschärfen.
SPD-Parteichef Müntefering sagte dazu nach einem Bericht der Bildzeitung: »Die Sozialsysteme sind klamm, und auch der sozialste Politiker kann kein Geld drucken.« Eine zwar späte, aber gute Einsicht. Die Staatskassen sind leer, wir müssen sparen, Leistungen abbauen. Hier gibt es zahlreiche Möglichkeiten.
Für wie unselbstständig hält ein Staat seine Bürger, wenn er sie sogar Geld für Kondome beantragen lässt, neben ihrer Sozialhilfe? Man überlege einmal, welche Antragsflut für solche Einzelleistungen bearbeitet werden muss, bei 2,8 Millionen Sozialhilfeempfängern. Ist der Staat der Meinung, dass seine Bürger nicht eigenständig mit Geld wirtschaften können? So erzieht man sich den unmündigen Bürger. Einige dieser Auswüchse wurden und werden jetzt geändert – das ist gut und überfällig.
Aber wie nachlässig gehen Staatsbedienstete mit den ihnen anvertrauten Steuergeldern um! In Berlin sponserte der Kultursenator Sex-Workshops mit gefesselten Frauen – ein »Künstler« erhielt dafür 100 000 Euro Fördergelder für die Jahre 2004/2005. Stellungnahme des Senats: »Die Künstler müssen vorab nur grobe Konzepte vorstellen.« Als der Vorgang durch Zufall öffentlich wurde, gab es Empörung im Berliner Abgeordentenhaus. Doch der zuständige Senator lehnt schärfere Kontrollen ab. Er meinte in einem Interview: »Staatlicher Dirigismus würde das Provokante, das Kunst einbringen muss, beschneiden.«
Auch ich bin für Freiheit in der Kunst. Doch wenn Sozialhilfeempfänger sich auf Herz und Nieren prüfen lassen müssen, dann, denke ich, sollten »Künstler« auch ihre Konzepte genauer offen legen, bevor sie Fördergelder erhalten.
Einige andere Beispiele: Laut einem Artikel der Bildzeitung zahlt das Arbeitsamt Bremen einer Frau 1500 Euro Überbrückungsgeld für ihren neuen »Beruf« als Wahrsagerin. Ihren früheren Job bei einem Sicherheitsdienst mit sechs Euro Stundenlohn hatte sie gekündigt. Sabine Kettler, die Chefin des Arbeitsamtes Bremen-Ost, meinte dazu: »Mit einem Gutachten überzeugte uns die Antragstellerin davon, dass sie bald selbst für ihren Unterhalt sorgen kann. Darum war es für uns selbstverständlich, sie zu fördern.«
Oder: Wie will der Staat seinen Bürgern erklären, dass er Krötentunnel für 225 000 Euro baut und gleichzeitig die Straßen in den Städten verrotten lässt?
Im Haushaltsentwurf für 2005 findet sich eine Position mit 300 000 Euro für »verdeckte Feldbeobachtung« des Bundesumweltministeriums von Jürgen Trittin (Grüne). Mit dem Geld soll das Umweltbundesamt verdeckte Ermittler engagieren, die kontrollieren, ob die Landwirte korrekt mit Pflanzenschutzmitteln umgehen oder nicht.
Dieses sind nur Einzelbeispiele – es gibt Tausende anderer. Sie zeigen, dass ein hohes Einsparpotenzial bei öffentlichen Geldern vorhanden wäre, wenn man nur wollte.
Aber nicht nur für seine Bediensteten, auch für eine große Zahl von Bürgern ist der Staat eine anonyme Melkkuh. Wie soll man sonst verstehen, dass zum Beispiel eine Professorin der Humboldt-Universität in Berlin ihren Studentinnen freimütig gestand, dass sie ihrer 24-jährigen Tochter dringend geraten hätte, noch während des Studiums ein Kind zu bekommen. Ihre Begründung: Dann erhielte sie sämtliche Förderungen und Unterstützungen des Staates. Das müsse man doch ausnutzen.
Oder jene Sozialhilfeempfänger, die kurz vor Einführung der Hartz-IV-Gesetze die Ämter mit einer Flut von Anträgen für Einmalleistungen wie Fernseher, Sofas, Schränke, Computer etc. überschwemmten: In Hamburg bestellte eine Familie innerhalb einer Woche zwei Sofas, ein Berliner bestellte einen neuen Kühlschrank, obwohl er wenige Monate zuvor einen erhalten hatte. Er behauptete, der »alte« Kühlschrank sei schon kaputt. Ein anderer Berliner bestellte innerhalb weniger Tage zwei Waschmaschinen, eine Familie aus Brandenburg beantragte einen Zweitfernseher. Welcher Geist steht hinter dieser Haltung?
All diesen Bürgern fehlt die Erkenntnis, dass der Staat wir alle sind, uns alle angeht. Wenn sie den Staat ausnutzen, nutzen sie das ganze Volk aus – sich selbst auch. Sie verlassen sich viel zu sehr auf den Staat und auf staatliche Leistungen. Man muss den Bürgern immer wieder sagen: Leute, vergleicht doch mal, was ihr brutto auf eurem Lohnzettel habt, und was ihr netto herausbekommt. Da liegen ja Welten dazwischen. Das ist das Ergebnis der staatlichen Umverteilungs- und Verschwendungspolitik. Das nimmt der Staat euch weg und verteilt es irgendwo um, und ihr wisst nicht einmal genau, wo es hingeht.
Unrechtsbewusstsein ist bei uns nur mangelhaft entwickelt: Derselbe Mann, der über »die Reichen« schimpft, die angeblich ihr Geld ins Ausland bringen, um Steuern zu hinterziehen, geht ohne schlechtes Gewissen nach Feierabend oder am Wochenende schwarzarbeiten. Dass er damit gleichfalls Steuern hinterzieht, überlegt er nicht.
Steuerhinterziehung gilt als Kavaliersdelikt im öffentlichen Bewusstsein. Viele Menschen empfinden ihr Handeln als Notwehr im Hochsteuer- und Umverteilungsstaat. Schätzungsweise rund 72 Milliarden Euro gehen dem Staat durch Steuerhinterziehung verloren, etwa 145 Milliarden durch Sozialleistungsmissbrauch, wie Graf Lambsdorff kürzlich in Cicero schrieb. Rund 400 Milliarden Euro werden in Schwarzarbeit erwirtschaftet. So kommt es, dass der Ehrliche zum Dummen wird. Das können wir nicht wollen!
Zu lange haben wir Solidarität falsch verstanden, indem wir nur eine Seite sahen – die Bedürftigkeit. Solidarität muss jedoch zwei Kriterien genügen: Jeder, der in Not gerät, muss wissen, dass ihm geholfen wird. Das ist das eine. Das andere aber: Jeder muss eigenverantwortlich danach trachten, nicht in Not zu geraten und die Solidargemeinschaft möglichst wenig zu belasten. Niemals darf Hilfe den Willen zur Selbsthilfe konterkarieren. Sie darf Leistung nicht demotivieren. Im Gegenteil, Hilfe muss zu Selbsthilfe, zu Leistung motivieren. Mündige Bürger nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand! Eigenverantwortung und Solidarität gehören zusammen: Das gilt im Verhältnis des Einzelnen zu seiner Familie, zur Gesellschaft, zum Staat. Das gilt auch zwischen Bundesstaaten und zwischen den Euro-Partnerstaaten. Es gilt schließlich weltweit.
Tagtäglich hören wir die Formel von der Gerechtigkeit. Ich meine, dass Freiheit die viel gerechtere Lebensform gewährt. Deshalb bin ich aber nicht der Meinung, dass wir uns nicht um Gerechtigkeit bemühen müssen. Aber das bedeutet doch nicht eine häufig so verstandene Ergebnisgerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit der Ausgangsbedingungen. Gerechtigkeit kann nicht heißen, dass am Schluss alle auf gleich niedrigem Niveau sind oder dass wir – sinnbildlich gesprochen – beim 100-Meter-Rennen alle gleichzeitig durch die Ziellinie rennen. Das kann nicht das Ziel von Gerechtigkeit sein. Es wird immer Läufer geben, die schneller sind oder mehr Durchhaltevermögen haben. Es geht also darum, dass möglichst viele mit ähnlicher Kondition und ähnlicher Einstellung an den Start gehen. Das Ziel von Gerechtigkeit kann nur sein, dass man Menschen die gleichen Chancen einräumt – nicht im Ergebnis, sondern in den Voraussetzungen, in den Grundbedingungen. Und da leistet eine wettbewerbsorientierte freie Wirtschaft allemal mehr als eine monopolistische Staatswirtschaft. Das dokumentiert ja auch die Erfahrung, die wir mit sozialistischen Staatswirtschaften gemacht haben. Am Schluss waren zwar alle ein Stück weit gleicher, aber alle auf so niederem Niveau, dass es verdammt ungerecht war.
Der Begriff der Gerechtigkeit ist zu lange missverstanden worden. Gerechtigkeit heißt nicht Gleichheit. Ich habe den Eindruck, dass mancher Politiker ganz bewusst diesen Unterschied nicht klar gemacht hat.
»Was hat Ihr Anzug gekostet?«, wurde ausgerechnet SPD-Chef Franz Müntefering kürzlich im Osten bei einer Demonstration angepöbelt. Der Fragende meinte wohl: Wenn du – Müntefering – einen teuren Anzug trägst, steht mir das auch zu. Dass zur Gleichheit auch die gleiche Leistung, die gleiche Anstrengung gehört, war ihm nicht bewusst – oder er wollte es nicht wahrhaben.
Es herrscht ein Ungeist in unserem Lande. Der Ungeist heißt Neid. Es gibt eine ideologisch aufgeladene Neiddebatte mit Vokabeln aus der Zeit des Klassenkampfes. Die Gleichung lautet: »Die Reichen müssen die Armen alimentieren.« Wenn die Staatskassen leer sind, müssen »die Reichen« eben noch mehr zur Kasse gebeten werden: über höhere und neue Steuern. Hier kennt der Erfindungsgeist der Politiker keine Grenzen. Dabei wird in der Regel verschwiegen, dass nur zehn Prozent der Steuerzahler, die Höchstverdienenden, bereits 55 Prozent der gesamten Einkommensteuer aufbringen: Einen Menschen mit einem Porsche kann man um seinen schicken Sportwagen ja durchaus beneiden – missgönnen sollten wir ihm diesen nicht. Und wir sollten sehen: Dieser Mensch sichert Arbeitsplätze mit dem Kauf seines Autos. Wir sollten uns wünschen, dass sich noch viel mehr Menschen einen Sportwagen kaufen können. Denn es nutzt uns allen. So sollte sich der Ungeist der gleichmacherischen Neidkultur wandeln.
Amerika ist in dieser Hinsicht ein Vorbild. Fred Langhammer, Co-Chairman des US-Institutes für zeitgenössische deutsche Studien, sagt: »In den USA haben die Menschen eine Can-Do-Mentalität. Du schaffst das schon. Knie dich rein. Wenn einer Leistung erbringt und etwas erreicht, gibt es keinen Neid und keine Missgunst, sondern Anerkennung und Schulterklopfen. Der hat's geschafft. Ich will's auch schaffen. Erfolg wird in Amerika honoriert und von der Gesellschaft gefördert. «
Eine Allensbach-Umfrage ergab: In Ostdeutschland meinten 51 Prozent, Gleichheit gehe vor Freiheit, in Westdeutschland waren 53 Prozent für Freiheit und 37 Prozent für Gleichheit. In den 1970er-Jahren lag dieser Wert bei rund 25 Prozent. Das zeigt, dass auch im Westen der Wunsch nach Gleichheit zugenommen hat.
Ich finde diese Entwicklung bedenklich. Sie zeigt, dass bei uns die Zahl der ängstlichen, risikoscheuen Mitbürger zunimmt. Sie können offensichtlich das hohe Gut der Freiheit nicht mehr in dem Maß schätzen, wie es meiner Meinung nach nötig wäre. Freiheit ist Wagnis und Chance zugleich. Man kann gewinnen, aber auch verlieren. Allerdings: Wenn ich nicht wage, eigene Entscheidungen zu treffen, Erfahrungen auszuwählen, mein Schicksal selbst zu gestalten, habe ich auch keine Chance zu gewinnen. Ich erfahre nicht, ob ich vielleicht tüchtiger, erfolgreicher, cleverer wäre als bisher. Wenn ich mich stets auf andere verlasse – in diesem Falle auf den Staat, die Gesellschaft –, werde ich das Potenzial, das in mir steckt, nicht nutzen. Ich bleibe unmündig – wie ein Kind, das die Hand der Mutter nicht loslassen will: Es wird niemals allein laufen können. Es wird niemals die stimulierende Kraft der Freiheit erfahren, die ihm ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht.
Forschungsergebnisse zeigen deutlich, dass der Erfolg einer Gesellschaft wesentlich davon abhängt, wie viel Bedeutung sie dem Wert der Freiheit einräumt. Nach Analysen des kanadischen Fraser-Instituts herrscht in Ländern mit weitgehender wirtschaftlicher Freiheit nicht nur allgemein ein größerer Wohlstand als in Ländern, in denen der Staat stark ins Wirtschaftsleben eingreift, sondern anders, als oft behauptet wird, haben in einer freien Wirtschaft auch die ärmeren Bevölkerungsschichten eher einen etwas größeren Vorteil am Gesamteinkommen als bei einer staatlich kontrollierten Verteilungswirtschaft. Die Studie belegt, dass Wohlstand ohne eine liberale Wirtschaftsordnung nicht zu haben ist. Je weniger paternalistisch sich der Staat gebärdet und je mehr Entfaltungsspielraum Unternehmen haben, desto besser geht es den Menschen im Land.
Graf Lambsdorff meinte kürzlich in einem Cicero-Artikel, eine freie Gesellschaft könne Moral und Gemeinsinn stärken. Diese Einsicht stehe im Gegensatz zu der Vorstellung, dass »neoliberale« Freiheit für alle moralischen Verfehlungen unserer Zeit verantwortlich sei.
Wir brauchen dringend einen Bewusstseinswandel: von der angestrebten Gleichheit zur Freiheit. Mündige Bürger sind nicht bequem und wollen nicht gegängelt werden. Sie haben Selbstvertrauen und brauchen Freiheit zur Entfaltung ihrer Talente. Mündige Bürger sind nicht neidisch auf die Leistungen anderer. Sie wissen: Höchstleistungen entstehen als Folge von Talent und harter Arbeit. Das bestätigt jeder, der Höchstleistungen vollbringt. Mit Bequemlichkeit erreicht man keine Höchstleistungen. Es gibt eine alte Erkenntnis von Thomas Edison: Genie bedeutet ein Prozent Inspiration und 99 Prozent Transpiration.
Leistung wird bei uns zu wenig anerkannt. Das ist sicherlich auch eine Nachwirkung der 68er-Generation, die teilweise Leistung aus Protest verweigerte. Spitzenleistungen werden bei uns zwiespältig wahrgenommen – einerseits bewundert, andererseits gesellschaftlich abgelehnt, weil der Neid geweckt wird. Der Unternehmensberater Roland Berger sagte dazu in einem Interview mit der Welt am Sonntag: »Herauszuragen, mehr als der Durchschnitt zu leisten und zu verdienen, gilt hier im Lande eher als politisch unkorrekt. Dabei sind es diejenigen, die Höchstleistungen vollbringen und damit dem Land dienen, denen materiell wie gesellschaftlich Anerkennung gebührt.« Nach den Ursachen befragt, meinte er: »Eine Mehrheit der Deutschen ist satt. Die ältere Generation hatte nach dem Zweiten Weltkrieg ein klares Ziel vor Augen, nämlich das Nachkriegselend zu überwinden und Wohlstand zu schaffen. In diesen Wohlstand wird jeder Deutsche heutzutage hineingeboren. Das heißt, es fehlt ein materielles Motiv, sich zu quälen.«
Berger findet die Situation vergleichbar mit dem Zustand des deutschen Fußballs. Die Bundesliga sei Weltklasse, die Nationalmannschaft eher Mittelmaß, erklärt er. Warum? Weil in der Bundesliga ausländische Spieler den Unterschied ausmachen. Sie erbringen Höchstleistungen, weil dies ihre Chance ist, schnell nach oben zu kommen. Den meisten Deutschen, so Berger weiter, fehle für diese Quälerei die Motivation.
Wir beobachten auch noch ein anderes Phänomen: Je mehr sich die Menschen auf staatliche Institutionen verlassen, desto mehr sinkt ihre eigene Hilfsbereitschaft. In Amerika zum Beispiel ist die Hilfsbereitschaft des Einzelnen gegenüber dem Nachbarn, dem Bedürftigen, wesentlich ausgeprägter als bei uns. Kindern wird schon in der Schule beigebracht, sich um arme, von der Gesellschaft vernachlässigte Menschen zu kümmern. Bei uns verlassen sich dagegen die meisten auf staatliche Hilfe, nach dem Motto: Ich habe ja bereits bezahlt, also habe ich automatisch Anspruch auf staatliche Leistungen.
Wir müssen den Staat zurückdrängen und mehr Freiheit wagen. Freiheit fördert die Selbsthilfe. Ich vermute, dass dann auch wieder mehr Nachbarschaftshilfe zurückkehrt in unsere Gesellschaft und mehr Gemeinsinn entsteht.
»Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frage, was du für dein Land tun kannst«: Mit diesem Wahlspruch rüttelte John
F. Kennedy die amerikanischen Bürger auf, als er 1960 in den Wahlkampf zog. Diese Maxime sollte auch in unserem Land gelten.
Die erwähnte Allensbach-Umfrage ergab zudem, dass die Bevölkerung in der Mehrheit auch heute noch einen stark ins Wirtschaftsleben eingreifenden Staat als gerechter, »menschlicher« und eher den Wohlstand sichernd empfindet als einen zurückhaltenden. Dass es mit der Wirtschaft vorangeht, dass die Preise nicht steigen, dass es gerechte, der Leistung angemessene Löhne gibt, sieht eine deutliche Mehrheit der Deutschen als Aufgabe des Staates an.
Hier bestehen erhebliche Wissensdefizite. Denn der Staat sollte nach allen Erfahrungen lediglich die Rahmenbedingungen setzen. Hinzu kommt ein beträchtlicher Aufklärungs- und Informationsbedarf. Ich erkenne dies auch an zahlreichen Briefen, die ich als BDI-Präsident erhalte. Sie zeigen oft einen gravierenden Mangel an wirtschaftlichem Sachverstand. Zum Beispiel schrieb kürzlich jemand, wir Unternehmer würden den Standort Deutschland schlecht reden, schließlich seien wir immer noch Exportweltmeister. Der Schreiber dieses Briefes weiß offensichtlich nicht, dass es für die Wirtschaft eines Landes nicht ausreicht, sich auf hohe Exportraten zu verlassen. Es kommt darauf an, wie diese Exporte zusammengesetzt sind, wie viel deutsche Wertschöpfung sie enthalten und wie nachhaltig die jeweiligen Exporte sind. Diese können ganz schnell einbrechen, wenn sich die Verhältnisse in den Abnehmerländern ändern – durch Währungsschwankungen etwa oder wenn diese Länder ein spezifisches eigenes Knowhow entwickeln. Hier nur zum Vergleich das Thema Handyentwicklung: Ein deutscher Entwickler arbeitet 1600 Stunden im Jahr und kostet 90 Euro pro Stunde. Ein chinesischer Entwickler arbeitet 2600 Stunden im Jahr und kostet 15 Euro die Stunde. Es gibt zahlreiche dieser Beispiele. Mehr darüber bei These 20.
Ich nehme solche Briefe ernst. Sie zeigen mir, dass der wirtschaftliche Sachverstand bei vielen Politikern, bei zahlreichen Lehrern und in großen Teilen der Bevölkerung fehlt; selbst bei manchem Unternehmer. Deshalb fordere ich, schon in Schulen den Jugendlichen die Grundzüge wirtschaftlichen Denkens beizubringen. Viele Lehrer haben keine konkreten Vorstellungen vom Wirtschaftsleben, aber häufig tiefsitzende Vorurteile. Es ist nicht so, dass sich die Schulen überhaupt nicht mit Wirtschaftsdingen beschäftigen würden, aber oft sind sie dabei so sehr auf Einzelaspekte ausgerichtet, dass das bestimmt keinen besonders prägenden Eindruck hinterlässt. Hinzu kommt: In keinem Unternehmen zählt die fachliche Qualifikation so wenig wie bei der Besetzung von Ministerämtern. Natürlich braucht man die Erfahrung einer politischen Karriere – aber fachliche Qualifikation tut für die Ausübung eines Ministeramtes gewiss auch gut.
Ein anderer Missstand: Auch im Bundestag sitzen viel zu wenig Leute, die jemals in der freien Wirtschaft ihr Geld verdient haben, geschweige denn ein Unternehmen führten. Wie sollen wir dabei Entscheidungen erwarten, die wirtschaftlichen Sachverstand beweisen? Essenziell bedeutet regieren führen, wirtschaften – und haushalten!
Ist der wirtschaftliche Spitzenplatz Deutschlands verloren, der weitere Abstieg unaufhaltsam, oder gibt es einen Ausweg?
Das ist auch eine Frage der Mentalität. Die Allensbach-Umfrage macht Hoffnung: Der Aussage »Jeder ist seines Glückes Schmied« stimmen 52 Prozent der unter 30-Jährigen in Ostdeutschland zu, in den alten Bundesländern mehr als 40 Prozent der gesamten Bevölkerung. Allensbach kommt zu dem Schluss: »Hier wird eine überraschende Energie, ein überraschendes Selbstbewusstsein in einer jungen Generation spürbar, die in der Öffentlichkeit oft vorschnell als perspektivlos abgestempelt wird. […] man kann annehmen, dass eine solche Neuorientierung der jungen Generation das öffentliche Klima in den neuen Bundesländern zukünftig zunehmend bestimmen und längerfristig auch in Westdeutschland weiteren Raum gewinnen wird.« Was wir brauchen, ist eine Kultur der Freiheit, Selbstverantwortung und Risikobereitschaft. Zur Freiheit gehört, Initiative zu entfalten, mit guten Angeboten Geld zu verdienen, Arbeitsplätze zu schaffen und das Land nach vorn zu bringen.
Eines unserer Kernprobleme ist, dass wir zehn Jahre lang nur wenig mehr als ein Prozent im Jahr im Durchschnitt gewachsen sind und in manchen Jahren weniger. Wenn es uns gelänge, wieder auf Wachstumsraten von drei Prozent zu kommen und mehr, dann würde sich manches unserer momentanen Probleme von selbst lösen. Dann ließe sich auch wieder mehr Wohlstand entwickeln, ließen sich teure Sozialsysteme viel leichter finanzieren. Wachstum ist dafür ein Schlüsselbegriff.
2 Freiheit wagen, Verantwortung tragen
Zwei Seiten einer Medaille
Freiheit und Verantwortung gehören zusammen – das eine geht nicht ohne das andere. Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt, sagte Rosa Luxemburg. Diese Grenzen wahrzunehmen und zu respektieren, dazu gehört ein ausgeprägtes Verantwortungsgefühl. Dieses Verantwortungsgefühl für unser Staatswesen vermisse ich häufig bei wichtigen gesellschaftlichen Gruppen.
Stattdessen erleben wir viel Populismus und wenig Wahrhaftigkeit. Jeder thematisiert überwiegend die Wünsche seiner Klientel. Es ist häufig fatal, wie von zahlreichen gesellschaftlichen Gruppen bekannte Fakten ignoriert werden, nur um die eigene Klientel mit Partikularinteressen zu bedienen. Denn nur dieses Verhalten garantiert scheinbar den eigenen Erfolg und Machterhalt. Wir finden dieses Verhalten in allen gesellschaftlichen Gruppen: ob in Politik, Parteien, Gewerkschaften, Medien, Wirtschaft, sogar Kirchen. Der am gesellschaftlichen Leben unbeteiligte Bürger hat es schwer, sich umfassend zu informieren und ein klares Bild von der Realität zu erhalten. Dementsprechend erhascht er oft nur einen Zipfel der Wahrheit und muss sich ein eigenes Urteil bilden. Doch dazu bedarf es eines sicheren Urteilsvermögens.
Eine Frau wie die stellvertretende DGB-Vorsitzende Ursula Engelen-Kefer zum Beispiel, die stets mit schriller Stimme vehement für die Rechte der Arbeitnehmer und der »sozial Schwachen« eintritt, ist von Hause aus Volkswirtin. Sie müsste also Einblick in wirtschaftliche Zusammenhänge haben. Ich habe aber den Eindruck, sie schert sich nicht darum, weil sie es nicht als ihre Aufgabe ansieht, zu überlegen, woher das Geld kommt, das verteilt werden soll. Sie fühlt sich offensichtlich vorrangig für die Verteilung zuständig und nicht dafür, wie das Geld verdient wird. Sie stand aber auch nie – ebensowenig wie die meisten ihrer Gewerkschaftskollegen – in der Verantwortung für ein Unternehmen. Da ist es ein Leichtes, Forderungen zu stellen, die mit der Realität kollidieren.
Auch uns Unternehmern wird häufig der Vorwurf gemacht, wir verträten einseitig nur unsere eigenen Interessen. Doch der Vergleich hinkt. Im Gegensatz zu Frau Engelen-Kefer und ihren Gewerkschaftskollegen schaffen Unternehmer immerhin Arbeitsplätze. Mag das Eigeninteresse noch so groß sein, es paart sich mit dem gesellschaftlichen Interesse, möglichst vielen Menschen Beschäftigung zu bieten. Diese Menschen, die Mitarbeiter, sind das kostbarste Kapital eines Unternehmens. Ohne qualifizierte, leistungsbereite Mitarbeiter kann ein Unternehmer sein Unternehmen nicht führen. Es ist eine Gemeinschaftsaufgabe, in der der Unternehmer auch eine gewisse Fürsorgepflicht hat. Er muss sein Unternehmen umsichtig führen, damit es seinen Mitarbeitern und ihm gut geht. In guten Zeiten wird er seine Mitarbeiter gut bezahlen, in schlechten Zeiten wird der glaubwürdige Unternehmer von den Mitarbeitern auch Opfer verlangen können. Besser vorübergehend Lohneinbußen in Kauf nehmen als den Arbeitsplatz verlieren. Die große Mehrzahl der Unternehmer ist sich der Verantwortung bewusst.
Ich würde mir für alle gesellschaftlichen Gruppen ein Verantwortungsethos wünschen. Deutschland krankt an einer substanziellen Verantwortungs- und Vertrauenskrise. Deshalb fordere ich die Verantwortlichen in Regierung und Opposition in persönlichen Gesprächen und öffentlich Mal um Mal auf: Setzt auf eine Kooperation der Verantwortung, wartet nicht bis zur nächsten Bundestagswahl!
Jedes Volk hat die Politiker, die es verdient, heißt es. Haben wir unsere Politiker wirklich verdient?
Die Politik steckt in einer Glaubwürdigkeitskrise. Die absinkende Wahlbeteiligung der letzten Jahre offenbart diesen Mangel. Viele Menschen fühlen sich von den Politikern im Stich gelassen. Manfred Güllner, Chef des Berliner Meinungsforschungsinstitutes Forsa, spricht für viele, wenn er diagnostiziert: »Die Leute haben das Gefühl, die Politiker rangeln nur um Macht und scheren sich zu wenig um die Interessen der Mitbürger.«
Ich fordere mehr Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit. Die Karten auf den Tisch legen. Dem Volk die Wahrheit sagen. Nicht immer nur an Einzelbaustellen herumlavieren und flicken, sich von einer Wahl zur nächsten hangeln. Auch mal zugeben, dass man sich geirrt oder Fehler gemacht hat. Das würde ihre Glaubwürdigkeit stützen.
Hier nur einige Negativbeispiele aus der jüngsten Zeit:
Wie glaubwürdig sind Politiker der Opposition, die einerseits den Hartz-IV-Beschlüssen zustimmten, nachher aber dagegen demonstrierten – nur weil eine Wahl bevorstand?
Wie glaubwürdig ist ein Bundestagspräsident Thierse, dessen Partei die Reformen beschlossen hatte und der trotzdem großes Verständnis für die Demonstranten äußerte?
Oder der SPD-Linke Ottmar Schreiner, der von seiner Regierung verlangt, die Kürzungen von Sozialleistungen zurückzunehmen?
Reformen wie »Hartz IV« sind notwendig – und es ist gut, dass die Regierung Schröder sie angepackt hat. Sie widersprechen allerdings so gut wie allen SPD-Versprechen aus der Wahl von 2002. Auch so ist die Wut der Bürger zu erklären. Woran sollen sie sich orientieren, wenn heute so und morgen anders gesprochen wird?
Wie viel Heuchelei der verschiedensten Gruppen konnte die Öffentlichkeit im Zusammenhang mit der Hartz-IV-Reform erleben! Von der »Arbeitslosen-Empörungsindustrie« und den gut entlohnten »Betroffenheits-Protagonisten« sprachen einige Medien, als Politiker quer durch die Parteien, Mitarbeiter der Arbeiterwohlfahrt sowie Gewerkschafter für die Januar-Auszahlung des neuen Arbeitslosengeldes II kämpften. Frank Bsirske, Chef der Gewerkschaft ver.di, schäumte: »Es kann ja wohl nicht sein, dass es beim Übergang von Arbeitslosenhilfe zum Arbeitslosengeld II einen Monat lang überhaupt kein Geld gibt.« Nein, so war das auch nicht geplant. Es ging letztlich um eine Differenz von wenigen Tagen.
Angesichts der inszenierten Proteste gab die Bundesregierung nach. Bundeskanzler Schröder verlangte Nachbesserungen, vermutlich wegen der anstehenden Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und an der Saar. Die Auszahlung des Arbeitslosengeldes II Anfang Januar 2005 kostet 1,2 Milliarden Euro, die zuvor nicht eingeplant waren. Der Betrag wird voraussichtlich über weitere Schulden finanziert werden müssen.
Auch der Vorschlag des SPD-Politikers Sigmar Gabriel, die bereits beschlossene Absenkung des Spitzensteuersatzes von 45 auf 42 Prozent zu streichen, zeugt nicht von Mut zur Verantwortung, sondern von Populismus. Die Absenkung ist der letzte Teil der Steuerreform und soll 2005 in Kraft treten.
Heute hü, morgen hott. Wirkt dieses Verhalten vertrauenerweckend auf die Bürger? Ich denke, es verunsichert, weil es wankelmütig wirkt. Handwerkliche Fehler bei der Abfassung von Gesetzen können passieren. Sollte man jedoch nicht erst nach einer »Probezeit« Korrekturen anbringen? Die so häufig zitierte »Politik der ruhigen Hand«– in diesen Fällen wäre sie angebracht und würde für mehr Glaubwürdigkeit sorgen.
Was soll man dazu sagen, wenn während der Hartz-IV-Debatte die Arbeitlosenverbände öffentlich den 500 000 Langzeitarbeitslosen, die ab 1. Januar kein Geld mehr bekommen – weil der Partner zu viel verdient – rieten, doch eine Ich-AG zu gründen. Wer sich selbstständig macht, bekommt bis zu 600 Euro Förderung im Monat. Mit anderen Worten: Wir zeigen euch Wege, wie ihr doch noch Geld vom Staat bekommen könnt.
Oder was sollen wir von solchen Ratgebern halten, die den Sozialhilfeempfängern öffentlich rieten, Vermögenswerte auf Angehörige zu übertragen, damit man vor den Sozialkassen »bedürftig« erscheint? Zeigt sich so verantwortungsbewusstes Handeln?
Ich wünsche mir Verbandschefs, Kirchenmänner und andere Vertreter gesellschaftlicher Gruppen, die den Menschen beibringen, den Staat nicht auszubeuten. Ich wünsche mir Politiker, die den Menschen ehrlich sagen: Wir müssen runter von unserer Wohlstandsarroganz. Hinter den Grenzen unseres Landes leben viele Menschen, die für wesentlich weniger Geld gleiche Arbeit leisten. Mit ihnen müssen wir konkurrieren. Wir müssen besser und schneller sein und dürfen nicht viel teurer sein. Dafür müssen wir mehr und effizienter arbeiten – auch mal ohne Lohnerhöhung und sicher mit längeren Arbeitszeiten.
Kurz: Wir müssen uns mehr anstrengen und unsere Ansprüche an den Staat reduzieren. Wir müssen Härten ertragen, damit hinterher wieder die Sonne scheint. Wir werden alles Menschenmögliche tun, dass wir dieses Tal schnell passieren – wenn ihr alle mitgeht.
Ich habe die Hoffnung, dass es inzwischen in Deutschland so weit ist, dass die Bürger solche Botschaften akzeptieren können. Vor allem, wenn man ihnen auch begreiflich macht, dass wir die Verantwortung nicht nur für uns tragen, sondern auch für unsere Kinder und Kindeskinder. Ich glaube, dass die Menschen draußen im Lande ein gutes Gespür dafür haben, wenn es jemand ehrlich meint.
Zudem beobachte ich ein nachhaltiges Verständigungsproblem in Deutschland. Wir leiden offensichtlich unter einer gestörten Kommunikation. Haben die Vertreter der gesellschaftlichen Gruppen noch Bürgernähe? Realisieren sie, welche Sorgen den »kleinen Mann« bedrücken? Sind nicht viele von ihnen »betriebsblind« durch das tägliche Geschäft? Oft benutzen sie bestimmte Vokabeln, die nebulös wirken, den Menschen Sand in die Augen streuen sollen. Sie sprechen von »Sozialumbau«, statt ehrlicherweise zu sagen: Wir müssen einen »Sozialabbau« vornehmen, weil wir kein Geld mehr in den Kassen haben. »Reform« ist ebenfalls ein strapaziertes Unwort.
Ich denke, man sollte den Menschen viel mehr erklären. Wenn 76 Prozent der Menschen in der Bundesrepublik nach Bekanntgabe der Hartz-IV-Gesetzgebung der Meinung waren, die Demonstrationen dagegen seien berechtigt, dann zeigt dies ganz deutlich, dass hier eine Wahrnehmungs- und Informationslücke besteht. Auch wenn es noch so schwierig ist – diese Lücke muss besser und früher gefüllt werden – von der Politik, von der Wirtschaft und von den Medien.
Ich verstehe, dass Verteilungspolitik viel populärer zu verkaufen ist als prozessorientierte Politik. Wachstumspolitik ist Prozesspolitik. Das heißt, ich muss heute etwas tun und ernte die Früchte erst in zwei, drei, vier, fünf Jahren. Dabei ist der Grundzusammenhang eigentlich einfach. Es lässt sich nur verteilen, was zuvor erwirtschaftet wurde. Vielen Bürgern das begreiflich zu machen, ist offenbar viel schwieriger, als wenn der Staat zehn Milliarden Euro in die Wirtschaft pumpt und Erwartungen weckt. Jedenfalls glauben das die Heilsbringer per Schulden von Bsirske bis Lafontaine. Das ist ja auch populärer als die unbequeme Wahrheit.
Richtig wäre es, dass die Politiker den Bürgern sagen, unsere Aufgabe ist es, für Rahmenbedingungen zu sorgen, damit ihr Menschen euch entfalten könnt. Und damit ihr euch möglichst so entfaltet, dass wir alle dabei reicher werden. Ob der eine dabei reicher wird als der andere, ist völlig sekundär. Dann haben wir als Staat auch Geld zum Verteilen und können den wirklich Bedürftigen so helfen, wie es nötig ist. Aber das wirkt nicht von heute auf morgen, und deshalb müssen wir auch einige Durststrecken in Kauf nehmen. Wir müssen eben den einen oder anderen Zopf abschneiden, an den wir uns gewöhnt haben.





























