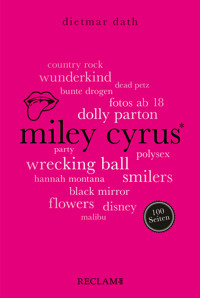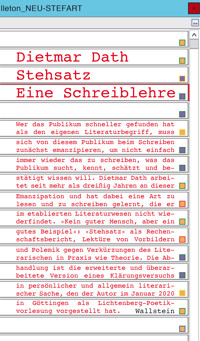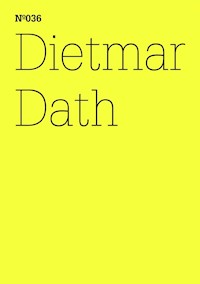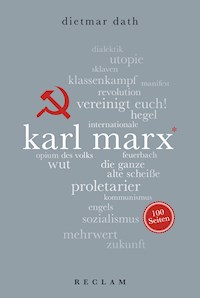Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verbrecher Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
"Für immer in Honig" ist ein historischer Roman über Dinge, die nie passiert sind und nicht passieren werden. Er erklärt alles, was in der Zeitung steht und im Fernsehen kommt und handelt von Leuten, die sehr viel wissen und trotzdem alles falsch machen. Die Geschichte umfasst mehrere Jahrzehnte, in denen Deutschland vor die Hunde geht und die Beziehungen der Vereinigten Staaten von Amerika zum Rest der Welt sich verschlechtern, während die Toten ins Leben zurückkehren, die Wissenschaft Fortschritte eher seitwärts als nach vorne macht und die Popmusik sich nicht gerade verbessert. Das Buch enthält ausreichend Liebe, Gewalt und wichtige Enthüllungen über brennende Zeitprobleme, so dass man die rund tausend Seiten trotz Studium oder Berufsleben relativ rasch runterlesen kann und danach bald wieder Zeit für neue Romane, CDs und DVDs hat. Die verhandelten Themen sind unter anderem: Pädophilie, Hillary Clinton, Wölfe, Molekulargenetik, die NATO, die Schulden der Dritten Welt, süddeutsche Provinznester, Schnee, Nazis, Islamismus, Ehebruch, Berlin, Videokunst, Poststrukturalismus, Messer, haitianische Küche, Fernsehen, moderne Krankheiten, Pinguine, Frankfurt, Wladimir Putin und Ohrstöpsel aus Schaumstoff.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1700
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DIETMAR DATH
FÜR IMMER IN HONIG
Für Alexander Grothendieck und das fragliche Mädchen
Die Menschen, Ereignisse und großen historischen Züge in diesem Buch sind frei erfunden. Firmen, Personen der Zeitgeschichte und andere aus den Nachrichten, dem Feuilleton oder akademischen Zusammenhängen bekannte Einzelwesen verhalten sich nicht so, wie hier geschildert, haben das nie getan und werden das auch in Zukunft bestimmt nicht tun. Eine Wirtschaftsordnung, wie der Roman sie skizziert, wäre nicht lebensfähig, politische Entscheidungsträger und Gelehrte, die den hier beschriebenen glichen, wären verrückt und gemeingefährlich. Ähnlichkeiten mit dem, was tatsächlich der Fall ist, sind also zufällig und eigentlich eher unwahrscheinlich. Es ist alles in Ordnung, es gibtnichts zu sehen, bitte nicht stehenbleiben, schön weitergehen.
Einige Personen der Handlung
(verschiedene Namen bezeichnen nicht zwingend verschiedene Menschen)
Beate »Bea« Eich:Kunstbuchlektorin
Fred Jochen »Freddy« Schörs:Buchhändler
Ianthe:böse Feindin
Matjasewitsch:Bote
Valerie Thiel:Schöninchen, später Messerfrau
Margarete Thiel:Mutter, tot oder lebendig
Peter Thiel:Vater, Mörder
Christina:befreundet mit Valerie
Sarah:auch befreundet mit Valerie
Torsten Herbst:nicht mehr zusammen mit Valerie
Philip Klatt:Alkoholiker und Mathematiker
Astrid Riedler:Rechtsradikale
Schacko:kleiner Dealer
Alfred:ein Schulrektor
Michaela Klatt:Philips Exfrau
Peter:vielseitiger Kleinkrimineller
Robert Rolf:Journalist und Schriftsteller
Judith Neumann:Roberts Freundin
Ileana:befreundet mit Judith
Rainer »Der Dokter« Utzer:Vollzeitfaschist
Klaus Utzer:Rainers Bruder
Joachim Behnke:Mitläufer
Gina Weil:dumme Kuh
Schorsch:Neonazi
Bernd:noch ein Neonazi
Frau Flasch:ehemalige Mathematiklehrerin
Karl:Verleger
Jochen:ebenfalls Verleger
Isabella Ackermann:Jugendbetreuerin
Jennifer Brunner:bestinformierter Mensch der Welt
Michael »Michi« Beer:Popmusiker
Vitus Wendlein:auch Popmusiker
Patrick Baumann:Ex-Musikzeitschriftenchef
Der Hausmeister:ein Kuriosum
Hillary Rodham Clinton:Senatorin
William Jefferson Clinton:Schlingel
Iyari »Chica«:aus Las Vegas
Madeleine Albright:Ex-Ministerin
Bettina:Robert Rolfs Ehefrau
Dieter Fuchs:Kunstexperte
Stefanie Mehring:Fuchsens Frau
Anselm:Kunstunterstützer
Zetta:eine Verwahrloste
Teufel:ein Verwahrloster
Julia / »Fette«:mag Junk Food
Andreas »Andy« Witter:Punkrocker
Der Bürgermeister von Sonnenthal:Zombotiker
General Christof Reuland:Bonapartist
Der Mecklenburger:Reulands rechte Hand
Wladimir Putin:Russe
Skriba:Gastwirt
Machmud Abdullajew:Unterhändler
Yakov:Söldner
Jamal:Palästinenser
Jim Corbett:ehemaliger Agent
Karin Lay:ehemalige Wissenschaftlerin
Simon:Karins erster Sohn
John:Karins zweiter Sohn
Aeryn:Karins Tochter
W Sinja:eine Diaphane
W Rod:Widerstandskämpfer
W Bela:erst recht Widerstandskämpfer
Carl von Ranke:reicher Mann
Jeanne Alber:reiche Frau
Dr. Rock:Praktiker
W Jerry Cornelius:Berühmtheit aus England
W Catherine Cornelius:noch eine Berühmtheit aus England
W Una Persson:Berühmtheit aus Skandinavien
Vijay Prashad:Revolutionär
Mister Cohn:guter Nachbar
Miß Rosenberg:Biographin
Lena Dieringshofen:klügste Frau der Welt
Mark Dieringshofen:Lenas Mann
Eugen Leviné:kommunistischer Gelehrter
Jürgen:Denker
Jacques:zweiter Denker
Colin Kreuzer:Auswanderer
Denise Ehrke:Vertraute Kreuzers
General Jabotinsky:Schusselchen
Miri Eisin:Veteranin
F-4-10-7-100-95:Haftopfer
Toussaint L’Ouverture:Rebell
Franz Rosenzweig:Mystiker
Roland Koch:Kanzler
Klemens August Braun:Theoretiker
Cordula Späth:Musikantin
Das flinke Scheusal:Taktiker
Johanna Rauch:Psychologin
Elizabeth Anne Summers:Facharbeiterin
PROLOG
Erste Minidisc-Aufnahme
F: Was ich dich fragen wollte: Wie kommst du eigentlich klar jetzt, mit der Hand, nachdem Ianthe dir die Finger …
J: Mach das lauter! Lauter!
F: Was?
J: Das Scheißradio, Mensch! Mach das sofort lauter, ich muß auf den Verkehr gucken!
F: So? Reicht das?
R: … of the bluebird as she sings … (Rauschen) … six o’clock alarm would never ring …
J: Ich liebe das, diese Version ist so wunderschön …
F: Was is’n das?
J: »Daydream believer«, in der Fassung von Mary Beth Maziarz. Hör dir das an, nur mit Klavier und … oh Mann …
R:Cheer up sleepy Jean / oh what can it mean / to a daydream believer / and a homecoming queen …
F: Stimmt, das ist wirklich … das ist toll.
J: Ja, nicht? Es läuft einem kalt den Rücken runter, pardon the cliché.
F: Von wem ist eigentlich das Original?
J: Wie, weißt du nicht? Das waren die Monkees.
F: Echt? Diese Retortenband?
J: Ach, du hast doch keine Ahnung, du Idiot, die waren äußerst bedeutend, diese Monkees. Das hier ist eine völlig gerechtfertigte Ehrenbezeugung. Die Version ist nur deshalb so klasse, weil schon das Originalmaterial extrem sublim war. Auf der »Birds, Bees and Monkees« ist das drauf.
F: Aber hat denn …
J: Schnauze!
R: And our good times start and end / without dollar one to spend / how much baby do we really need?
J: Herrlich. Allein die Phrasierung … sagenhaft.
(Pause, man hört eine Weile lang nur die Musik. Dann ist sie fertig, das Radio wird leiser gedreht.)
F: Du hast recht. Das ist richtig unheimlich, wie schön das ist. Ein Abgesang auf Erhabenes. Wehmut ist Hoffnung und umgekehrt, ganzeigen.
J: Aufs amerikanische Jahrhundert, würde ich sagen. Und ich muß es wissen, ich war dabei. Ganz vorne, teilweise.
F: Und du kommst klar? Mit der linken Hand, wo jetzt die beiden Finger fehlen?
J: Klar. Ich brauch’ sie nicht mal zum Wichsen, weißt du. Außerdem habe ich ja dich dabei.
F: Vielen Dank.
J: And a homecoming queen.
F: Wo sind wir denn eigentlich?
J: Wir sind schon fast in Frankfurt. Schau mal, der Mond!
EINS: OBJEKTE
oder Wo wir alle herkommen und wie man nicht kämpft
ERSTES KAPITEL
Hab’ ein Gesicht, das ich nicht zeigen kann • Gründe und Anlässe • Beate Eich zieht um • Eine Rennerei
1 Bis Freddy kam, saß Beate häufig nachts allein da, teuer angezogen, in einer Bar, mit dem Alkohol.
Niemand traute sich, sie anzusprechen. Ihr kam das ganz richtig vor: Sehr wenige Frauen in ihrem Beruf hatten einen. Oder eine. Oder überhaupt was, außer diesen Beruf, und entsprechend viel Geld sowie Kram, den man sich dafür kaufen konnte. Mit einem leicht vermuffelten Anflug von Wehmut dachte sie manchmal an ihren schönen Tisch, damals, als sie anderthalb Jahre in Amerika gelebt hatte, weil da die Geschäfte besser gingen: Glasplatte auf Bronze, acht Gäste hätten drum herum gepaßt, Silas Seandel Studio, 551-3 West 22nd Street, New York,NY10011. Schön war der gewesen, wie die Woodmode-Küche mit den dunklen, duftenden Schränken, der Ahornschreibtisch im Arbeitszimmer, die körperangepaßte Techno-Scout-Matratze, der riesige schwarze Flachbildschirmfernseher, die Waverly-Tapeten, die Andrew-Marc-Ledersachen, die meistens an der Garderobe im Flur hingen, weil sie so was kaum anzog.
»Scheiße, ich hatte sogar ein Tigerfell vor dem Sofa. Wahnsinn«, flüsterte sie, und lächelte, weil ihr gefiel, daß nichts davon geblieben war. Je vergänglicher der Reichtum, desto reicher fühlt er sich im Rückblick an. Wann werden wir frei sein?
Hinter den schönen Farben der teuren Alkoholika sah der Zustand, in dem sie sich inzwischen befand, das Leben in Bars, die Erinnerungen an ein Luxusleben, das gerade mal drei Jahre zurücklag, würdig aus, melancholisch, auf jeden Fall selbstgewählt: Ach Gott, fühle ich mich wieder höllisch alt heute abend. Da kann ich dann nachher in der Wohnung wieder weinen, still für mich und schön, Tränen der Wut wahrscheinlich, ich muß mich nicht schämen. Hätte ich einen, oder eine, oder überhaupt was, außer diesen Beruf, könnte ich meinem Lebensabschnittsgehilfen, meiner Daseinsbegleiterin, irgendeinem Kind undKegel sowieso nicht erklären, worum es geht. Niemand wäre starkgenug, mit mir meinen Verrat zu tragen.
Nichts ist wahr und nichts ist richtig, also bin ich heute nacht allein. Außerdem habe ich schon mit siebzehn mit zwei Typen gleichzeitig gevögelt. Ein junger Exzeß prägt fürs Leben, besser kommt’s nicht mehr, da kann man später ruhig mal abstinent beziehungsweise einsam sein. Er oder sie würde sowieso nur versuchen, mich zu ändern, und das geht gar nicht. Ich habe ein Gesicht, das ich ihm oder ihr nie zeigen könnte, ich muß die Regeln selber machen, während ich mich durchwurstle, also bitte, mir ist es eigentlich egal, ich schlage mit Fäusten auf die Geschichte ein, um es ihr zurückzuzahlen.
So dachte sie. Dazu konnte sie Teures trinken; manchmal war das an die hundert Jahre alt.
Dann kam Freddy.
Fred Jochen Schörs, den sogar seine Eltern Freddy nannten, seit er sich Ende der Achtziger beim Queen-Sänger Mercury den Oberlippenbart abgeguckt hatte, war ein absurd gutaussehender Mann. Er hätte nicht schön sein sollen: Wer sich die schwarzen Haare so ölig nach hinten gelt, wer sich solche Hemden anzieht, wer ein so markant knochiges Gesicht mit so deutlich eingekerbten Wangen spazierenführt und die engstmöglichen schwarzen Jeans zu taubenweißen Adidas-Turnschuhen trägt, als wären Fleetwood Mac,REOSpeedwagon und Foreigner immer noch die Herrscher des Morgenradios, den dürfte Anfang des neuen Jahrtausends niemand schön finden, schon gar keine Frau wie Beate.
Und doch: Ein romantischer junger Heldendarsteller war das, den Friedrich Schiller rollengerechter nicht bei Amazon.com hätte bestellen können. Seht her, der hier schlägt Drachen tot, wenn es sein muß, steht in der S-Bahn für alte Damen ab Dreißig auf und heuchelt bei Gedichtlesungen blasser, stotternder Lyrikerinnen aus Schtuttgart nochglaubwürdig Interesse, wenn den Lehrerinnen, Volkshochschulzwangsverpflichteten und Rentnern im Publikum längst das kochende Blut aus den Ohren tropft.
Es lag an den Augen. Blau waren die wie Wodka, den ein Engel auf jungfräuliches Eis geweint hat, blau wie die Unschuld selbst, vom Juwelier des Jenseits mit Tüchlein und Tinktur auf heiligen Glanz poliert, blau wie der himmelweite Friede Gottes, höher denn alle Vernunft.
Freddy Schörs lebte den Widerspruch zwischen seinen scheußlichen Klamotten und der Schönheit seiner Augen sowie seines Wesens mit entspanntem Understatement und heimlichem Elan. Schon kurz vor dem Abitur an einem erzbadischen Gymnasium beschloß er, einen Beruf zuergreifen, den man am allerwenigsten mit Leuten verbindet, die aussehen wie er: »Ich werde Buchhändler. Mit eigenem Laden. Die erste Adresse für Bücher, die … gut sind. Gute Bücher. Anstatt die ganzen schlechten. Die sollen sie mal schön woanders kaufen. Bei mir gibt es nur gute. So wird das.«
Abitur, Buchhändlerlehre (praktischer Teil: Katholische Buchhandlung Herder, Freiburg im Breisgau), Geld borgen (von der Bank und von seinem Vater, einem erfolgreichen Sportmediziner), los ging’s: Jetzt mache ich das einfach, dieses »ein erwachsener Mensch sein«. Das Niedlichste an diesem erwachsenen Menschen, fand Bea später, war wohl, daß er für das, was die meisten Leute »beknackt« oder »bescheuert« nannten, einen eigenen Ausdruck besaß, dem was Lautmalerisches anhaftete und dessen Herkunft er selbst nicht erklären konnte, eins dieser Wörter, die Kinder erfinden oder irgendwo falsch aufschnappen: »beschemselt«.
Beate Eich begegnete Freddy auf der beschemselten Frankfurter Buchmesse 2001.
Das war eine nicht besonders splendide, eher bedrückte Veranstaltung, die noch ganz im Zeichen des 11. September stand, überschattet von Milzbrandpostpanik und der Gruselhoffnung auf irgendeine sehenswerte Messekatastrophe. Das Hotel, an dessen Bar Freddy Schörs die Bekanntschaft von Beate machte, nannte sie, schon leicht angeheitert, mit einem destruktiven Glitzern im Blick, »prima mittelschäbig«.
Freddy erkannte sofort, daß er in Beate einen Menschen vor sich hatte, der fast noch unstimmiger schön war als er selbst: Gekleidet in einen grauen Wickelrock und eine brieftaubenweiße Bluse sowie die dazu passenden dunklen Strümpfe und blutroten Schuhe, erinnerte die Frau, die Freddy zutreffend auf Anfang Dreißig schätzte, mit ihrer Schmetterlingsbrille und dem roten, glatten, eigentlich schulterlangen, aber streng nach hinten gekämmten und dort mit einem Schildpatt-Steckkamm zusammengebundenen Haar, den flaschengrünen Augen und den ungeschminkt himbeerroten Lippen an gut drei Dutzend Rollen, die Jodie Foster in ihrem Leben gespielt hatte. Streng, dachte er, und Altertümern gegenüber sicher aufgeschlossen – Antiquitäten wie mir, dem vergessenen Sänger einer fast vergessenen Stadionband.
Was die wohl macht? Vertriebsleiterin eines archäologischen Fachverlages? Heidelberger Oberchefin einer rechtsextremen Studentenverbindung? Redakteurin bei der »Jungen Freiheit«? Lektorin für Jürgen Möllemann? Heimliche Geliebte Jörg Haiders, Organisatorin des ehrwürdigen öffentlichen Klagenfurter Wettfurzens?
Guten Tag, ich heiße Freddy Schörs, mein Laden heißt »Flaubert & dergl.«, führt nur gute Bücher und folglich keine von aufstrebenden zwölfjährigen Schnöseln, die über ihre zwei Wochen zurückliegende Kindheit poplustige Traktätchen im Stil evangelischer Jugendarbeit verfassen, ich habe noch nicht mal ein eigenes Auto und esse nur Salziges zum Frühstück. Wie also, um das jetzt also doch gleich mal ganz deutlich zu fragen, wäre es mit uns beiden? Aus der Box der bareigenen Quatschmusikanlage gab sich Sheryl Crow angemessen gelassen:
Pour a drink And I’ll pull the blind And I wonder what I’ll find
Nein, berichtigte Beate lachend, für Möllemann habe sie noch nicht gearbeitet. Vielmehr sei sie freischaffende Lektorin für verschiedene (nicht archäologische, aber doch) Kunst- und Bildbandverlage, und Sheryl Crow gefiele ihr auch ganz gut, die habe sie sogar mal live gesehen, in New York, Madison Square Garden, mit den Dixie Chicks und Eric Clapton als Gästen.
I have a face I cannot show Make the rules up as I go
Er erzählte ihr daraufhin, was er so trieb und warum er auf seine unvermeidliche Pleite einigermaßen gelassen wartete: »Ich will dabei vor allem lernen. Vielleicht mache ich danach einen Kleinverlag auf. Man muß seinen Ehrgeiz vor allem darauf richten, auf möglichst viele verschiedene Arten keinen Erfolg zu haben.«
He was high on intellectualism I’ve never been there but the brochure looks nice
Sie unterhielten sich sehr gut, zwei Stunden lang: Salman Rushdie, Sheryl Crow, Jill Sobule, Alison Krauss, Countrymusik allgemein, Jugendkriminalität, der 11. September, George W. Bush, Bill Clinton, New York, Parfüm, beschemseltes Zeug aus aller Welt.
Dann waren sie komplett betrunken und gingen zusammen auf seinZimmer. Dort zerknüllten und verwuschelten sie schön fleißig diefroschgrünen Laken und ihre Frisuren. Es war ein Anfang.
Hätte Freddy Schörs damals, während der ansonsten so stumpfsinnig-angstbeladenen Messe, außer den Literaturbeilagen der großenüberregionalen deutschen Tageszeitungen im Hotel beim Frühstück auch die regionalen Frankfurter Nachrichten studiert, wäre ihm vielleicht beiläufig, ohne daß er ihn erkannt hätte, der wahre, in der Tat berufliche, aberalles andere als kulturelle Grund für Beates Anwesenheit unter dieAugen gekommen. Zu seiner Ehre darf man aber sagen, daß er selbst im unwahrscheinlichen Fall, daß ihm irgendein Lektüredetail die richtigen Verbindungen zwischen den Tatsachen suggeriert und ihn also auf einen zutreffenden Gedanken darüber, womit Beate ihr Geld verdiente,gebracht hätte, weiterhin an ihr interessiert geblieben wäre. Wahrscheinlich wäre sie durch dergleichen sogar noch interessanter für ihn geworden. So tickte er nun mal,crazy little thing called love.
Die Idee einer einigermaßen vernünftigen, tragödienfreien Lebensplanung hatte ab dem Moment jener Bar-Begegnung im Zeichen der relaxten Sheryl aber nicht nur bei ihm, sondern bei allen beiden nichts mehr zu bestellen: Springen wir rein, auf geht’s.
2 Gründe und Anlässe: daß ich das immer verwechseln muß, dachte Beate später, als nichts mehr zu ändern war.
Sie hatte angenommen, daß ein möglicher, ja sogar ein klassischer Grund dafür, den Wohnsitz aufzugeben und mit dem Liebsten zusammenzuziehen, der sein konnte, daß man den Beruf, den man hatte, nicht unbedingt an dem Ort ausüben mußte, wo man bis dahin gewohnt hatte.
Weil bei ihr zu einer grundsätzlichen Mobilität dieser Art in letzter Zeit immer deutlicher hinzugekommen war, daß sie sich vor lauter Geld und Erfolgen gar nicht mehr recht sicher war, ob sie den blöden Beruf überhaupt viel länger ausüben wollte und es nicht vielleicht vorzog, sich mal ein halbes bis dreiviertel Jahr auf ihrem Giropolster auszuruhen, war die Sache im Prinzip schnell geklärt: Sie würde also zu Freddy ziehen, in sein kleines, winkliges, moosiges, seltsames Freiburg im Breisgau, und dort ihr Leben überdenken, das jetzt schon spektakuläre 28 Jahre gedauert hatte, was bei ihrem Beruf alles andere als selbstverständlich war. Sechs ihrer liebsten Kolleginnen und Kollegen aus der schönen, aber schweren Anfangszeit vermoderten in irgendwelchen Särgen auf irgendwelchen Friedhöfen, drei weitere wurden nie gefunden. Vielleicht, nahm sie an, konnte ihr Leben mindestens noch mal 28 Jahre dauern, vorausgesetzt, sie wechselte den Beruf.
Die dauernde Lügerei war jedenfalls schlecht für die Haut, verursachte vermutlich auch die lästige Migräne, über die Beate in letzter Zeit zu klagen hatte, störte ihren Schlaf, beschleunigte den Haarspliß. Man mußte, sagte sie sich, öfter zur Coiffeuse, und die wiederum ging ihr auf den Geist, wovon der Spliß nur noch schneller kam, ein Teufelskreis.
Gründe und Anlässe: Der wahre Grund dafür, daß sie zum Liebsten zog, hätte einfacher nicht sein können; der Liebste war halt der Liebste. Alles andere, also ob man außerdem bei Gelegenheit so eines Umzugs auch noch den Job wechseln, ein paar Gramm abnehmen, die Haare anders färben oder eine neue Religion auswendig lernen mochte, lief bei normalen Menschen unter »Anlässe«.
Wenn Bea Eich das klar gewesen wäre, bevor sie sich in den Intercity setzte, dann hätte das, was folgte, vermieden werden können. Vielleicht nämlich – skandalös revolutionäre Idee – hätte sie Freddy dann die Wahrheit sagen können, vielleicht hätte sie das sogar müssen. Zur Begründung dafür, daß sie das nicht tat, hatte sie sich etwas scheußlich Lahmes ausgedacht: Es ergab sich eben nie.
Etwa einmal alle anderthalb Monate war sie in den zwei Jahren der coolen Fernbeziehung in Freiburg gewesen; er selber kam in ähnlichem Rhythmus nach Berlin. Länger als vier Tage am Stück, von den zwei Urlaubsreisen abgesehen, sah man sich nie. Das bißchen gemeinsame Zeit also hatte Beate nie gereicht, eine große Lebensbeichte abzulegen, es gab so viel anderes, was in der Aufbauphase der Beziehung erledigt werden mußte: Wir lernen füreinander kochen, wir sitzen gemeinsam haarsträubend fürchterliche Filme aus, die der Partner mag, wir dürfen entzückt erkennen, daß dieser Partner die dumme Ausstellung, die uns langweilt, genauso greulich findet wie wir selber.
Ah: »Und Pimpern!« (Freddy)
Erst überhaupt sehr oft, dann auch mal zur Feier der allmählichen Abstimmung zweier Körper aufeinander (»Ohrenvergleich«, witzelte Freddy gern), und schließlich, sobald man es richtig raushatte, einfach deshalb, weil es gut war, wie Frühsommer als solcher, Pizza, die Sterne.
Das letzte halbe Jahr war Freddy ihr, obwohl sein kleiner Laden gerade endgültig in sich zusammenfiel, so glücklich vorgekommen, so lebendig und mutig, bei all der gemeinsamen Plänemacherei – allein die Wohnungsbesichtigungen im Winter und Frühjahr und die dazu hinführenden oder sich daran anschließenden Spaziergänge in Freiburg hatten ihn so aufgebaut, wo er doch gerade in so einer miesen beruflichen Lage rumkrauchte, also: Da hatte Beate es dannschließlich, obwohl jetzt endlich genug Zeit vorhanden schien, einfach nicht fertiggebracht, ihm zu eröffnen, womit sie ihr vieles Geld verdiente.
Eine Art Verschlossenheit, die sich mit häufiger Lachlust und ansonsten unkomplizierter Lebensart wundersamerweise vertrug, hatte er früh an ihr zu akzeptieren gelernt. Vielleicht, vermutete Bea – er redete darüber seinerseits nicht viel –, fand er die sogar attraktiv, der Schlumpf.
Im Abschotten war sie geübt. Das war schon auf der Schule so gewesen.
Ihr Deutsch- und Klassenlehrer von der Neunten bis zur Zehnten, Herr Schuback, hatte sie dafür auf Klassenfahrt mal hart angekantet: »Du kapselst dich von deinen Mitschülern ab, außer von diesen beiden Jungs, die sich aber auch abkapseln, das fällt mir auf, das ist kein gutes Zeichen.«
Abkapseln, leck mich, du Arschbart: Nur weil Beate keine Lust hatte, sich mit den traurigen Figuren näher zu befassen, die ihr ihre neuen Turnschuhe aus dem Umhängesack klauten, ihr wegen ihrer unverheirateten Mutter und deren exzentrischer Haarfarbenexperimente zwischen Blutorange und Zehnmarkscheinblau blöd auf dem Hof nachjuchzten oder in der Stadt, Samstagnacht, in der Kneipe, so taten, als ob sie Beate noch nie gesehen hätten … Was soll das denn, das kannvon mir aus alles im nächsten Krieg verbrennen, fand sie, schlimmgenug, daß ich sterblich bin.
Jetzt also noch einmal ein neues Leben, diesmal in Freiburg.
Berlin, das wußte sie, würde sie nicht vermissen – nicht mal in New York hatte sie erleben müssen, daß Leute mehrere Stationen weit kommentarlos und ohne Emotionsabsonderung in einem öffentlichen Nahverkehrsmittel stehen und sitzen, das strenger nach Pisse stinkt als die verkommensten Klos auf den übelsten Bahnhöfen.
New Yorker regen sich dann wenigstens auf, lautstark und, wie sagt man? Colorful. Die haben nämlich Soul.
Berlin? Mein lieber Schwan, diese Gestalten: Er, bärtig, Anfang Vierzig, geduckt, geprügelt in seiner untersetzt feindseligen Haltung, in Klamotten, wie sie den Pitbullhalter zieren, Stonewashed-Jeansjacke, Trainingshose, braune Halbschuhe, zu ihr, Karottenjeans und Kapuzenpulli unter Nappalederjacke: »Kannst ma nich imma allet Jeld abknöpfn, ick muß ma ooch ersma Jeld hol’n, vor dassick et ausjehm kann.«
Sie, giftig defensiv: »Ick ha’ Hunga jehabt, wennde Hunga hass, musse wat essn.«
»Nee, wennde Jeld hast, dannkannstewat essn. Und dit Jeld, dit is meins.«
Ein paar Fahrgäste schmunzelten; statt ihn zu würgen, sie zu treten.
3 Beates milde Misanthropie hatte mit den Jahren zu einer Art Aufmerksamkeits-Kurzsichtigkeit geführt: Besonders gerne beschäftigte sie sich mit ganz kleinen Sachen, die man sich, um sie richtig würdigen zu können, möglichst nahe vors Gesicht halten mußte, wie man, wenn man dachte wie sie, sich umgekehrt die meisten Menschen vom Leib hielt, weil man nicht von ihrem Treiben, ihren Meinungen und Zuständen gereizt werden wollte. Beate hatte schon als Jugendliche nie dicke Liebes- oder historische Romane mit viel Personal gelesen, sondern lieber kurze Aufsätze, Gedichte von Stefan George oder Brecht und philosophische Büchlein von vietnamesischen Intellektuellen, die in derDDRlebten. Sie zog Aphorismensammlungen jederzeit dicken Studien vor, mochte Insekten gern, aber hatte was gegen Pferde, und war sofort vonCDs begeistert, als die aufkamen, weil sie das feine Gegenteil der angeberischen Vinylplatten waren, die alle Mitglieder der unsympathischen Großfamilieordinary fuckin’ peopleeinander in der Schule vorführten, ausliehen, herumtrugen, in diesen protzigen Plattensammler-Knisterplastiktüten, nein danke.
Das kleine, das nahe Zeug, die Details: In ihrem Beruf kam ihr das Interesse daran natürlich sehr zugute. Mit dem kleinen, nahen Zeug aber fing auch der große, bald globale Ärger an, zu dem sich der Umzug nach Freiburg schließlich auswachsen sollte; damit nämlich, daß Beate just im Kleinsten plötzlich lauter Fehler machte.
Vielleicht lag das daran, daß durch die Verflechtung ihres Lebens mit dem des Freddy Schörs etwas angefangen hatte, dem man besser mit Weitsicht begegnete als mit der Lupe, und sie das zwar spürte, aber nicht riskieren wollte. Jedenfalls traten am Tag ihrer Reise vom alten zum neuen Wohnort fünf eher kleine, unscheinbare Mißgeschicke in Konjunktion und entfachten gemeinsam schweres Unheil.
Instrumente der Geschichte waren fünf alberne Winzgegenstände: ein Päckchen mit vier Walkmanbatterien, ein Paar orange Ohrstöpsel, ein Kühlschrankmagnet, eineEC-Karte und ein Schlüsselbund.
Die Walkmanbatterien – Philips PowerlifeXXLUltra AlkalineLR & AA/AM3, Mignon, eine typische Photoladen- und Bahnhofskioskmarke – hatte sie vor der Abreise zu kaufen vergessen, obwohl sie das bei Fernreisen sonst immer auf dem Plan hatte. Der Discman und dieCDs, die sie mitgenommen hatte, um die sechseinhalb Stunden Fahrt zu verkürzen und das Geplärr der Babys und das Gequatsche der Bewußtlosen an Bord nicht hören zu müssen, waren ohne Batterien unbrauchbar: der erste Fehler.
Die mandarinenschalenfarbenen Ohrstöpsel von Jill Miró Earwear (»exzellente Schalldämmung aus Weichschaum«) steckte sie sich also – der zweite Fehler – bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof Zoologischer Garten sofort in die Gehörgänge, um zwar mangels Musik vonCDs keine kurzweilige, aber doch eine leidlich ruhige Fahrt zu erleben. Den flachen Kühlschrankmagneten, ein kitschig-lustiges Herzchenmotiv aus dem Souvenirshop Friedrichstraße, unweit ihrer alten Wohnung, wo Freddy sechs- bis achtmal im Jahr Gast gewesen war, hatte sie – der dritte Fehler – in ihren Geldbeutel gesteckt, der während der Fahrt sicher in der Innentasche ihres weiten Mantels verstaut war. Sie wollte Freddy mit dem blöden Ding überraschen; er hatte nämlich, ganz wie Bea selber, eine große Schwäche für solchen Quatsch.
DieEC-Karte steckte jedoch – der vierte Fehler – ebenfalls im Geldbeutel, nämlich im vordersten der vier für dergleichen vorgesehenen Fächer und damit leider sehr nah an dem flachen Magnetspielzeug.
Der Schlüsselbund schließlich, unter anderem mit Haus- und Wohnungsschlüssel zum neuen Freiburger Apartment, den Freddy ihr,»symbolisch«, in einem kleinen Päckchen zwei Tage vorher nach Berlin geschickt hatte, klirrte und klimperte, von Beate ohrstöpselhalber gänzlich unbemerkt, seit Berlin in der rechten Hosentasche ihrer weitgeschnittenen Hose; da hätte sie – der fünfte Fehler – sie besser nicht hingetan.
Auf der schier endlosen Reise las Bea die aktuelle, zuverlässig öde Ausgabe derZEIT, eine schmale Biographie John F. Kennedys und fast alle in der einbändigen Fischer-Taschenbuch-Gesamtausgabe enthaltenen Gedichte von Gottfried Benn. Kurz vor Mannheim schlief sie ein.
Weil aber die Schaumstoffschalldämpfer in den Ohren längst zu maximalem Stopf-Volumen aufgequollen waren, hörte sie die Ansage der Einfahrt in den Freiburger Hauptbahnhof nicht und bekam nur durch Zufall, da ihr gerade die Glieder wehtaten, sie ihre Sitzlage in ihrem engen Großraumwagendoppelplatzwinkelchen deshalb veränderte und dabei aufwachte, beim verklebten Blinzelblick aus dem Fenster überhaupt mit, daß sie angekommen war.
Erschrocken arbeitete sie sich, schwankend und fluchend, in die Senkrechte hoch, griff ihr nicht besonders schweres Handgepäck von der Ablage über den Sitzen und zwängte sich vorbei an schwach protestierenden Leuten, die gerade einstiegen, aus dem Wagen. Das Rasseln, das sie dabei hörte, beachtete sie nicht, es war ja leise, gedämpft wegen der Ohrenstöpsel, die aus den Ohren zu nehmen sie in der Eile vergaß. Schon auf dem Bahnsteig wurde ihr klar, daß das, was da leise gerasselt hatte, die aus der Hosentasche fallenden Schlüssel gewesen waren. Sie ächzte, pulte sich die Stöpsel aus den Ohren und bemerkte erschrocken, daß sich die Zugtüren zu ihrer Linken soeben automatisch schlossen. So fuhr der Intercity ab, als Freddy, der Beate auf dem allmählich weniger überlaufenen Bahnsteig schon verwundert bis enttäuscht gesucht hatte, vor sie hintrat.
Der schöne Mann hielt ihr einen lächerlich großen Strauß gelberRosen unter die Nase und sagte: »Ich hab mir fast das Kreuz gebrochen, deine ganzen Kisten aus dem Umzugswagen in die Wohnung hochzuschleppen. Was hast du mir verschwiegen, deine wertvolle Steinkopf-Sammlung von den Osterinseln?«
Beate lächelte müde, schnupperte an den Rosen. Die rochen gut, mehr wie feurige kleine Tierchen als wie Pflanzen, Salamander vielleicht, oder Libellen.
Dann sagte sie: »Ich glaub’, mir ist grad mein Schlüssel weggefahren.«
»Hinterrücks?« fragte Freddy grinsend.
»Hinterrücks«, stimmte Bea zu, und hakte sich bei ihm unter.
»Ist ja voll beschemselt«, äußerte Freddy sein Mitgefühl und freute sich übers Unterhaken.
Sie wußte, was in den Kisten war, von denen er geredet hatte: Bücher hauptsächlich, schwere Bildbände, Kunstgeschichte und Kunst, von den Hethitern bis zu Jeff Wall. Das würde nicht nur ihm, wenn man’s zusammen auspackte, nicht nur ihren angeblichen Broterwerb plausibel machen, sondern war ihr auch wirklich lieb.
In der großen, hellen Wohnung zu Berlin war sie abends gern am Schreibtisch, im Sessel oder auf dem Bett gesessen und hatte sich langsam blätternd zerstreut.
Nichts, was ihn argwöhnisch hätte machen können, war mit diesen Kisten angekommen; ihr Arbeitszeug hatte sie drei Tage früher einem Vermittler anvertraut, das heißt einem Boten zwischen einigen ihrer Stammkunden und ihr selbst, im sicheren Gefühl, es so bald nicht zu brauchen: Ein halbes Jahr Abstand vom Job, der Entschluß war gefaßt.
Schlimm fanden beide das mit dem Schlüssel nicht.
Man wußte ja ziemlich sicher, wo er war, und würde sich sehr bald drum kümmern können: »Das Ding fährt nach Zürich weiter«, stellte Freddy fest, »und wenn ein Passagier es findet, gibt er’s sicher beim Schaffner ab. Tja, und der bringt es dann … die Bahn wird das Ding irgendwie aufheben, da kommt man schnell wieder ran.«
»Können wir für die Wohnung nicht auch einfach gleich morgen früh einen nachmachen lassen?«
»Tschoo … Weiß nicht … das ist ja so ’ne hochmoderne Schließanlage … wir haben zwei, die Hausverwaltung hat noch einen, und der Hausmeister, der kommt überall rein. Diese Buden da am Seepark sind halt Neubauten, da ist alles auf Sicherheit und Spitzenkomfort ge… ähm.«
»Gedreht?«
»Gemurkst. Ich glaub’, es bedeutet insgesamt weniger Ärger, wenn wir deine Schlüssel erst mal von der Bahn zurückzukriegen versuchen. Sonst muß man vielleicht das ganze Schlössersystem austauschen und bezahlen oder ich weiß nicht was.«
Beate zuckte mit den Schultern und sagte: »Ich hol’ mir gleich mal Geld und zahl’ uns das Taxi.« Die Bahnhofsvorhalle war laut, aber überschaubar. »Soll das heißen, du hältst mich für einen Hungerleider, nur weil ich im Moment wieder bei den Katholischen in der Gebetbuchabteilung jobbe und mein kleiner Laden zusammengeknickt ist?«
»Nee. Das soll heißen, daß ich im Moment kein Bargeld im Geldbeutel habe, und mir welches holen will. Paß bitte auf die Taschen auf, o.k.?«
Der Kartenschlitz desEC-Automaten der Reisebank nahm Beates Plastik nicht an.
Die Elektronik blockierte den ganzen Vorgang sogar schon, als sie es einen Fingernagel breit reingeschoben hatte. Beate seufzte: Reisebank, das bedeutet eh immer Ärger. Am Bahnhof Zoo hatte so ein Ding mal zwar die von ihr verlangten 50 € abgebucht, aber nicht ausgezahlt, woraufhin sie sich per Handy bei der auf einem Etikett am Kasten vermerkten Beschwerdenummer gemeldet und das beanstandet hatte. Die Frau am andern Ende der Verbindung hatte ihr gestreßt versichert, es wäre schon alles o.k., und tatsächlich wurde der Betrag auch nicht aus Beates Giroguthaben rausgesäbelt, aber die Karte war nach diesem Telefonat einen ganzen Tag lang gesperrt, bei allen anderen Automaten, telematisch, telepathisch oder was immer die Reisebank sonst auf Lager hatte: »Nicht möglich« oder »Ihre Zentrale ist im Moment nicht erreichbar, bitte versuchen Sie es später noch einmal«, sehr ärgerlich. Danach hatte Beate sich eigentlich vorgenommen gehabt, so bald nicht mehr die Hilfe dieses Kreditinstituts in Anspruch zu nehmen – auch wenn der Grund für die Sperre damals vielleicht der berechtigte gewesen war, auf diese Weise zu verhindern, daß jemand, der ihre Karte unrechtmäßig gebraucht und sich danach am Servicetelefon für sie ausgegeben hatte, größeren Schaden anrichten konnte.
Daß sie ihren Vorsatz jetzt verletzte, bereute sie sofort: toll, blockiert.
Jetzt wird wahrscheinlich wieder einen Tag lang nix gehen.
»Kein Geld. Kein Schlüssel. Ein neues Leben«, lachte sie, als sie zu Freddy und ihren beiden kleinen Koffern zurückkam. Es war nämlich eigentlich komisch, und damit er auch was zum Lachen hatte, schenkte sie ihrem Liebsten noch auf dem Bahnhof den kleinen Kühlschrankmagneten.
4 Beates neue gute Laune blieb ihr während der ersten Woche in Freiburg erhalten und beflügelte sie bei all ihren kleinen bis halbgroßen Unternehmungen: Bücher in die neuen Regale einsortieren, sich einrichten, spazieren, bei der Gelegenheit die Sicherheitslage der neuen Umgebung aus alter Berufsgewohnheit auskundschaften, abends auf Freddy warten, bis der von »den Katholischen« zurückkam und ihm die Tür öffnen, weil sie tagsüber den jetzt einzigen Schlüssel zur Wohnung benutzte, bis die Affäre ausgestanden war. Gleich am nächsten Morgen nach dem Schlüsselverlust ging Beate zum Service Point der Bahn, wo man ihr allerdings nicht besonders eifrig half.
Sie bekam nämlich bloß eine kleine Pappkarte mit dem Aufdruck einer Fundbüro-Nummer ausgehändigt, die tatsächlich anzurufen irgendein ganz unverhältnismäßiges Wuchergeld kosten sollte, das frech auf der Karte stand. Na gut: Sie rief tatsächlich an und beschrieb einer jeden Dialogschritt mit extremer Schläfrigkeit verschleppenden Auskunftsstimme geduldig den »verlorenen Gegenstand«, der, wie sie versuchte, dieser unwilligen Helferin einzuschärfen, nicht gestohlen, weil niemandem von Nutzen sein konnte – auf den zwei Plastiketiketten am Schlüsselbund stand nämlich nur »Haus« und »Wohnung«, also keinerlei Adresse.
»Sind Sie da ganz sicher, denn sonst besteht Einbruchgefahr, da müssen Sie die Polizei verständigen.«
Beate hätte fast lachen müssen: Daß ihr, in ihrem Beruf, noch mal jemand nahelegte, die Polizei auf sich aufmerksam zu machen, das war wirklich ein kleiner Höhepunkt. Am Ende teilte die Stumpfsinnige ihr mit, Bea sei infolge ihrer Ausführungen soeben eine Verlustnummer zugeteilt worden, und zwar folgende, bitte notieren.
Obwohl Beate nicht recht glauben konnte, daß es neben den beiden ihr einzig sinnvoll erscheinenden Alternativen a) »der Schlüssel ist spätestens bei der Reinigung am Zielbahnhof Zürich gefunden worden« und b) »der Schlüssel ist weg« noch etwas Drittes geben sollte, hörte sie sich zum Abschluß die Erläuterung an, daß es zweckmäßig sei, zumindest noch »drei, vier Tage lang« immer wieder das Bahnfundbüro anzurufen und die ihr zugeteilte Verlustnummer anzugeben – »das kann schon dauern, es ist kompliziert, wir haben in Zürich ja Schweizer Personal, das geht dann seinen Gang, bis das vielleicht dann zurückkommt zum Badischen Bahnhof in Basel, der unserer ist, oder aber es liegt schon dort, auf dem Fundbüro im Badischen Bahnhof, denn bevor der Zug über die Grenze fährt, schauen sie immer noch mal alle Sitzreihen durch, da kann es dann aber auch sein, daß die nicht gleich reagieren und wir erst warten müssen, bis die Verlustanzeige und das verlorene Ding einander finden, so… zu… sagen…«
»Schon gut. Nicht weinen. Ich ruf’ ja wieder an.«
Dies zunächst zum Schlüssel. Dann war da die Geldgeschichte: Beate hatte sich geirrt, als sie annahm, der fehlgeschlagene Buchungsversuch am Ankunftstag sei die Schuld der Reisebank gewesen. Als sie am nächsten Tag auch bei der Volks- und der Deutschen Bank in Freiburg mit ihrer Karte kein Glück hatte, dämmerte ihr allmählich, daß die Scherereien sich einer Beschädigung des Magnetstreifens verdankten.
Als das Wort »Magnetstreifen« erst einmal auf der Hirnrinde aufgeleuchtet war, erklärte sich der Rest von selbst: Das Geschenk für Freddy hatte mit seinem Magnetfeld ihren Zugriff aufs wichtigste ihrer diversen Konten, nämlich das Berliner Sparkassengiro, vorläufig beendet. Die Karte konnte sie wegschmeißen.
Freddy, abends, auf den zwei weißen Schafsfellen vor dem Fernseher, fand’s drollig, krümelte mit Chips und prustete, sich auf den Rücken drehend: »Tabula rasa, das ist ja geil. Wie in ›Fight Club‹, die Stelle, wo sie diese ganzen Videokassetten löschen, mit so einem Handmagneten. Destruktiv, nein, noch cooler: Selbstdestruktiv. Wittgenstein hat sein Geld wenigstens bloß verschenkt, als er den Rappel gekriegt hat. Aber du … du hast den Schlüssel zum Tresor rumgedreht und ins Klo geschmissen. Das ist Kunst, Bea. Kunst. Beschemselt, aber Kunst.«
Sie rümpfte die Nase und krabbelte mit den Fingern unter seinem Hemd auf der Brust rum: »Kein Wunder, daß deine Buchhandlung krepiert ist, wenn du immer alles gleich philosophisch siehst, du blödes Arschloch.«
»Ich blödes Arschloch, indeed«, stimmte Freddy gelassen zu, und dann ging es sofort um sehr viel wichtigere Knutschereien.
Beate blieb nichts übrig, als eine Sparkasse aufzusuchen, wo man ihr per sogenannter »Blitzgiro-Überweisung« bei Vorlage eines Personalausweises – es war der einzige der in ihrem Besitz befindlichen sechs verschiedenen, den sie in Freiburg zu benutzen vorhatte, hier wollte sie, anders als in Berlin, nur untereinemNamen auftreten – fürs erste wenigstens mal zweitausend Euro aus Berlin »kabelte«, wie der Freiburger Bankjunge sich überraschend altväterlich ausdrückte. Einen Antrag auf eine neueEC-Karte, versicherte ihr vertrauter Berliner Kundenberater Bea telefonisch, würde man ihr mit der Post schicken. Sobald sie den ausgefüllt zurücksandte, wäre alles Weitere dann eine Frage von wenigen Tagen, allerhöchstens zweieinhalb Wochen, dann würde sie ihre neue Karte im Briefkasten finden. Kleine Probleme, mittelgroße Lösungen.
So glaubte Beate in dieser ersten Woche ihres neuen Lebens, keinen Grund zur Unruhe zu haben.
Sie wußte nicht, daß die Schlüsselfahndung der Bahn keinen Erfolg haben konnte, weil eine alte berufliche Konkurrentin an jenem Tag der Fehler und Mißgeschicke mit ihr im selben Intercity gefahren war, sie nämlich beschattet hatte, um zu verifizieren, daß die Gehasste tatsächlich in den Süden umzog. Die Feindin, die während der ganzen Reise bloß zehn Meter hinter Beate, lediglich einen Waggon weiter, gelauert hatte, mit Sonnenbrille auf der Nase und blonder Perücke auf dem Kopf, war gelegentlich zum Schein aufs Klo gegangen, um dabei nach der lesenden, dann schlafenden Beate zu sehen, und stieg in Freiburg kurz nach ihr aus.
»Kurz nach«, das heißt: dicht hinter ihr.
Sie konnte ihr Glück kaum fassen, als Beate der Schlüsselbund aus der Hosentasche fiel.
Zwei Wochen, beschloß sie, wollte sie abwarten und Beates weiteres Verhalten, inklusive etwaiger Versuche, die Schlüssel wiederzubekommen, genau beobachten, bevor sie handelte.
Sie wollte nämlich sicher gehen, daß das mit dem Verlust der Schlüssel eine echte Panne, keine Falle war. Beates Abstecher zum Service Point, den die Feindin vom Zeitschriftenladen aus verfolgte, räumte in dieser Hinsicht zwar die meisten Zweifel aus. Aber sicher war sicher. Die Feindin hatte Zeit.
ZWEITES KAPITEL
Aus der Schachtel rauserzählt • In einem dunklen Wort • Unterwegs nach Sex
1 Valerie Thiel war hübsch wie ein Bild von Balthus, im Kopf recht fit und im übrigen von allen Seiten völlig fünfzehnjährig. Ich muß von ihr erzählen, sonst hat alles andere gar keinen Sinn.
Ich sitze zwischen schiefgegangenen Abbildungen, weiß gerade nicht, ob das jetzt eher »Funktionen« oder »Funktoren« sind – so etwas zu klären, fällt mehr in Philips Gebiet als in meines, ich hab’ mich mal fürchterlich blamiert dabei. An der Wand vor mir, soviel läßt sich erkennen, jagt ein prähistorisches, dickbäuchiges Männchen mit Pfeil und Bogen meinen Schatten, die beiden rennen immer im Kreis, Wand vor mir, Wand links von mir, Wand hinter mir, Wand rechts von mir, dann wieder Wand vor mir. Ich weiß gar nicht so genau, ob das Männchen wirklich den Schatten jagt oder nicht doch eher mein richtiges Selbst, das ich wirklich bin, während der Schatten dann umgekehrt in diesem Sessel sitzt, auf dessen weichen Armlehnen meine oder seine Hände und Ellenbogen ruhen, während ich mit Euch rede.
Egal: Ich nehme mal an, ich darf Euch Valerie Thiels Geschichte erzählen.
Ist, von Euch aus gesehen, schließlich auch nicht sinnloser, als demschwarzen Männchen dabei zusehen, wie es meinen Schatten odermeine Seele (ti bon ange– wie lange ist das eigentlich her, daß ich was darüber gelernt habe?) oder meinetwegen ganz allgemein »mich« jagt. Von mir aus gesehen aber, ich erwähnte es bereits, ist Valerie schon fast der ganze Sinn von letztlich allem.
Valerie Thiel war eine schöne Jugend in kargen Zeiten und wollte auch nichts weiter sein. Sie las gern Manga-Comics, und zwar, mit ihren eigenen Worten, »so nachgemachte aus Italien wie ›Witch‹ fast gleich gern wie die richtigen aus Japan«.
Ihre Eltern waren in Ordnung. Ein bißchen lebten sie allerdings hinterm Mond, ihre, wie soll man sagen: Elterndetektoren waren nichtjederzeit auf Empfang geschaltet und wenn doch, dann häufig auf der falschen Frequenz. Aber es gab selbstverständlich Schlimmeres, als derlei völlig durchschnittliche Eltern aushalten zu müssen, denen man manchmal halt nicht erklären konnte, was los war, und die man hin und wieder anlügen mußte, zu ihrem eigenen Besten.
Valeries Mutter war tot, lief aber wieder rum, Valeries Vater war ein passabler Ernährer und heimlicher knabenversessener Serienmörder, der während sowohl angeblicher wie echter Geschäfts- und Fortbildungswochenenden in fremden Städten (und einmal auch bei einem allein verbrachten Erholungsurlaub im Ausland) überwiegend Strichjungen tötete, bloß zweimal gewöhnliche Buben, die zum falschenZeitpunkt am falschen Ort gewesen waren. Daß die Mutter nicht immer mithalten konnte mit den Stimmungsumschwüngen und sonstigen Entwicklungsschüben der Tochter, sah ihr Valerie problemlos nach – als Tote, genauer: als wiederbelebte Zombotikerin, wunderte sich »das alte Mädchen« (wie Valeries Vater Valeries Mutter manchmal nannte) nicht nur über die Anstalten und Abenteuer der Frucht ihres Leibes, sondern immer wieder auch über winterliche Eisblumen am Fenster, Herbstwind, den Brötchengeruch, der morgens aus der warmen Bäckertüteströmte, Krankenwagensirenen von der Straße her, Hitzewellen imSommer und andere erznormale Dinge, die sie während ihrer drei Wochen im Jenseits vergessen hatte und sich, seit sie wieder auf der Welt war, offenbar einfach nicht wieder aneignen, geschweige dauerhaft merken konnte.
Daß ihr Gatte kleine Jungs erstach, wenn ihn sein Rappel packte, hätte sie wahrscheinlich nicht mal erfasst, wenn es vor ihrer Nase passiert wäre. Valerie hatte davon ebenfalls nicht die geringste Ahnung, was sich vielleicht damit entschuldigen läßt, daß der arme Mann drei Viertel seines Wachlebens auch selbst in völliger Unkenntnis dieser während schwerer psychotischer Episoden begangenen Verbrechen fristete.
So oft der gemeinsame Wille ihrer Eltern dem nicht entgegenstand, ging Valerie mit ihren Freundinnen Christina und Sarah Samstag abends fast immer in die Stadt – am liebsten in die ganz großen Großraumdiscos und die Studentenclubs, in die man leichter reinkam, wenn man mehr Lidschatten und Mascara benutzte als unbedingt nötig. »Manchmal muß man trotzdem den Ausweis zeigen, dann geben wir auf, gehen zu McDonald’s, überlegen uns was anderes, außerdem ist Sarah schon 19 und kriegt uns oft noch irgendwo rein. Wenn aber gar nichts läuft, kannste immer noch ins Kino.«
Valerie liebte ihre Wildleder-Stiefeletten, die perlenbesetzten violetten Jeans mit Schlag und das Jeans-Spaghetti-Top mit Schleife, mochte Platten von Avril Lavigne, Pink und Bush, schickte gernSMS-Botschaften durch die Gegend, telefonierte andauernd mit ihrem Handy – der Ausdruck trifft es genau: Sie telefonierte weniger mit ihren menschlichen Gesprächspartnerinnen und -partnern als mit dem Handy selbst, das sie seit ihrem fünfzehnten Geburtstag besaß und dessen Grundgebühr ihr vom Taschengeld abgezogen wurde, während die Gesprächskosten mit dem Geld vom gelegentlichen Zeitungsaustragen bezahlt wurden. Als ich jung war, so alt wie Valerie zum Zeitpunkt, da die Geschichte anfing, die ich erzählen muß, hätten meine besten Freunde, Philip und Jenny, jemanden wie Valerie als »ein Schöninchen« bezeichnet. Ich weiß nicht mehr, wer diese leicht spöttische Verniedlichungsform von »eine Schöne« oder »eine Schönheit« damals eigentlich erfunden hat, vielleicht war ich es auch selber. Jenny und Philip hatten jedenfalls immer eine Menge Spaß daran, mir vorzuhalten, daß ich, selber gerade erst vierzehn oder fünfzehn Jahre alt, mich fast immer in Mädchen verliebte, die entweder wirklich erst zehn, zwölf, dreizehn Jahre alt waren oderdoch so aussahen, auf großäugige, blasse Weise hübsch, kleine Gespenstinnen eben, meist mit langen, glatten Haaren, bevorzugtschwarz –genau, richtig, jetzt fällt es mir auch ein, wie das zustande kam mit dem »Schöninchen«: Philip hat mich dabei beobachtet, wie ich im Aufenthaltsraum unserer Schule, einem aquaresken Glaskasten in typischer sozialliberaler Siebziger-Jahre-Schulbauweise, einem dieserMädchen hinterhergeschmachtet habe, das da grad den Raum verließ, und dann hat Philip gesagt: »Wieder so ein Schneewittchen. Dein Typ steht fest, oder?«, und in diesem Augenblick war Jennifer dazugekommen und hatte gesagt: »Was ist mit Schöninchen?« – eine Verballhornung, richtig, eine Wortverdrehung. »Morphismus«, wie Philip das dann später zwanghaft nannte, als wir das Buch gefunden hatten. Frau Flasch hätte es uns wegnehmen sollen – vor allem Philip. Na ja, verschüttete Milch.
Wo war ich stehengeblieben? Valerie Thiel.
Sie fand sich gut zurecht in der kargen Landschaft, die von den Erwachsenen »Krise« oder »Rezession« genannt wurde. Sehr gut war’s ihrer Ansicht nach, unter solchen Umständen in einer großen Stadt zu leben. Man konnte da fast alles finden und umgekehrt fast allem aus dem Weg gehen. Kleinstädte oder Dörfer mußten in dieser Hinsicht fürchterlich sein, sie wollte gar nicht wissen, wie schlimm.
Valerie war nicht leicht zu erschrecken; bei der Tochter einer Zombotikerin zwar nichts Besonderes, aber im Alltag doch auch ein Bonus: in Bio, als ein Film über die Paarungsnickligkeiten der Gottesanbeterin gezeigt und von Mitschülerinnen und Mitschülern einigermaßen Bäh gefunden wurde, äußerte sie in der anschließenden Fragestunde, sie habe das alles »eigentlich eher interessant« gefunden. Sarah erzählte sie sofort danach, in der Pause, per Handy alles: »Echt, paß auf: Eines der ganz wenigen Insekten, die überhaupt einen Hals haben, bei den andern sitzt der Kopf auf dem Leib, und die kann ihren um 360° drehen, lang und biegsam … Dreht sich also in sämtliche Richtungen, da kann sie dann locker das Männchen verspeisen, während es ihr aufhockt und sie öh, na ja … begattet, nämlich indem sie den Kopf nach hinten dreht und seinen abbeißt. Gleichzeitig zwei Sorten fun, oder?«
»Hä?«
»Na, die Liebe und die Mahlzeit.«
»Klar«, meinte Sarah darauf abgeklärt, »wenn ich ’n Zombotiker in der Familie hätte …«
»Zombotikerin!« verbesserte Valerie.
»… würd’s mir auch am Arsch vorbeigehen. Fressen die nicht frisches Hirn, um in Form zu bleiben? Deine Mutter? Frißt die eigentlich frisches Hirn?«
Valerie rümpfte die Nase, dann schnaubte sie: »Pff! Was lallst du denn da schon wieder für’n totalen Quatsch an mich ran, Sarah? Haste das in ›Coupé‹ gelesen, aufRTLgesehen oder was? Erstens sind Zombotiker keine Monster – was du meinst, ist die Rohform, Zombies, so wie die ersten, vor ewigen … öh, ach, weiß nicht genau, jedenfalls vor ’nem Dutzend Jahren, als das Verfahren noch nicht mal … wie heißt das … ausgereift war, genau, da hatten …«
»Zombies«, verkürzte Sarah die Apologie. »Ich weiß schon.«
»Eben. Und nicht mal die essen ›frisches Hirn‹, es sei denn, ihr Zombiemeister befiehlt es ihnen.«
»O.k. Der Zombiemeister. Wenn du es sagst. Wer ist das bei euch, dein Alter?«
Manchmal machte es ja Spaß, sich gegenseitig anzupflaumen, aber diese Bemerkung kränkte Valerie genug, daß sie das Gespräch mit einem Daumentastendruck abbrach. Es gongte sowieso gerade wieder, Ruf in den Unterricht, und bis zur nächsten Pause war die Beleidigung dann glücklich vergessen.
2 Fünfzehn Jahre, na gut: Man konnte schon über die Hecke oderMauer ins Erwachsenenweltall schauen, war aber noch nicht verpflichtet, den damit verbundenen Mumpitz von Verantwortlichkeit, Wackersinn und so weiter mitzumachen. Allgemeiner Sozialkram und speziell Sex, die beiden großen furchtbaren, manchmal auch furchtbar gewöhnlichen Aussichten dieser abstrakten Erwachsenengegend jenseits der Grenze, ließen sich vom Rand der Veranstaltung schon mal ein bißchen kennenlernen: die Geräusche, die Probleme, der Geschmack. Dabei half besonders die etwas – und das heißt in diesem Alter: entscheidend – ältere Sarah, die Valerie beim Babysitten für Handygeld kennengelernt hatte, auf Christinas kleinen Bruder Lukas paßten dann beide ab und zu abwechselnd auf. Sarah bekannte sich offen dazu, daß sie »gern mit den beiden abhängt«, obwohl Christina und Valerie erst sechzehn und fünfzehn waren. Christina sah allerdings reifer aus, Valerie dagegen niedlich genug, um als Zwölfjährige durchzugehen – aus diesen beiden physiognomischen Altersunschärfen ergaben sich je nach Situation für Sarah sogar bescheidene Vorteile, besonders beim Flirten in Clubs, auf Jahrmärkten, in der U-Bahn oder an Imbissbuden.
»Erwachsen« hieß, hatte Valerie rausgefunden, daß man zwar immer noch haushalten mußte mit dem, was man hatte – Geld, Bekanntschaften, Talente –, dieses Haushalten aber irgendwie ernster wurde, zugleich bizarrer, als die analoge soziale Kontoführung einer Fünfzehnjährigen. Das ganze Erwachsenendasein kam ihr vor wie eine Art mit hoher Aufmerksamkeit gelebter und ausgehaltener Traum. Wann immer sie sichin die Zeit nach dem Abitur vorausdachte, meldete sich eine Erinnerung, die ihr versinnbildlichte, wie das werden würde. Diese Erinnerung bezog sich auf einen sehr merkwürdigen Abend.
Sarah hatte Valerie am Samstagmittag per Handy angerufen und ihr mitgeteilt, daß die (erwachsene) Bekannte einer (ebenfalls erwachsenen)Bekannten in einem »eher nicht so hippen Wohnviertel« der Stadt»heute abend um zehn« eine Party veranstalten würde. Zu Besuch bei den echten Mittzwanzigern, cool!
Valerie hatte ihre Eltern mit routiniert händeringendem Gebettel dazu gekriegt, ihr zu erlauben, ausnahmsweise bis zwölf dort zu bleiben, also erst um halb eins mit einer der letzten S-Bahnen nach Hause zu kommen.
Christinas Eltern waren weniger aufgeschlossen. Daher traf Valerie am Burger King unweit der zur Partywohnung nächstgelegenen Station bloß Sarah.
Mit der ging es durch Straßen, deren Fenster in lauter hohen, verbraucht nachtgrauen Wohnblockhäusern allesamt nicht erleuchtetwaren: »Kann das sein, daß die schon alle schlafen? Um zehn, am Samstagabend?« wunderte sich Valerie. Aus dem Viertel, wo sie lebte, kannte sie das nicht – die Studenten, Architekten, Therapeuten und Fernsehdramaturgen, die da wohnten, hatten das Licht fast immer noch an, wenn Valerie ihres löschte und dann, wie in den meisten Nächten, kurz vor dem Zubettgehen noch einmal ans Fenster trat, um zu sehen und zu spüren, daß das um sie herum eine richtige Stadt war und nicht einfach irgendeine Gegend.
»Na ja, hier wohnen schon viel alte Leute.« Sarah zuckte mit den Schultern.
»Aber um zehn? Am Samstag? Schau mal, hier ist dasganzeHaus dunkel!«
»Ja, äh … vielleicht sind die Wohnzimmer auf der anderen Seite?«
Klar: Das hier mußten alles Küchen- und Schlafzimmerfenster sein. Wenn die Wohnungen, wie Valerie ältere Freunde von Sarah öfter hatte sagen hören, so »geschnitten« waren, dann bedeutete es nichts Schlimmes, daß nirgends Licht brannte. Trotzdem: unheimlich.
»Was ist das eigentlich für eine Party, wo wir da hinwollen?« erkundigte Valerie sich nach weiteren zehn Metern stummen Weges durch die stille lange Straße mit den obskur geschnittenen Wohnungen.
»Die Frau zieht aus oder sowas, hat Jordis erzählt … Jordis ist diese Freundin von mir, studiert … und diese Frau da, die studiert mit ihr, und muß am Montag da ausziehen oder so, deshalb die Party. Jetzt müssen wir mal schauen – was war die Hausnummer? Neunundachtzig … hier ist sieben- und -achtzig, siehste … ah ja.«
Ein einziges Fenster des arg unlebendigen Altbaus vor ihnen mahnte stumpfgelb, wie ein Notsignal an Außerirdische, direkt im ersten Stock. Über dem dazugehörigen Balkon hing ein wahrscheinlich regenbogenbuntes (das war im Straßenlaternenlicht nicht richtig auszumachen) Tuch, auch eine große Decke.
Sarah und Valerie traten an die Haustür. Sarah läutete bei »Schöne«.
Eine Stimme, gegensprechanlagenverzerrt, fragte gut aufgelegt:»Hallo ja?«
»Ja, hier ist Sarah, die Freundin von Jordis. Ich hab’ noch wen mitgebracht.«
»Alles klar!« freute sich die Fremde. Ein Türsummer wurde betätigt – immerhin, dachte Valerie, die wegen der dunklen Häuser nach wie vor leicht angegruselt war, haben sie eine richtige Schließanlage hier, es ist also nicht wie in Horrorfilmen, wo der alte befrackte Diener mit dem Leuchter in der Hand die schwere Eichentür von innen aufmacht und dann …
Sarah und Valerie gingen die krummgetretenen Treppenstufen im engen Treppenhaus hoch und wurden an der Tür von der ausgelassenen Stimme begrüßt, die zu einer blonden Frau gehörte, sichtlich älterals Sarah, einen halben Kopf kleiner als Valerie. Sie umarmte beideGäste, die sie überhaupt nicht kannte, kurz und herzlich, dazu erklärte sie mit einem für Valerie nicht identifizierbaren ausländischen Akzent: »Ihr seid ja von Jordis, ja das isch ein leischte Problem … Isch habe der ganze Party abgesagt, weil man uns … uns hat der Baupolizeiamt verboten, daß viele Leute kommen, aber isch konnte nischt alle einladen … Wir haben hier eine kaputte Boden, die Balken verrottet, und müssen nächste Woche ausziehen, drei Wochen lang … bis dahin ischt es gemacht, aber wir wissen nischt wohin, ja? Es ist alles eher verrückt … Zieht doch die Jacken aus …«
»Kommt Jordis äh … also Jordis kommt schon noch?« fragte Valerie und schalt sich gleichzeitig zu unsicher deswegen: Muß ich denn unbedingt Leute um mich haben, die ich kenne? Zumal ich Jordis gar nicht so gut kenne, eigentlich kaum. Sarah beruhigte sie beiläufig. »Ich hab’ sie grad noch am Handy gehabt, bevor wir uns getroffen haben. Sie kommt auf jeden Fall noch, mit ihrem neuen Freund … Sie weiß anscheinend, daß die Party sehr wenig Leute … ah, hallo.«
»Hallo!«
Es war ein Schatten in der verdunkelten Küche rechts vom Flur, derSarahs Gruß erwiderte – ein junger Mann. Auf dem Küchentischbrannte schwach eine Kerze. Valerie blinzelte, nieste. Das Arrangement schien gemütlich, aber auch mulmig.
Als Valerie, nachdem sie ihre Jacke an einen Kleiderhaken gehängt hatte, von der sich immer noch über verrottete Balken, Mieterschutzund dreiwöchige Sanierungen verbreitenden Gastgeberin mit einerGeste aufgefordert wurde, Sarah durch den mit blauen Plastikperlen besetzten Jamaikavorhang zur Küche zu folgen, kam ihr die Situation kurz bedrohlich vor, wie wenn eine Drogenwirkung einsetzt, ein nicht ganz gewollter Rausch einen überkommt.
Innere Inventur: Was haben wir hier? Eine, na ja, Party – mit bislang vier Leuten, Gläsern auf dem Tisch und Obst in einer Schale, Weinflaschen daneben, Achtziger-Jahre-Hits aus einem winzigen Radio über der Spüle.
Schäbig, gemütlich, nicht ganz nachvollziehbar: erwachsen.
Lauwarm halbverdutzt saß man zusammen, und die Frau, die zu schnell und zu akzentbelastet redete, als daß Valerie alles verstanden hätte, gab zu verstehen, daß sie aus Schweden (oder Dänemark?) stammte, daß das hier schon ihre sechste Berliner Wohnung in nur zwei Jahren war, daß sie immer wieder übers Ohr gehauen wurde und daß nebenan, übern Flur, in dem Zimmer, das zum Balkon gehörte und dessen Erleuchtetheit man von der Straße aus hatte sehen können, ihre Mitbewohnerin gerade ein ernstes Gespräch unter Frauen mit ihrer besten Freundin führte – wirklich, hatte sie das gesagt: »Mit ihrer besten Freundin«? Oder bloß »mit ihrer Freundin«? Valerie fragte sich neugierig, aber auch etwas schamhaft, ob die Mitbewohnerin vielleicht lesbisch war.
Verrottete Balken. Verschlossene Türen. Gespräche unter Frauen.
»Soll das heißen«, fragte Sarah, sich eine Zigarette anzündend, mit ihrer antrainiert selbstbewußten, also typisch neunzehnjährigen Offenheit in Gesellschaft, »daß wir hier jetzt auf einem Boden sitzen, der durchbrechen kann, und die Polizei aus dem Grund die Party verboten hat?«
Valerie mochte und bewunderte solche Offenheit, auch wenn sie Sarah gelegentlich ermahnte: »Das ist typisch. Sei nicht immer so typisch«, worauf Sarah regelmäßig, im Sinne einer auswendig gelernten Pointe, zurückgab: »Ich bin auch nicht typischer als sonst. So typisch bin ich immer.«
»Na ja«, half also auf Sarahs typische Frage der im Kerzenhalbdunkel nicht genau erkennbare Typ mit der beginnenden Stirnglatze, im – soweit Valerie erkennen konnte – hübschen Pulli und mit großen Ohren,seiner schwedisch-dänischen Bekannten aus, »der Schaden ist ja eigentlich bloß in der Speisekammer und in der Küche, nur da sind die Dinger so richtig morsch, da werden die Renovierhanseln auch am meisten richten, wobei Sophie«, so hieß also die Frau aus dem Norden, dieschicksalsergeben lächelnd hinter der Kerze saß und eine Orangeschälte, »halt Angst hat, daß die jetzt auch noch das Bad kacheln, wenn sie alles richten. Und danach dann einfach die Miete erhöhen.«
»Das dürfen sie aber gar nicht«, erwiderte Sarah mit großer Bestimmtheit, »so was Ähnliches ist Kai … Kai Friese, kennst du den, der ist mit Katharina zusammen, die Jordis kennt …«
Er nickte, sie fuhr entflammt fort: »Und also ähm bei Kai ist der Boiler in der Küche verreckt, und da haben sie dann festgestellt, daß auch noch andere Sachen im Arsch waren, Wasserzuleitungen oder was, und das ist alles gemacht worden, und dann wollten sie danach auch die Miete erhöhen, aber da ist er zur Mieterberatung, Mieterverein, Mieterschutzbund oder wie das heißt gelaufen und … Da solltest du auch hingehen, Sophie …«
Die dänische Schwedin lächelte noch breiter und sagte in leisem Singsang: »Ach isch weiß nischt, hab isch eigentlisch keine Zeit für.«
In diesem Moment, wie von Loki Lügenzunge angefacht, flackerte die Kerze kurz auf und erlosch.
Die vier saßen im Dunkeln.
Valerie dachte, den Atem einen Augenblick lang anhaltend: Hoffentlich kommt Jordis wirklich bald. Vielleicht können wir dann ganz schnell woanders hingehen, meine zwei den Alten abgetrotzten Stunden sind schon zu einem Viertel aufgebraucht, und lustig ist es hier eigentlich nicht. Warum macht sie jetzt nicht ein Licht an?
Sophies nächster Satz zerstörte diese Hoffnung: »Ischt ja witzig … hier in Dunkel … isch glaube, so lassen wir das. Es ist ein Abwechslung, nischt?«
So blieb es wirklich. Eine weitere endlose Viertelstunde später fragte sich Valerie, ob das eigentlich wirklich wahr sein konnte, ob sie tatsächlich hier war, als wäre das nicht komplett Gaga, blind wie ein Maulwurf – und man unterhielt sich über Schweden, das heißt primär darüber, wie lang das Land ist, und daß der Weg von Südschweden nach Nordschweden genauso weit ist wie der von Südschweden nach Rom.
Absolutes Dunkel bückte sich, spürte Valerie nervös, über ihrem Kopf, um ihr in die Augen zu fassen und da irgendwas rauszupopeln: Warum fallen mir nur immer solche Sachen ein, solche Bilder und Befürchtungen? Bin ich irre? Liegt das daran, daß meine Mutter eigentlich tot ist, aber trotzdem noch, oder wieder, bei uns wohnt?
Vom Fenster her, in Sophies Rücken, vibrierte lustlos ein Schimmer, weil wenigstens das rückwärtig gegenüberliegende Haus ein paar erleuchtete Fenster hatte.
Als Jordis eintraf, standen die Schwedin und Sarah auf, begrüßten Jordis und ihren Freund auf dem Flur (da funzelten wenigstens zwei schwache Glühbirnen, Valerie bekam richtig Sehnsucht nach Licht, wenn sie nur hinzwinkerte). Wir sind gefangen, umlauert von Schwärze, fehlt nur noch, daß wir flüstern müßten … und ich, als Jüngste auf dieser »Party«, kann ja schlecht verlangen, daß man die bedrückende Versammlungauflöst, oder mich am Ende aufspielen wie dieser Goethe, als er starb: mehr Licht.
Um nicht ganz hysterisch zu werden, wandte Valerie ihre Aufmerksamkeit dem einzigen neuen Reiz zu, der seit zwanzig Minuten angefallen war: Jordis hatte also ihren Freund mitgebracht, einen, wie sich rausstellen sollte, sehr schweigsamen, übertrieben mundfaulen Menschen, der ein verschattetes Kinn hatte, sehr kurze Stoppeln um den Mund und kaum Schultern, soweit Valerie das von der dunklen Küche aus auf dem Flur hatte erkennen können. Sie mußte, stellte sich heraus, aufgrund der beengten Raumverhältnisse mit ihrem Stuhl einStückchen in Richtung Fenster rücken, um dem Bartschatten Platz zu machen, und als sie dabei unter ihren Sitz griff, auch einmal mit der Hand auf den Boden patschte, weil sie glaubte, ihr Schal sei vom Stuhl gerutscht, bekam sie etwas Rundes und Kühles zu fassen, hob es hoch und teilte es leise und vorsichtig den andern mit: »Hier äh hab’ ich … irgendwas.«
Es sah, bei dem wenigen Licht, aus wie ein Kugelfisch – die kleine Ausbuchtung an einem der Pole schien der Kopf und fühlte sich, mit dem Daumen betastet, besonders unangenehm an.
»Das ischt ein Orange«, erklärte die finnische Norwegerin. Kein Kugelfisch, dachte Valerie enttäuscht: Sind die nicht giftig? Die Eierstöcke oder Leber oder was das war? Hatten wir neulich in Bio. Und trotzdem eine Delikatesse, in Japan als »Fugu« begehrt … jedenfalls aufregender als eine dämliche Orange.
»Neulisch ist unsere Obstschale umkippt, es sind Früchte auf dem Boden gefallen … Ischt gut, wenn sie gefunden werden, oder?«
So, dachte Valerie, den falschen Fugu noch in der Hand, konnte man also wirklich leben: Erwachsene, das waren Leute, denen Früchte schon mal unter die Stühle rollten, wenn keiner achtgab, und die sie dann, auf morschem Balkenboden, während morbider Sitzpartys im Finstern, erfreut wiederfanden. Der junge Mann, der schon bei Sarahs und Valeries Ankunft da gewesen war, begann jetzt, während die Radioplätscherbegleitung von Achtziger-Geklingel zu Neunziger-Technogestampfe überging, von seinen Wanderurlaubserlebnissen in Westengland zu erzählen: »Da kann man überall langlaufen, es gibt Pfade, man hat auch einfach Wegerecht … oder wie das heißt. Zäune sind nicht verbindlich. Meine Eltern haben einen Bauernhof in Schleswig-Holstein, die würden jeden erschießen, der ihnen einfach so übers Feld stolpert, aber da in Westengland ist das normal. Alles sehr hügelig, nah an der Küste, und jeweils in Abständen von einem Tagesmarsch findet man immer ’ne Herberge, einen Backpack-Schuppen, ein Youth Hostel oder Bed & Breakfast. Als ob sie genau wüßten, wie weit man so kommt als Tourist an einem normalen Tag, als ob es staatlich geplant wäre. Nur das Essen da, das ist nicht so gut, das kann man in die Tonne treten – selbst England-Pädophile behaupten ja nicht, daß das Essen in England besonders gut wäre.«
Fast alle im Raum, Valerie inklusive, stutzten über diesen Satz. Gastgeberin Sophie, inzwischen mit schwerer Weißweinzunge, hakte nach: »Was … was meinscht du, England-Pädophile?«
»Na ja …«, verteidigte sich matt der Urlaubserlebniserzähler, dem dämmerte, daß er sich auf ein Fremdwort eingelassen hatte, das ihm nicht so recht gehorchen wollte, »ich mein’ … so Leute, die halt England lieben und für das größte halten … England-Pädophile …«
»England-Pädophile halt, Mann«, ergänzte und besiegelte Sarah das Unglück des Schwätzers, durchaus gehässig. »Sei nicht so typisch«, lachte Valerie, aber niemand sonst fand das lustig, und ob Sarah wenigstens mitgrinste, war nicht zu erkennen.
Jordis’ Freund hatte unterdessen offenbar mit Jordis die Köpfe zusammengesteckt, soweit Valerie das im Zwielicht ahnen konnte. Man tuschelte wahrscheinlich darüber, wie man hier rauskam, aus dieser Partyfalle, möglichst schnell. Warum, fragte sich Valerie erneut, taten sich die Älteren das überhaupt an? Aus Mitleid mit Sophie? Wegen der morschen Balken? Oder war’s ein unbestimmter Effekt des Überrumpeltwordenseins?
Sophie lenkte mit neuen nordischmorschen Geschichten von der England-Pädophilenzwickmühle ihres Gastes ab. Ein Kater erschien – Jordis’ Freund spürte ihn zuerst, am Schienbein, dann nahm Sophie ihn vom Boden hoch. Er schnurrte in der Rabenschwärze, ein kleiner elektrischer Rasierapparat für Damen. Die Rave-Randalierer von Scooter brüllten kopflos aus dem Radio, zu unmenschlichem Beat. Es war allmählich soweit ganz nett hier, und daß sie das spürte, beunruhigte Valerie: Ist das Spinnenlähmgift, was mir allmählich in die Glieder sickert? Ist diese Sophie vielleicht eine Gottesanbeterin, die uns alle fressen will?
Noch einmal zwanzig Minuten vergingen, bis endlich Sarah sich ein Herz faßte: »Ja, ich glaube, Valerie muß allmählich heim. Ihre Alten sind streng … und ich bin heut einfach müde, zu nix zu gebrauchen … Ist o.k., oder?«
»Tut mir leid, daß es so langweilich ischt …«, jammerte Sophie gespielt, also in Wirklichkeit böse fröhlich. Valerie beschloß, mit beachtlicher Verspätung, diese Frau nicht zu mögen, kein bißchen, im Gegenteil. Die war einfach bekloppt, das hatte nichts Charmantes, was immer die Erwachsenen denken mochten.
Unter viel Geruckel, Gestoße und Gezupfe brachen Sarah und Valerie in der Finsternis und aus ihr auf.
Natürlich war Valerie nach dem gotischen HockIn nicht sofort nach Hause gegangen, sondern hatte, wie um sich des Fortbestands einer verstehbaren Welt außerhalb der sozialen Dunkelkammer dieses verelendeten Erwachsenseins zu versichern, Sarah überzeugt, noch mal bei Burger King vorbeizuschauen. Tatsächlich schloß sich auf diese Weise der angeeierte Kreis dieser Nacht: Denn da hatten sie dann ein paar knappe, gutmütige Witze ausgetauscht, nichts ätzendes, einfach, um einander die Verarbeitung des erlebten Unsinns zu erleichtern, als Freundinnen. Vor allem der »England-Pädophile« bekam sein Fett weg.
Am Ende war Valerie einigermaßen beruhigt heimgelaufen.
Was bei ihr blieb, war allerdings der Eindruck, daß es nicht etwa, wiein Erzählungen älterer Freundinnen, auch Sarahs, von Drogen unddurchgemachten Nächten, irgendwodraußen, außerhalb des Alltags, den Valerie kannte, sondern vielmehr in dessen Mitte, in angefressenen Kammern des innersten Innern der Stadt, gut verschlossen, etwas Schwieriges,für Fünfzehnjährige nicht wirklich Betretbares gab.
3 Sex? Au weia.