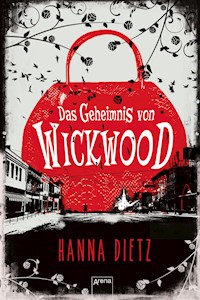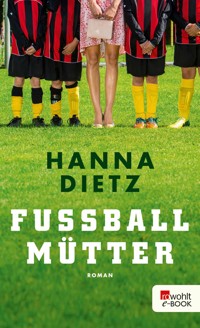
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit den anderen Müttern und einem Kaffeebecher am Spielfeldrand stehen und zusehen, wie die Kleinen kicken – so stellt sich Carolin ihr neues Leben als Fußballmutter vor. Also meldet sie ihren Sohn Luis in der F2-Jugend des 1. FC Reschheim an, der Gurkentruppe des Vereins. Aber der Kampf auf dem Rasen ist nichts gegen das, was sich am Rand abspielt: Da wird intrigiert, gemobbt, gepöbelt. Schwer zu ertragen für Carolin, die nach ihrer traumatischen Scheidung nur ihre Ruhe will. Doch da taucht ihr Scheidungsgrund nebst fußballbegeistertem und leider talentiertem Sohn auf, und in Carolin erwacht ein lange vergessenes Gefühl: Kampfgeist. Wäre doch gelacht, wenn Luis' Mannschaft nicht die angeberische Vorzeigemannschaft des Vereins besiegt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Hanna Dietz
Fußballmütter
Roman
Über dieses Buch
Mit den anderen Müttern und einem Kaffeebecher am Spielfeldrand stehen und zusehen, wie die Kleinen kicken – so stellt sich Carolin ihr neues Leben als Fußballmutter vor. Also meldet sie ihren Sohn Luis in der F2-Jugend des 1. FC Reschheim an, der Gurkentruppe des Vereins. Aber der Kampf auf dem Rasen ist nichts gegen das, was sich am Rand abspielt: Da wird intrigiert, gemobbt, gepöbelt. Schwer zu ertragen für Carolin, die nach ihrer traumatischen Scheidung nur ihre Ruhe will. Doch da taucht ihr Scheidungsgrund nebst fußballbegeistertem und leider talentiertem Sohn auf, und in Carolin erwacht ein lange vergessenes Gefühl: Kampfgeist. Wäre doch gelacht, wenn Luis’ Mannschaft nicht die angeberische Vorzeigemannschaft des Vereins besiegt …
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Juni 2017
Copyright © 2017 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg
Umschlagabbildung www.SebastianSchmidt.co
ISBN 978-3-644-22451-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für alle Ehrenamtler, die sich weder von Wind und Wetter noch von übereifrigen Müttern und Vätern davon abhalten lassen, unseren Kindern das Fußballspielen zu ermöglichen
«Im Kinder- und Jugendfußball gibt es eine große Gefahr: Eltern!» Bild am Sonntag, 14.12.2014
1
Wenn dir das Leben den Boden unter den Füßen wegzieht, kauf dir einen Teppich.
Hach, was bin ich wieder gut drauf! Sogar alte persische Sprichwörter lasse ich mir einfallen. Zufrieden grabe ich die nackten Zehen in den flauschigen Flor, der mich in den Zehenzwischenräumen kitzelt. Natürlich wäre es besser gewesen, wenn ich den Teppich im Wohnzimmer selbst gekauft hätte. Und nicht die Vermieterin. Ich meine, was hat sie sich bei dem Motiv nur gedacht? Hübsch zwischen Blumengirlanden eingewebt, senkt ein Löwe seine Pranke in die Flanke eines Elefanten, der sich überrascht aufbäumt. So weit, so naturnah. Aber die ganzen Proportionen stimmen nicht, der Elefant hat Stummelbeinchen, der Löwe bratpfannengroße Tatzen und einen winzigen Kopf mit einer Mähne, die aussieht wie ein Heiligenschein. Konstantin würde sich kaputtlachen.
Nein, schlimmer. Er würde mich dafür verachten und seine Verachtung mit einem schmalen Lächeln tarnen. Stillosigkeit gehört für meinen Ex zu den Todsünden. Und Stil bedeutet für Mr. Superarchitekt reduzierte Formen und nichts als Edelstahl und Schiefer. Was für ein Glück, dass ich jetzt wieder meine eigene Herrin bin! In meinem Leben und in meiner Wohnung. Sie hat vier Zimmer sowie eine Sonnenterrasse und damit ausreichend Platz für Luis und mich. Und sie ist möbliert. Für jemanden, der neben seinem Herzen auch sein Mobiliar in dem gemeinsamen Haus zurücklassen musste, eine echte Erleichterung. Außer ein paar Koffern und Kisten mussten wir nichts schleppen. Toll ist auch, dass ein großer Kellerraum zur Wohnung gehört. Dort kann ich nämlich das Riverboat-Regal verstauen. Das ist ein wuchtiges hölzernes Kanu, das irgendein Möchtegerndesigner in der Mitte durchgesägt, mit dem Bug nach oben hingestellt und mit Brettern versehen als Regal umfunktioniert hat. Allerdings passen nicht mal zwanzig Bücher hinein, weil es nach oben hin so schmal wird, völlig unnütz also.
Jetzt ragt es in der Ecke des Wohnzimmers auf.
«Ist das nicht famos?», hatte die Vermieterin, eine weißhaarige Dame in Leinentunika, bei der Besichtigung gerufen. «Es erinnert mich an reißende Fluten und den Aufbruch in eine neue Welt!» Sie hatte die Hände begeistert in die Höhe gerissen, und ich hatte begeistert genickt. «Ich liebe koloniale Möbel», hatte meine Vermieterin zufrieden gesagt. «Sie nicht auch?»
«Doch, und wie!», hatte ich geantwortet. «Die sind so … besonders.» Besonders unpraktisch. Aber auch scheußlich. Was ich aber für mich behielt, schließlich wohnte ich da noch mit Luis bei meinen Eltern. In meinem alten Jugendzimmer. Dann doch lieber Giraffentische und indische Schränke! Und mit diesem Teppich habe ich mich inzwischen auch angefreundet, er ist so himmlisch weich. Über den lächerlichen Löwen werde ich einfach den Couchtisch schieben. Nur dieses Kanu-Regal muss weg. Und zwar bevor meine Eltern zum Antrittsbesuch aufmarschieren.
Entschlossen packe ich es mit beiden Händen. Aber obwohl es nach Leichtbauweise aussieht, ist es anscheinend aus irgendeinem tropischen Hartholz geschnitzt. Jedenfalls überrascht mich sein Gewicht, und das Ding rutscht mir aus den Fingern und knallt auf meinen kleinen nackten Zeh.
«Aua», schreie ich, und mir schießen augenblicklich die Tränen in die Augen.
«Was ist, Mama?», ruft Luis aus seinem Zimmer.
«Alles okay, hab mich nur gestoßen», presse ich zwischen zusammengekniffenen Lippen hervor.
«Weinst du schon wieder?», fragt er durch den Flur, und mir wird flau, wie immer, wenn er sich Sorgen macht. Dann bekommen seine schönen grün-blauen Augen diesen betrübten Ausdruck, und auf seiner glatten Kinderstirn bildet sich eine kleine Falte. Und auf Kinderstirnen sollten keine Falten sein. Vor allem keine, die ich verursacht habe.
«Nein, kein bisschen», rufe ich betont fröhlich zurück. Zum Glück ist der Teppich so weich, dass meine Zehen von dem Regal tief hineingedrückt wurden und kein bleibender Schaden entstanden ist. Trotzdem scheint es mir ratsam, für diese Unternehmung Schuhe anzuziehen. Und zwar welche, die die Zehen vor jeglichen Quetschattacken schützen. Dafür habe ich genau die richtigen!
Als ich mich das nächste Mal dranmache, stelle ich fest, dass ich das Kanu nur falsch angepackt habe. Wenn ich die eine Hand unter das oberste Regalbrett lege und die andere unter den spitzen Bug, dann ist es ganz einfach. Ich stemme das Regal hoch und trage es zur Wohnungstür. Obwohl ich wegen des schönen Sommerwetters nur Shorts und ein Spaghettiträgertop anhabe, fange ich an zu schwitzen. Aber ich schaffe es, das Regal aus der Wohnung bis zum Treppenabsatz zu manövrieren. Jetzt nur noch zwei Etagen runter, dann habe ich es geschafft. Ich verschnaufe einen Moment, und mir fällt ein, dass ich mich bei nächster Gelegenheit bei den Nachbarn vorstellen sollte. In einer kleinen Hausgemeinschaft mit drei Parteien ist ein gutes Nachbarschaftsverhältnis besonders wichtig. Morgen können Luis und ich bei den Nachbarn klingeln. Dann atme ich einmal tief ein, hebe das Möbel erneut an und stakse die erste Stufe runter.
Aber schon bei der zweiten verschätze ich mich in der Breite der Treppenstufen – was nur an diesen dämlichen Schuhen liegt, die anderthalb Nummern zu groß sind. Im letzten Moment klammere ich mich an das Geländer und kann nur mehr tatenlos zusehen, wie das Kanu langsam nach vorne kippt, um dann Bug voran die Treppe runterzurumpeln. Es macht einen Krach, als ob ein ganzer Stamm Massai-Krieger auf seinen Trommeln herumhämmert. Voller Entsetzen starre ich dem Regal hinterher, da öffnet sich die Tür zur Wohnung im Erdgeschoss, und ich kann nur noch «Achtung!» schreien. Der Mann springt zurück und drückt sich in den Türrahmen, ehe es zu einer folgenschweren Kollision kommt. Das Kanu bleibt schließlich vor seinem Eingang liegen.
«Entschuldigung», rufe ich atemlos, während ich die Stufen hinuntereiere, wobei ich mich wegen der dämlichen Schuhe mit beiden Händen am Geländer festhalte – unter ästhetischem Gesichtspunkt sicher wenig vorteilhaft. «Ich wollte nicht …», keuche ich, da sehe ich das unverschämte Grinsen im Gesicht des jungen Mannes. Des ziemlich gutaussehenden jungen Mannes.
«… den neuen Nachbarn mit einem Einbaum überfahren?», vollendet er meinen Satz. Er schaut von dem Kanu zu mir, dann auf meine Schuhe, und sein Grinsen wird noch breiter.
«Das sind Arbeitsschuhe», erkläre ich, um jede weitere spöttische Bemerkung im Keim zu ersticken. Ich vermute, er ist mindestens zehn Jahre jünger als ich. Da wird er doch wohl nicht wagen, über mich zu lachen!
«Interessant», schmunzelt er. «Ich wusste gar nicht, dass es in diesen Breitengraden noch wilde Rinderherden gibt, die man mit dem Lasso einfangen muss.» Und dann lacht er glucksend.
Na gut, was habe ich auch anderes erwartet. Ich trage die Cowboystiefel, die ich mal für eine Westernparty bei eBay ersteigert habe, abgrundtief hässliche Dinger aus grün-weißem Pythonleder. In Größe 42. Besonders in Kombination mit einer kurzen Hose eine Fußbekleidung der mehr als zweifelhaften Sorte. Meine Vorstellung bei den Nachbarn hatte ich mir wirklich anders ausgemalt. Irgendwie gediegener. Meiner Position als sechsunddreißigjährige geschiedene Mutter eines achtjährigen Sohnes angemessen.
«Die Rinder stehen schon auf der Weide», informiere ich ihn kühl. «Jetzt muss ich nur noch dieses Ding in den Hafen verfrachten, dann galoppiere ich nach Hause.»
Frecherweise grinst er immer noch. Sein Mund ist wirklich schön, die Oberlippe hat einen kühnen Schwung, herzförmig fast. Aber das fällt mir im Grunde gar nicht auf, schließlich bin ich frisch getrennt, habe von Männern die Nase voll und mein Leben auch alleine total im Griff. Ich will gerade das Regal wieder hochstemmen, da bückt er sich schon und hebt es hoch, als wäre es aus Pappe.
«Wo soll das denn hin?», fragt er. Und dann trägt mir mein Nachbar das Riverboat-Regal, mit dem ich ihn vor ein paar Minuten fast erlegt hätte, die steile Kellertreppe hinunter, und ich bin so in den Anblick seiner muskulösen Schultern vertieft, dass ich zu langsam schalte, als er vor Keller Nummer 2 stehenbleibt und fragt: «Hier, oder?»
Ich sage ja, und da stößt er auch schon die Tür auf und knipst das Licht an, und erst jetzt fällt mir siedend heiß ein, dass ich es oben auf den Kartons habe liegen lassen. Das Weihnachtsgeschenk, das mir meine beste Freundin vor ungefähr hundert Jahren nach einer männertechnischen Durststrecke kichernd überreicht hatte. «Zwölf Monate Männerglück» sollte er mir bringen, der Kalender mit den männlichen Pin-ups – Waschbrettbäuche, aus Granit modellierte Hintern und enorm ausgebeulte Tangas. «Was soll ich denn damit?», hatte ich sie entgeistert gefragt, und meine Freundin hatte mir erklärt, dass der Kalender mein Liebeskarma verbessern würde, wegen der erotischen Schwingungen. Ich hatte sie für nicht ganz dicht erklärt und ihn in meinem Schrank versteckt.
Na gut, ein paarmal hatte ich ihn rausgeholt und durchgeblättert. Die Typen waren allesamt von oben bis unten eingeölt, selbst ihr Lächeln war glitschig, und diese Beulen untenrum sahen einfach nur lächerlich aus. Im September zeigte der Kalender einen nur mit einem Werkzeuggürtel bekleideten Klempner, die blonden Haare tatendurstig verwuschelt, mit Rohrzange (oben) und Schlauch (am unteren Bildrand). Ich hatte damals beschlossen, den Kalender endgültig wegzuschmeißen. Doch dann hatte ich am 5. September Konstantin kennengelernt, und meine beste Freundin hatte gesagt: «Siehst du, der Kalender hat dir Glück gebracht.» Also hatte ich ihn behalten. Als Andenken an unsere erste Begegnung und an meine beste Freundin, die ein Jahr später der Liebe wegen nach Freiburg gezogen war.
Als ich den Kalender beim Umzug in die neue Wohnung wiederentdeckte, hielt ich ein kleines Zwiegespräch mit Mr. September über Liebeskarma im Allgemeinen und die verhängnisvolle Verkupplung mit Konstantin im Besonderen und wir kamen überein, dass eine Trennung das Beste für uns beide wäre. Ich wollte ihn gerade in den Müll befördern, aber dann rief Luis nach mir, und ich ließ den Kalender im Keller liegen. Und jetzt posiert dort oben auf dem Karton in vorderster Reihe, angeleuchtet von der Glühbirne und somit im Rampenlicht, ein ziemlich nackter, ziemlich gut bestückter Klempner.
«Nanu», entfährt es meinem Nachbarn. «So eine Visitenkarte hat mir mein Installateur aber nicht gegeben.»
«Den hat mir mal eine Freundin geschenkt», sage ich hastig.
«Ach was», schmunzelt er und wirft einen Blick auf mich, und ich sehe mich selbst – mit meinen Shorts und diesen hässlichen Quadratlatschen und den feuerroten Wangen – und denke an all die Leute, die den Verkäufern in den Sexshops erzählen, sie kaufen Vibratoren und Liebeskugeln, weil sie «für eine einsame Freundin ein Geschenk suchen» oder «für einen Roman recherchieren».
«Den wollte ich schon lange wegschmeißen!» Entschlossen nehme ich den Kalender. «Also, weg damit», füge ich betont fidel hinzu.
«Meinetwegen müssen Sie das nicht wegwerfen», sagt mein Nachbar, und seine Mundwinkel zucken schon wieder verdächtig. «Wer weiß, wann Sie den nächsten Rohrbruch haben.»
Ich überhöre seinen Spott geflissentlich. «Dann sind wir hier ja wohl fertig», sage ich kühl, knipse das Licht aus, und wir gehen wieder hoch, und da spazieren uns im Hausflur meine Mutter, mein Vater und mein Sohn entgegen. Mein Vater trägt einen Blumentopf, mein Sohn seinen Fußball und meine Mutter ihr optimistischstes Lächeln. Und ich Shorts, Cowboystiefel und einen erregten Klempner. Ich stoße einen erschreckten Schrei aus und verstecke den Kalender hinter meinem Rücken.
«Mama», kräht Luis. «Guck mal, wen ich auf der Straße gefunden habe!»
«Oma und Opa, wie schön!» Krampfhaft bemühe ich mich um Heiterkeit.
«Unsere Caro, da ist sie ja endlich!», ruft mein Vater, als wäre ich monatelang verschollen gewesen, und stürmt mit ausgebreiteten Armen auf mich zu. Gerade überlege ich, wie ich die Umarmung meistern soll, ohne meine Eltern mit der prallen Installationsgurke zu erschrecken. Und darauf habe ich nun gar keine Lust. Doch da spüre ich, wie mir der Kalender von hinten aus der Hand genommen wird.
Erleichtert begrüße ich meine Eltern und strubbele Luis durch die Haare, der an mir vorbei zu unserem Nachbarn lugt und ganz lässig «Hallo, Yannik» sagt, worauf der mit «Hallo, Sportsfreund» antwortet und hinterherschiebt: «Demnächst kicken wir mal ’ne Runde, okay?» Luis nickt begeistert und springt dann fröhlich die Treppe hinauf. Ich linse nach dem pädagogisch wenig wertvollen Objekt, aber Yannik hat es hinter seinem Rücken versteckt. Ich atme auf. Das ist ja noch mal gutgegangen.
«Hallo, ich bin Burkhard Schulz», stellt sich in dem Moment mein Vater vor und streckt Yannik die Hand hin, eine Geste, die Letzterer freundlich erwidert, während ihm Installateur nebst Rohr aus der anderen Hand auf den Boden fallen.
Was ist eigentlich die Maßeinheit für Blamagen?
Das Schmach-o-Meter habe ich heute auf jeden Fall total gesprengt. Erst überfahre ich meinen Nachbarn fast mit einem Kanu, dann konfrontiere ich meine Eltern mit meinem Cowgirl-Aufzug und einem entblößten Handwerker. Konsterniert starren meine Eltern auf den Kalender.
«Upps», sagt Yannik und lacht freundlich. «Der war nicht für Sie bestimmt.» Er klemmt das Bild unter den Arm. «Das ist eine Requisite», erklärt Yannik. «Ich arbeite beim Fernsehen.» Und wie er so selbstbewusst und ruhig flunkert, wirkt der Kalender auf einmal nicht mehr ganz so obszön.
«Ach wirklich», sagt mein Vater, «das ist ja interessant.» Was nicht gelogen ist, wie jeder weiß, der meinen Vater kennt. Denn er findet jedes Thema spannend, solange es ihm ermöglicht, eine Unterhaltung mit völlig Fremden zu führen. Und so entspinnt sich tatsächlich ein Smalltalk über Fernsehen und seltsame Reportagen und die Qualität von Bratwurst in Fußballstadien.
Meine Mutter guckt angesichts ihres dauerplaudernden Ehemanns wie die zwangsgeduldigen Mütter im Kindergarten, die gerade die Prüfung Mein Kind kann sich schon alleine anziehenertragen müssen. «So, wir müssen dann mal», unterbreche ich. «Der Kuchen wird kalt.»
«Oha», ruft mein Vater belustigt. «Na, das dürfen wir natürlich nicht zulassen.»
Ich verabschiede mich von Yannik mit einem Nicken und eile die Treppe hoch, so schnell es diese Schuhe zulassen. Als wir in unserer Wohnung abkommen, streife ich sie als Erstes ab.
Meine Mutter will gerade eine Bemerkung machen, wird aber von dem weißen Kronleuchter abgelenkt, der wie eine explodierte Schneeflocke im Flur hängt. «Nein, also wirklich, das ist ja tod…», sagt sie und kommt kurz ins Stocken, als sie die Giraffe entdeckt, die eine Tischplatte aus Glas auf dem Rücken trägt. «…schick. Wirklich todschick!» Sie überspielt jede Irritation mit ihrem superoptimistischen Lächeln.
«Da wünscht man sich ja sofort ein Jagdgewehr», dröhnt mein Vater und legt Luis den Arm um die Schulter. «Nicht wahr, Luis? In eurer Wohnung kann man ja fast auf Safari gehen!»
«Aber wir schießen doch nicht auf Tiere, oder, Luis?», mische ich mich in einem pädagogischen Reflex ein. «Wir beobachten Tiere höchstens in ihrem natürlichen Lebensraum. Dabei fällt mir ein, der Blick von der Terrasse ist wirklich schön.» Aber der Versuch, meine Familie mit der schönen Aussicht abzulenken, scheitert.
«Guck mal hier, Opa», sagt Luis. Stolz zeigt er den Löwenteppich.
Meine Eltern spielen die Posse natürlich mit. Denn erstens ist Luis’ Begeisterung für die exotische Einrichtung in der Tat herzerwärmend, und zweitens verkneifen sich meine Eltern seit der Trennung von Konstantin vorsichtshalber jede Kritik an mir. Ich muss ihnen dringend mal sagen, dass es allmählich genug damit ist, mich wie ein rohes Ei zu behandeln. Schließlich hat gerade ein neuer Lebensabschnitt für mich begonnen: Die Scheidung ist rechtskräftig, ich habe eine neue Wohnung, und um das zu feiern, habe ich sogar einen Kuchen gebacken. Und der sieht wirklich klasse aus! Jetzt wo ich ihn mit einer dicken Schicht Schokoguss zusammengeklebt habe. Beim Stürzen aus dieser dämlichen Gugelhupfform ist er mir nämlich zerbrochen. Aber das merkt man dank meiner geschickten Dekoration gar nicht.
«Der sieht aber toll aus», lobt meine Mutter.
«Ja», sage ich und nehme das Messer. «Finde ich …» Die Glasur ist steinhart. «… auch», sage ich gerade, da dringe ich mit dem Messer durch, und das Kuchenstück zerbröselt unter der Glasur in Abermillionen Teile. «Vielleicht ist er ein bisschen trocken geworden», murmele ich verlegen.
«Mit einem Schluck Kaffee geht’s», ruft mein Vater mit aus dem Mund stiebenden Krümeln.
«Ob trocken oder nicht, der Geschmack ist ja da», bekräftigt meine Mutter fröhlich.
Und mein Vater verkündet: «Das Wichtigste ist doch: Gut, dass du den Kerl endlich los bist und wieder auf eigenen Füßen stehst!»
Ich schließe schnell die Wohnzimmertür, damit Luis, der mit seinem neuen ferngesteuerten Auto schon in sein Zimmer verschwunden ist, von diesem Thema verschont bleibt.
«Man sieht dir richtig an, dass es dir bessergeht», befindet meine Mutter.
«Findest du?», frage ich und freue mich. Heute Morgen war ich beim Blick in den Spiegel das erste Mal seit langem wieder zufrieden mit mir gewesen. Keine dunklen Ringe mehr unter den grünen Augen, ein paar Sommersprossen auf der Nase, die wunderbar zu den blonden Balayage-Strähnchen (oder wie der Friseur es nannte: der Must-have-wow-Effekt) in meinem hellbraunen mittellangen Haar passen. «Danke», sage ich schnell. «Das tut es auch. Wirklich. Ich fühle mich wie befreit, jetzt in der neuen Wohnung und mit dem neuen Job und so. Die Scheidung liegt hinter mir, da bin ich wirklich drüber weg. Jetzt schaue ich nur noch nach vorne und …» An dieser Stelle gerate ich ins Stocken, weil ich auf einmal feststelle, dass der Couchtisch mit seinen eisernen Rollen aussieht wie eine Lore.
«Ja, das ist toll», sagt meine Mutter. «Und jetzt hast du so eine schöne neue Wohnung mit so vielen … interessanten Möbeln.»
«Ich bin so froh, dass sie möbliert war», sage ich. «Da mussten wir nicht viel schleppen, und neue Möbel hätte ich mir gar nicht leisten können.»
«Wie jetzt? Ich dachte, Konstantin kommt für die neue Einrichtung auf, wo er doch all die anderen Möbel behalten hat», dröhnt mein Vater.
Ich merke, wie ich rot werde, und stecke schnell meine Nase in die Kaffeetasse. Mist. Ich wollte es eigentlich für mich behalten, weil ich mich richtig schäme, dass ich mich so über den Tisch habe ziehen lassen. Aber meine Mutter hat es natürlich schon bemerkt.
«Was?», fragt sie alarmiert.
Ich muss schlucken. Konstantin sagte, es sei am besten für uns, wenn wir nur einen Anwalt hätten, dann würde es billiger werden. Und dass wir es total schnell abschließen könnten, wenn wir uns auf geteiltes Sorgerecht und Verzicht auf das Trennungsjahr einigen. Und ich wollte genau das: es schnell hinter mich bringen. Mir tat alles so weh, besonders mein Herz, ich war total erschöpft von der ganzen Heulerei. Das ganze Scheidungsverfahren lief ab wie ein Film, ich sah mich da in dem Raum sitzen, mit Konstantin und diesem Koloss von Anwalt, und versuchte zu erfassen, was die beiden von sich gaben, während es in meinem Kopf rauschte und ich nur an drei Dinge denken konnte: an Konstantin und den Scheidungsgrund. Und an Luis’ Gesicht mit der Sorgenfalte. Als ich wieder zu mir kam, hatte ich die Trennungsvereinbarung unterschrieben, in der ich auf finanzielle und materielle Ansprüche verzichtete. Ich glaube, man nennt so etwas seelische Unzurechnungsfähigkeit.
«Aber nur, weil ich einen Rosenkrieg vermeiden wollte», rechtfertige ich mich meinen Eltern gegenüber. «Wegen Luis natürlich. Er hat es schon schwer genug, da braucht er nicht noch mitzubekommen, was sein Vater für ein mieser Kerl ist. Außerdem hatte Konstantin ja recht, es waren sein Haus und seine Möbel und – na ja …», sage ich, um das Thema optimistisch abzuschließen. «Immerhin bekomme ich für Luis Unterhalt, und den Rest schaffe ich auch allein.» Ich unterstreiche den letzten Satz mit einem energischen Lächeln.
Meine Eltern werfen sich einen Blick zu, dann tätschelt meine Mutter meinen Arm und holt tief Luft, als habe sie eine wichtige Ankündigung zu machen. «Weißt du, wir wollten nichts sagen, bis du wirklich drüber weg bist», sagt sie feierlich, und da wird mir mulmig. «Wir haben …»
«Dass das ein Hallodri ist, habe ich auf zehn Kilometer gegen den Wind gerochen!», posaunt mein Vater dazwischen.
«Ja», sagt meine Mutter, «dass das nicht gut ausgeht, das …»
«Ich wusste es!», schreit mein Vater. «Ich habe es von Anfang an gewusst!» Zur Bekräftigung haut er mit der flachen Hand auf den Tisch.
Ich zucke zusammen.
«Wir beide wussten es», sagt meine Mutter.
Wie jetzt? Ich schaue verwirrt zwischen beiden hin und her. Meine Mutter hat doch so gestrahlt, als ich den gutaussehenden Architekten angeschleppt habe!
«Ich habe zu deiner Mutter gesagt, Marlies, habe ich gesagt, das geht in die Hose.» Mein Vater scheint darüber äußerst zufrieden zu sein. Als hätte er nie mit Konstantin am Grill gestanden und sich stundenlang im Synchron-Wurstwenden geübt!
«Aber … aber warum habt ihr denn nichts gesagt? Ich meine, früh genug?», frage ich entgeistert.
«Ach», sagt meine Mutter. «Das hätte doch nichts gebracht. Wenn man verliebt ist, dann ist man doch für keinerlei Argumente zugänglich.»
Womit sie vermutlich recht hat. Ich war dermaßen in Konstantin verliebt, dass ich meinen Eltern kein Wort geglaubt hätte.
«Und jetzt ist das doch vorbei und abgehakt», befindet mein Vater. «Jetzt fängst du ein neues Leben an. Hast du schon ein Hobby?»
«Ein Hobby?», frage ich verwirrt.
«Hobbys sind das A und O der Geschiedenen und Rentner», doziert mein Vater. «Und weil ich jetzt Rentner bin, habe ich eine zweite Karriere begonnen. Eine Hobby-Karriere.» Er lacht dröhnend.
«Dein Vater ist jetzt im Männer-Kochclub», erklärt meine Mutter.
«Und außerdem lerne ich mauern und baue uns im Garten ein schönes Gewächshaus», verkündet er.
«Ein Gewächshaus?», schaltet sich meine Mutter erstaunt ein.
«Sicher! Du wolltest doch schon immer eines haben!»
«Ich … äh … wollte ich das?»
Er nickt stolz, dann langt er über den Tisch und tätschelt meinen Arm. «Du wirst sehen, ein neues Hobby ist wie ein neues Leben.»
Meine Eltern sind lange weg, Luis hat schon die Zähne geputzt, und ich lege mich wie immer vor dem Einschlafen zu ihm in sein neues Bett, das wir mit Hilfe von Star-Wars-Bettwäsche in ein Raumschiff verwandelt haben.
«Hey», sage ich. «Du hast zwei neue Poster!» Von der Wand über seinem Schreibtisch lächeln Manuel Neuer und Thomas Müller zu uns herüber.
«Die waren in der Fußballzeitschrift», sagt er. «Ich habe sie selbst aufgehängt. Sind ein bisschen schief.»
«Macht nichts, sieht schön aus», sage ich und denke an das erste Bild, das wir für Luis in seinem alten Kinderzimmer aufgehängt hatten. Es war eine lustige Arche Noah mit vielen bunten Tieren, die fröhlich über den Weltuntergang schauten. Konstantin erklärte Luis, das seien schlaue Viecher, die hätten sich vor der Flut gerettet. «Und was ist mit den anderen?», fragte der dreijährige Luis. «Die müssen schwimmen», antwortete Konstantin und fuhr dann zur Arbeit, während ich Luis beruhigen musste, dass das nur eine Geschichte sei und «in echt» kein Tier ertrunken sei. Trotzdem beschäftigte Luis das Thema «Welche Tiere können schwimmen und welche gehen unter» ziemlich. Und ein paar Tage später ersetzte ich das irritierende Arche-Bild mit einem vom kleinen Drachen Kokosnuss. Aber die Zeiten der Helden aus Bilderbüchern sind nun endgültig vorbei. An Kindern sieht man, wie die Zeit vergeht, sagte meine Tante immer, wenn sie zu Besuch kam. Den Spruch fand ich natürlich dämlich. Erst jetzt verstehe ich ihn. Ich kann kaum glauben, dass seit dem Arche-Noah-Poster fünf Jahre vergangen sind und mein kleiner Sohn schon ein richtig großer Junge ist.
«Wann komme ich endlich in den Fußballverein?», fragt Luis.
«Tja», sage ich. «Da müssen wir Papa fragen, der wollte das doch mit dir machen.» Schon vor der Trennung hatte Konstantin versprochen, mit ihm zum Probetraining zu gehen.
«Ja, aber wann?», beharrt Luis.
«Wir fragen Papa, wenn er am Mittwoch kommt, okay?», seufze ich und drücke meinen Jungen an mich. Einen Moment liegen wir still da und schauen uns das neue Zimmer an. Unsere Einschlafgespräche sind so was wie mein Highlight des Tages. Hier zwischen den Kissen und Decken an ihn gekuschelt fühlt sich mein Leben gut an. Da weiß ich, dass ich nicht alles falsch gemacht habe. Denn allen Katastrophen zum Trotz sind Luis und ich ein Team, das niemand auseinanderbringen kann. Außerdem überrascht er mich in solchen Momenten mit besonderen Fragen. So auch heute.
«Wissen ist doch Macht, oder?», fragt Luis plötzlich.
«Ja, so sagt man», antworte ich. «Aber das stimmt nicht immer. Wissen kann auch belastend sein. Wenn man zum Beispiel …», ich mache eine Pause, um ein gutes Beispiel zu finden, da sagt Luis schon:
«Wenn der FC Bayern zum Beispiel wüsste, dass er ein Spiel verlieren wird! Dann hätten die Spieler doch gar keine Lust mehr zu spielen.»
«Ja», sage ich. «Ganz genau.» Ich schiele nach links, um das Profil meines Sohnes zu bewundern. Die Nase, die sich keck gen Himmel reckt, von neun Sommersprossen verziert. Die langen Wimpern und den kleinen Mund, aus dem so kluge Worte kommen.
«Mama», fängt er jetzt an. «Was hättest du gemacht, wenn du gewusst hättest, dass Papa und du euch irgendwann scheiden lasst. Hättest du ihn trotzdem geheiratet?»
«Natürlich», antworte ich schnell, dann muss ich schlucken, weil ich auf einmal einen Kloß im Hals habe. «Man muss immer optimistisch bleiben», sage ich tapfer. «Und auch wenn es mal schlecht läuft, muss man daran glauben, dass alles gut ausgeht.» Auch wenn ich Luis normalerweise ermuntere, alle Fragen zu stellen, die ihm durch den Kopf gehen, hoffe ich doch, dass er nicht weiterbohrt. Dieser Kloß in meinem Hals breitet sich nämlich gerade unangenehm aus und drückt auf die Tränendrüse.
«Okay», sagt Luis. «Mama?»
O Gott, was will er denn jetzt noch von mir wissen?
«Darf ich noch was lesen?»
«Darfst du», sage ich erleichtert. «Noch zehn Minuten.»
Ich wünsche ihm eine gute Nacht, gebe ihm einen Kuss, winke ihm noch mal von der Tür und schaffe es tatsächlich, die Tränen zurückzuhalten, bis ich im Wohnzimmer angekommen bin. Dann setze ich mich an den Tisch und heule eine Zeitlang auf die krümelübersäte Kuchenplatte. Wie bin ich nur auf die Idee gekommen, dass ich super drauf wäre? Dass ich über die Scheidung hinweg wäre? Von wegen, kein rohes Ei mehr! Alles gelogen! Mein Leben ist wie dieser Kuchen, den ich gebacken habe. Nur zusammengehalten von einer Schicht Schokoglasur. Aber wenn ich mir ein Stück abschneiden will, dann zerbröselt alles.
«Die Zuschauer und die Betreuer sind es meistens, die die Aggressivität auf dem Spielfeld verursachen. Die flippen selbst an der Seitenlinie aus und regen sich dann auf, dass die Kinder anfangen, unfair zu spielen.» Hiltrud S., Jugendwartin
2
Bei einer Scheidung trennt man sich ja nicht nur von seinem Mann. Man trennt sich auch von seiner gewohnten Umgebung, der Alltagsroutine, von dem Gefühl, geliebt zu werden, und von dem Gefühl, es wert zu sein, geliebt zu werden. Und von seiner Kaffeemaschine. Und da stehe ich also am Montagmorgen und muss mich zusammenreißen, nicht schon wieder anzufangen zu heulen. Blöder Konstantin, denke ich. Noch blödere Caro. Deine Würde hast du dagelassen, aber wenigstens die Kaffeemaschine hättest du mitnehmen sollen. Da musste man nur auf ein Knöpfchen drücken, und schwupps hatte man im Handumdrehen eine Tasse Kaffee aus frisch gemahlenen Bohnen. Stattdessen mache ich es jetzt nach Oma-Art: mit der Hand kochendes Wasser durch einen Filter gießen.
«Luis, beeil dich», rufe ich und meine eigentlich das Wasser, das eine Ewigkeit braucht, bis es durch den Filter rinnt. Beim Abnehmen des Filters kleckere ich einen Schwung Kaffeesatz auf die Arbeitsplatte, und beim ersten Schluck verbrenne ich mir die Zunge. Ich schmiere Luis schnell ein Brot, suche meinen Lipgloss, der die unverschämte Angewohnheit hat, unbemerkt von einer Tasche in die andere zu wandern, und dann ist es auf einmal höchste Zeit. Schließlich ist der Schulweg jetzt etwas länger. Aber immerhin konnte Luis auf der Grundschule Langgasse bleiben.
Wir eilen also die Treppe runter, und ich lege einen Zahn zu, als wir im Erdgeschoss an Yanniks Tür vorbeikommen. Auf ein weiteres Zusammentreffen mit meinem Nachbarn bin ich wirklich nicht scharf. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, was der von mir denkt. Und wissen will ich es schon gar nicht. Doch Luis bleibt vor Yanniks Tür stehen, drauf und dran zu klingeln.
«Komm schon», zische ich Luis zu. «Du kommst noch zu spät.»
«Ich will Yannik nur fragen, wann er mit mir Fußball spielt», sagt Luis.
«Aber doch nicht jetzt!» Ich winke hektisch.
«Natürlich nicht jetzt.» Luis rollt verächtlich mit den Augen. «Aber nachher vielleicht.» Sein Finger bewegt sich auf den Klingelknopf zu.
«Nein», rufe ich entsetzt. «Nicht.»
«Aber ich brauche jemanden zum Fußballspielen», beharrt mein Sohn. «Wenn ich gegen die Hofmauer knalle, motzt die alte Frau vom Hinterhaus wieder.»
«Dann spiele ich halt mit dir», höre ich mich sagen. «Nur komm jetzt endlich.»
«Echt jetzt?» Luis reißt die Augen auf vor Überraschung.
Ich nicke tapfer. «Na klar!» Mist. Fußball spielen finde ich in etwa so verlockend wie alte Tapeten abkratzen. Aber bei einer Scheidung trennt man sich eben auch von dem Luxus, für Vätersachen nicht zuständig zu sein.
Wenn ich jetzt von Frauen höre, die für ihren Mann arbeiten, am besten noch als seine Sekretärin, dann kann ich nur sagen: Tut es nicht. Schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. Denn irgendwann wird er anfangen, euch auch zu Hause wie seine Sekretärin zu behandeln. Meine Mutter meint zwar, ich solle nicht von Konstantin auf andere Männer schließen, aber das heißt auch nicht, dass andere Männer nicht so sind wie Konstantin. Aus Erfahrung wird man klug, sagt man. Aus schlechten Erfahrungen noch klüger. Mein Intelligenzquotient hat sich seit der Scheidung mindestens verdoppelt. Was mich leider nicht davor bewahrt, mich andauernd saublöd zu fühlen.
Zum Beispiel an meinem ersten Arbeitstag bei Fliesen Günther vor fünf Wochen. Mein Vater hat mir den Job besorgt, Hans-Joachim Günther ist ein alter Kumpel von ihm.
«Verstehst du was von Fliesen?», fragte mich mein neuer Chef bei meiner Einstellung und hakte seine Daumen in den Gürtel unter seinem mächtigen Bauch ein.
Ich nickte tapfer und klappte den Mund auf, um Kompetenz zu verströmen, aber mir fielen nur Sätze ein wie «Ja, die kleben an der Wand oder auf dem Boden» und «Sie sind leicht zu reinigen, hab ich gehört». Aber mein neuer Chef schaute mich so liebenswürdig an, dass ich zerknirscht gestand: «Nee, nicht die Bohne.»
«Kein Problem. Ich bringe es dir bei!» Dann brüllte er aus seinem Büro in die Ausstellungshalle, an deren Ende zwei Schreibtische standen: «Wassily!» Und als Wassily angeschlendert kam, sagte Hans-Joachim Günther: «Wenn du etwas wissen willst, frag Wassily. Wassily weiß alles.»
Wassily gab einen kleinen zufriedenen Lacher von sich, aber sobald der Senior weg war, rollte er mit den Augen und sagte: «Der Chef übertreibt mal wieder. Ich weiß längst nicht alles. Nur alles über Fliesen! Und darüber, dass Guido Maria Kretschmer die ganze Welt täuscht. Der hat nämlich überhaupt keine Ahnung von Mode.»
Wassily hat kurze, an den Schläfen graumelierte Haare, etwas engstehende blaue Augen und zwei entzückende Grübchen in den blitzblank rasierten Wangen. Er trägt gerne schmal geschnittene Jacketts zu schwarzen Jeans und nennt sich selbst «Fliesendesigner». Am Anfang dachte ich, ein klarer Fall von russischer Selbstüberschätzung, aber seit ich ein paarmal mitbekommen habe, wie er die Kunden berät und ihnen am Computer Bilder zeigt, wie ihre Wohnung mit den neuen Fliesen aussehen könnte, bin ich der Meinung, dass seine überkandidelte Berufsbezeichnung völlig in Ordnung geht.
Neben Wassily arbeitet Olaf im Verkauf. Olaf ist fast zwei Meter groß, hat den Bauchumfang einer deutschen Eiche (wie Wassily sagt), er liebt Calvin-und-Hobbes-Cartoons und seine Freundin Kerstin, und sein Lachen klingt ein bisschen nach einer meckernden Ziege, was angesichts seiner Leibesfülle so komisch ist, dass Wassily und ich davon immer angesteckt werden. Außerdem kocht und backt Olaf leidenschaftlich gern und bringt nicht selten Kostproben davon mit zur Arbeit, um uns dann mit roten Bäckchen beim Probieren zu beobachten und unsere Meinung einzuholen.
Im Lager arbeiten noch Prek, Michi und Ali. Die drei sind für den Zuschnitt von Fensterbänken und Küchenarbeitsplatten und für die Lieferung bestellter Fliesen zuständig. Sie sind sehr nett und sehr wortkarg, es sei denn, es geht um die Bundesliga. Da reden sie sich schon mal in Rage. Aber ansonsten sind die drei ebenfalls sehr angenehme Kollegen.
Kurz und gut: Ich habe wirklich Glück gehabt mit meinem neuen Job, für den ich auch nur ein paar Kilometer weit in den Nachbarort fahren muss, wo Fliesen Günther in dem kleinen Industriegebiet seinen Laden hat.
«Hey», begrüßt mich Wassily an diesem Montagmorgen, «schickes Kleid.»
«Ach, das olle Ding», sage ich und wedele mit dem hellblauen Rock. «Habe ich vor hundert Jahren für einen Appel und ein Ei auf einem Markt auf Ibiza gekauft.»
«Carolin!», tadelt Wassily und wirft dramatisch die Arme in die Luft. «Eine Frau nimmt Komplimente mit einem Lächeln an. Höchstens ein Danke darf ihr über die Lippen kommen. Oder ein Lob an den Modesachverständigen.» Er lächelt kokett.
«Du spinnst», sage ich freundlich. «Aber ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, was ich ohne dich machen würde.»
«Ja, das geht allen so», sagt er und bleibt nur für einen Moment ernst, bevor er in schallendes Gelächter ausbricht.
In der Mittagspause, in der Hans-Joachim Günther für eine Stunde das Geschäft schließt, was wir natürlich zu ausführlichem Tratschen und Essen nutzen, murmelt Olaf heute was von «Überraschung» und «Neuigkeiten» und verschwindet mit einem Korb im Besprechungszimmer. Wassily und ich schauen uns verwundert an.
«Vielleicht kündigt er und macht ein Restaurant auf», rät Wassily.
«Oder ein Café. Würde auch gut passen. Aber es wäre echt schade, wenn er gehen würde», seufze ich.
«Nur meine Figur würde sich freuen», sagt Wassily und streicht sich über den Bauch, der so flach ist wie eine Fliese.
Das Besprechungszimmer ist ein schlichter Raum neben dem Chefbüro. Die Fenster zur Ausstellungshalle sind zum Teil aus Milchglas, sodass viel Licht hereinfällt, man aber nicht durchsehen kann. Auf der anderen Seite an der Wand hängen großformatige Fotos von Fliesen. Am Kopfende des langen Tisches steht Olaf vor einer cremeüberzogenen Torte, Sektkelchen und einer Flasche Sekt in einem Kühler. Seine Wangen glühen vor Aufregung, als er uns begrüßt.
«Oh, das sieht aber toll aus», lobe ich die Torte. «Meinen Kuchen vom Wochenende hättest du mal sehen sollen, ein Krümeldesaster sondergleichen, viel zu trocken war er.»
«Hast du vielleicht die Butter vergessen?», fragt Olaf.
«Nein, natürlich nicht!», protestiere ich. «Ich habe genau die angegebene Menge Margarine genommen.»
Olaf kneift skeptisch die Augen zusammen. «Diätmargarine?»
«Äh», sage ich ausweichend und werde rot, «ich weiß nicht?» Olaf schüttelt den Kopf. «Wirklich, Caro, die besteht doch aus Joghurt und Wasser und all so einem Kram. Gute Butter! Du musst immer gute Butter nehmen!»
Prek, Michi und Ali kommen herein, darauf hat Olaf nur gewartet. Er richtet sich noch etwas mehr auf, und dann verkündet er mit rosigen Bäckchen, dass er seine Kerstin heiraten wird. Der Chef springt auf und umarmt ihn, und auch die anderen gratulieren alle herzlich, was mir die Gelegenheit gibt, mich zu sammeln. Früher musste ich bei jeder Hochzeitsankündigung vor Glück weinen. Jetzt habe ich einen Kloß im Hals, weil ich all die schrecklichen Dinge vor Augen habe, die einem in der Ehe passieren können. Aber ich schaffe es, meine Erfahrungen in Sachen «Bund fürs Leben» für mich zu behalten und Olaf alles Gute zu wünschen. Ich meine, nur weil es bei mir nicht geklappt hat, heißt das ja nicht, dass es anderen genauso ergehen muss!
Olaf verteilt strahlend den Sekt. Alle greifen zu, nur der Chef lehnt ab mit der Ausrede, er müsse dringend telefonieren. Was ziemlich ungewöhnlich ist.
«Alles okay, Chef?», fragt Wassily.
«Sicher, sicher», antwortet Hans-Joachim im Hinausgehen, aber es klingt irgendwie nicht überzeugend.
Vermutlich macht es ihm doch mehr zu schaffen, als er zugeben will, dass wir hier im Ort Konkurrenz bekommen. Nächste Woche öffnet nämlich die Fliesenkette Casa Superiore eine Filiale keinen Kilometer von hier. Bisher hat er immer so getan, als lasse ihn das kalt, weswegen wir uns auch keine Sorgen gemacht haben. Olaf lenkt mich von meinen Gedanken ab, indem er mir einen Teller mit Kuchen in die Hand drückt.
«Und wir hatten schon gedacht, dass du ein Café aufmachst und uns verlässt», sage ich, nachdem wir auf ihn und Kerstin angestoßen haben und Prek, Michi und Ali mit ihrem Kuchen ins Lager verschwunden sind.
«Euch würde ich doch niemals verlassen», behauptet Olaf lächelnd.
Derweil beäugt Wassily den Kuchen. «Was ist da eigentlich drin?» Seit Olaf ihm einmal einen Möhrenkuchen untergejubelt hat, ist er ziemlich skeptisch Olafs Kreationen gegenüber.
«Nüsse», sagt Olaf. «Und Doppelrahm-Frischkäse.»
«Ehrlich? Keine Schweinereien? Wie Möhren?»
Olaf schüttelt den Kopf.
Wassily probiert ein Stück und nickt gnädig. «Wirklich gut», lobt er, aber als Olaf anfängt zu grinsen, stellt er klirrend den Teller ab und schreit: «Oh, ich wusste es! Ich bin schon wieder reingefallen! Was ist es diesmal?»
«Rotkohlkuchen.» Olaf freut sich diebisch über Wassilys Aufregung und fügt süffisant hinzu: «Oder hättest du lieber Rote-Bete-Kuchen gehabt?»
«Nein», sagt Wassily gedehnt. «Rote Bete esse ich nur in Borschtsch. Und da gehört Gemüse auch hin. In Suppe. Oder Eintopf. Aber doch nicht in Kuchen.» Demonstrativ schiebt er den Teller noch ein Stück weiter von sich.
«Lecker», sage ich begeistert. «Total saftig.» Auch Olaf mampft, ohne auf den eingeschnappten Wassily zu achten.
Der linst immer wieder auf den Kuchen und sagt schließlich: «Also gut. Ihr habt mich überredet.» In null Komma nix isst er das Stück auf. «Ihr Deutschen seid doch alle verrückt», brummt er dabei. «In Kuchen gehören Eier, Zucker, Mehl und Butter. Aber doch kein Gemüse. Was für ein Quatsch!» Er schüttelt den Kopf. «Aber das habt ihr alles Adolf Hitler zu verdanken.»
Ich pruste fast den Kuchen auf die Tischplatte. «Was hat denn Adolf Hitler mit Rotkohlkuchen zu tun?», frage ich entgeistert.
«Wegen Hitler habt ihr Deutschen generell ein schlechtes Gewissen», behauptet Wassily. «Das ist euch in Fleisch und Blut übergegangen. Und deswegen steckt ihr auch in Kuchen Gemüse rein. Um beim Kalorienschaufeln euer Gewissen zu beruhigen. Auf so eine idiotische Idee würden Russen niemals kommen!»
«Aber ihr macht aus Kartoffeln Schnaps», protestiert Olaf.
«Genau», sagt Wassily stolz. «Das ist die russische Mentalität! Wenn schon Gemüse, dann das Beste draus machen. Und wenn wir sündigen, dann richtig.» Mittlerweile hat er das ganze Stück verputzt und nimmt sich noch ein zweites. Dabei schaut er Olaf anklagend an. «Aber nur damit das klar ist, du bist schuld, wenn ich meine Topfigur ruiniere.»
Olaf verdreht die Augen. «Meinetwegen brauchst du nicht noch ein zweites Stück zu essen.»
«Doch, natürlich», sagt Wassily. «Wie kann ich nein sagen zu so einem köstlichen Kuchen? Das wäre sehr unhöflich! Außerdem – wie sagte meine Großmutter immer: Gibt es keinen Fisch, gilt auch der Krebs als Fisch.»
Als Mutter eines Sohnes bekommt man Einblicke in Dinge des Lebens, die man sich niemals hätte träumen lassen. Die drei wichtigsten sind:
Die durchschnittliche Überlebensdauer einer Jeans beträgt acht Tage, dann ist mindestens ein Loch im Knie.
Senator Palpatine ist Darth Sidious und bildet den Jedi Anakin Skywalker zum bösen Sith aus.
Fußball ist eine schmerzhafte Angelegenheit.
Besonders Letzteres wird bei der Stellenbeschreibung einer Mutter überhaupt nicht erwähnt. Diese Erkenntnis muss man sich schon selbst erarbeiten.
Wir sind hinter unserem Haus. Der Hinterhof ist ungefähr so groß wie ein Tennisplatz. An der Mauer zum benachbarten Getränkemarkt vorbei führt ein Weg zum Hinterhaus. Es gibt ein kleines Rasenstück und drei Tannen (die vermutlich irgendeinen protzigen Namen haben wie Latschenkiefer oder Goldlärche, aber für mich sind alle Nadelbäume einfach Tannen). Mit dem Ball gegen die Mauer schießen mag die Nachbarin aus der Erdgeschosswohnung des Hinterhauses nicht, wie sie Luis neulich ziemlich deutlich zu verstehen gegeben hat. Sie hat ihn verscheucht mit den Worten: «Hau ab mit deinem Ball.» Das finde ich echt dreist. Wenigstens höflich kann man bleiben. Ich meine, natürlich möchte ich keinen Ärger mit der Nachbarschaft haben, wo wir gerade eingezogen sind. Aber im Mietvertrag steht nichts davon, dass im Hinterhof nicht gespielt werden darf. Habe ich extra nachgeguckt. Und gegen ein bisschen Kicken auf dem Rasenstück wird die Nachbarin wohl nichts einzuwenden haben.
Solange ich meine Schmerzensschreie unterdrücke jedenfalls. Ich weiß nicht, wieso das im Fernsehen immer so leicht aussieht. Mir tut es weh. Denn erstens: Luis schießt total hart. Zweitens: Der Ball ist total hart. Drittens: Mein Fuß leider nicht. Er scheint für diese Sportart nicht gemacht zu sein.
«Aua», sage ich, als ich den Ball zu Luis kicke.
«Du musst den Fuß anders halten», ruft Luis. «So!»
Er macht es mir vor, aber ich kann gar keinen Unterschied erkennen zu meiner Fußhaltung. Vielleicht liegt es doch an meinen Sneakern, die nur aus dünnem Stoff sind, sodass ich bei jedem Schuss das Gefühl habe, mein Fuß würde auseinanderbrechen. Vielleicht habe ich aber auch irgendein undefinierbares Fußleiden. Fußballspezifische Knochenschwäche oder so. Gerade will ich Luis vorschlagen, lieber eine Runde Federball zu spielen, da sehe ich die bärbeißige Nachbarin auf ihre Terrasse treten. Ihr weißes Haupt leuchtet angriffslustig zu uns herüber. Sie hat eine Gießkanne in der Hand und beugt sich über ihre Blumenkästen, aber ich erkenne eine Drohgebärde, auch wenn sie als Geraniengießen getarnt ist. Aber ich werde ihr zeigen, dass wir uns von ihr nicht vertreiben lassen. Luis darf in diesem Hinterhof Fußball spielen. Punkt. Also beiße ich die Zähne zusammen und kicke tapfer weiter.
Mit Begeisterung spielt Luis mir die Bälle zu. Will die blöde Nachbarin vielleicht endlich reingehen, damit ich aufhören kann? Aber nein, jetzt fängt sie auch noch an, verblühte Blüten abzuknipsen, wobei sie immer wieder mit zusammengekniffenem Mund zu uns starrt. Ich hebe meinen Kopf noch etwas höher und lache angestrengt, damit sie sieht, wie viel Spaß wir haben und dass wir uns den von ihrer Miesepetrigkeit nicht verderben lassen. Lange halte ich aber nicht mehr durch. Luis donnert den Ball zu mir herüber, er steigt auf wie eine Rakete, einen Moment denke ich daran, ihn zu fangen, aber in einem Anfall von Vernunft lasse ich die Finger davon. Ich muss mir ja nicht auch noch die Hände verletzen. Der Ball segelt über mich drüber, und da erst kommt mir die Idee, dass eventuell eine Fensterscheibe in seine Schussbahn geraten könnte, auch die blöde Nachbarin legt die Hand an die Stirn wie ein erschrockener Cowboy bei der Sichtung schießwütiger Indianer. Ich ziehe die Schultern zusammen in Erwartung des Klirrens, das dem Fußballspielen im Hinterhof ein für alle Mal ein Ende bereiten würde. Doch dann höre ich, wie jemand den Ball schnappt.
«Guter Schuss, Luis», ruft Yannik, der mit der einen Hand sein Fahrrad schiebt, in der anderen den Ball hält.
«Hey, Yannik», ruft Luis.
Yannik stellt sein Rad ab, kickt Luis den Ball zu und grinst mich an. «Darf ich mitspielen?»
«Aber klar», sage ich erleichtert. «Ich wollte sowieso gerade eine Pause machen.» Also setze ich mich auf die Gartenbank, die unter einer der Tannen steht, und schaue den beiden zu.
Erstaunlicherweise ist die Nachbarin plötzlich von ihrer Griesgrämigkeit kuriert und ruft fröhlich: «Ach, Herr Brugger, genießen Sie auch das schöne Wetter?»
«Na klar, Frau Heinze», ruft Yannik zurück, und dann verwickelt ihn Luis in einen Zweikampf, in dem sie sich gegenseitig den Ball abzujagen versuchen.
Das Gesicht meines Sohnes leuchtet. Er muss in den Fußballverein, so viel steht fest. Ich kann ja nicht darauf bauen, dass sich unser Nachbar regelmäßig zum Kicken zur Verfügung stellt. Obwohl ich mich an den Anblick gewöhnen könnte.
«Pöbelnde Eltern beim Kinder-Kicken: In Hamburg wurde ein F-Jugend-Spiel zwischen Altenwerder und dem FC Vier- und Marschlande abgebrochen, weil die Eltern sich nach einem Schiri-Pfiff erst beschimpften und dann handgreiflich wurden. In Wiesbaden explodierte die Situation bei einem D-Jugend-Spiel, als eine Mutter Kommandos brüllte wie ‹Hau ihn um!›.» Bild am Sonntag, 14.12.2014
3
Es gibt Momente, da werden pädagogische Grundsätze auf einmal nebensächlich. Auf langen Autofahrten. Bei Partys, wo man wegen ein bisschen Gequengle des Kindes noch nicht gehen möchte. Und nach Scheidungen, wenn man mit ansehen muss, wie der eigene Sohn auf den unzuverlässigen Vater wartet.
«Willst du eine Runde Clash of Clans spielen?», frage ich und halte Luis das Tablet hin.
«Nö», antwortet er. Er sitzt im Flur, den Rucksack mit der Trinkflasche gepackt, und wippt missmutig mit der rechten Sandale auf und ab.
«Möchtest du vielleicht was Süßes?», rufe ich heiter.
Er schüttelt den Kopf und vergräbt das Kinn in seinem T-Shirt, womit er den Kragen ausleiert – was normalerweise absolut verboten ist.
Ich seufze. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht mehr für ihn tun kann, als ihm die Wartezeit so angenehm wie möglich zu machen. Gleichzeitig fühle ich mich schlecht, weil ich ihm viel mehr durchgehen lasse, als aus erziehungstechnischer Sicht gut ist. Das Schlimme ist aber, dass ich ganz offensichtlich das einzige Elternteil bin, das ein schlechtes Gewissen verspürt. Denn Konstantin der Große hat noch nicht mal ein Problem damit, Verabredungen mit seinem Sohn zu vergessen. Er ist schon zwanzig Minuten überfällig, um ihn zu einem Basketballspiel mitzunehmen.
«Lass mal dein T-Shirt in Ruhe», mahne ich sanft und greife zum Telefon. Konstantin meldet sich mit seiner Wer-wagt-es-mich-zu-stören-Stimme, und ich habe sofort wieder diese Szene vor sechs Monaten vor Augen, als er mich anherrschte: «Was machst du denn hier?» Und das in meinem Exhaus. In meinem Exwohnzimmer. Und in meinem Schock sagte ich damals tatsächlich: «Entschuldigung.» Und ging raus, auf wackeligen Beinen und mit Watte im Kopf und diesem Bild vor Augen, das sich für immer auf meiner inneren Festplatte eingebrannt hat. «Wo steckst du denn?», frage ich und versuche, den Ärger zu unterdrücken.
«Wieso?», blafft er zurück.
«Na, Luis wartet. Ihr wolltet doch zu den Telekom Baskets.»
«Ach, stimmt!», fällt ihm ein. «Nee du, ich schaff’s heute nicht. Ich habe einen Termin mit Rolf Gerling, höchstpersönlich. Das sagt dir doch was, oder? Gerlingversicherungen?»
Und wenn er mit der Queen einen Termin hätte, sein Sohn ist doch wohl wichtiger! Das werde ich ihm jetzt auch ganz deutlich klarmachen. Nur nicht da, wo Luis es hören kann. Also gehe ich ins andere Zimmer, um ihm eine Standpauke zu halten, da sagt er schon: «Sag ihm, beim nächsten Mal.» Und legt auf. Noch nicht mal eine Entschuldigung! Unfassbar. Und auch keinerlei Gelegenheit, ihn anzuschreien. Luis sitzt nach wie vor auf seinem Stuhl, die kleine Falte auf der Stirn.
«Basketball fällt aus», sage ich und bemühe mich um eine fröhliche Stimme. «Aber dafür darfst du dir jetzt aussuchen, was wir beide unternehmen!»
«Egal was?»
«Egal was», sagt mein schlechtes Gewissen. «Kino, Schwimmbad, Eisdiele.»
Sein Gesicht fängt wieder an zu leuchten. «Dann will ich in den Fußballverein. Jetzt.»
«Gut», seufze ich. «Dann also Fußballverein.»
Das Probetraining ist allerdings erst am nächsten Tag, wie ich herausfinde. So können wir wenigstens noch Fußballschuhe kaufen gehen.
«Warum klebt denn da ein Dino zwischen den Sternen?», frage ich und deute an die Zimmerdecke mit den fluoreszierenden Sternen, die meine Mutter ihm geschenkt hat.
«Ist doch klar», sagt Luis. «Das Licht, das wir heute von den Sternen sehen, ist schon viele Millionen Jahre alt. Und damals lebten noch Dinosaurier.»
«Hmm», mache ich. «Da ist was dran.»
Eine Zeitlang liegen wir da und gucken in das Urzeit-Universum.
«Mama», fängt Luis dann an. «Wie verliebt man sich eigentlich?»
«Tja, gute Frage», sage ich. «Man trifft jemanden, den man nett findet, und dann merkt man plötzlich, dass man immer an denjenigen denken muss und sich total freut, wenn er in der Nähe ist.» Ich schiele zur Seite und kann es kaum glauben. Mein kleiner Junge interessiert sich schon für die Liebe! Wer von seinen Klassenkameradinnen könnte denn die Glückliche sein? Vielleicht Emily, die ist süß. Oder Cara. Na ja, auf jeden Fall bin ich mir sicher, dass die Mädchen irgendwann Schlange stehen werden.
«Und wie entliebt man sich?», fragt Luis weiter.
«Äh», mache ich, atme einmal tief durch und überlege, wie ich das jetzt am besten erklären soll. «Na ja», sage ich dann. «Man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass die Liebe eine Batterie ist, die am Anfang, wenn man frisch verliebt ist, total voll ist. Und dann verbraucht man jeden Tag ein bisschen Energie, und irgendwann ist die Batterie leer.»
Luis ist einen Moment still. Dann wendet er ein: «Aber es gibt doch aufladbare Akkus.»
«Ja. Das ist richtig.»
«Aber Papa und du, ihr hattet keinen Auflade-Akku.»
«Nein», seufze ich. «Leider nicht.»
«Schade», sagt er.
Ich drücke ihn an mich, und es tut mir mal wieder unendlich leid, dass ich es nicht verhindern konnte. Um ihn vor dem Einschlafen auf bessere Gedanken zu bringen, füge ich hinzu: «Morgen gehen wir zum Probetraining! Das wird bestimmt klasse!»
«Durch positiven Umgang mit Spielern/-innen, Eltern und Schiedsrichtern schaffen die Trainer und Betreuer ein gutes Klima für das mannschaftliche Miteinander und vermitteln Spaß am Mannschaftssport. Als Repräsentanten des Jugendfußballs verzichten alle Trainer und Betreuer auf Alkohol und Rauchen im Umfeld der Spieler/Spielerinnen.» Aus dem Leitfaden Jugendfußball des TSV Maulbronn
4
Der Platz des 1. FC Reschheim liegt am Rand des gleichnamigen Ortes, der knapp zwei Kilometer entfernt ist, aber auch noch zum Stadtgebiet gehört. Die Sonne lockt zum Draußenspielen, und Luis plappert, seit wir von zu Hause losgefahren sind, aufgeregt auf mich ein. Auch bei mir steigt die Spannung. Erstens habe ich von Fußballvereinen ungefähr so viel Ahnung wie von Teilchenphysik, und zweitens wirkt das Vereinsgelände größer als gedacht. Während ich an den belegten Parkplätzen vorbeirolle, verfluche ich Konstantin, der sich schon immer das Recht rausgenommen hat, in Sachen Haushalt und Kinderbetreuung nur für das zuständig zu sein, wozu er gerade Lust hat. Und jetzt ist es also so weit, dass ich mich eben auch um die Sachen kümmere, für die er eigentlich die Verantwortung zu übernehmen angekündigt hatte.
Ein Nissan Micra steht mitten auf der Linie zwischen zwei Parkplätzen. «Da hätten wir uns hinstellen können», sage ich mehr zu mir selbst, «aber der muss ja zwei Parkplätze blockieren. Ah, dahinten ist einer!» Ich steuere den freien Platz neben einer Hecke an und nehme mir vor, es auf jeden Fall besser zu machen als dieser rücksichtslose Nissan. Wäre doch gelacht! Rückwärtsgang rein und … hoppla. Wo kommt denn auf einmal der Bordstein her? In Gedanken höre ich Konstantin, der in derartigen Situationen immer spottete: «Mit deinen Einparkkünsten melde ich dich bei Wetten dass..? an.» Dieser Idiot!
«Mama, was machst du da?», fragt Luis.
«Das siehst du …» Vorwärtsgang, Rückwärtsgang. «… doch.» Jetzt habe ich genug Abstand zu der Hecke auf meiner Rechten. Oder doch zu viel? «Wie weit sind die Büsche noch weg, Luis?»
«Ich weiß nicht. Zwei Meter?»
«Das sind doch niemals … aber gut. Setze ich ihn was näher ran.» Knirsch. Verdammt. Heimtückische Brombeerhecke. Hoffentlich hat sie nicht den Lack zerkratzt. Also, noch mal vor. Und zurück.
«Wie lange dauert das noch?», fragt Luis.
«Moment …» Mit der Zunge zwischen den Lippen bugsiere ich das Auto in die Lücke. «Bin schon fertig!», sage ich freudestrahlend. «Na, wer sagt’s denn? Perfekt!»
«Warum lacht der Mann da so?», fragt Luis.
«Äh … welcher Mann?»
«Der da vorne mit dem Anzug.»
Jetzt sehe ich ihn. Einen Typen im schicken schwarzen Anzug, der auf den Parkplatz eines Sportvereins ungefähr so gut passt wie ein Schneemann in die Wüste. Und er glotzt in meine Richtung und grinst. Ich steige aus.
«Da soll noch mal einer sagen, Frauen könnten nicht einparken», sage ich laut zu niemand bestimmtem. Keine Ahnung, warum der Schnösel noch mehr lacht. Aber dann klingelt sein Telefon, er setzt sofort die Miene von Mr. Wichtig auf und spaziert mit dem Handy am Ohr auf den Fußballplatz.
Luis dribbelt mit seinem Ball ungeduldig los, und ich trotte ihm nach, durch das Eingangstor des 1. FC Reschheim. Hinter einem gepflasterten Vorplatz liegt ein großes Fußballfeld zwischen zwei kleineren, und überall trainieren verschiedene Kindermannschaften, alleine auf dem großen Platz sind es vier.
«Wo müssen wir hin?», fragt Luis aufgeregt.
«Gute Frage», sage ich und kneife die Augen zusammen. Konstantin hat immer gesagt, ich hätte das Orientierungsvermögen eines Maulwurfs im Sonnenschein. Aber hier ist wirklich schwer durchzublicken. Überall wuseln Jungs in Trikots herum, Grüppchen von Müttern stehen da und quatschen, Bälle fliegen durch die Luft, und kleinere Kinder flitzen mit Rollern und Laufrädern vorbei.
«Den da vorne kenne ich», ruft Luis, «der ist auch in der dritten Klasse.»
«Okay», sage ich erleichtert. «Dann ist das wohl die F-Jugend.»
Wir steuern das große Fußballfeld an, an dessen linker Seite ein Haufen Jungs in grün-schwarzen Trikots auf den Pfiff eines Trainers hin zusammenkommt, ihn umringt und ihm aufmerksam zuhört. Ich bin jetzt schon beeindruckt von der Disziplin. Am Rand befindet sich eine Art Minitribüne aus ausgeblichenen Holzdielen und Beton. Davor stehen die Mütter zusammen und unterhalten sich, während sie das Training beobachten. Ich gehe auf zwei von ihnen zu.
«Und der Trainer hat gesagt, mein Simon hätte eine außerordentliche Spielintelligenz», sagt die eine Mutter, dunkelhaarig, energisches Kinn, während sie die Mannschaft nicht aus den Augen lässt. «Außerordentlich! So was gäbe es ganz selten, hat der Trainer gesagt.»
«Wirklich?», näselt die andere Mutter. Sie hat die Figur eines Torpfostens, und auf ihrem T-Shirt steht Fuck Diet, was mich irritiert, weil sie eine Diät ungefähr so dringend braucht wie ein Fisch eine Pudelmütze. «Mein Joel hat ja schon lange eine Einladung vom 1. FC Köln.»
«Ach, ich dachte, er wäre nicht genommen worden», gibt Simons Mutter zurück.
«Das ist noch nicht entschieden», sagt die dürre Diäthasserin hastig. «Er soll noch ein zweites Mal kommen. Die Konkurrenz war sehr stark beim ersten Probetraining, wirklich, das haben alle gesagt.»
«Das ist normal beim FC», sagt Simons Mutter abschätzig, «vielleicht ist Joel einfach noch nicht so weit. Mein Simon dagegen …»
Die Diäthasserin stöhnt fast unhörbar und wendet sich mir zu, während Simons Mutter unbeirrt weiterprahlt.
«Hallo», sage ich. «Wir sind hier für das Probetraining der F-Jugend.»
Als hätte ich irgendeinen Alarmcode benutzt, stoppt Simons Mutter ihre Lobhudelei. Sie und die Diäthasserin schauen mit unbeweglichen Mienen von mir zu Luis. «Ich habe mit Herrn Riedel telefoniert», rechtfertige ich mein Anliegen.
«Wir sind hier die F1», antwortet Simons Mutter gespreizt und zuckt mit den Schultern, als wäre damit alles gesagt.
«Ja!» Ich nicke eifrig. «Wir wollen ja auch zur F-Jugend.»
«Ist er ein Anfänger?» Die Diäthasserin deutet mit ihrer spitzen Nase auf Luis.
«Ja, natürlich», sage ich heiter und lege Luis den Arm um die Schulter.