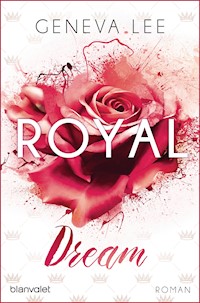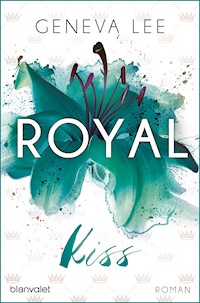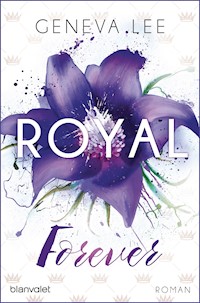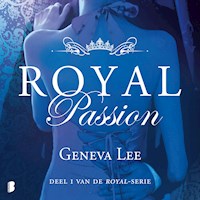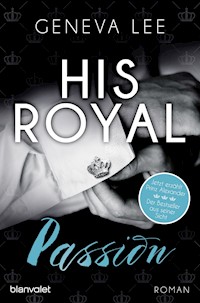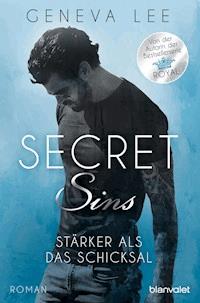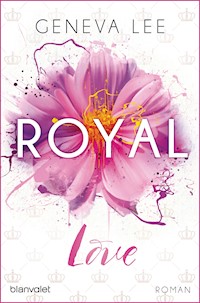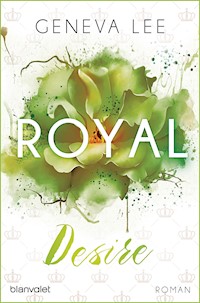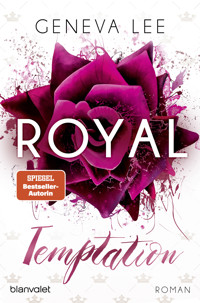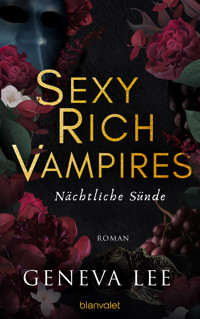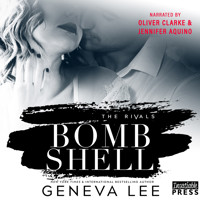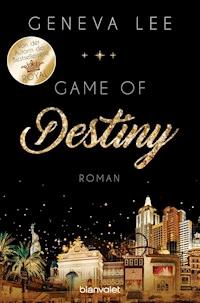
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Love-Vegas-Saga
- Sprache: Deutsch
Viva Las Vegas! Verbotene Küsse, gefährliche Liebe und gestohlene Herzen – in der sündigsten Stadt der Welt ...
Die leidenschaftliche Liebe, die Emma Southerly und Jamie West verbindet, konnten auch die jüngsten Ereignisse in Belle Mère nicht ins Schwanken bringen, sie sind sich näher denn je. Doch der Mord an Jamies Vater bleibt ungeklärt und hält die High Society von Las Vegas weiter in Atem. Das junge Paar muss fest zusammenhalten, um nicht weiter in den Fokus der Polizei zu geraten. Doch das ist nicht Emmas einziges Problem: Sie wird von der dunklen Vergangenheit ihrer Familie eingeholt und muss sich schließlich einer bitteren Wahrheit stellen – doch das könnte bedeuten, dass sie Jamie für immer verliert …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Die leidenschaftliche Liebe, die Emma Southerly und Jamie West verbindet, konnten auch die jüngsten Ereignisse in Belle Mère nicht ins Wanken bringen, sie sind sich näher denn je. Doch der Mord an Jamies Vater bleibt ungeklärt und hält die High Society der Stadt weiter in Atem. Das junge Paar muss fest zusammenhalten, um nicht weiter in den Fokus der Polizei zu geraten. Doch das ist nicht Emmas einziges Problem: Sie wird von der dunklen Vergangenheit ihrer Familie eingeholt und muss sich schließlich einer bitteren Wahrheit stellen – doch das könnte bedeuten, dass sie Jamie für immer verliert …
Autorin
Geneva Lee ist eine hoffnungslose Romantikerin und liebt Geschichten mit starken, gefährlichen Helden. Mit ihrer Royals-Saga um den königlichen Bad Boy Prinz Alexander begeisterte sie die Leserinnen und stürmte die internationalen Bestsellerlisten. Geneva Lee lebt gemeinsam mit ihrer Familie im Mittleren Westen der USA.
Geneva Lee ist online zu finden unter
www.geneva-lee.de, www.facebook.com/genevaleeauthor
Von Geneva Lee bereits erschienen
Secret Sins – Stärker als das Schicksal
Die Royals-Saga
Royal Passion (01) • Royal Desire (02) • Royal Love (03) • Royal Dream (04) • Royal Kiss (05) • Royal Forever (06) • Royal Destiny (07)
Die Love-Vegas-Trilogie
Game of Hearts (01) • Game of Passion (02) • Game of Destiny (03)Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag
GENEVA LEE
GAME OF
Roman
Band 3
Deutsch von Charlotte Seydel
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »All Fall Down« bei Ivy Estate, Kansas City.1. Auflage
Copyright der Originalausgabe © 2016 by Geneva Lee
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2018 by Blanvalet Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Redaktion: Susann RehleinUmschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (© Lauritta) und PatternPictures/pixabay.comWR · Herstellung: samSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-20904-9V002www.blanvalet-verlag.de
Für Josh, der es kommen sah
Später
Nach den Ferien sind wir an der Belle Mère Prep zurück. Manche haben den Sommer in Europa verbracht, andere ein paar neue sexuelle Eroberungen gemacht. Ich bringe einen Leibwächter mit. Das ist doch besser als nichts.
Sollen sie mich in den Fluren ruhig anstarren. Wer kann es ihnen verdenken? Schließlich habe ich den Großteil des Sommers als Hauptverdächtige in einer Mordermittlung zugebracht. Meine Mitschüler glotzen mich an, als ich mich hinsetze. Zweifellos versuchen sie zu erkennen, ob sich schon ein Babybäuchlein abzeichnet. Das würde das Ganze noch toppen.
Das habe ich dem TMZ zu verdanken, diesem Klatschblatt.
Doch während sie gaffen, muss ich immerzu an jene denken, die heute Morgen nicht da sind, um ihr letztes Schuljahr zu beginnen. Ihre Abwesenheit beunruhigt mich genauso wie ein unerklärlicher Schatten in einem leeren Zimmer. Manche sind weg. Eine hat das Ende des Sommers nicht mehr erlebt.
Lebendig oder tot – jetzt sind sie Gespenster, und ich bin es ihnen schuldig, aus ganzem Herzen zu leben.
Manchmal sind Entscheidungen gefragt. Beispielsweise, wenn man eine Tür öffnet und davor jemand steht, mit dem man absolut nicht gerechnet hat. Soll man die Tür wieder zuschlagen oder so tun, als wäre man erfreut? Ein netter Mensch würde die Ertappte vielleicht gnädig davonkommen lassen. Doch dass ich nett bin, muss ich mir nicht vorwerfen lassen. Jedenfalls nicht von Monroe West.
»Monroe.« Als sie ins Zimmer tritt, spreche ich sie mit dem Namen an, unter dem ich sie kenne. Dann korrigiere ich mich: »Ich meine, May. Wie ich sehe, hast du deinen Traumjob gefunden.«
May West. Das hat was. Ich frage mich, ob sie sich etwas dabei gedacht hat oder ob sie versehentlich ein so berühmtes Pseudonym gewählt hat. Ihr normalerweise glattes Haar fällt ihr in Wellen über die Schultern, und sie hat so viel Lidschatten aufgetragen, dass ein Pornostar vor Neid erblassen würde. Sie sieht nicht mehr wie eine Siebzehnjährige aus gutem Hause aus, sondern würde auch als verlebte fünfundzwanzigjährige Showtänzerin durchgehen. Stünde sie nicht direkt vor mir, hätte ich meine Mitschülerin, die Schwester meines Freundes und – wenn ich das so sagen darf – völlig durchgeknallte Zicke, womöglich gar nicht erkannt. In letzter Zeit waren wir uns ein kleines bisschen näher gekommen, aber irgendetwas sagt mir, dass diese unerwartete Begegnung uns weit zurückwerfen wird.
Monroe zupft an dem paillettenbesetzten silberfarbenen Schlauch, der vorgibt, ein Kleid zu sein, und sieht mich wütend an. Eins muss man ihr lassen: Die Angst, die ich kurz in ihren Augen aufblitzen sah, als ich die Tür öffnete, ist nun hinter einer bösartigen Maske verschwunden. Trotz des gewagten Kleides wirkt sie im Zimmer dieses Fünfsternehotels nicht deplatziert. Andererseits ist in diesem Zimmer des West Casino Hotel alles mehr Schein als Sein: Das fängt mit dem schimmernden Glanz der Tapeten an und reicht bis zu der prall gefüllten Minibar. Diese Schwäche scheinen die Hotels von Nathaniel West und seine Familie gemeinsam zu haben.
»Wie viel?«, fragt sie mit zusammengebissenen Zähnen.
»Ich dachte, ich müsste dich bezahlen.« Ich schließe die Tür und lehne mich dagegen. Als sie begreift, dass ihr der Ausgang versperrt ist, bekommt sie schmale Augen.
»Spar dir die Witze«, zischt sie. »Was willst du, damit du die Klappe hältst?«
Ich atme hörbar aus. »Ein Pony. Das verlorene Atlantis. Und vielleicht noch eine Reise zum Zauberer von Oz.«
Ich mache mir nichts vor. Wäre die Situation umgekehrt, würde die böse Hexe des Westens, alias mein Herzchen Monroe, die Nachricht von meinem Sündenfall an der Belle Mère Prep breittreten. Aber ich will ihr nicht schaden, darum bin ich nicht hier. Dass ich hier bin, hat nur einen einzigen Grund: der Dealer.
Vor ein paar Tagen war ein mysteriöses neues Foto in der Timeline vom Dealer aufgetaucht. Ich hatte nicht erwartet, dass die Spur zu einer Escort-Agentur führen würde. Als ich begriffen hatte, ließ ich es darauf ankommen und tat, als würde ich mich dort für einen Job interessieren. Der Trick funktionierte, und es gelang mir, einen Termin mit May einzutragen. Ihr Name war der einzige Hinweis, mit dem der Dealer seinen Post versehen hatte.
Doch weshalb führte er mich her? Was haben Monroes außerschulische Aktivitäten mit der Nacht zu tun, in der Nathaniel West umkam? Ich dachte, der Zweck dieses Instagram-Accounts sei es, den Mörder zu offenbaren. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Vielleicht legt es der Dealer auch nur darauf an, jeden Einzelnen von uns auf schlimmste Weise zu blamieren.
Monroe kommt auf mich zu und bohrt mir ihren Zeigefinger in die Brust. »Wie hast du es überhaupt herausbekommen?«
Ich weiche zur Seite aus und gehe zur Minibar. Dort greife ich mir zwei kleine Fläschchen West Tennessee Whisky. Eines werfe ich ihr zu. Auch wenn sie cool tut, ist mir klar, dass sie eine flüssige Stärkung genauso gut vertragen kann wie ich.
Als sie das Etikett sieht, rollt sie mit den Augen und stolziert zur Bar. »Ich bevorzuge Gin.«
»Gehört West Tennessee Whisky nicht eurer Familie?«, frage ich, drehe den Verschluss ab und leere den Inhalt mit einem einzigen Schluck. Er läuft mir heiß die Kehle hinunter und entfacht ein Feuer in meinem Magen.
»Ja, aber meiner Familie gehört sowieso alles.« Ihre Stimme klingt brüchig, doch das spült sie mit dem Whisky hinunter. Dann sucht sie noch ein Fläschchen Beefeater Gin heraus.
»Was machst du nur?«, frage ich, und plötzlich ist es kein Verhör mehr. Ich will keine Informationen aus ihr herausquetschen. Stattdessen möchte ich sie am liebsten schütteln. Ich empfinde nicht gerade Zuneigung für Monroe West, aber ich weiß, was sie ihrer Familie damit antut. Ich mag ihre Mutter, und in ihren Bruder bin ich verliebt. Die beiden mussten dieses Jahr ohnehin so viel durchmachen, das hier könnte den Zusammenhalt ihrer Familie endgültig zerstören.
»Was geht dich das an?«
Das klingt nicht gerade wie ein Hilfeschrei. »Der Dealer hat mich hergeschickt, und das heißt, dass dir jeder, der seine Posts verfolgt, hier die Tür hätte öffnen können.«
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Polizei und das FBI von dem Account Wind bekommen. Dann gibt es richtig Ärger. Zurzeit folgen dem mysteriösen Feed nur eine Handvoll Leute, und jeder von uns hat gute Gründe, sich für die Identität unseres netten Nachbarschafts-Stalkers zu interessieren. Der Dealer hat nicht gerade unsere Sternstunden gepostet, weshalb die Bilder auch noch keiner geteilt hat – bis jetzt.
»Was hat er gegen dich in der Hand?«, fragt sie, und ihre Augen blitzen, als sei ihr plötzlich etwas Wichtiges klar geworden.
Monroe ist wohl doch nicht so dumm, wie sie aussieht. Ich hatte schon immer den Verdacht, dass ihr Auftreten als blonde, hohlköpfige Erbin nur Show ist und sie mehr begreift, als sie zugibt – jetzt bin ich mir sicher. Dass ich hier gelandet bin, habe ich auch nicht allein meiner Neugier zu verdanken. Ich zucke die Schultern.
»Vielleicht hat er den Beweis, nach dem Mackey sucht«, sagt sie und nimmt sich noch ein Fläschchen, stürzt es diesmal jedoch nicht mit einem Schluck hinunter, sondern nippt nachdenklich daran und mustert mich, wahrscheinlich sucht sie in meinem Verhalten nach einem Hinweis, der ihren Verdacht bestätigt.
»Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber er hat nichts gegen mich in der Hand«, sage ich. Keines der Fotos in dem Feed schien direkt auf mich abzuzielen, doch viele nahmen jemanden aus meiner Umgebung aufs Korn. Für das FBI sind allerdings die Leute in meinem Umfeld schon so gut wie ein Schuldbeweis. Schlechter Umgang. Plötzlich fällt mir etwas ein. »Ich weiß, was ich für mein Schweigen haben möchte.«
»Ja?«, bellt sie. Ich könnte schwören, dass ihre Augen für den Bruchteil einer Sekunde rot glühen wie bei einem Dämon, aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein.
»Die Wahrheit.« Wenn Monroe von mir verlangt, über meine Entdeckung Stillschweigen zu bewahren, muss sie mir zuerst sagen, warum sie das hier überhaupt tut.
»Wahrheit ist heutzutage Mangelware.« Sie lässt sich in einen Sessel fallen und starrt durch das große Fenster hinaus auf die glitzernden Lichter der Stadt. Selbst am Tage setzt Vegas sein schönstes Gesicht auf, um Touristen mit der Aussicht auf Glück und Reichtum zu locken. Monroes Blick bekommt etwas Abwesendes, als hätte die Stadt sie ebenso in ihren Bann gezogen wie all die anderen.
»Warum?« Ich lasse nicht locker. »Du hast doch alles. Warum wirfst du das weg?«
»Glaubst du, ich würde es wegwerfen?« Sie reißt den Kopf herum und starrt mich wütend an. »Weißt du, was Vegas ist? Ein Platz für Träumer. Hier kann man leicht aus der Spur geraten. Frag deinen Daddy.«
»Frag doch deinen«, kontere ich kühl.
Sie verzieht kurz das Gesicht, doch dann lacht sie hohl, wirft sich das Haar über die Schulter und fährt fort: »Entweder geht man unter, oder man macht etwas aus sich.«
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Monroe ihre Wahl bereits getroffen hat, aber das behalte ich für mich. Wenn ich sie weiterhin provoziere, werde ich nie die Antworten erhalten, auf die ich aus bin.
»Mein Vater ist aus eigener Kraft stinkreich geworden. Alle erwarten von mir, dass ich den Rest meines Lebens im Wellnesscenter oder beim Shoppen verbringe. Ich brauche nicht zu arbeiten.« Sie blickt kurz zu mir herüber, um sich zu vergewissern, dass ich ihr zuhöre. Ich nicke, damit sie weiterredet. »Aber ich will keine von diesen Erbschleicherinnen werden, die auf Kosten anderer leben. Gott weiß, dass es davon schon genug auf der Welt gibt.«
»Willst du lieber eine Nutte sein?« Die Frage ist mir so rausgerutscht, und ich kneife die Lippen zusammen. Mein Hang zum Sarkasmus ist wirklich ein Problem.
»Ich bin keine Nutte«, sagt sie und wirft mir einen vernichtenden Blick zu.
»Escort«, korrigiere ich mich und hänge noch ein »Tut mir leid« an.
»Mein Vater hat sein Vermögen mit Spielern verdient. Er hat Geld mit Geld gemacht. Jameson wird sein Reich übernehmen. Keine Arbeit. Keine Herausforderung. Es gehört ihm einfach.«
»Ich bezweifle, dass er das auch so sieht.« Als sie meinen Freund erwähnt, erwacht mein Beschützerinstinkt.
»Natürlich nicht. Wie die meisten Männer kann er sich den Luxus leisten, sich über seine Lebensumstände zu beklagen und gleichzeitig alle Vorteile zu genießen, die sie bieten.« Sie zeigt mit dem Finger auf mich, dann auf sich: »Wir beide können das nicht.«
Bin ich jetzt auf einmal ihre Schicksalsgenossin? Tja, Wunder gibt es immer wieder. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass unser Zwei-Mädels-Frühstücksclub noch einmal stattfinden wird, nachdem wir diesen Raum verlassen haben.
»In Vegas gibt es jede Menge Geld. Es ist fast schon eine Schande, Geld mit Geld zu verdienen.«
»Dann willst du also Geld mit Sex verdienen?«, rate ich.
»Ich werde mit Sex ein Imperium aufbauen«, korrigiert sie mich. »Die jüngste Bordellchefin in der Geschichte von Vegas. Ich habe das Geschäft von den Besten gelernt, und seien wir ehrlich: Ich bin gebildet.«
Ich denke an den Englischunterricht zurück. Vermutlich muss man sich nicht groß mit klassischer Literatur auskennen, um eine Escort-Agentur leiten zu können.
»Um die Konkurrenz brauche ich mir keine Sorgen zu machen.« Die Aussage ist ganz klar ein Köder.
Und ich beiße an: »Wieso nicht?«
»Weil alle Angst davor haben werden, dass ich auspacke. Weil sie mich eingestellt haben, als ich noch minderjährig war. Ich werde mich als geschäftliche Naturbegabung präsentieren«, beendet sie ihren Vortrag.
Sich als Volltrottel zu präsentieren gelingt ihr jedenfalls schon ganz gut, denke ich.
Monroe betrachtet mich einen Moment, mit Sicherheit fragt sie sich, was ich jetzt von ihr denke. »Wenn das mit Jameson nicht klappt, hätte ich vielleicht einen Job für dich.«
»Ich glaube, wir zwei sollten lieber keine Geschäfte miteinander machen.« Dass Monroe nicht nur meine Highschool-Feindin, sondern auch noch meine Zuhälterin sein soll, ist doch ein bisschen viel auf einmal.
»Du weißt ja, wo du mich findest«, sagt sie unbeeindruckt. »Und wenn du mich jetzt bitte entschuldigen würdest, ich habe wichtigere Dinge zu erledigen. Und du … hast sicher auch noch etwas vor.«
Mit deinem Bruder zum Beispiel.
Als sie gegangen ist, lege ich mich aufs Bett und starre an die Decke. Wie die Teile eines geheimnisvollen Puzzles treten einzelne Schemen aus der Dunkelheit hervor. Eine Frage habe ich Monroe zu stellen vergessen: Welches Interesse könnte der Dealer daran haben, sie zu outen? Ich frage mich, ob ich etwas übersehen habe. Ich suche auf meinem Handy nach einer Antwort, doch da ist nichts. Als ich Instagram öffne, ist das Foto verschwunden. Sieht aus, als hätte der Dealer meine Botschaft verstanden und endlich reagiert. Das müsste sich eigentlich wie ein Sieg anfühlen, doch stattdessen habe ich das Gefühl, mir eine riesige Zielscheibe auf den Rücken gemalt zu haben.
Meine Sandalen klackern über den Marmorfußboden der Lobby des West Resort. Weiter hinten klingeln die einarmigen Banditen, und selbst hier schmecke ich noch den abgestandenen Zigarettenrauch aus der Casino-Etage. Es ist genau wie in jedem anderen Hotel-Casino in dieser Stadt. Vielleicht ein bisschen netter als in den meisten. Warum ist in einer Stadt, in der überall die Sünde lauert, eigentlich ausgerechnet dieses Hotel in letzter Zeit vermehrt zum Tatort von Verbrechen geworden?
Hier hat das Rätsel für mich begonnen. Hat hier auch für den Mörder alles seinen Anfang genommen? Kaum zu glauben, dass jene tödliche Party, durch die ich in diese Welt hineingeraten bin, schon Monate zurückliegt. Dabei hatte ich gar nicht hingehen wollen, doch meine beste Freundin Josie, die unbedingt zu den angesagten Leuten gehören will, hatte mich überredet, sie auf Monroe Wests Party zu begleiten. Es wurde der letzte Tag unseres ersten Jahres in der Oberstufe gefeiert, und ich war natürlich nicht eingeladen.
Wir schmuggelten uns auf die Party, und ich müsste lügen, würde ich behaupten, dass ich mich nicht über Monroes Gesicht gefreut habe, als sie mich erwischte. Wir waren noch nie beste Freundinnen gewesen, schon gar nicht, nachdem Monroe vor der halben Jahrgangsstufe mit meinem damaligen Freund herumgevögelt hatte. Seitdem befanden wir uns im permanenten Kriegszustand, und auf ihrer Party aufzukreuzen kam einer Kampfansage gleich. Nach unserer Konfrontation wollte ich gehen, doch anstatt Josie einzusammeln, lernte ich jemanden kennen. Ich hatte ihn noch nie gesehen, aber etwas an ihm zog mich unwiderstehlich an. Wir verbrachten die Nacht zusammen – nicht im biblischen Sinn, aber ziemlich knapp davor. Am nächsten Morgen war er verschwunden.
Als ob es nicht schon schlimm genug gewesen wäre, allein am Pool meiner besten Feindin aufzuwachen, musste ich mich auch noch von meinem Exfreund Jonas und seinem schmierigen besten Freund Hugo nach Hause fahren lassen. Eigentlich wollte ich diese Nacht nur schnell vergessen, doch dann erfuhr ich aus den Nachrichten, dass man Nathaniel West ermordet hatte. Die Hauptverdächtigen? Alle, die auf der Party seiner Tochter waren. Ich wäre vielleicht mit einer einfachen Befragung davongekommen, doch dann fand ich heraus, dass der Typ, mit dem ich in jener Nacht herumgemacht hatte, Jameson West war – Erbe des West-Imperiums und Sohn des Mordopfers. Ganz offensichtlich habe ich einen zweifelhaften Männergeschmack – wenn auch nicht so merkwürdig wie der Geschmack meiner besten Freundin Josie, die auf ältere Männer steht. Diese Schwäche hatte sie dazu gebracht, in jener Nacht mit irgendeinem Typen in seinem Hotelzimmer zu verschwinden, wodurch ich in die Verlegenheit kam, mir ein Alibi verschaffen zu müssen.
Jameson galt als Hauptverdächtiger – und zwar zunächst auch mir. Insbesondere, nachdem er anfing, überall dort aufzutauchen, wo ich mich gerade aufhielt. Obwohl er sich wie ein Stalker aufführte, wollte ich mehr über ihn wissen. Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich mich in ihn verlieben würde.
Jetzt weiß ich, dass er unschuldig ist, aber in den Augen des FBI sind wir beide nach wie vor verdächtig. Als dann ein mysteriöser Instagram-Account von einem gewissen The Dealer mit peinlichen Fotos all jener Belle-Mère-Prep-Schüler auftauchte, die auf der Liste der Verdächtigen ganz oben standen, begann ich, auf eigene Faust nachzuforschen. Ich will Frieden. Ich will unsere Namen reinwaschen, und das kann ich nur, wenn ich herausfinde, wer Nathaniel West umgebracht hat.
Doch seit heute Nachmittag gibt es etwas, das mir noch schwerer auf der Seele liegt. Dank der zuständigen Nervensäge vom FBI, Detective Mackey, mache ich mir jetzt Sorgen, ob ich überhaupt mit Jameson zusammen sein darf. Dass meine Schwester einen anderen Vater hatte als ich, habe ich bereits herausgefunden – eine Tatsache, die meine Eltern sogar noch über ihren Tod hinaus vor mir geheim gehalten haben. Doch dass auch ich einen anderen Vater haben könnte als gedacht, war mir nicht in den Sinn gekommen. Falls Mackey nicht lügt – und als rechtschaffener Polizistin ist ihr das garantiert untersagt –, muss ich jetzt mehr als ein Geheimnis lüften. Ob es für Fernsehdetektivin Nancy Drew im Streifen »Das Geheimnis des Kindsvaters« (mit mir in einer der Hauptrollen) ein Happy End geben kann, wird sich erst noch herausstellen.
Es stimmt nicht. Ich bin nicht Nathaniel Wests Tochter.
Diesen Gedanken wiederhole ich innerlich wie ein New-Age-Mantra. Ich muss fest daran glauben, denn sonst wird aus dem flauen Gefühl in meinem Magen ein Abgrund, der mich verschlingt.
Die Frage arbeitet noch in mir, als ich die Drehtür erreiche, doch bevor ich hindurchgehen kann, packt mich jemand an der Schulter und wirbelt mich herum. In Gedanken noch ganz bei dem Verbrechen, stoße ich einen spitzen Schrei aus, den Jameson West mit seinen Lippen erstickt.
Ich reiße mich von ihm los und versuche, das Bedürfnis zu unterdrücken, mich an ihn zu schmiegen.
In seinem Anzug sieht er älter aus, als er in Wirklichkeit ist. Wenn man genau hinsieht, entdeckt man sogar einen feinen Bartschatten auf seinen Wangen. Ohne lange nachzudenken, streiche ich mit den Fingerspitzen darüber. Er seufzt. Dann reibt er sich mit der Hand über die Stoppeln und schüttelt den Kopf. »Ich habe mich heute Morgen erst rasiert, Herzogin.«
»Damit siehst du so mächtig aus.«
Eine seiner Brauen nimmt die Form eines Fragezeichens an. »Es macht mich alt.«
Nach dem unerwarteten Tod seines Vaters hat Jameson die Leitung des Familienunternehmens übernommen. Er hatte sich gerade erst mit seinem Vater gestritten, weil er das College geschmissen hatte, und war bestimmt nicht darauf eingestellt, einen Fortune-500-Laden zu leiten, eines der weltweit umsatzstärksten Unternehmen. Vielleicht lässt ihn die Verantwortung, die neuerdings auf ihm lastet, vorzeitig altern, und ihm zu sagen, was ich seit heute weiß, wäre da sicher nicht gerade hilfreich.
Ich suche in seinem Gesicht nach der Wahrheit, sehe jedoch nur seine markanten Gesichtszüge und einen undurchdringlichen Blick. Sein widerspenstiges kupferfarbenes Haar ist gebändigt. Heute spielt er die Rolle des Geschäftsmannes: distanziert, unnahbar und berechnend. Und im Moment bin offensichtlich ich diejenige, die er analysiert. Ich weiche vor ihm zurück.
»Was ist mit dir los?« Sein misstrauischer Ton macht mich nur noch nervöser.
»Nichts«, lüge ich – zu schnell, um glaubwürdig zu klingen. »Ich habe nur nicht mit dir gerechnet.«
»Ich auch nicht mit dir«, sagt er gedehnt. »Wolltest du zu mir? Oder was machst du hier?«
»Warum sollte ich ausgerechnet hierherkommen, wenn ich dich sehen will?« Ich bräuchte jetzt dringend ein Mittel gegen den verbalen Durchfall, den meine Paranoia auslöst.
»Weil ich hier arbeite, Herzogin. Ich habe die Neuerungen bezüglich der Sicherheitssysteme kontrolliert.« Er wartet, dass bei mir der Groschen fällt, aber irgendwie bin ich gerade völlig neben der Spur. »Ich hab dir eine SMS geschickt.«
»Mein Handy spinnt heute ein bisschen.« Lügen und Paranoia sind ganz schlechte Redner. Völlig unglaubwürdig.
»Ich habe ein paar Minuten Zeit. Wie wäre es, wenn ich dir mal die Büros zeige?«
Als er meine Hand nehmen will, weiche ich noch weiter zurück. Kurz wirkt er verletzt, doch er zwingt sich zu einem angespannten Lächeln.
»Tut mir leid. Josie ist krank, ich muss mich beeilen, und wenn wir zwei erst einmal anfangen …«
Er lässt mich davonkommen – gnädig, könnte ich hinzufügen – und enthält sich jeglichen weiteren Kommentars, doch kurz bevor sich die Drehtür zwischen uns schiebt, ruft er mir noch eine letzte Frage hinterher: »Was wolltest du hier?«
Ich komme auf der anderen Seite heraus, und wir blicken einander durch die Scheibe hindurch an. Ich könnte jetzt wieder hineingehen und ihm alles erklären, doch ihn überhaupt zu sehen ist schon schlimm genug. Vielleicht ist das unser Schicksal: Wir sehen einander, dürfen uns aber niemals berühren.
Als ich vor Josies Häuschen stehe, sehe ich den winzigen Zweizimmerkasten auf einmal als das, was er ist. Ich war heute schon einmal hier, um Abbitte zu leisten, da war es mir noch nicht aufgefallen. Doch jetzt steht meine ganze Welt kopf – vielleicht sehe ich deshalb alles in einem anderen Licht. Die letzten paar Monate bin ich zwischen Milliardären herumgegeistert wie in einer schlechten Folge von »MTV-Cribs« (eigentlich sind alle Folgen schlecht, wer will schon sehen, wie Stars wohnen), doch nun bin ich wieder hier, und es zählt nur noch eins: Ich fühle mich, als wäre ich endlich zu Hause. Ich kam mir vor wie eine Hochstaplerin, und es ist an der Zeit, innezuhalten und zu den Leuten zurückzufinden, die mich kennen und lieben.
Trotz meiner neugefundenen Entschlossenheit klopfe ich ziemlich zaghaft an die Tür. Marion, Josies Mutter, öffnet mit erstaunter Miene.
»Seit wann klopfst du denn?«, fragt sie. Und das ist es, sie hat recht: Ich bin zu Hause. Hier gehöre ich hin, das sind meine Leute. Sie ist frisch geschminkt und hat das Haar zu einem festen Knoten nach hinten gebunden. Es dauert einen Moment, dann fällt mir ein, dass Freitagabend ist. »Tut mir leid, Süße, aber ich bin auf dem Sprung. Ich muss in dreißig Minuten in der Garderobe sein.«
So sieht das Leben von Showgirls in Las Vegas am Wochenende aus. Die nächsten paar Tage ist sie damit beschäftigt, die Annäherungsversuche allzu selbstbewusster Geschäftsmänner und schmieriger Teilnehmer von Junggesellenabschieden abzublocken. Diese Leute fallen für zwei Tage in Las Vegas ein, dann ziehen sie wieder ab und hinterlassen nichts als einen Haufen Rechnungen.
»Eigentlich wollte ich zu Josie«, sage ich.
Sie zieht die Augenbrauen zusammen. »Sie ist krank, und du weißt ja, wie sie dann ist.«
»Und ob ich weiß, wie meine beste Freundin drauf ist, wenn sie krank ist.«
Krankenhäuser wurden für Leute wie Josie Deckard erfunden, die es schafft, aus jeder Erkältung eine Schwindsucht zu machen. Seit ich sie kenne, geht sie geradezu in Quarantäne, sobald auch nur ihre Nase zu laufen droht. Früher war es mir dann gestattet, ein paar Opfergaben in Form von Disneyfilmen an ihrer Tür zu hinterlegen, eintreten durfte ich allerdings nie. Selbst Marion musste ihre ganze Überredungskunst einsetzen, um in ihr Zimmer zu dürfen. Doch heute muss sich ihre Hypochondrie auf den Rücksitz verziehen, weil ich auf meinen Rechten als bester Freundin bestehe. Ich zögere. Falls ich Marion meine traurige Geschichte erzähle, würde sie mir sofort die Couch anbieten, die mir sowieso schon sicher ist. Aber diese Entscheidung darf ich nicht ihr überlassen. Dazu ist zwischen Josie und mir noch zu vieles ungeklärt.
»Ich riskiere es«, sage ich laut. Ganz gleich, wie gut es sich anfühlt, hier zu sein, ich brauche Josies Segen, um in meine zweite Heimat zurückzukehren.
Marion küsst mich auf die Wange, und das vertraute Zeichen ihrer Zuneigung lindert meine Nervosität ein wenig. Ihre Haut streicht über meine. Sie ist warm und weich, so wie sich die Wange einer Mutter anfühlen sollte. Diese Überzeugung beruht ausschließlich auf den Erfahrungen, die ich in den vergangenen Jahren mit ihr als Ersatzmutter machen durfte. Meine eigene Mutter bevorzugt europäische Luftküsse, bei Fremden genauso wie bei ihren eigenen Kindern. Der deutliche Kontrast zwischen Josies Mom und meiner eigenen war mir noch nie so bewusst wie in diesem Augenblick. »Mach die Tür hinter mir zu«, sagt sie mit einem Lächeln.
Ich nicke und spüre einen dicken Kloß in meinem Hals. Hätte ich doch besser hier meinen Sommer verbracht! Zwischen meinen Einsätzen im Pfandleihhaus meines Vaters hätte ich Netflix-Serien gucken, jede Sekunde meines zukünftigen Abschlussjahres an der Belle Mère Prep verplanen und ein wachsames Auge auf Josies Liebesaffären haben können. Stattdessen drückte man mir plötzlich und ohne Vorwarnung die Rolle des bösen Schickeria-Mädchens auf. Jetzt ist es an der Zeit, diese Rolle abzulegen und wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukehren.
Ich winke Marion hinterher, drehe den Griff der Eingangstür, hole tief Luft und marschiere den kurzen Weg durch den Flur zu Josies Zimmer. Dort versuche ich, mich nicht abschrecken zu lassen, und klopfe. Totenstille empfängt mich, und nach einer Ewigkeit sagt eine erstickte Stimme: »Geh weg.«
Es läuft in etwa so, wie ich es mir vorgestellt habe.
Ich versuche es mit dem Türknauf, bin jedoch nicht überrascht, dass abgeschlossen ist. Doch weil dieses Haus, wie so vieles in Las Vegas, aus den 1970er Jahren stammt, brauche ich nur eine Haarnadel, um mich mit meiner besten Freundin auseinandersetzen zu können. Ich ziehe mir eine aus dem Haar und fummele damit so lange in dem kleinen Loch neben dem Knopf herum, bis das Schloss aufspringt. Die Erbauer dieser Häuser dachten bestimmt, sie würden den Eltern einen Gefallen tun. So können sie ihren Kindern Autonomie vorgaukeln, doch in Wirklichkeit reicht ein Metallteilchen im Wert von einem Cent, um die Tür zu öffnen.
»Wird schon«, murmele ich leise vor mich hin und stoße die Tür auf. Josie liegt unter ihren Decken vergraben und hat ein Kissen auf dem Gesicht.
Augenblicklich sitzt sie kerzengerade im Bett, ihre Baumwollfestung sackt um sie herum zusammen, und sie starrt mich an.
»Mir geht’s nicht gut«, zischt sie.
Ich zucke die Schultern.
»Die Welt erlebt eine Wirtschaftskrise, ein Reality-Star bewirbt sich um die Präsidentschaft, und wir hängen in einer Stadt fest, in der man immer noch glaubt, Passivrauchen sei unschädlich. Niemandem geht’s gut«, erwidere ich. Ich stemme die Hände in die Hüften und warte, was sie mir als Erstes an den Kopf werfen wird, doch stattdessen wirft sie sich zurück aufs Bett.
Ich nehme mir einen Moment Zeit und sehe mich im Zimmer um. Viel hat sich nicht verändert. Überall liegen Haufen von Klamotten herum, auf dem Schreibtisch Hefte und Zeitschriftenstapel. Sie hat nichts umgestaltet, nichts umgestellt und auch keinen Hobbyraum aus ihrem Mädchenzimmer gemacht. Alles ist immer noch so, wie es sein sollte, doch auf den zweiten Blick entdecke ich ein paar Auffälligkeiten. Die Kleiderstapel sind höher, als sie sein sollten. Die Zeitschriften auf ihrem Schreibtisch sind auch nach dem langen Sommer, den sie eigentlich am Rand eines Swimmingpools verbringen wollte, noch unberührt. Am meisten beunruhigt mich jedoch, dass der Fernseher nicht eingeschaltet ist. Dabei weiß doch jeder, vom Kleinkind bis zum Greis, dass bei Krankheit heutzutage nur noch Netflix helfen kann.
»Du bist gar nicht krank«, stelle ich fest. »Du versteckst dich. Ich will gar nicht erst lange herumreden. Hast du dich verleugnen lassen, als ich heute vorbeigekommen bin?«
Es sieht Josie überhaupt nicht ähnlich, in einer solchen Situation den Kopf einzuziehen und sich zu verstecken.
»Da ist aber jemand ganz schön eingebildet. Das kommt vermutlich dabei heraus, wenn man mit einem West zusammen ist.«
Sie spricht den Namen aus wie ein Schimpfwort, und ich würde lügen, wenn ich behauptete, dass mich diese Provokation kaltlässt. Ich gehe um ihr Bett herum und suche nach Hinweisen.
»Ja, ich bin in die Geheimgesellschaft der Houser eingeführt worden«, erwidere ich und fülle meine Worte mit der richtigen Menge Verachtung. Wir beide gehörten nie zu den Housern. Dieser Ehrentitel ist der Elite von Belle Mère vorbehalten – den Kindern der Ober-Oberschicht von Las Vegas. Die schmeißen die Show, und wir andern hoffen auf ein Plätzchen im Zuschauerraum. »Meine Kacke stinkt nicht mehr, und ich kenne ihren speziellen Handschlag.«
Sie sieht mich nur böse an, deshalb setze ich meine Analyse fort.
Eine Weile lässt sie mich reden und schaut mich nur ungläubig an. »Oh mein Gott, hör endlich auf«, sagt sie schließlich. »Du hast ja recht. Ich sterbe nicht, du Geier. Falls du vorhattest, dich über meine Leiche herzumachen, musst du dir ein anderes Opfer suchen.«
»Das ist süß von dir. Aber deshalb bin ich nicht hier. Ich muss dich um einen Gefallen bitten.«
»Das ist also deine Art, jemanden um etwas zu bitten?«
Na schön, da hat sie vielleicht nicht ganz unrecht. Zu den wenigen guten Ratschlägen, die mir meine Mutter gegeben hat, gehört, dass man mit Honig Fliegen fängt. Ich habe diese Strategie noch nicht ausgiebig erprobt, vielleicht auch, weil meine Mutter sich nie bequemt hat, mit gutem Beispiel voranzugehen. Außerdem sind Josie und ich über die gezuckerten Plattitüden aufgesetzter Freundschaftsbezeugungen längst hinaus. Trotzdem hat sie recht. Wir müssen unseren Streit beilegen, bevor ich wieder nach Hause kommen kann. Doch zunächst mache ich ihr natürlich erst einmal Vorwürfe: »Was ist los mit dir, Josie? Du bist schon seit Wochen so komisch. Und jetzt versteckst du dich auch noch im Bett und tust, als wärst du krank? Und das nicht nur mir gegenüber, sondern auch noch gegenüber deiner Mutter.«
Es tritt eine Stille ein, die geradezu biblische Längen erreicht. Dann richtet Josie sich auf. Jetzt, wo sie mich nicht mehr so böse anblickt, sehe ich, dass ihre Augen gerötet sind. Josie Deckard hat geweint. Dass Teenie-Mädchen in ihre Kissen schluchzen, mag nichts Ungewöhnliches sein, aber meine beste Freundin passt nicht in dieses Klischee. Hat sie nie.
»Was hast du so getrieben in der Zwischenzeit?«, fragt sie mich leise.
Die Frage ist nicht so leicht zu beantworten, wie es vielleicht aussieht, und sie verdient keine knappe Antwort oder nichtssagende Höflichkeitsfloskel. Also packe ich alles aus. »Ich stehe unter Mordverdacht, ich habe mich verliebt, meine ganze Familie zerstört, unglaublich blöden Mist gemacht und festgestellt, dass alles umsonst war.«
Aber das ist erst der Anfang, das ist uns beiden klar. Dann setze ich mich auf ihre Bettkante und informiere sie ausgiebig über den Stand der Dinge. Manches lasse ich aus, wahrscheinlich auch Wichtiges, aber das Wesentliche bringe ich rüber. Als ich fertig bin, ist mir eine große Last von den Schultern genommen. Ich hatte ganz vergessen, wie schwer es ist, Geheimnisse mit sich herumzuschleppen. Dass ich sie jemandem anvertrauen kann, erleichtert mich enorm.
»Und was ist mit dir?«, frage ich. »Ich bin nicht die Einzige, die diesen Sommer nicht erreichbar war.«
Josie und ich waren in den letzten paar Jahren während der Sommerferien oft voneinander getrennt gewesen. Entweder musste ich nach Palm Springs zu meiner Mutter, oder ich hing bei meinem Dad im Pfandleihhaus fest. Josie musste zu Hause bleiben oder irgendeinen Job annehmen, um zum Unterhalt beizutragen, da niemand für sie zahlt. Aber wir haben immer telefoniert. Später gesimst oder geskypt. Und immer haben wir es ab und zu möglich gemacht, zusammen zu übernachten, gemeinsam essen zu gehen oder auch dann und wann mal eine Kleinigkeit in einem Laden mitgehen zu lassen. Aber diesen Sommer hat es zwischen uns kaum für ein Emoji gereicht.
Josie lässt meine Frage unbeantwortet. Stattdessen steht sie auf. Es dauert lange, so als müsste sie ihren Gliedmaßen erst befehlen, sich zu bewegen, und ihren Körper dazu überreden, einen Schritt nach dem anderen zu machen. Sie öffnet die Schreibtischschublade, kramt ein paar Minuten darin herum und hebt schließlich den doppelten Boden heraus. Das war jahrelang unser Geheimversteck für Dinge wie ein Päckchen Zigaretten, Schnaps oder Kondome – in der Phase, als wir älter sein wollten, als wir aussahen. Sachen, von denen alle Eltern wissen, die wir aber trotzdem verbergen wollten.
Auf das, was sie jetzt aus der Schublade herauszieht und mir hinhält, bin ich überhaupt nicht vorbereitet. Weil ich so gut wie keine Erfahrung mit der Sache habe, starre ich viel zu lange auf das Schwarz-Weiß-Foto in meiner Hand. Das Papier ist dünn und das Bild verzerrt, aber ich kann lesen.
In der Ecke steht ihr Name. Ich kann gerade noch begreifen, dass die Zahlen Wochen und Tage bedeuten. Doch sosehr ich mich auch anstrenge – das unscharfe weiße Geflimmer in der Mitte des Bildes ergibt für mich keinen Sinn.
»Ist das …« Ich stocke mitten im Satz und verschlucke die Worte. Wenn ich sie nicht ausspreche, ist es vielleicht nicht wahr.
»Ein Ultraschallbild«, sagt sie. Ihre Stimme scheint sich von ihrem Körper zu lösen, als sie ganz sachlich weiterredet. »Die Klinik, in der ich war, zwingt einen dazu, eins zu machen, bevor man sich entscheidet. Selbst wenn man sich schon entschieden hat. Das hat sich bestimmt irgend so ein Politiker als Strafe ausgedacht.«
Sie redet weiter, als könnte sie die Spannung, die in der Luft liegt, mit ihren Tiraden zerstreuen. Sie erzählt, wie sie in die Klinik gegangen ist. Weiße Wände, Gestank.
»Oh mein Gott«, keuche ich und höre ihr schon gar nicht mehr zu. »Hast du …? Bist du …?«
»Bin ich«, sagt sie.
»Warum?«, platzt es aus mir heraus. Plötzlich ergibt alles einen Sinn: ihre Distanziertheit, ihre Reizbarkeit. Aber dass ich jetzt alles weiß, macht die Sache auch nicht besser. Es fühlt sich eher an, als würde ich aus einem Albtraum erwachen und merken, dass ich gar nicht geschlafen habe. Dass es kein Traum war. Sie reißt mir das Bild aus der Hand und stopft es zurück in die Schublade, als wäre die Situation anders, wenn sie es versteckt. »Es wird so viel davon geredet, aber keiner sagt einem, wie viel Geld so etwas kostet. Ich habe den ganzen Sommer über gespart. Es reicht immer noch nicht und …« Sie führt den Satz nicht zu Ende, doch das braucht sie auch nicht. Allein die Vorstellung, das alles durchzumachen, ist furchtbar, auch wenn ich es nicht selbst über mich ergehen lassen muss.
»Ich kann dir helfen.« Das ist nicht nur ein Angebot, sondern eine Aufforderung. Sie wird meine Hilfe annehmen, ob sie will oder nicht. »Ich hätte dir doch geholfen. Warum hast du mir nichts davon gesagt?«
»Es ist kompliziert.«
»Weiß der Vater davon?«
»Er hat keine Ahnung«, sagt sie mit trotzig bebenden Nasenflügeln.
Ich halte es für das Beste, nicht weiter nachzubohren. Wenn sie bereit ist, mir mehr zu erzählen, wird sie es tun.
»All die Jahre über war sie immer so paranoid«, sagt Josie geistesabwesend. »Und dann gehe ich los und tue genau das, was meiner Mutter das Herz brechen wird.«
»Sie muss es nicht erfahren«, flüstere ich.
Sie blinzelt, als würde sie sich wieder erinnern, dass ich da bin, dann sieht sie mich an. »Em, ich schaffe das nicht allein.«
»Das brauchst du auch nicht«, verspreche ich.
Die nächsten paar Tage tun wir, als hätten wir keine Probleme, und sehen stattdessen so viele schlechte Fernsehsendungen, wie wir vertragen können. Nachdem wir einander das Herz ausgeschüttet haben, ist es leichter, sich einfach nur berieseln zu lassen, als weiter über unsere nächsten Schritte nachzudenken. Ich brauche eine Pause. Eine Pause von den Nachforschungen, den Vorwürfen und dem Misstrauen. Ich kann mir nicht annähernd vorstellen, wie dringend erst Josie eine Pause braucht. Ich gebe mir Mühe, sie nicht anzustarren, wenn die Realität in mein Bewusstsein dringt und die Handlung auf dem Fernsehschirm überlagert.
Josie wirkt unverändert. Vielleicht liegt es daran, dass sie seit ungefähr drei Tagen ihre Pyjamahose nicht gewechselt hat, aber es ist wirklich noch nichts zu erkennen. Sollte man es ihr nicht irgendwie ansehen können? So funktioniert das, wenn man schwanger wird? Dann könnten wir also alle ständig schwanger sein, ohne es zu merken?
»Glotz mich nicht immer so an«, mault sie schließlich eines Nachmittags. »Es wird mir nicht plötzlich aus dem Bauch platzen, ein Lied singen und tanzen.«
»Tut mir leid«, sage ich schuldbewusst. »Es ist nur so verrückt.«
Sie stöhnt und schüttelt den Kopf, während sie die neuesten Social-Media-Einträge durchgeht.
»Weißt du, was verrückt ist? Dass dein Leibwächter auf der anderen Straßenseite vor unserem Haus parkt.«
Okay, da hat sie recht.
»Lass uns so tun, als wären wir wieder zwölf«, schlage ich vor, »als unser größtes Problem war, dass wir endlich zum ersten Mal unsere Periode bekommen wollten.«
Kaum habe ich sie ausgesprochen, möchte ich meine Worte wieder zurücknehmen. Doch Josie lacht nur bitter. »Ja, ich hoffe wirklich die ganze Zeit, dass ich meine Periode bekomme.«
»Und der Preis für die mieseste Freundin des Jahres geht an …« Mit dramatischer Geste schlage ich mir vor die Brust. »Mich. Ich möchte meiner Mutter danken, die mir alles beigebracht hat, was ich weiß, meinem Vater, der auch seinen Teil beigetragen hat, und generell danke ich dafür, dass ich von den schlechtesten Vorbildern umgeben bin, die ein Mädchen haben kann.«
Josies aufgesetztes Lachen verwandelt sich in ein amüsiertes Kichern. »Welchen Preis gewinne ich? Wahrscheinlich den, ein solches Mädchen auf die Welt zu bringen?«
Ich zucke zusammen und erschrecke mich fast zu Tode, als Josies Mutter plötzlich die Tür aufmacht. Gäbe es einen Preis für den unschuldigsten Gesichtsausdruck, hätte momentan keine von uns beiden eine Chance, ihn zu gewinnen.
»Em, deine Mutter hat mich angerufen.« Sie blickt mir tief in die Augen.
Irgendwie hatte ich damit gerechnet. »Es könnte sein, dass ich ihre Telefonnummer blockiert habe.«
Marion kneift sich in den Nasenrücken, stöhnt laut auf und gibt gleichzeitig das perfekte Bild mütterlicher Fürsorge ab. »Du kannst doch deine Mutter nicht blockieren.«
»Komisch, mein iPhone sagt, ich kann.« Ich deute ein Lächeln an, als wäre das ein Witz, doch wir wissen beide, dass ich es ernst meine.
»Sie sagt, dass sie dich dringend sprechen muss.«
Marion redet nicht erst lange um den heißen Brei herum, sondern kommt gleich zur Sache. »Wenn deine Mutter nicht damit einverstanden ist, kannst du nicht hierbleiben.«
»Meiner Mutter wäre es sogar egal, wenn ich unter einer Brücke lebe«, knurre ich, zücke dann aber mein Handy und suche ihre Telefonnummer heraus. »Ich rufe sie an.«
Marion verschwindet mit einem triumphierenden Blick, und Josie stößt mich mit der Schulter an.
»Soll ich dich einen Moment allein lassen?«
»Nein.« Ich habe ihr bereits alles erzählt. Was ich über Becca erfahren habe und wie Hans versucht hat, mich zu bedrängen. Ich hatte nichts ausgelassen. Wenn meine Mutter jetzt mildernde Umstände ins Feld führen wollte, würde ich es ihr auch nicht vorenthalten.
Mom hebt schon beim ersten Klingeln ab. »Emma«, sagt sie so atemlos, als sei sie rastlos umhergetigert, während sie auf meinen Anruf wartete.
»Vivian«, erwidere ich unterkühlt. Sie verzichtet darauf, mich zu verbessern, obwohl sie es nicht ausstehen kann, wenn ich sie mit dem Vornamen anspreche. Gerade jetzt brauche ich die Distanz und das bisschen Selbstvertrauen, das mir daraus erwächst, nötiger denn je.
»Wir müssen uns unterhalten.«
Wir müssten uns schon seit acht Jahren unterhalten, aber ich bin froh, dass sie es endlich auch begreift.
»Ich komme nicht nach Palm Springs«, sage ich.
Mom gehört nicht zu den Leuten, mit denen man am Telefon ernsthafte Gespräche führen kann. Sie zieht es vor, jemanden auf die gute alte Art, von Angesicht zu Angesicht, fertigzumachen.
»Nicht nötig«, versichert sie mir. »Ich bin in Las Vegas.«
»Welches Restaurant?«, frage ich.
»Ich glaube, es ist besser, wenn ich zu dir komme.«
Ich habe mir über viele Jahre hinweg eine Narbenhaut gegen die Spitzen und Zurückweisungen meiner Mutter zugelegt, damit sie mich nicht mehr verletzen kann, aber es gelingt ihr immer noch, mich zu überraschen.
»Ich bin bei Josie«, stoße ich hervor, während ich überlege, was so schrecklich sein kann, dass sie sich dazu herablässt, ihr Fünfsterne-Leben zu verlassen und sich unter das gemeine Volk zu mischen.
»Dann komme ich heute Abend vorbei«, sagt meine Mutter. »Soll ich etwas von McDonald’s mitbringen?«
»Ja, Mom, besorg mir ein Happy Meal«, antworte ich lakonisch. Wir legen auf, und ich frage mich, ob sie vielleicht krank geworden ist und dadurch an einem vorübergehenden Gedächtnisverlust leidet. Vielleicht hat sie sich den Kopf gestoßen und denkt, ich sei neun Jahre alt und nur für ein verlängertes Wochenende bei Josie.
»Was wollte sie?«, fragt Josie, sobald das Gespräch beendet ist.
Ich werfe ihr einen Blick zu, der weitaus mehr ausdrückt als das, was ich dann frage. »Rate mal, wer zum Abendessen vorbeikommt.«
Am Abend bringt meine Mutter mir tatsächlich ein Happy Meal mit.
»Ich weiß nicht, ob du immer noch keinen Ketchup magst«, sagt sie, als sie mir an der Tür die Schachtel in die Hand drückt.
»Ich habe meinen Frieden mit Tomaten gemacht«, versichere ich ihr und blicke auf die sorgfältig verpackten Kalorienbomben, die sie dabeihat. Wer sagt eigentlich, dass Apfelscheiben Fast Food sind? Dennoch ist nicht zu übersehen, dass zum ersten Mal seit sehr langer Zeit meine Mutter in der Tür steht. Nicht Vivian von Essen.
Ihre perfekt manikürten Nägel sind bis zum Nagelbett heruntergebissen, statt eines maßgeschneiderten Kostüms trägt sie ein einfaches Wickelkleid, und obwohl sie sich das Haar aufgedreht hat, hängt es ihr schlaff über die Schultern. Irgendwie sieht sie aus wie das »Vorher«-Bild in einer Modezeitschrift.
Das ist die Frau, mit der ich aufgewachsen bin: leidend und nervös. Wegen der Spielsucht meines Vaters konnte aus seinen Geschäftsplänen unmöglich etwas werden. Jahrelang hatte sie zugesehen, wie sich ihre Träume in Luft auflösten, bis sie schließlich so aussah wie jetzt. Dann machte sie eine Kehrtwende und ließ alles hinter sich, was sie wieder runterziehen könnte in Elend und Geldmangel. Ich weiß nicht, was es bedeutet, dass sie jetzt hier ist. Und dass sie so aussieht.