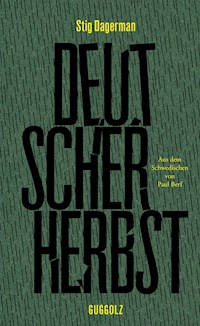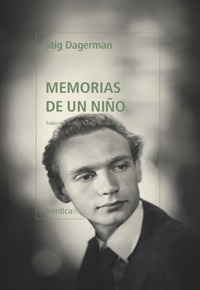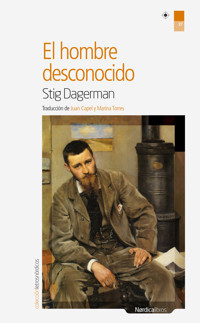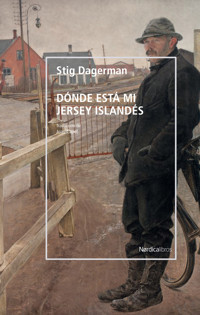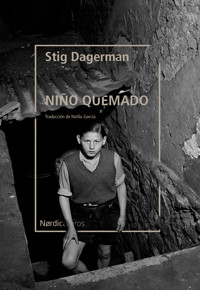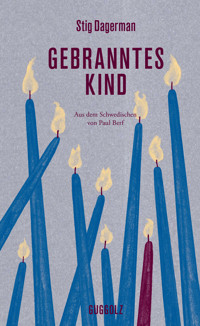
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Guggolz Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bengt, ein junger Mann aus dem Arbeiterviertel Stockholms, der gerade an der Schwelle zum Erwachsenwerden steht, gerät durch den unerwarteten Tod seiner Mutter aus dem Gleichgewicht. Sein Vater Knut hat eine neue Frau kennengelernt, Gun, die im Stadtteilkino Eintrittskarten verkauft. Bengt weigert sich jedoch zu akzeptieren, dass sein Vater eine neue Person in ihren geschützten Alltag einlässt, dass das Leben auch ohne seine Mutter weitergeht. Mit lodernder Eifersucht steigert er sich in die radikale Verurteilung seines Vaters und in die fieberhafte Ablehnung der neuen Frau hinein – und immer deutlicher wird, wie stark er selbst sich zu ihr hingezogen fühlt. In einer intensiven psychologischen Innenschau, die Bengts adoleszente Abgründe sichtbar macht und einem beim Lesen den Atem verschlägt, lässt Stig Dagerman uns teilhaben an den Obsessionen seines Helden, an dessen Verweigerung und unbändiger Wut auf die ganze Welt. Der Feinsinn, mit dem Dagerman seine Figur bis in die verstecktesten Winkel ausleuchtet, zeigt sich auch in der Sprache, die vibriert vor Spannung, schillert zwischen niederdrückender Dunkelheit und hell aufleuchtender Sehnsucht nach Befreiung, zwischen sanftem, fast weinerlichem Selbstmitleid und zerstörerischer, rücksichtsloser Brutalität. Paul Berf navigiert uns Lesende mit seiner beeindruckend standfesten Übersetzung durch die inneren Erschütterungen und Kämpfe des Protagonisten Bengt – Stig Dagerman hat eine unvergessliche, aufwühlende Figur geschaffen, die im Roman keine Versöhnung erfährt und auch nach beendeter Lektüre noch lange keine Ruhe gibt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stig Dagerman
Gebranntes Kind
Stig Dagerman
GEBRANNTES KIND
Aus dem Schwedischen vonPaul Berf
Mit einem Nachwort vonAris Fioretos
GUGGOLZ
Es stimmt nicht, dass ein gebranntes Kind das Feuerscheut. Feuer zieht es an wie das Licht die Motte.Es weiß, wenn es ihm nahe kommt, wird es sich wiederverbrennen. Dennoch kommt es ihm zu nahe.
EINE KERZE AUSPUSTEN
Eine Ehefrau soll um zwei Uhr beerdigt werden, und um halb zwölf steht der Ehemann in der Küche vor dem gesprungenen Spiegel über dem Spülbecken. Lange geweint hat er nicht, aber er hat lange wachgelegen, und die Augäpfel sind rot. Das Hemd ist weiß und blütenrein, und die Hose dampft nach dem Bügeln schwach. Während seine jüngste Schwester den harten weißen Kragen hinten am Hals einhakt und danach die weiße Fliege so sanft über die Kehle streift, dass es einer Zärtlichkeit gleicht, lehnt der Witwer sich über das Becken und sieht sich aufdringlich in seine Augen. Dann streicht er über sie, als wollte er eine Träne wegwischen, aber der Handrücken bleibt trocken. Die jüngste Schwester, die seine schöne Schwester ist, hält die Hand unter seiner Kehle still. Weiß wie Schnee glänzt die Fliege auf der roten Haut. Verstohlen streichelt er ihre Hand. Die schöne Schwester ist die Schwester, die er liebt. Wer schön ist, den liebt er. Seine Frau war hässlich und krank. Deshalb hat er nicht geweint.
Die hässliche Schwester steht am Herd. Dort zischt Gas. Der Deckel des glänzenden Kaffeekessels hüpft auf und ab. Mit roten Fingern sucht sie unter den Gashähnen, um es abzudrehen. Zwölf Jahren lebt sie schon in der Stadt, hat aber noch nicht gelernt, die richtigen Hähne zu finden. Sie trägt eine Brille mit schwarzen Bügeln, und wenn sie jemandem in die Augen sehen will, beugt sie sich weit vor und glotzt in einer Weise, wie man es hier nicht tut. Endlich findet sie den richtigen Hahn und dreht ihn ab.
»Trägt man zur Beerdigung eine weiße Fliege …?«
Es ist die schöne Schwester, die das fragt. Der Witwer fingert an den Manschettenknöpfen herum. Er trägt überlange schwarze Schuhe, und als er sich plötzlich auf die Zehenspitzen stellt, knirschen sie kurz. Aber die hässliche Schwester fährt hastig herum, als würde sie von jemandem angegriffen.
»Zur Beerdigung eine weiße …! Das weiß ich seit der vom Konsul …!«
Dann kneift sie den Mund zu. Ihre Augen blinzeln hinter der Brille, als fürchteten sie sich. Vielleicht tun sie das auch. Sie weiß alles über Beerdigungen. Dagegen kaum etwas über Hochzeiten. Die schöne Schwester lächelt und fährt fort, anzuprobieren und zu streicheln. Die hässliche stellt eine Vase mit weißen Trauerblumen vom Tisch auf den Spültisch. Der Witwer blickt erneut in den Spiegel und merkt auf einmal, dass er lächelt. Er schließt die Augen und atmet den Duft der Küche ein. So weit seine Erinnerungen zurückreichen, riechen Beerdigungen nach Kaffee und verschwitzten Schwestern.
Es ist jedoch auch eine Mutter, die beerdigt werden soll, und der Sohn ist zwanzig und nichts. Jetzt steht er in dem Zimmer, das voller Menschen ist, allein unter der Deckenlampe. Seine Augen sind leicht geschwollen. Er hat sie nach den Tränen der Nacht mit Wasser gekühlt und glaubt, es wäre nichts zu sehen. In Wahrheit ist aber alles zu sehen, und deshalb haben die Trauergäste ihn allein gelassen. Nicht aus Rücksicht, sondern aus Furcht, denn die Welt fürchtet den, der weint.
Eine Weile steht er vollkommen still, nestelt nicht einmal an seinen Manschetten herum, zieht nicht einmal am Trauerflor. Die goldene Pendeluhr, das Geschenk zum Fünfzigsten, schlägt schwach, ganz schwach ein Mal. An den Fenstern stehen die Gäste und reden. Sie haben Trauerflor in den Stimmen, aber einer aus der Verwandtschaft des Vaters klopft mit den Knöcheln auf dem Fensterbrett einen Marsch. Es sind harte Knöchel, und er wünschte, sie würden verstummen. Sie verstummen jedoch nicht. Dann dreht einer der vom Land Angereisten am Radio, obwohl es noch keine zwölf Uhr ist. Es brummt und brummt, aber fürs Erste kommt keiner auf die Idee, es wieder auszuschalten.
Lautlos fällt das Januarlicht ins Zimmer und schimmert auf allen glänzenden, knarrenden Schuhen. Mitten im Raum, unter der Lampe, ist eine neue, große Leere, und dort steht er allein und sieht und hört alles, obwohl er selbst woanders ist. Bevor seine Mutter starb und er allein zurückblieb, stand dort ein langer Tisch aus Eichenholz, doch dieser Tisch steht nun am Fenster. Eine weiße Decke ist über ihn gebreitet worden, und auf der Decke stehen Gläser und Karaffen mit dunklem Wein und fünfzehn zerbrechliche weiße Tassen und eine große braune Torte, die süß ist, aber bitter schmecken soll. Hinter den Karaffen, auf dem eigentlichen Fenstertisch, ist an diesem Tag das Porträt der Mutter in einem schweren schwarzen Rahmen aufgestellt. Es ist von Grün umflochten, dem teuren Grün des Januars. Während der Begräbniskaffee gekocht wird und der Pfarrer sich im Pfarrhof rasiert und die Beerdigungswagen in der Garage aufgetankt werden, versammeln sich die elf Gäste um den Tisch und das Bild der Toten. Es ist ein Jugendporträt, ihre Haare sind dunkel und voll und legen sich schwer über die glatte Stirn. Die Zähne, die zwischen den runden Lippen auftauchen, sind weiß und ohne Karies.
»Da war sie fünfundzwanzig«, sagt einer.
»Sechsundzwanzig«, berichtigt ihn ein anderer.
»Alma war hübsch, als sie jung war.«
»Ja, die Alma war hübsch.«
»Man versteht schon, dass Knut, dass Knut … äh …«
Dann erinnert man sich an den Sohn, der im Zimmer steht und zuhört.
»Schöne Haare hatte sie«, wirft jemand ein. Allzu schnell.
»Zu der Zeit erwartete sie wohl schon das Mädchen.«
»Ach was, sie hatte ein Mädchen …?«
»Sie hätte eins haben sollen. Aber es starb.«
»Als Säugling …?«
»Ein Jahr war es alt. Und dann bekamen sie den Jungen. Aber da waren sie verheiratet.«
Da erinnert man sich erneut an ihn und verstummt diesmal. Jemand zieht ein großes weißes Taschentuch heraus und schnäuzt sich. Jetzt dreht man das Radio ab. Dann tritt man mit kleinen, knirschenden Schritten zur Seite, denn der Kaffee kommt. Die nette Tante, die er mag, weil sie hinter ihrer Brille geweint hat, trägt die Kanne. Sie hält sie hoch und würdevoll wie einen Kerzenständer und schwitzt in ihrem engen schwarzen Kleid. Dahinter kommt die junge Tante. Sie hat schwarze Seidenstrümpfe an, und die Männer im Raum vergessen bei ihrem Anblick den Moment und bemerken, dass sie schöne Beine hat. Einem Blick zuliebe lächelt sie jemanden an. Sie hat nicht geweint.
Als Letzter kommt der Vater. Langsam und mit gesenktem Blick geht er auf den Sohn zu. Alle sind verstummt und haben sich umgedreht. Auch der Mann, der einen Marsch klopfte, ist still. Auch der Vater ist still. Still und allein begegnen sie sich mitten im Raum. Ihre Hände begegnen sich, und ihre Arme begegnen sich. Dann begegnen sich ihre Brustkörbe. Zuletzt begegnen sich ihre Augen. Nicht lange, aber lange genug, dass beide sehen können, wer geweint hat und wessen Augen trocken geblieben sind.
»Weine nicht, mein Junge«, sagt der Vater.
Er hat es leise gesagt, trotzdem haben es alle gehört. Jetzt schluchzt jemand unter den Gästen auf, wenngleich nur kurz. Schuhe knirschen, und einige Kleider rascheln wie Schritte auf Laub. Der Arm des Vaters ist hart wie Stein.
»Weine nicht, mein Junge«, sagt er nochmals.
Da löst sich der Sohn sachte von ihm, der nicht geweint hat. Allein geht er den langen Weg von seinem Platz unter der Lampe zu dem Tisch mit den dampfenden Tassen und randvollen Gläsern. Jemand, der ihm im Weg steht, weicht scheu zur Seite. Ohne zu zittern, nimmt er eine Tasse und gleich darauf ein Glas und dreht sich langsam um.
Der Vater steht noch da. Der harte Arm hängt wie angeschossen an seiner rechten Seite hinab. Sachte senkt er den Kopf und klappt das eine rote Ohr platt nach vorn gegen den Wangenknochen. Doch erst als die Sonne zum Fenster hereinblitzt, erkennt der Sohn, dass die Augen des Vaters auf einmal feucht sind. Da verschüttet er ein paar Tropfen dunklen, bitteren Weins auf den Fußboden zwischen seinen Schuhen.
Bevor die Wagen eintreffen, stehen sie dann verteilt im Raum in Gruppen zusammen. Vier stehen unter der klingenden Pendeluhr und halten Gläser in den Händen. Wenn keiner hinsieht, nippen sie an ihnen. Es sind Leute vom Land, die Verwandten des Witwers, die man nur auf Hochzeiten und Beerdigungen sieht. Ihre Kleider riechen nach Motten. Sie sehen die teure Uhr an. Danach sehen sie einander an. Sie sehen die teure Enzyklopädie an, deren Lederrücken hinter dem Glas des Bücherschranks glänzen. Danach sehen sie einander an und nippen. Plötzlich stehen sie da und flüstern mit Lippen, die von Kaffee und Wein weich sind. Die Tote haben sie nie gemocht.
Unter der Lampe stehen die Schwestern mit den vier Freunden des Vaters zusammen, die sich den Montagvormittag freigenommen haben, um auf die Beerdigung zu gehen. Man hatte wohl auf mehr gehofft, aber nicht einmal die vier, die gekommen sind, haben die Tote gemocht. Dennoch sprechen sie eine Weile mit leisen, bedrückten Stimmen über sie. Anschließend sprechen sie über etwas anderes. Aber die Stimmen bleiben gleich.
An einem Fenster stehen der Witwer und sein Sohn bei drei der nächsten Nachbarn. Es sind zwei Frauen, die sich über etwas Abwechslung freuen, sowie ein Mann, der krankgeschrieben ist. Direkt am Fenster steht der Sohn. Er hat Glas und Tasse auf dem Fensterbrett zwischen zwei Blumentöpfen abgestellt. Er weiß, dass die Nachbarn seine Mutter nicht leiden konnten. Deshalb will er nicht zuhören. Der Krankgeschriebene spricht unterdessen über seine Krankheit. Die beiden Nachbarinnen sprechen über andere Krankheiten. Der Witwer spricht über die Krankheit der Toten. Sie hatte ein schwaches Herz und war von Wasser aufgeschwemmt. In der Zwischenzeit blickt der Sohn aus dem Fenster. Er weiß, dass sie bald alle zum Fenster hinausschauen werden, und beeilt sich deshalb, so viel zu sehen, wie er nur kann. Er sieht die bläulichen Straßenbahnschienen, in der Kurve weiß von Eis und Salz. Er sieht die kleinen, frierenden Flocken, die auf die Straße hinabschweben. Er sieht blauen Rauch, der aus dem Schornstein einer Wärmehalle aufsteigt. Einige Arbeiter, die mit Presslufthammer und Hacken die Straße aufgerissen haben, stellen ihre Werkzeuge ab, hauchen weißen Atem in ihre Hände und machen Pause. Eine Katze tapst durch den Schnee, und ein breitbeiniges Brauereipferd pinkelt gegenüber einen gelben Strahl in den Rinnstein.
Doch die ganze Zeit funkelt die Sonne auf dem vergoldeten Stierkopf über einer Metzgerei. In dem Geschäft ist alles wie immer. Die Tür wird von Leuten mit Zigaretten in den Mündern geöffnet und geschlossen. Im Fenster liegt das Fleisch auf weißen Platten, und hinter der Marmortheke heben die Verkäuferinnen ihre scharfen Beile. Wie so oft zuvor lehnt er sich so weit zum Fenster vor, dass es von seinem heißen Atem beschlägt. Wie so viele Male zuvor, dennoch nicht wie an den ersten Tagen. Denn an diesen ersten Tagen war es am schlimmsten. Da war nach kurzer Zeit die ganze Scheibe beschlagen. Er musste seine Hand packen und zur Tasche hinunterziehen, damit sie sich nicht losriss und die Scheibe einschlug. Er musste sich auf die Lippe beißen, damit der Mund nicht aufsprang und schrie: Warum habt ihr nicht geschlossen …? Ihr da unten …! Wie könnt ihr nur …! Warum hängt ihr keine Laken vor die Fenster …? Warum schließt ihr eure Tür nicht ab …? Warum lasst ihr die Lieferwagen mit Fleisch kommen, obwohl ihr wisst, was passiert ist …? Ihr Metzger …! Ihr grausamen Metzger …! Warum lasst ihr zu, dass alles wie immer ist, obwohl ihr wisst, dass alles verändert ist …?
Jetzt ist er ruhiger, lehnt sich vor und schaut. Lehnt sich einfach vor und atmet. Richtet nur seinen Blick wie ein Fernrohr auf den goldenen Stierkopf und das hohe Schaufenster mit seinen schweren Bergen von Fleisch. Presst nur seinen Schenkel schmerzhaft fest gegen das Fensterbrett. Denkt nur: Da drinnen starb meine Mutter. Da drinnen starb meine Mutter, während mein Vater in der Küche saß und sich rasierte und während ich, ihr Sohn, in meinem Zimmer saß und mit mir selbst Poker spielte. Da drinnen sank sie von einem Stuhl, ohne dass einer von uns dabei war und sie auffangen konnte. Da drinnen lag sie im Dreck und in den Sägespänen auf dem Boden, während ein Metzger mit dem Rücken zu ihr ein Lamm zerlegte.
Vielleicht ist er doch nicht so ruhig. Vielleicht hat er doch etwas gesagt. Vielleicht hat er zumindest gezuckt. Jedenfalls spürt er einen Arm aus Stein um seine Schulter. Jedenfalls sieht er eine Hand aus Stein, die über das beschlagene Glas reibt und reibt. Nein, über ein großes, kaltes Auge. Er setzt seine Fingerspitzen darauf und friert. Aber die Hand aus Stein reibt, und als sie aufhört, ist das Auge kalt und klar, aber der Rücken der Hand ist tränennass. Er wischt sie am Ärmel trocken und lässt sie anschließend fallen.
»Weine nicht, mein Junge«, hört er den Vater flüstern.
Dann weint er trotzdem. Jemand drückt ihm ein Taschentuch in die Hand, und während er die Augen trocken und klar wischt, hört er der Stille im Raum an, dass alle seinem Weinen lauschen. Da schweigt er aus Scham. Zwingt seine Augen zu Gehorsam und knüllt das kleine gelbe Taschentuch, das nach einem kräftigen Parfüm riecht, zu einem Ball zusammen und reicht es der am nächsten stehenden Frau. In dem Moment sagt der Vater:
»Behalt es. Ich habe noch eins.«
Da wird der Ball schwer in seiner Hand. Er beugt sich ganz dicht zur Scheibe vor, aber jetzt beschlägt sie nicht. Der Vater legt die Wange an seine. Es ist eine Wange aus Stein.
»Sieh mal«, flüstert er.
Und der Sohn sieht. Sieht, dass die Wagen in einer langen Reihe um die Ecke rollen. Fünf schwarze Wagen im bläulichen Schneefall. Fünf schwarze Wagen, die unerbittlich auf den Hauseingang zurollen und mit schneebedeckten Dächern sanft anhalten.
»Drei hätten völlig gereicht«, flüstert die Tante mit der Brille so, dass keiner es hören soll, jedoch gleichzeitig so, dass fast alle es hören können.
Und sicher, drei hätten gereicht, aber erst fünf schwarze Wagen sehen nach etwas aus. Und der Vater liebt das, was nach etwas aussieht. Der Vater liebt das, was schön ist. Deshalb hat er fünf bestellt.
Nach unten sind vier Treppen zu gehen. Sie steigen sie sehr langsam hinunter, als wäre es das letzte Mal. Als Erster geht der Vater, und ihm folgt der Sohn, und dann kommen die dreizehn anderen. Durch die Treppenhausfenster sehen sie den Schnee, der immer dichter fällt und die Pfosten der Teppichstangen in graue Wolken hüllt. Wenn es nicht aufklart, werden die Wagen ohnehin nicht zu sehen sein. Nun schweigen alle fünfzehn, nein, sechzehn, denn auf der dritten Treppe kommt ihnen die Freundin des Sohnes entgegen. Sie ist dünn und blass und hat von ihrem Kurzwarenhandel im Stadtteil Norrmalm nur nach langem Drängen frei bekommen. Schnee hat sie auf ihrem schwarzen Mantel, und Schnee hat sie auf den schwarzen Handschuhen, und Schnee hat sie auf dem Schleier des Huts, so dass man nur ihre Augen sehen kann. Und geweint hat sie durchaus. Aber wer weiß weshalb …?
Schwarz und still schreitet das Gefolge die Treppen hinunter. Nachbarn öffnen ihre Türen und schauen ernst und schweigend zu. Es ist ein schönes Schauspiel mit guten Rollen. Ein Kind beginnt zu weinen und presst sich an die Wand, als sähe es den leibhaftigen Tod. Aber sobald sie vorbei sind, werden sämtliche Türen barmherzig leise geschlossen. Als Erstes geht der Sohn, und dann geht die Freundin des Sohnes, und dann geht der Vater, und dann gehen die dreizehn anderen. Hart ist der Stein der Treppenstufen, und schrecklich ist der Klang der harten Absätze und das Rascheln der schwarzen Kleider. Schrecklich ist der Schnee, der draußen lautlos und schwer fällt und alles Lebende und Tote unter sich begräbt. Schrecklich ist auch die Länge der Treppen. Sie gehen und gehen, kommen dennoch nie unten an. Der Sohn greift nach der Hand seiner Freundin, aber was er findet, ist ihr nasser, kalter Handschuh. Er drückt ihn fest, ganz fest, fühlt dabei jedoch nur, wie sehr sie friert. Er schaut die Treppe hinab und geht und geht. Tief sind die Rillen in den Treppenstufen der Trauer und voller Salz und Sand.
Schrecklich ist schließlich der Anblick, der sich ihm nach dem Ende der letzten Treppe bietet. Schön, aber schrecklich. Ohne es zu merken, hat er die Hand seiner Freundin losgelassen und ist allein durch den dunklen Flur bis zur Haustür gegangen. Als er sie schon öffnen und zu den wartenden Wagen hinaustreten will, die durch Schnee und Glas nur schemenhaft zu erkennen sind, wird ihm jedoch bewusst, wie still und dunkel es hinter ihm ist. Da dreht er sich auf dem Gitterrost stehend langsam um und erblickt ein Bild, das er nie vergessen wird, weil es so schön und so schrecklich ist. Denn mitten auf der Treppe sind alle fünfzehn in ihren schwarzen Kleidern stehengeblieben. Mit ihren Körpern verdecken sie die Fenster im Treppenhaus. Deshalb ist es so dunkel. Hinter den dichten Schleiern glänzen die Gesichter der Frauen hart wie Knochen. Alles andere ist dunkel, die Treppe, die Wände und die schweren Kleider. Nur die Gesichter sind weiß und eine einsame, handschuhlose Hand auf einem Mantel. Für einen Moment stehen sie vollkommen still, als warteten sie auf einen unsichtbaren Fotografen. Dann schreiten sie langsam weiter abwärts und wie ein einziger großer Schatten auf ihn zu. Die Treppe der Trauer ist zu Ende.
Draußen fällt Schnee. Eine Straßenbahn bimmelt und rollt verborgen vorbei. An der Baustelle glühen schwach Laternen. Mit Schnee auf den Kleidern steigen sie in die Wagen ein. Sie sind sechzehn für fünf große Autos und müssen verteilt sitzen und frieren. Kurz bevor sie losfahren, nimmt der Schneefall etwas ab, so dass wenigstens die Gelegenheit besteht, sie losfahren zu sehen. Sie holen den Pfarrer am Pfarrhof ab. Barhäuptig steht er im Eingang und wartet. Er setzt sich vorn zum Fahrer in das Auto der nächsten Trauernden und drückt ihre Hände durch die Öffnung in der Scheibe. Jeden einzelnen von ihnen betrachtet er lange und ernst. Vom schneidenden Wind tränen ihm die Augen. Für einen Moment glauben sie fast, dass er weint.
Unterwegs fragt er sie über die Verstorbene aus. Wie sie lebte, woran und wie sie starb. Es ist der Vater, der für die vier antwortet, für sich selbst, für den Sohn, für die Freundin des Sohns und für seine schöne Schwester. Er kann Pfarrer nicht leiden. Er findet es nur schön, dass ein Pfarrer dabei ist. Deshalb antwortet er mürrisch, dass sie lebte, wie arme Leute es tun. Als sie konnte, ging sie putzen. Als sie das nicht mehr konnte, blieb sie daheim. Lag die meiste Zeit. Konnte launisch sein. Ansonsten war sie lieb. War wohl meistens lieb. Meinte es zumindest gut. In der letzten Zeit war sie aufgeschwemmt und hatte Probleme mit Treppen.
Der Sohn sitzt am Fenster und sieht hinaus. Es klart auf. Über Södermalm wird der Himmel glasig wie Eis. Die Straße, auf der sie fahren, ist kalt und hart. Über die Bürgersteige fegt der harte Besen des Winds. Einen Hut bringt er mit, einen neuen schwarzen Hut. In einer Metzgerei steht ein weißer Mann mit einer Säge in der Hand … hatte Probleme mit Treppen … Und trotzdem ließen sie sie gehen. Sie fahren über die Brücke. Der Kanal ist zugefroren. Schmale Skispuren schlängeln sich über ihn. Am Kai liegt schief ein festgefrorenes Boot und friert.
»In welchem Krankenhaus ist Frau Lundin gestorben«, erkundigt sich der Pfarrer.
Da zucken alle zusammen und blicken auf den Boden des Wagens. Woran sie starb, darüber spricht der Vater lange, ziemlich lange, ja, fast, bis sie die Friedhofsmauern sehen können. Aber wie sie starb, geht niemanden etwas an. Die blasse Freundin dreht sich um und sieht den Sohn an. Doch der Sohn schaut zur Heckscheibe hinaus. Sieht die anderen Autos, eines nach dem anderen, in die lange weiße Kurve rollen. So viele in einer Reihe sind schön, und jemand bleibt stehen und schaut.
»Sie ist zu Hause gestorben …?«, erkundigt sich der Pfarrer.
»Ja«, sagt die schöne Schwester, »so ist es. Sie ist zu Hause gestorben.«
Dann sind sie da.
Nun gehen sie den langen Weg zu dem Kreuz hinauf. Der Wind zerrt an den Schleiern und peitscht ihnen Tränen in die Augen. Als Erstes gehen der Pfarrer und der Vater. Dann folgen der Sohn und die Freundin. Dahinter gehen die Tanten Hand in Hand, gefolgt von den Verwandten des Vaters vom Land. Dann gehen die wenigen falschen Freunde, dahinter die zwei Nachbarinnen. Als Letzter geht der Krankgeschriebene und denkt an seine Krankheit.
In der Kapelle nehmen sie nicht viel Platz ein. Schwer setzt sich der Vater in die erste Bank, den schwarzen Hut in der Hand. Er wirft einen Blick über die Schulter, um zu schauen, ob noch jemand kommt, aber es ist keiner zu sehen. Doch, als alle Platz genommen haben, nähern sich zwei Frauen mit einer Fahne. Einst, bevor sie hässlich und aufgeschwemmt wurde, war die Tote in einem Frauenverein gewesen. Das hätten sie fast vergessen. Aber der Verein hat es nicht vergessen. Und während die Fahnenträgerin den Gang hinaufgeht, die Fahne tapfer erhoben, erinnert sich auch der Witwer schmerzlich deutlich. Es war nicht böse gemeint, aber eines Abends hatte er sich über ihre ständige Rennerei zu Versammlungen beschwert, und von da an war sie nie mehr hingegangen. Jedenfalls ist die Fahne mit ihrem schwarzen Flor schön, und die Frau, die sie trägt, sieht auch nicht schlecht aus. Rot vom Wind ist sie vorher schon gewesen, aber ein wenig errötet sie nun auch unter den achtzehn Blicken. Die Verwandtschaft vom Land ist angesichts der roten Fahne sicher ein wenig pikiert, aber gut ist ja, flüstert jemand, dass sie immerhin einen Flor, also Trauer trägt.
Mitten im Raum steht der gelbe Sarg, und obwohl man versucht, woandershin zu schauen, ist man am Ende natürlich gezwungen zu bemerken, dass er dort steht. Dass er auf seinem Podest steht und hübsch aussieht mit seinen acht Kränzen. Legt man den Kopf schief, kann man lesen, was auf den Schleifen geschrieben ist.
»Ein letzter Gruß von Familie Carlsson«, liest eine Frau leise in das Ohr ihres Mannes. Dann schluchzt sie plötzlich. Es ist ihr Kranz. Und er ist schön.
Da beginnt die Musik. Es spielen Geige und Orgel, und während man auf der Empore musiziert, blickt der Sohn auf die Hände seines Mädchens hinab. Sie zittern in den Handschuhen fein wie zwei Blätter. Dann betrachtet er die Hände des Vaters. Schwer und still liegen sie auf den Knien. Plötzlich ziehen sie jedoch eine Uhr aus der Tasche, und solange die Musik anhält, öffnen und schließen sie ein ums andere Mal das Uhrengehäuse. Die schöne Schwester fingert an einem Ring herum, dreht ihn hin und her. Dann zieht sie ihn ab und schaut sich ratlos um. Aber die hässliche Schwester sieht den Sarg schlecht. Deshalb haucht sie auf die Brillengläser und putzt sie mit einem großen weißen Taschentuch. Danach sieht sie besser. Und ganz vorn und dem Sarg am nächsten steht starr und steif die Fahnenträgerin, aber an dem flatternden Flor erkennt man, dass sie zittert.
Jetzt redet der Pfarrer. Es ist eine Ansprache über eine gute Ehefrau für einen guten Ehemann und eine gute Mutter für einen guten Sohn und eine gute Tochter. Der Pfarrer glaubt also, die Freundin des Sohnes wäre eine Tochter der Toten. Deswegen ärgern sich die anderen über sie. Schauen zumindest in ihre Richtung. Sie selbst kaut auf ihrem Handschuh herum und weint. Sie weint schnell. Nun spricht der Pfarrer über ein strebsames Leben und die große Geduld, die erforderlich ist, um eine Krankheit zu ertragen. Da schluchzen sämtliche Frauen in ihre Taschentücher oder in die Ärmel ihrer Mäntel, weil sie ja alle ihre Krankheiten haben. Schließlich spricht der Pfarrer über das Glück, zu Hause sterben zu dürfen, umgeben von seinen geliebten Nächsten. Da beißen sich alle Männer fest oder locker auf die Lippen, denn sie haben ja alle Angst zu sterben. Aber der Sohn nestelt ein Taschentuch heraus, das feucht ist und nach Parfüm riecht. Dann raschelt der Sand, und der Sarg versinkt mit all seinen Blumen langsam wie eine Kinoorgel. Sie versuchen ihn so lange zu sehen, wie es nur geht, so wie man einem Zug hinterherschaut, der mit einem Freund an Bord verschwindet. Schließlich ist nichts mehr zu sehen. Nur ein Loch im Boden, das nach Blumen riecht und bald nicht einmal mehr nach Blumen. An dem Loch steht dann der Witwer. Scheu und leicht gebeugt steht er dort, und durch den aufgeknöpften Mantel sehen sie die Uhr herabhängen. Und wenn er zu sprechen ansetzt, schwingt sie jedes Mal wie ein Pendel unter dem schwarzen Mantel.
»Liebe«, sagt er.
Aber dann übermannen ihn die Tränen. Die Gewissheit trifft ihn plötzlich wie eine Peitsche, und er zuckt spürbar zusammen. Dass tut er so heftig, dass jemand befürchtet, er würde hineinfallen. Doch er fällt nicht. Er verneigt sich nur über dem Loch. Dann geht er rückwärts, und sein Blick ist von Gewissheit starr. An der Bank legt der Pfarrer jedoch beruhigend eine große Hand auf seine, bis sie nicht mehr zittert und ruhig wird wie ein Stein.
Der Sohn liest ein Gedicht am Grab. Es ist ein kleines weißes Blatt, das in seiner Tasche neben dem nassen Taschentuch gesteckt hat. Deshalb riecht das Gedicht nach Parfüm, und deshalb ist die Tinte zu den Rändern hin verlaufen, aber das ist nicht der Grund dafür, dass er so schlecht liest. Der Grund sind die Tränen. Das Gedicht kann er auswendig, und die letzten Verszeilen gelingen ihm, als er sich eingewöhnt hat, sehr gut. Seine Stimme ist ruhig und fest, vielleicht sogar ein wenig zufrieden mit sich selbst.
Zufrieden ist auch der Vater. Er mag alles, was schön ist. Schöne Gedichte auf schönen Beerdigungen mag er. Er sieht den Pfarrer an, doch der Pfarrer lauscht nur. Aber er lauscht schön. Er ist geübt darin, Beerdigungsgedichten schön zu lauschen. Es ist ein langes Gedicht, aber das Blatt ist klein, und mehrere schauen am Ende zum Pfarrer, um zu sehen, was er von ihrer Beerdigung hält.
Für den Sohn ist das Blatt jedoch auf einmal leer. Da steht er vor dem Loch und hält ein Blatt in der Hand, und die Hand zittert. Er betrachtet die weiße Leere und kann es nicht verstehen. Er schaut über den Rand des Blatts hinweg, und sein Blick fällt und fällt. Die Ränder des Grabs sind grau und glatt. Der Sargdeckel ist gelb und kalt. Die Blumen glimmen rot.
Erst da versteht er es. Und es ist schwer zu verstehen. Ein Schritt nach vorn und dann weinen. Noch ein Schritt und dann wissen, hier ist Schluss. Ein Taschentuch fest auf die Augen gedrückt und danach fühlen, dass es keinen Aufschub mehr gibt. Keine Todesanzeige ist mehr zu formulieren. Keine Einladungskarten sind mehr zu schreiben. An kein Gedicht muss in den Nächten gedacht werden, wenn man nicht schlafen kann. Es gibt keinen Trost, und es gibt keinen Schutz und kein Ende und keinen Anfang. Nur die Gewissheit gibt es, leer wie ein Grab, dass da unten seine Mutter liegt und tot ist, unwiderruflich fort. Fort für Gebete und Gedanken, für Blumen und Gedichte und Tränen und Worte. Und das Taschentuch abwechselnd auf die beiden Augen gepresst, weint er vor Leere, weint und weint, denn die Leere hat mehr Tränen als irgendetwas anderes.
Behutsam führt ihn der Pfarrer zurück, und eine Hand aus Stein zieht ihn auf einen Stuhl hinab, und ein Arm aus Stein wird um seine Schulter gelegt. Durch einen Schleier aus Tränen sieht er dann die Frau mit der Fahne vortreten und ihre Fahne drei Mal in das Loch senken, aber als die Fahne das dritte Mal gehoben wird, ist der Trauerflor lose. Sachte schwebt er auf den Boden der Kapelle. Anschließend treten alle ein letztes Mal an das Grab. Wer einen kleinen Strauß dabei hat, lässt ihn fallen. Hart schlägt er auf den Sargdeckel oder fällt raschelnd in einen Kranz. Die anderen schauen nur, ein kurzer oder langer Blick und zwei Schritte zurück und dem Pfarrer die Hand geben.
Am Rand des Grabs macht sich der Sohn frei von dem Arm aus Stein, und mit der Leere wie ein Schmerz in der Kehle zerreißt er sein Gedicht in kleine, winzig kleine Teile. So klein, dass sie Schneeflocken gleichen, als sie sachte auf den Sarg rieseln, getrübt von Blumen und Tränen.
Den Pfarrer setzen sie in der Schneewehe vor dem Pfarrhof ab. Er hat es eilig, ins Haus zu kommen, und jetzt glaubt keiner mehr, dass er weint. Es schneit heftig, und auf der Straße in die Stadt haben sich die fünf Wagen im Schneegestöber verloren. Sie sind sechs, und sie sind sieben im Trauerzug geworden. Ein Metzgerauto ist dazugekommen sowie ein kleiner Lastwagen mit Möbeln. Als es auf der Brücke für eine halbe Minute aufklart, erkennt man auf dem einen Auto einen Schrank mit einem Spiegel und auf dem anderen ein großes geschlachtetes Tier. Der Weg vom Kreuz ist schwer zu gehen gewesen. Bei denen, die nicht geweint haben, hat der wirbelnde Schnee Tränen herausgepeitscht. Aber die anderen, die geweint haben, hat er des Weinens beraubt und ihnen stattdessen nur Tränen gegeben. Die Frau mit der Fahne und ihre Begleiterin haben sie eingeladen, im letzten Wagen mitzufahren, und wegen der langen Fahnenstange mussten sie ein Fenster offen lassen. So ist Schnee hereingewirbelt worden und er, der krankgeschrieben ist, hat sich die ganze Fahrt beklagt und über seine Krankheit gesprochen und darüber, wie empfindlich er auf Kälte reagiert. Die zwei Frauen vom Verein haben dagegen über Alma gesprochen.
»Alma war eine gute Genossin«, haben sie gesagt, »eine bessere Genossin hätte man nicht finden können.«
Aber keiner hat ihnen zugestimmt, alle haben geschwiegen, ihnen jedoch nicht beigepflichtet, und als die beiden oben auf Södermalm ausgestiegen sind, hat man rasch das Fenster hochgekurbelt und auf einen warmen Leichenschmaus gehofft.
Und warm ist es in der Gaststätte. Warm und gepflegt. Etwas ungewohnt ist es schon, dass die Kellner so weiße Livreen tragen und sich so tief verbeugen. Sie hätten ihn sicher auch daheim abhalten können, also den Leichenschmaus. Die Schwester mit Brille hätte das Essen zubereiten und die Schwester ohne hätte es servieren können, und genügend Platz hätten sie dafür durchaus gehabt. Aber es ist ein feines Restaurant, und der abgetrennte Bereich, den der Witwer gemietet hat, ist ein schöner und feierlicher Raum, und was schön und feierlich ist, gefällt dem Witwer, auch wenn es etwas kostet.
So gesehen war Alma geizig, denken manche unter ihnen, die gerade den abgetrennten Raum betreten haben, und wäre Knutte vor ihr gestorben, hätte der Leichenschmaus mit Sicherheit im Trauerhaus stattgefunden – wenn es überhaupt einen gegeben hätte. Vielleicht höchstens einen Kaffee vorher und ein Glas Wein und ein Stück Kuchen hinterher.
Ehe sie sich setzen, vergehen ein paar stille Minuten. Für siebzehn ist der Tisch gedeckt, und zwischen seinen Schwestern steht der Witwer und zählt. Zählt die Gedecke und die Stühle und kommt nur einmal auf sechzehn. Drei Mal kommt er dagegen auf siebzehn. Schwach ist das Licht im Raum, und heiß und rot nach dem Sturm und der Trauer sind die sechzehn Gesichter. Gesättigt von herrlicher Trauer sind diese seltsamen, stillen Minuten, die vergehen, zunächst vollkommen still, dann immer weniger still. Denn jemand reibt sich die Hände, reibt und reibt wie vor einer schweren Arbeit. Da hustet ein anderer, damit man das Reiben nicht hört. Schließlich dreht sich der Witwer um.
»Dann wollen wir uns mal setzen«, sagt er, flüstert es fast.
Kleider rascheln und Schuhe knarren. Stühle scharren und Taschenverschlüsse klicken. Es ist dunkel und feierlich im Raum, und sie fühlen sich eigentümlich rein, wie sie dort sitzen, zunächst jeder für sich, und auf ihre weißen Teller hinabsehen. Rein, fast wie Kinder. Und die Teller glänzen. Sie können ihre Gefühle in ihnen spiegeln. Ein schönes Bild wird daraus.
Dem Witwer passiert jedoch ein Malheur. Er sitzt neben seinem Sohn, und auf der anderen Seite sitzt die schöne Schwester. Er schaut sich nach dem Essen und dem Schnaps um, hebt schon die Hand, wie um zu winken. Da öffnen sich jedoch die doppelten Türen, und drei in einer Reihe kommen weiße Kellner mit ihren Tabletts herein. Sie sehen ihn so eigenartig an, als sie vorbeigehen, dass er sich windet und den Blick senkt. Erst da fällt ihm die Kerze ins Auge. Einer nach dem anderen bemerken sie daraufhin alle die Kerze, die hohe, weiße Kerze in dem schwarzen Ständer, die einsam auf dem Tisch brennt. Einer nach dem anderen betrachten sie die Kerze und den großen, weißen Teller vor dem Witwer. Dann sehen ihn alle an.
»Du sitzt auf Almas Platz«, sagt jemand schneidend laut.
Es ist die hässliche Schwester, die das sagt. Ihre Augen blinzeln hinter den beschlagenen Gläsern, und er könnte sie dafür schlagen, dass sie es so laut gesagt hat. Würdevoll soll die Art sein, in der er sich erhebt, aber es gerät erschrocken, scheu und erschrocken. Und auf Almas weißem Teller bleibt ein abgebranntes Streichholz zurück.
Danach sitzt der Sohn der Kerze am nächsten. Es ist die Kerze der Mutter, die herunterbrennt. Er betrachtet sie, empfindet aber nur Leere. Er starrt in die Flamme, bis er nichts anderes mehr sieht, und geblendet versucht er zu denken: Es ist das Leben meiner Mutter, das da brennt. Es ist meine Mutter, die langsam stirbt.
Aber er weiß, dass sie tot ist und die Kerze daran nichts ändert. Es ist nur eine gewöhnliche Kerze, die brennt, und wenn sie heruntergebrannt ist, wird nichts anderes geschehen sein, als dass eine gewöhnliche Kerze in ihrem Ständer heruntergebrannt ist. Seine Freundin, die er dann ansieht, wagt es jedoch nicht, die Kerze anzusehen. Sie wagt nur, in ihren Schoß zu schauen, wo ein zerknülltes Taschentuch liegt. Sonst muss sie weinen.
Da sieht der Sohn seinen Vater an. Sieht ihn lange an, so lange, dass er zu essen vergisst. Das Sandwich liegt ungegessen auf dem Teller, und das Bier bleibt ungetrunken. Denn plötzlich hat er solche Lust bekommen, dem Vater in die Augen zu sehen. Noch weiß er nicht wirklich warum, weiß nur, dass er ihm in die Augen sehen muss, und sei es auch nur für einen kurzen Moment. Aber der Vater schaut nicht in die Richtung des Sohnes. In der Richtung des Sohnes steht die Kerze. Und er will die Kerze nicht ansehen. Es ist eine schöne Kerze, und er mag alles, was schön ist, doch er will sie dennoch nicht ansehen. Deshalb schaut er in andere Richtungen, in jede andere Richtung geht sein Blick. Er schwitzt und wird rot davon, den Hals so viel zu drehen, nickt den Gästen gegenüber und zu beiden Seiten zu, wirft hier ein Wort ein und dort ein anderes, lässt eine Gabel mit Hering in seinen Schoß fallen. Vergisst auf einmal, wo er ist, und lacht. Lacht, wie man es über fast nichts tut. Die Schwester packt seinen Arm, die hässliche Schwester kneift ihn über dem Ellbogen und sagt so, dass fast alle es hören:
»Du darfst doch nicht lachen, Knut …!«
Nein, er darf nicht lachen. Er begreift es selbst und erstarrt. Eiskalt schießt ihm die Scham durch den Körper. Er zieht sein Taschentuch heraus. Es ist trocken. Jetzt wird es feucht von Schweiß, vom Schweiß der Scham. Er versteckt sich eine Weile dahinter und ordnet seine Gesichtszüge, und als ihn wieder alle sehen können, trägt er eine schöne Maske aus Ernst, ja beinahe Trauer. Und während der Schnaps serviert wird, schaut er der Maske zuliebe zu der Kerze. Aber vor der Kerze sitzt sein Sohn, und die Augen des Sohns senken sich in seine, stechen so hinein, dass es fast brennt. Da fällt es leichter, die Kerze zu betrachten. Es ist eine schöne Kerze, die er lieben kann. Aber der Sohn hat keine schönen Augen. Deshalb liebt er sie nicht. Deshalb will er nicht in sie sehen.
Dann trinken sie schweigend auf die Tote. Einen gibt es, der nach dem Kurzen Aah macht, aber seine Frau hustet, um es zu übertünchen. Der Witwer hustet auch. Dann klopft er an sein Glas.
»Eine Schweigeminute für Alma«, sagt er. Senkt danach den Kopf.
Alle senken ihre Köpfe. Fast alle denken an die Tote. Die Kerze brennt mit hoher, klarer Flamme. Draußen wirbelt Schnee und bellen Hunde. Drinnen ist es still und warm, und aus dem Restaurant hört man ferne, herrliche Musik. Lang ist eine Minute. Vieles geschieht unterdessen. Einer sieht vor sich, wie der Sarg sinkt und von einem Loch verschluckt wird. Eine sieht den Krankenwagen, der mit roten Lichtern im Schnee heranschlittert, und einer sieht Alma, die geschwollenen Beine auf ein Kissen gelegt, in seinem Garten sitzen. Einer sieht sie in jungen Jahren mit einem Handtuch um die Haare auf einer Treppe stehen. Einer hört ihre Stimme etwas Unangenehmes durch eine Tür sagen. Er schüttelt den Kopf, bis eine bessere Erinnerung auftaucht. Wenn man den Kopf schüttelt, taucht immer eine auf.
Aber einer denkt an etwas anderes und wünscht sich, dass die Minute vorübergeht und die Kerze schnell herunterbrennt. So sehr fürchtet er sich vor der Stille und der Kerze. Ein anderer sieht Alma auch nicht, weil er weiß, dass sie tot ist, und wenn jemand tot ist, bleibt ein großes, leeres Loch zurück. Er schaut eine ganze Minute auf seinen Teller hinab, und die ganze Zeit liegt auf dem Teller ein Paar ängstlicher Augen mit großen roten Augäpfeln. Eine ganze stille Minute denkt er: Warum hat Vater Angst …? Und er weiß, dass es genau das war, was er wissen wollte: Ob diese Augen trauerten oder bloß Angst hatten.
Nachher folgt den ganzen Abend keine weitere Schweigeminute. Sie bekommen viel Schnaps, auf mystische Art und Weise viel mehr, als ihnen zusteht, und Schnaps ist gut. Als Erstes wärmt er einen, und man bekommt schöne Augen. Alle anderen bekommen auch schöne Augen. Alles, was hart ist, wird weich, und alles, was unser ist, wird zu etwas der anderen. Gibt man eine Hand, findet sich jemand, der sie nimmt. Sagt man ein Wort, findet sich jemand, der es sich anhört, als hätte es verdient, gehört zu werden. Nahe kommt man einander, und es ist herrlich, einander nahezukommen. Schöne Lippen bekommt man und gute, weiche Münder. Warm wird alles, und alle Schatten weichen. Die Trauer erhält einen Rand aus Freude.
Sie betrachten die Kerze, die brennt und brennt und bald heruntergebrannt sein wird. Aber es entsetzt sie nicht, dass sie so schnell brennt, dass dort ein Leben steht und mit klarer, scharfer Flamme brennt. Klar, scharf …? Nein, sie ist weich und warm, und je tiefer sie sinkt, desto weicher wird sie. Je tiefer sie sinkt, desto weicher wird die Erinnerung an Alma. Alle holen ihre Bilder heraus und halten sie vor den gütigen Augen ihrer Nachbarn hoch.
»Sie war lieb und geduldig«, sagt sie, die auf dem Bürgersteig stand und den Krankenwagen schlittern sah, »und als Tote war sie schön. In der Leichenhalle lag sie so fein mit gefalteten Händen. Und dass sie auf die Stirn gefallen war, hat man kaum gesehen.«
»Und eine gute Genossin, das war Alma«, sagt er, der krankgeschrieben ist und im Auto gefroren hat.
»Und was hat sie gelitten«, sagt er, in dessen Garten sie einmal mit geschwollenen Beinen saß, »und was hat sie in ihrem Leben gekämpft.«
»Und was hat sie geschleppt«, sagt seine Frau.
»Und was sie für Knut gewesen ist, das wissen wir ja alle. Und am besten weiß er es selbst«, sagt einer, der niemals ihr Freund war.
Aber es ist wahr. Am besten weiß er es selbst. Deshalb ist er so still. Schnaps ist gut. Sitzt jemand da und schweigt, merkt es keiner. Hat jemand Angst, eine Kerze anzusehen, merkt es auch keiner. Es mag stimmen, dass der Tod ein großes, leeres Loch ist und Trauer bedeutet, zu wissen, wie leer dieses Loch ist, aber das stimmt nur, wenn man nüchtern ist. Hat man Schnaps, kann man das Loch mit all den schönen Gedanken füllen, die man denken kann, und all den feinen Worten, die man sich einfallen lassen kann. Bis zum Rand kann man es füllen. Und im Anschluss einen Stein dorthin stellen.
Kann man das jedoch nicht, muss man dafür seine Gründe haben, und während der ganzen Zeit, die der Sohn mit seiner kleinen, blassen Freundin über seine tote Mutter spricht, denkt er: Warum sagt Vater nichts …? Und warum hat er solche Angst …?
Er selbst füllt kein leeres Loch, denn er weiß, wie leer es ist. Er spricht nur mit seiner Freundin über die Tote. Er tut das nicht, weil er getrunken hat. Er trinkt nie. Fast nie. Er tut es, weil er sie geliebt hat. Und über den Menschen, den man geliebt hat, spricht man. Wenn man denn spricht. Und geliebt hat er sie, weil sie ihn geliebt hat. Und wenn einen jemand liebt, erwidert man dessen Liebe. Sonst ist man dumm.
Aber die Flamme sinkt und sinkt, und mehrere wollen aufbrechen, ehe sie den Grund erreicht. Als Erstes geht die Freundin des Sohnes. Sie ist blass und hat Kopfschmerzen. Sie ist immer blass und hat fast immer Kopfschmerzen. Oder sie weint. Selbst wenn sie lacht, weint sie ein bisschen. Sie ist erst siebzehn. Der Sohn begleitet sie ins Vestibül. Dort steht auf einem Tisch ein Telefon. Ein Ober ruft ihr ein Taxi, denn es schneit, und sie friert fast immer. Als sie die Handschuhe angezogen hat, drückt er ganz fest ihre Hand und sieht ihr lange in die Augen. Da beginnt sie zu weinen. Dann kommt der Wagen im Schnee. Er gibt ihr drei Kronen für die Fahrt. Es ist alles, was er hat.
Danach sitzt er zwischen der Kerze und einem leeren Stuhl am Tisch. Jetzt ist die Flamme tief unten. Dann wärmt sie mehr. Sie wärmt seine Hände. Es ist schön, gewärmt zu werden, denn wenn er seine Freundin anfasst, friert er. Er hat sie gern, aber er friert. Deshalb hat er sie nicht haben können. Um sich noch mehr zu wärmen, rückt er näher an die Kerze heran. Zwei Widersacher der Toten gehen, denn es ist alles ausgetrunken und aufgegessen. Da sind sie zu dreizehnt am Tisch, und als die Verwandten vom Land dies merken, wollen auch sie gehen. Der Vater begleitet sie hinaus. Es sind seine Verwandten. Die Tote hatte keine mehr. Zwei gut zwanzig Jahre ältere Brüder starben in Amerika. Die Mutter starb in einem Sanatorium in Jämtland, der Vater starb jung auf See.
Die Verwandten des Vaters nehmen ein Taxi durch den Schnee. Sie fahren nicht zum Bahnhof, wie sie sagen. Sie fahren zu reicheren Verwandten auf Essingen. Aber sie sind lieb, und jemanden, der arm und in Trauer ist, wollen sie nicht verletzen. Außerdem sind sie ein bisschen betrunken. Zu Beerdigungen und Kindstaufen kommen sie in die Stadt, bleiben dort dann aber lange.
Während sie an der Tür stehen und sich verabschieden, brechen zwei weitere Widersacher auf. Es sind zwei Arbeitskollegen. Sie sind gut gelaunt, und da es erst neun ist, haben sie noch reichlich Zeit für eine weitere Kneipe. Das sagen sie Knut jedoch nicht, denn wer möchte schon einen frisch verwitweten Mann verletzen. Und die eine Schwester, die schöne, kommt eine halbe Minute später. Hat Kopfschmerzen und will heim. Als das Taxi der Arbeitskollegen vorfährt, steigt sie allerdings in denselben Wagen.
»Schöne Beine hast du«, sagt der eine und streicht Schnee von ihren Strümpfen.
Das hat er den ganzen Tag gedacht. Selbst in der Kapelle hat er es gedacht. Das flüstert er ihr ins Ohr. Das findet sie im ersten Moment unpassend. Dann findet sie es lustig. Dann findet sie es gut. Sie mag den, der sie schön findet. Es gibt viele, die sie schön finden. Deshalb mag sie viele. Am meisten mag sie sich selbst.
Doch in dem abgetrennten Raum brennt die Kerze bald herunter, und die hässliche Schwester will weinen. Bevor sie weint, geht sie. Sie weiß, dass sie hässlich wird, wenn sie weint. Noch hässlicher. Aber der Vater wird wütend, als sie aufbricht. Nicht weil sie aufbricht, sondern weil sie hässlich ist. Hässliche Frauen wecken oft seinen Zorn.
Warum ist Vater so wütend, denkt der Sohn. Jetzt sitzt er fast an der Kerze. Ihm ist warm, und wenn ihm warm ist, sehnt er sich nach seiner Freundin. Das tut er, weil er sie wärmen möchte. Aber wenn sie kommt, wird er nur kalt. Dann sieht der Vater ihn an, versehentlich vielleicht, aber er schaut hin. Warum hat Vater solche Angst, denkt er da.
Vielleicht liegt es an der Kerze. Jetzt sengt die Flamme fast das schwarze Krepppapier an. Unbarmherzig sinkt sie zu ihrem Grund hinunter. Über ihr ist Leere. Die große Leere des Todes. Unter ihr ist noch ein Stück Wachs. Plötzlich hofft er, dass dieses Stück noch lange hält. Über die Leere weiß er alles, und trotzdem kann er hoffen. Warum hofft er …? Weil sein Vater sich so davor fürchtet, dass die Kerze ausgeht …?
Da brechen die Nachbarn auf und lassen sie mit der Kerze allein. Nein, der Vater begleitet sie hinaus und lässt den Sohn mit der Kerze allein. Die Flamme flackert. Es ist fast dunkel im Raum. Und in dieser Dunkelheit macht der Sohn etwas Unerhörtes. Still und sachte steht er von seinem Stuhl auf und wechselt auf den der Mutter. Er ist so kalt, dass es ihn schaudert. So kalt ist der Tod. So fürchterlich kalt. So dünn ist die Flamme des Lebens wie die Flamme jetzt. Jemand öffnet eine Tür und schaut herein, und die Flamme flattert. Er legt die Hände um sie, will sie so schützen. Aber an der Tür steht ein Ober.
»Herr Lundin …?«, fragt er.
»Ja«, antwortet der Sohn.
»Telefon für Sie.«
»Für welchen Herrn Lundin …? Für Bengt …?«
»Ja«, sagt der Ober. »Ich glaube, es war für Bengt.«
Der Sohn geht hinaus, um mit seiner Freundin zu sprechen. Vorsichtig schließt er die Tür, damit die Kerze nicht erlischt. Am Telefon redet er sehr gern mit seiner Freundin. Da kann er seine Stimme so warm machen und seine Wärme in ihr kaltes Ohr pusten. Auch ihre Stimme wird dann warm. Am Telefon sind sie beide warm.
Während der Sohn durch das fast leere Restaurant geht, sitzen die drei Nachbarn in einem Taxi. Sie sind zu dritt und können es sich teilen. Einzeln hätten sie sich keins leisten können. Sie fahren die Götgatan hinauf, und der Schnee fällt schön. Vor den Schaufenstern draußen wogt er sachte wie ein dicker Vorhang.
»Eine schöne Beerdigung hat sie bekommen«, sagt die eine Nachbarin.
Die andere schweigt, denn es ist alles gesagt. Aber er, der krankgeschrieben ist, sitzt in der Mitte und ist plötzlich nicht mehr krank. Er ist gesund und munter. Und betrunken ist er auch. Als das Auto in ihre dunkle Straße einbiegt, greift er der einen deshalb an die schneegleichen Brüste. Da lacht die andere.
Während der Sohn noch durch den Raum geht, steht der Vater in der Toilette des Restaurants. Er hat sich gerade die Hände gewaschen. Jetzt wäscht er sie sich noch einmal. Dann hält er sie vor dem Spiegel hoch. Und natürlich sind sie sauber. Aber er wäscht sie sich trotzdem noch ein weiteres Mal.
Auf dem Tisch steht das Telefon mit abgehobenem Hörer. Als der Sohn sich setzt, schmunzelt er. Er schmunzelt über das, was er sagen wird. Hat sie Kopfschmerzen, wird er sagen: Nimm eine Tablette und denk an mich. Und wenn das nicht hilft, dann nimm noch eine und denk an etwas anderes. Weint sie, wird er sagen: Setz dich an den Tisch und schreib einen Brief an dich selbst. Sich selbst zu schreiben, lohnt sich immer. Fast nur sich selbst. Und wenn der Brief fertig ist, bist du nicht mehr traurig. Aber du hast einen langen Brief. Einen langen und schönen Brief.
Und er nimmt den Hörer auf und sagt Hallo.
Dann ist da die Stimme einer fremden Frau, und diese Stimme sagt:
»Wie fühlst du dich, Liebling …? Müde …?«
»Müde …?«, fragt er. »Mit wem spreche ich bitte …?«
»Hier ist Gun«, flüstert die fremde Frau.
Dann bekommt sie große Angst. Er hört an dem schluchzenden Keuchen, was für eine furchtbare Angst sie bekommt. Er selbst bekommt keine Angst.
»Mit wem spreche ich bitte …?«, flüstert sie.
»Hier ist Bengt, Bengt Lundin.« Das T spuckt er in den Hörer.
»Verzeihung«, sagt sie und ist weg.
Hörer auflegen. Kurz darauf zieht ein Ober das Telefon zu sich heran und bestellt ein Taxi für einen Betrunkenen. Als der Vater mit sauberen Händen aus der Toilette kommt, sitzt der Sohn allein auf einem Stuhl neben dem Telefontisch. Er raucht nicht. Er sitzt nur da. Zwischen den Zähnen hat er den Zipfel eines Taschentuchs. Wenn er aufgewühlt ist, kaut er immer auf etwas herum, auf Fingernägeln oder einem Taschentuch.