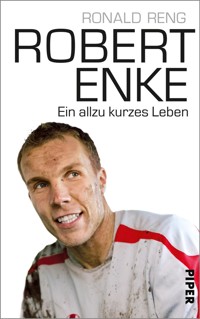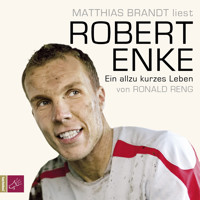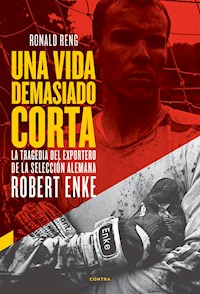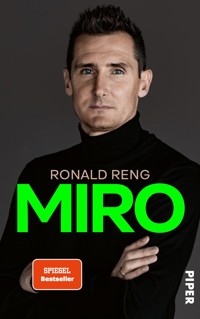12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Viele Städte haben ihren ganz besonderen Reiz. London aber hat alles und von allem im Überfluss: Bewohner, die die Höflichkeit zum höchsten Gut erhoben haben. Parks, die größer sind als deutsche Kleinstädte und schöner als Hugh Grant. So viel Energie. So wenig Regen. Den Premierminister Tony Blair, der in seiner Freizeit das Hemd aus der Hose und diese ohne Gürtel trägt. Das »Zafferano's«, das beste italienische Restaurant außerhalb von Italien. Die Tate Modern. Bewohner, die sich selbst am wenigsten ernst nehmen. All das hält London in Bewegung, und kein Verb beschreibt es besser: Die Stadt, sie schwingt!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Barbara, für die ich London verließ
Für Krisztina, Michael, Raphael, Rob und den Churchill Football Club, wegen denen ich gerne geblieben wäre
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
7. Auflage 2011
ISBN 978-3-492-95555-3
© Piper Verlag GmbH, München 2004
Umschlagkonzept: Büro Hamburg
Umschlaggestaltung: Birgit Kohlhaas, Egling
Umschlagabbildung: David Gibson/Millennium/LOOK-foto
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
»London; eine Nation, keine Stadt.«
Premierminister Benjamin Disraeli, 1870
Die Stadt, sie schwingt
Ich kannte London noch nicht und liebte es schon.
Ein Freund, dem ich bedingungslos vertraute, erzählte mir, dass in London die Geheimagenten durch Rosen an ihrem Revers heimlich miteinander reden konnten; den Briten war es gelungen, Blumen mit Mikrophonen in den Stängeln zu züchten. Meine Eltern ließen mich mittwochs bis nach zehn aufbleiben, und in der Europapokal-Zusammenfassung des deutschen Fernsehens sah ich die furiosen Tacklings der englischen Fußballer, ich spürte einen nie gekannten, aber auf merkwürdige Weise angenehmen Schauder, als die tiefen Gesänge der englischen Fans hinter dem Tor von Bayern Münchens Keeper Walter Junghans erklangen.
In der Schule lernten wir aus Büchern, in denen fabelhafte Sätze standen wie »Waiter, my toast is black!«, die wir uns den ganzen Nachmittag an den Kopf warfen, und irgendwann bekamen wir Besuch von einer Schulklasse aus England, voller Mädchen, die zwar weder von Rosen mit Mikrophon gehört hatten, noch etwas mit unseren Beifall heischend hingeworfenen Sätzen »Waiter, my toast is black!« anfangen konnten, aber unglaublich schöne Blümchenkleider trugen.
Ich war 13, und ich wusste: Dort würde ich leben.
Um ehrlich zu sein, ich war mir damals auch sicher, einmal in Budapest, Palermo und Reykjavik zu leben.
Später fuhr ich tatsächlich überall dorthin. Ich verbrachte in Budapest einen Abend mit einem Russen, der nur Russisch sowie einen Satz Englisch sprach, den er mir dafür umso öfter entgegenschleuderte: »I am a fuckin’ desperado, you understand, a fuckin’ desperado.« Ich verschickte aus Palermo mit meinem Freund Günther goldverzierte, professionell gemachte Karten, die von unserer Doppelhochzeit mit zwei fiktiven Sizilianerinnen kündeten. Ich sah in Reykjavik zum ersten Mal im Leben ein Mädchen, das auf die Straße pinkelte. Ich war glücklich und dachte, in London würde es genauso sein. Ich hatte ja keine Ahnung.
Es war Januar 1997, ich hatte das Studium in München beendet, einen Rucksack und eine Sporttasche dabei und einen Bekannten in Islington, bei dem ich auf dem Boden schlafen durfte. Jeden Morgen studierte ich die Mietangebote in dem Anzeigenblatt Loot, sprach auf ungezählte Anrufbeantworter von Vermietern, von denen ich, während ich redete, schon wusste, dass sie nie zurückrufen würden, und erreichte eine Prostituierte, deren Offerten versehentlich in die Mietangebote gerutscht war. Am vierten Tag fand ich ein Zimmer in Marylebone. Dusche und Toilette waren auf dem Gang, aus der Matratze sprangen losgelöste Metallfedern wie Stachel hervor. Ich bekam Atemnot, weil es in dem Zimmer nicht viel gab, aber reichlich von etwas, wogegen ich allergisch bin: Hausstaub. Die Miete betrug 400 Pfund im Monat, der Strom floss, wenn ich ein Fünfzig-Pence-Stück in den Zähler neben meinem Bett warf. Ich beschloss, aus London nie mehr fortzugehen.
Ich schrieb für deutsche Zeitungen über englischen Fußball und viele Briefe nach Hause, und wurde zunehmend verzweifelter, weil ich fühlte, meine Worte reichten nicht aus, um all die Wunder, die ganze Schönheit Londons zu beschreiben. Ich dachte, Dichter müsste man sein. Und eines Herbsttages in London hatte ich die Halluzination, ich wäre es.
Es war der Moment, als das Tageslicht schon verschwunden, die Dunkelheit aber erst im Kommen war,alssich das Zwischenlicht über die Stadt legte und alles in seinen besänftigenden milchigen Dunst einhüllte, die geraden Reihen der immer gleichen Backsteinhäuser mit den bunten Türen, die Fußball spielenden Kinder im Bishop’s Park mit den aus den Hosen hängenden, am Morgen noch weißen, nun lehmverschmierten Schulhemden, genauso wie die im ewigen Stau auf der Putney Bridge stehenden Autos mit den zitternden Auspuffen,alsin Victoria die Leute zu Tausenden hinunter auf die Bahnsteige strömten und in der Menschenmasse niemand dem anderen in den Weg kam, nicht einmal einer den anderen berührte, die vielen jungen Männer mit den immer noch nadelgestreiften Anzügen nicht die schon etwas älteren Frauen mit den trotzdem noch hohen Absätzen, die unvorhergesehen in diese Karawane der Berufspendler geratenen Nachmittagseinkäufer mit ihren extragroßen Plastiktüten nicht die alte Frau mit ihren vorsichtigen, langsamen Schritten und dem Evening Standard fest in der rechten Hand, den sie gleich, in der U-Bahn, auf den wenigen Zentimetern Platz, die ihr vor ihrem Gesicht blieben, lesen würde, aus einem Augenwinkel immer darauf achtend, dass sie niemanden anstieße,alsim Dove an der Hammersmith Bridge der Kinokartenabreißer aus dem nahen Riverside Cinema mit der bleichen Haut zwei italienischen Touristen zwei große Biere kaufte, auch, weil er einige wenige nette Worte mit ihnen gewechselt hatte, aber vor allem weil er Dienstschluss hatte,alsich, der gerade die U-Bahn in Victoria genommen hatte und später auf dem Fußweg nach Hause einer Gruppe fröhlich schwatzender Jungen mit lehmverschmierten Hemden begegnen würde, ins Dove eintrat, den Kinokartenabreißer das Bier für die Italiener ordern sahundspürte, was die Leute meinen, wenn sie sagen, London, es schwingt.
Es ist vermutlich nicht das Geschickteste, ein Buch mit einer Bankrotterklärung zu beginnen, doch die Wahrheit ist: Ich fürchte, viel besser als der junge Möchtegern-Dichter damals kann ich auch heute nicht in Worte fassen, wie wunderschön London ist. Ich will es trotzdem zumindest versuchen. Vielleicht sollte ich es so einfach wie möglich ausdrücken:
Es gibt keine bessere Stadt.
Budapest, Palermo, Reykjavik haben ihren Reiz. London aber hat alles, und von allem im Überfluss: Einwohner, die die Höflichkeit zum höchsten Gut erhoben haben. Parks, die größer als deutsche Kleinstädte und schöner als Hugh Grant sind. Hugh Grant. So viel Energie. So wenig Regen (weniger als Köln zum Beispiel). Den Premierminister Tony Blair, der in seiner Freizeit das Hemd aus der Hose und die Hose ohne Gürtel trägt, weil Engländer das so machen. Das Zafferano’s, ein besseres italienisches Restaurant als halb Italien hat. Die Tate Modern. Bars, in denen die Leute dreizehn Biere trinken und sagen: »Ich esse heute ja auch nichts!« Die weiten Abschläge von Arsenal-Torwart Jens Lehmann. Die anmutigste Schauspielerin der Welt (Wer? Weiterlesen!). Den Common Sense, den das Langenscheidt-Wörterbuch mit »gesunder Menschenverstand« übersetzt, auch wenn das diese bewundernswerte, unübersetzbare englische Geisteshaltung höchstens halb erklärt. Hunderennbahnen. The last night of the Proms. Kate Winslet (aha!). Ein Bruttosozialprodukt, größer als das von Schweden oder Irland. Einwohner, die sich selbst am allerwenigsten ernst nehmen.
Natürlich hat London auch: Einwohner, die hinter ihrer Höflichkeit verstecken, was sie wirklich denken. Hugh Grant. Eine U-Bahn, in der im Sommer nie weniger als 40 Grad herrschen – und das in einem Land, in dem Tiertransporte bei über 35 Grad verboten sind. Preise, die einen fassungslos machen (2,90 Pfund das Bier, 8 Pfund das Kino). Einwohner, die einem nach dem dreizehnten Bier vor die Haustüre pinkeln.
Aber das verdrängt man, das ignoriert man ganz bald. Weil man ja einer dieser Einwohner werden will, die sich selbst am allerwenigsten ernst nehmen.
All das hält London in Bewegung, und kein Verb beschreibt für mich Londons Bewegungen besser, selbst wenn die Swinging Sixties längst nur noch verklärte Erinnerungen sind: Die Stadt, sie schwingt.
Sie hört nie auf. Sie hat noch nicht einmal einen Horizont. Nach zwei, drei Jahren in der Stadt glaubte ich, ich würde mich auskennen, und dann traf ich jemanden, der sagte, er wohne in Upney, und ich fragte mich: »Wo zur Hölle ...?« 972 Quadratkilometer groß sei London, steht in der Statistik der Stadt, vielleicht sagt das irgendjemanden etwas, mir fehlt dazu die Vorstellungskraft. Ich spürte die ganze Größe Londons, als ich einmal mit einem Freund von seiner Wohnung in Southgate, im Norden der Stadt, zu mir nach Fulham, in den Südwesten, fuhr. Wir schauten auf den Tacho: 41 Kilometer. Und ich hatte gedacht, ich würde im Zentrum wohnen!
Der Architekt Richard Rogers, der in Chelsea wohnt und unter anderem das gelobte Lloyd’s Haus in der City entworfen hat, verkündet zwar schon seit Jahren, die Londoner würden bald das ganze Land zubetoniert haben, wenn sie nicht endlich anfingen, in die Höhe statt in die Breite zu bauen. Doch noch stoßen solche Appelle auf wenig Gehör. Wer auf dem Primose Hill steht, dem schönen Hügel am Nordende des Regent’s Park, blickt auf eine wenig beeindruckende Skyline. Saint Paul’s Cathedrale ist natürlich zu sehen und einige neuere höhere Gebäude wie der Gherkin, das von Rogers’ großem lokalen Rivalen Norman Foster errichtete, einem erigierten Riesenpenis nicht unähnliche Hochhaus einer Schweizer Rückversicherung. Aber sonst ist London flach, eine Kilometer breite Flunder. Die Idee, dass jede Familie ihr eigenes Haus haben muss, ist tief verankert im Londoner Denken, und so breiten sich in alle Himmelsrichtungen, kreuz und quer Reihenhäuser aus. Gerade in den Außenbezirken zeigt sich, wie geflickschustert und zusammengewürfelt London ist. Hier noch ein Anbau, dort noch ein Schornstein. In dieser Stadt darf jeder seinen Individualismus ausleben, auch wenn es sehr oft einfach nur Planlosigkeit ist. Selbst die Statue am Piccadilly Circus, im Herzen der Stadt, ist eine grandiose Fehlkonstruktion: Sie zeigt den Engel der christlichen Barmherzigkeit, mit einem Bogen in der einen Hand – aber ohne Pfeil in der anderen, was schon vor der Einweihung für viel Gelächter sorgte (und Mutmaßungen, ob der fehlende Pfeil die Impotenz des nackten Engels darstellen sollte). Als dann auch noch beim feierlichen Festakt 1893 ein beachtlicher Teil der Fontäne nicht in das Springbrunnenbecken herabfiel, sondern auf die umstehenden Passanten, wurde der Bildhauer Sir Alfred Gilbert, der das Denkmal entworfen hatte, mit Hohn und Spott überschüttet. Kurz vor seinem Tod gestand der arme Gilbert: »Die Angelegenheit Piccadilly hat mein Leben zerstört.«
Londons Schönheit liegt nicht in seinen Monumenten und Wahrzeichen. Sie liegt im Alltag, im Miteinander der Menschen. Ich kam als Deutscher nach England und lernte, dass du die Sprache noch so gut beherrschen, noch so viel mit Einheimischen zu tun haben, vielleicht sogar eine Einheimische heiraten kannst, dass aber der Einwanderer – wie überall auf der Welt – immer ein Ausländer bleiben wird. Ich kann mir bloß nicht vorstellen, dass es irgendwo anders so angenehm ist, Ausländer zu sein.
London ist eine Stadt, in der längst die ganze Welt zu Hause ist. 7,5 Millionen Menschen leben heute hier. Knapp ein Viertel der Bewohner gehören ethnischen Minderheiten an und jedes Jahr wächst die ausländische Bevölkerung um 120000 Menschen. 300 Sprachen, zählte das London Research Centre in seiner Erhebung von 1999, werden in London gesprochen, wobei nach meiner Erfahrung viele Londoner aufgegeben haben, zwischen unterschiedlichen Sprachen und Akzenten zu unterscheiden. »Oh, du bist Franzose, nicht wahr?!«, sagen sie, aber kein Neuankömmling sollte sich daraufhin wegen seiner vermeintlich französisch zarten Aussprache geschmeichelt fühlen. Für jene Londoner sind alle Ausländer aus Frankreich, der Einfachheit halber.
Die Anwesenheit von Ausländern allein unterscheidet London allerdings noch nicht von Sydney, New York oder Frankfurt. Erst der Umgang untereinander macht London so besonders. Wenn schon nicht miteinander, so leben die verschiedenen Kulturen doch zumindest hervorragend nebeneinander und mischen sich zur großen Nation of London. Eines Samstags lud mich eine italienische Freundin zu ihrer Geburtstagsfeier in ein sudanisches Restaurant ein, wo mir der amerikanische Freund ihrer besten Freundin mit seinem alkoholbefeuerten Geprahle im Ohr lag, während ich viel lieber mit der Griechin mir gegenüber geredet hätte. Aber Gott sei Dank gingen wir dann bald in einen Nachtklub im East End, wo sich der betrunkene Amerikaner mit einem Londoner pakistanischer Abstammung prügelte und ihm keiner von uns half, weil wir anderen Männer damit beschäftigt waren, die Griechin mit unserem Wissen über den iranischen Film zu beeindrucken, den wir gerade im ICA gesehen hatten. Keiner von uns wäre auf die Idee gekommen, irgendetwas an jenem Abend außergewöhnlich zu finden (außer vielleicht die Tatsache, dass der Amerikaner um fünf Uhr morgens immer noch aufrecht stand). Weil das alles – das italienische Geburtstagskind, das sudanische Restaurant, der betrunkene Amerikaner, der iranische Film – für uns einfach London war.
Natürlich gibt es auch in London Viertel, in denen die einzelnen ethnischen Gruppen fast unter sich bleiben, etwa in Southall, wo man leicht glaubt, mit dem Vorstadtzug mal eben nach Indien gereist zu sein, oder in Stoke Newington, wo man jemanden nach dem Weg fragt und zurückgefragt wird, ob man auch Türkisch spreche, Englisch gehe nicht so gut. Selbstverständlich gibt es auch traurige Fälle von xenophoben Grausamkeiten, und zwar in allen vorstellbaren Formen, nicht nur Weiß-gegen-Farbig. Während ich dies schreibe, berichten die Zeitungen vom Tod der sechzehnjährigen Heshu Yones, die eine junge Londonerin wie so viele war – selbstbewusst, mit Mobiltelefon und Make-up – und von ihrem kurdischen Vater ermordet wurde, der die Sticheleien seiner muslimischen Freunde nicht mehr aushielt: Wann er endlich etwas dagegen tue, dass seine Tochter einen Freund libanesischer Abstammung, christlichen Glaubens habe.
Aber diese Fälle sind im Verhältnis zur Größe der Stadt, zur Vielfalt ihrer Bevölkerung erstaunlich selten. Die ethnischen Viertel sind keine Ghettos, oft sehr wohl sozial schwierige Gegenden, aber mindestens genauso oft fröhliche Seiten einer Stadt, die eine niedrigere Kriminalitätsrate als Madrid oder Rom hat, gar nicht zu reden von vergleichbaren Metropolen wie Paris oder Moskau.
Zwei Wesenszüge, die der englischen Kultur seit Jahrhunderten eigen sind und in der Erziehung von Generation zu Generation als essenziell weitergereicht werden, vermischen sich in London aufs Beste: Die englische Höflichkeit und das gleichsam antrainierte englische Desinteresse gegenüber Fremden haben ein Klima ermöglicht, das ich die gleichgültige Toleranz nennen möchte. Man nimmt fremde Neuankömmlinge nicht mit offenen Armen auf, sondern als Selbstverständlichkeit einfach so hin. Gegründet von Ausländern, den Römern im dritten Jahrhundert nach Christus, zog Londinium als Handelszentrum vom ersten Tag an die Herren aller Länder wie ein Magnet an. Die Einwanderung zieht sich durch die verschiedensten Epochen; die in Frankreich religiös verfolgten Hugenotten zum Beispiel wurden nach ihrer Flucht 1695 hier genauso gleichgültig toleriert wie die Inder, die in den 1960er und 70er Jahren nach dem Zusammenbruch des britischen Empires in Scharen aus den ehemaligen Kolonien eintrafen.
Dass die Stadt keine Ghettos kennt, liegt auch – es klingt nur im ersten Augenblick paradox – am dörflichen Charakter der größten Metropole Westeuropas. Es war gar kein Platz, wie in Paris oder Rom, den Stadtrand immer weiter nach außen zu dehnen und an der Peripherie in gesichtslosen Wohntürmen großflächig Ghettos anzusiedeln, denn anders als normale Großstädte wächst London nicht von innen nach außen, sondern von außen nach innen. London setzte sich über die Jahrhunderte langsam aus den vielen kleinen Vororten und Dörfern zusammen, die in der Nähe der ursprünglichen City of London – dem heutigen Finanzdistrikt – lagen. Noch heute tun etliche dieser ehemaligen Vororte und jetzigen Stadtteile so, als hätten sie nichts mit der Stadt zu tun, deren Teil sie längst sind. In Barnes im Südwesten oder in Hampstead im Norden, mitten in dieser gigantischen Stadt, sieht man grüne Wiesen, liebliche Häuser, nette Sträßchen. Auch politisch hat bis heute jeder der 33 Londoner Stadtteile (boroughs) seine eigene Verwaltung behalten, und so wurde auch die Armut nicht an den Stadtrand gedrängt, sondern lediglich dezentralisiert: Jeder borough, selbst ein reicher wie Kensington & Chelsea, hat seine eigenen council estates, Siedlungen oder Blocks mit Sozialwohnungen. Ob es auf den berüchtigten englischen Humor zurückzuführen ist oder nur auf die Laune eines wildgewordenen Stadtverwalters, ist mir nicht bekannt, jedenfalls heißen die Estates in Chelsea treffen-der- oder zynischerweise, je nach Blickwinkel: World’s End.
London sei nicht England, sagen die Leute. Wie in den meisten Ländern, in denen eine einzige Metropole nahezu die gesamte politische und wirtschaftliche Macht besitzt und fast das komplette kulturelle Leben kontrolliert, sind auch in Großbritannien die Unterschiede zwischen der Kapitale und dem Rest des Landes gravierend. Doch, wenn auch nicht England, so ist London doch zumindest noch immer sehr englisch. Denn am Ende des Tages versucht selbst die Mehrheit von uns Auslandslondonern, die wir thailändische Restaurants, spanische Gestik oder deutsche Fußballtugenden nach London bringen, englisch zu werden. Deshalb sind wir ja gekommen: Weil wir ein Teil der Nation of London sein wollen, weil wir die Engländer aufrichtig bewundern. Ihre stoische Ruhe gegenüber Problemen. Ihre Schriftsteller. Ihre Redewendungen (»Well, to be honest with you, at the end of the day I simply have to admit that he is just not my cup of tea«). Ihren Takt. Ihre Rosen mit Mikrophonen.
Als ich heute am späten Nachmittag wieder an der Themse in Fulham entlangging, um mir Gedanken über dieses Buch zu machen, habe ich ihn wieder erlebt: den Moment, als das Tageslicht schon verschwunden, die Dunkelheit aber erst im Kommen war, und sich das Zwischenlicht über die Stadt legte und alles in seinen besänftigenden milchigen Dunst einhüllte. Und ich dachte an den Titel dieser Buchreihe: »Gebrauchsanweisung für ...«. Es ist ein sehr schöner Titel. Aber um ehrlich mit Ihnen zu sein, so muss ich am Ende des Tages zugeben, dass er in diesem Fall einfach nicht meine Tasse Tee ist. Dieses Buch ist keine Gebrauchsanweisung für ... Es ist eine Liebeserklärung an London.
Wir rufen Sie zurück
Ich kam in dem Glauben nach London, Englisch zu verstehen. Ich war mir sicher: »We call you back« hieß: »Wir rufen Sie zurück.« Dann rief ich Vicki Oyston an und wusste es besser. »We call you back« hieß: »Scheren Sie sich zum Teufel.«
Ich war auf einiges gefasst, als ich die Nummer des Blackpool Football Clubs wählte und Vicki Oyston verlangte. Nachdem sie 1988 Vorstandsmitglied des Profivereins geworden war, hatte sie unmissverständlich klar gemacht, welchen Umgangston sie pflegte. Nervös hatte sich Sam Ellis, der damalige Trainer des Teams, vor dem ersten Auswärtsspiel an sie gewandt: »Ich verstehe sehr gut, dass Sie im Mannschaftsbus mitfahren wollen, Vicki, und ich habe damit auch kein Problem. Es ist nur...«, Ellis zögerte, »ich bin nur ein wenig besorgt wegen der schlimmen Sprache im Bus.« Oh, sagte Vicki, er brauche keine Angst zu haben, sie werde sich zurückhalten.
Im Mai ’96 wurde Vickis Mann Owen Oyston, ein reicher Unternehmer und Besitzer des Blackpool Football Clubs, zu sechs Jahren Haft wegen Nötigung und Vergewaltigung verurteilt. Vicki übernahm kurzerhand die Präsidentschaft des Clubs. Eine Frau als Chefin in der Männerwelt Fußball eine spannende Geschichte, dachte ich, die sich als Reportage sicher an die Wochenendbeilagen der deutschen Zeitungen verkaufen ließe.
»Hello, Blackpool Football Club.«
»Hallo, hier ist Ronnie Reng, von der Süddeutschen Zeitung, der größten seriösen Zeitung Deutschlands.« Ich hatte in meinen ersten Tagen in London bereits gelernt, dass ein paar Vereinfachungen und Superlative hier selten schadeten.
»Guten Morgen.« Die Sekretärin klang ausgesprochen freundlich.
»Ich möchte gerne Vicki Oyston sprechen, bitte.«
»Oh, Vicki ist gerade nicht im Haus. Worum geht es denn?«
»Ich möchte sie interviewen. Sie wissen schon: Eine Frau an der Spitze eines Fußballklubs, das ist selten.«
»Sicher. Das ist sehr nett von Ihnen, eine interessante Idee. We will call you back, wenn das in Ordnung ist.«
»Ja, das wäre sehr freundlich. Meine Nummer ist 0207-3487505.«
»Wir rufen Sie so schnell wir können zurück.«
Ich war zufrieden und sollte es für die nächsten vier Tage bleiben. Dann hatte Vicki immer noch nicht zurückgerufen. Ich wurde unruhig. In zwei Tagen würde ich nach Liverpool für eine andere Reportage fahren. Ich wollte die Gelegenheit nutzen, wenn ich schon mal im Nordwesten war, auch gleich ins nahe Blackpool zu fahren. Das war denen beim Blackpool Football Club wohl nicht bewusst, dachte ich, und rief noch einmal an.
»Hello, Blackpool Football Club.« Ich erkannte die Stimme, es war dieselbe Sekretärin wie vor vier Tagen.
»Hallo, hier ist Ronnie Reng, erinnern Sie sich? Von derSüddeutschen Zeitung, der größten seriösen Zeitung Deutschlands.«
»Guten Morgen.« Sie sagte es genauso freundlich wie beim letzten Mal, aber ohne mir den geringsten Hinweis zu geben, ob sie sich an mich erinnerte oder nicht.
»Ich wollte gerne Vicki Oyston interviewen, und ich weiß, dass Sie eigentlich zurückrufen wollten, aber ich fahre in zwei Tagen nach Liverpool und ich dachte...« Sie unterbrach mich.
»Oh, Vicki ist gerade nicht im Haus. Worum geht es denn?« Sie war immer noch freundlich, ich aber irritiert. Hörte sie mir überhaupt zu?
»Äh, ich möchte sie interviewen. Sie wissen schon: Eine Frau an der Spitze eines Fußballklubs, das ist selten.«
»Sicher. Das ist sehr nett von Ihnen, eine interessante Idee. We will call you back, wenn das in Ordnung ist.«
»Ja, ja, aber ich fahre in zwei Tagen nach Liverpool, und...«
»Wie ist Ihre Nummer?«
»Aber die habe ich Ihnen doch schon gegeben...«
»Würden Sie bitte Ihre Nummer wiederholen?«
Ich rief in den nächsten vier Tagen noch sechsmal an. Von zu Hause, vom Bahnhof in London-Euston vor der Abfahrt nach Liverpool, aus einem kirchlichen Wohnheim in Liverpool, aus einer Telefonzelle in den Straßen von Liverpool. Ich dachte, irgendwann muss Vicki doch einmal im Büro sein, und wenn ich erst einmal persönlich mit ihr rede, wird alles ganz einfach sein. Sechsmal erreichte ich dieselbe Sekretärin, sechsmal war sie ungeheuer freundlich, sechsmal fragte sie mich, worum es gehe, sechsmal sagte sie zu mir »We call you back, wenn das in Ordnung ist?« und »Was ist Ihre Nummer, bitte?« Ich fragte mich, ob sie vielleicht nicht mehr ganz zurechnungsfähig war. Heute bin ich mir sicher, dass sie dasselbe von mir dachte. Wohl kein anderes Volk hat seine Sprache für den formalen Gebrauch so codiert wie die Engländer. Für Neuankömmlinge, so gut sie auch Englisch sprechen, ist es anfangs quasi unmöglich, die Regeln zu entschlüsseln. Wenn ein Engländer sagt: »Sehr interessant«, spielt es kaum eine Rolle, ob Begeisterung in seiner Stimme mitschwingt. In der Regel meint er damit: »Ihr Geschwätz langweilt mich zu Tode.« We call you back dagegen kann bedeuten, dass zwei Tage (oder auch mal zwei Wochen) später zurückgerufen wird – oder eben wie damals in Blackpool: »Lassen Sie uns bloß in Ruhe!« Es braucht vermutlich jahrelange Erfahrung und viel Fingerspitzengefühl, um den Code zu knacken. Oft liegt der Schlüssel in der Tonlage. Wenn die Sekretärin etwa ihr We call you back rasend schnell und ganz beiläufig hinwirft oder wenn sie beim zweiten Anruf ohne zu zögern darauf beharrt, dass Vicki schon wieder in einem Meeting oder nicht im Hause ist, kann man fast sicher sein, dass man gefälligst nicht mehr nachfragen sollte. Fast sicher. Könnte ja auch sein, dass die Sekretärin nur Kopfschmerzen hat.
Es ist eine nicht unberechtigte Frage, warum englische Sekretärinnen nicht einfach sagen: »Es tut mir Leid, Vicki Oyston möchte Ihnen kein Interview geben.« Die Antwort allerdings ist einfach: Weil es, nach englischem Verständnis, unhöflich wäre. Man stößt die Leute nicht vor den Kopf. Für mich, der ich in Deutschland dazu erzogen worden bin, offen seine Meinung zu sagen, waren die englischen Formalitäten zunächst ein Dschungel, in dem ich permanent Gefahr lief, mit einem falschen Wort zur falschen Zeit auszurutschen. Nach einer Weile jedoch erkannte ich, wie viel angenehmer die legendäre englische Höflichkeit den Alltag macht. Tief in mir hege ich zugegeben den Verdacht, dass die Engländer mit ihrer Diskretion vor allem eines erreichen wollen: ihre zweite Seite zu verstecken. Doch welche Motive auch immer dahinter stecken mögen – gerade in der Hektik einer Großstadt wie London ist die englische Weigerung zu brüllen oder auszuflippen ein Segen. Wobei die Londoner für meinen Geschmack manchmal vielleicht doch etwas zu weit gehen, etwa wenn der Bus wieder einmal vierzig Minuten auf sich warten lässt. Und die Londoner stehen regungslos Schlange. Sagen nichts, machen nichts. Stehen da. Kommt der Bus endlich, steigen sie ein, zahlen ihr Ticket, sagen lächelnd Thank you zum Fahrer und nehmen Platz. Wie oft habe ich mir in solchen Momenten gewünscht, dass irgendjemand den Fahrer anschreit, wo er denn verdammt nochmal so verdammt lange geblieben sei! Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, bestätigt zu bekommen, dass ich nicht anormal bin, mit meiner Wut, mit meinem Jähzorn.
Aber es gab – und da können wir beim Beispiel Busfahren bleiben – viel mehr Situationen in London, in denen mir klar wurde, dass die antrainierte Zurückhaltung die Engländer vielleicht nicht schneller zum Ziel, aber dafür zu einem angenehmeren Leben führt. Wir waren mit dem 74er von Roehampton Richtung Baker Street unterwegs, zumindest hatten wir das geglaubt. An der Grenze zwischen Fulham und Hammersmith jedoch bog der Fahrer nicht wie vorgesehen in die Lillie Road ab, sondern fuhr einfach weiter die Fulham Palace Road hinauf. Die ersten Fahrgäste sahen sich an. Niemand sagte etwas. Als wir an der Hammersmith Station vorbei und weiter geradeaus, nun vollends in die falsche Richtung fuhren, sagte noch immer niemand etwas. Immer mehr Fahrgäste blickten sich an. Der Augenkontakt genügte, uns zu versichern, dass die anderen dasselbe dachten: Er hat sich verfahren. Und der Blickkontakt sagte auch: Wollen Sie nicht nach vorne gehen und es ihm sagen? Diese höchst unangenehme Aufgabe übernahm schließlich eine Frau um die sechzig, mit grauen Haaren und weichen Zügen – genau die richtige Person für solch einen prekären Fall: Man sah ihr an, dass sie es nicht böse meinte.
»Excuse me, my love«, sagte sie zum Busfahrer, »ist es eventuell möglich, dass du dich ein klein wenig verfahren hast?«
Der Busfahrer war erleichtert, dass es endlich jemand bemerkt hatte. Und als wir sahen, dass er weder gemeingefährlich noch uns böse war, weil wir ihn auf seinen Fehler hingewiesen hatten, überschlugen wir Fahrgäste uns regelrecht mit Tipps und Anweisungen, um den Bus wieder auf die richtige Route zu bringen. Manche Leute mussten zwar einen Bus zurück nehmen, weil wir ihre Haltstellen nicht mehr anfahren konnten, die anderen kamen mit zwanzigminütiger Verspätung an, aber wir alle stiegen gut gelaunt aus.
Ursprünglich steckte hinter der englischen Höflichkeit nicht unbedingt die Idee, sich das Leben leichter zu machen. In allen Situationen sachlich und ruhig zu bleiben, galt in der herrschenden Upper Class des britischen Empires schlichtweg als Zeichen von Stärke. Öffentlich Gefühle zu zeigen, hieß, die Kontrolle zu verlieren. Diese Verhaltensregel wird nicht offen an den Schulen gelehrt, aber sie wird heute – Jahrzehnte, Jahrhunderte später – noch immer unterschwellig als ein Muss an die nächste Generation weitergegeben, durch alle sozialen Schichten hindurch. Als im November 2003 beim Besuch des amerikanischen Präsidenten George Bush 120000 Londoner am Trafalgar Square gegen die Irakpolitik der Amerikaner demonstrierten, gab der Schriftsteller Lawrence Norfolk zu bedenken, welche Überwindung es seine Landsleute gekostet hatte, auf die Straße zu gehen: »Zu protestieren hat in Großbritannien keinen besseren Ruf als sich zu beklagen, und Letzteres ist, offiziell zumindest, so akzeptabel, wie die Details des Verdauungsvorgangs zu erörtern...Beklage dich nie, erkläre nie, das ist seit Generationen das Mantra der britischen Oberklasse. Deshalb sind wir Briten zurückhaltende Demonstranten. Wir sind Weltmeister darin, uns mit etwas abzufinden. Deshalb kommen unsere Züge zu spät, deshalb schließen unsere Pubs zu früh, und deshalb ist unsere einheimische Küche nur genießbar, wenn man dreimal am Tag frühstückt.«
Tatsächlich lieben Engländer nichts mehr, als sich zu beklagen. Aber sie tun es nur im Privaten. Das höchste Gebot, ein freundliches Gesicht zu wahren, gilt bloß für formale Auftritte, wenn sie mit jemandem reden, den sie nicht oder nicht so gut kennen, bei der Arbeit oder im öffentlichen Raum. Wenn sie unter Freunden sind, haben Engländer eine große Freude daran zu schimpfen und zu zetern – und zwar am liebsten über sich und ihr Land. Dass ihre Züge zu spät kommen, ihre Pubs zu früh schließen, die einheimische Küche nur genießbar ist, wenn man dreimal am Tag frühstückt... Dieser Charakterzug ist neben der Höflichkeit das Wichtigste, was ein moderner Engländer haben muss: Selbstironie.
Die Engländer selbst verwenden dafür sogar ein noch stärkeres Wort. Self-deprecation. Selbstverachtung. Es ist das größte Kompliment, das etwa mein Freund Ian zu vergeben hat: »He is really self-deprecating.« Das ist eine Kunst, mit der gerade wir Kontinentaleuropäer große Schwierigkeiten haben: In den Augen der Engländer sind wir leider zu oft einfach nicht selbstverachtend genug. Da bekommt ein griechischer Austauschstudent zum Geburtstag nur Knoblauchzehen geschenkt, von einem englischen Geburtstagsgast nach dem anderen; da wird ein deutscher Banker bei der Weihnachtsfeier in der City vom Kollegen im Hitler-Kostüm empfangen, und was passiert? Der Grieche und der Deutsche können nicht richtig lachen. Wir machen den schlimmsten Fehler, den man in England begehen kann: Wir nehmen uns selbst zu ernst.
Dabei ist es kurios, dass die Engländer, obwohl sie so viel Wert auf Takt legen, beim Spaßmachen oft ins Extrem ausschlagen. Die krasse, schrille Seite des britischen Humors repräsentiert niemand besser als Basil, der exzentrische Hotelbesitzer in John Cleeses legendärer Fernsehreihe Fawlty Towers. Regisseur Cleese versichert noch heute in jedem Interview, er habe mit Basil den derben, platten Humor seiner Landsleute karikieren wollen, aber er redet längst auf verlorenem Posten: Basil ist das Gegenteil von einer Karikatur, vielmehr ist er ein Vorbild für viele Engländer. Deutsche Touristen begrüßt Basil im Stechschritt, die Hand über die Oberlippe gelegt, Hitlers Schnauzer imitierend.
Der Glaube, dass etliche Engländer deutsche Besucher gerne an den Nationalsozialismus erinnern, hält sich hartnäckig in Deutschland. Und in der Tat ist für viele Engländer das heutige Deutschland noch immer das Land der tollen Autos, imponierenden Fußballer und bösen Nazis. Als das Goethe-Institut in London vierzehn- bis sechzehnjährige Engländer bat, die zehn bekanntesten Deutschen aufzulisten, nannten manche Schüler »Helmet Coal« oder »Hermit Kolle«. Doch selbst als die Jury diese Nominierungen Helmut Kohl zubilligte, landete der Altbundeskanzler unter »ferner liefen«. Den Sprung in die Top Ten schafften sechs Sportler, drei Nazis und Ludwig van Beethoven. Klarer Sieger und somit berühmtester Deutscher war der Österreicher Adolf Hitler.
Uns Deutschen, die wir dazu erzogen wurden, über den Zweiten Weltkrieg allenfalls mit viel Vorsicht und Taktgefühl zu reden, fällt es nicht leicht, angemessen zu reagieren, wenn wieder einmal ein Londoner vor uns John Cleeses Helden Basil zitiert: »You’re German? Psst, don’t mention the war!« So viel Überwindung es uns auch kosten mag, es wird von uns dann ein flotter Spruch erwartet oder zumindest ein anerkennendes Lachen. Denn noch nie hat ein Engländer mir gegenüber den Krieg erwähnt, um mich zu beschimpfen, aber Dutzende Male in der Absicht, witzig zu sein. Als ich einmal den Middlesbrough Football Club besuchte, um dort den deutschen Nationalspieler Christian Ziege zu interviewen, begrüßte mich Zieges Teamkollege, der unvergleichliche Paul Gascoigne mit den Worten: »Noch ein Deutscher? Muss ich schon wieder über den verdammten Krieg reden?«
Selbstredend ist englischer Humor genauso oft überaus feinsinnig, unnachahmlich trocken, sogar in äußerst ernsten Situationen. Stundenlang verhörten englische Soldaten nach dem Irak-Krieg den ehemaligen Direktor der irakischen Kommission für Atomenergie, Faiz Al Berkdar, zum angeblichen Verbleib irakischer Atomwaffen. Al Berkdar versicherte jedoch hartnäckig, diese Waffen existierten nicht. Schließlich fragte einer der Briten, zu einem Zeitpunkt, als Amerikanern oder Russen vermutlich der Kragen geplatzt wäre: »So, are you suggesting that we should go home again, Mister Al Berkdar?«
Andererseits halte ich es, ehrlich gesagt, für durchaus nachvollziehbar, dass Engländer oft die derbsten und eigenartigsten Sachen für einen Spaß halten – etwa bei der Aufnahme von Gruppenfotos heimlich das Geschlecht aus der Hose hängen zu lassen. Wer im Alltag so sehr seine Emotionen kontrolliert, muss die Luft manchmal mit einem Knall rauslassen.
Schon als Kind werden uns grundsätzlich konträre Werte anerzogen: In den USA, in Deutschland oder Italien ist wichtig, dass sich das Kind als etwas Besonderes fühlt. Seine Kreativität, seine ganz besonderen Neigungen sollen sich bestmöglich entfalten. In England wird Kindern beigebracht, sich bloß nicht besser zu fühlen als andere, sich vor allem nicht so zu benehmen, als hielte man sich für etwas Besseres. Die Londoner Schriftstellerin Zoe Heller, die nun in New York lebt, berichtete einmal in ihrer Kolumne im Daily Telegraph über die täglichen Kulturschocks, denen sie mit ihrer kleinen Tochter in den USA ausgesetzt ist.
Ende der Leseprobe