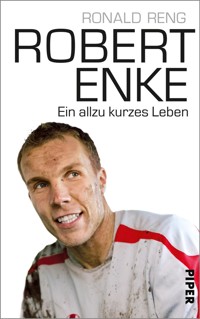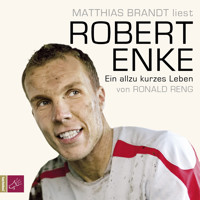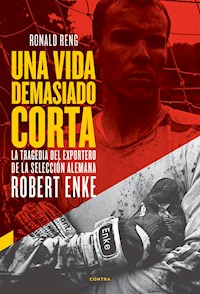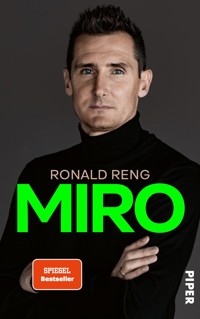9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Als Spieler, Trainer, Sportdirektor und Talentejäger ist Heinz Höher einer der ganz wenigen, die in 50 Jahren Bundesliga immer dabei waren. Mit ihm brechen wir 1963 in eine Liga auf, in der die Zigarren der Präsidenten zur Halbzeit in der Kabine qualmten. Er hat Ronald Reng von der Schönheit und den Gaunereien dieses deutschen Lieblingsspiels erzählt, vom Leben der Spielerfrauen wie von Pistolenschüssen beim Training, von Vereinsfürsten und Trainerlegenden. Dieses Buch macht anschaulich, warum Millionen am Samstag um halb vier mitfiebern. Und es zeigt, wie aus der biederen Liga das hochprofessionelle Unternehmen Bundesliga wurde, wie der Fußball sich veränderte und wie der Fußball die Menschen veränderte, die Spieler, die Trainer – und nicht zuletzt die Fans. Ronald Reng ist eine famose Abenteuergeschichte über die Deutschen und ihr liebstes Spiel gelungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
8. Auflage 2013
ISBN 978-3-492-96426-5
© 2013 Piper Verlag GmbH, München
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Umschlagmotiv: Christoph Buckstegen/photocake
Litho: Lorenz & Zeller, Inning a. Ammersee
Datenkonvertierung: Tobias Wantzen, Bremen
»Höher.«
»Guten Tag. Hier ist Ronald Reng. Sie hatten versucht, mich anzurufen.«
»Herr Reng. Danke, dass Sie zurückrufen. Herr Reng, ich muss Sie treffen.«
»Worum geht es denn?«
»Das kann ich Ihnen nicht am Telefon sagen.«
»Ach so.«
»Sie wissen schon, wer ich bin?«
»Ehrlich gesagt, bin ich mir nicht ganz …«
»Heinz Höher.«
»Ach, dann kenne ich Sie natürlich: der ehemalige Trainer des VfL Bochum und des 1. FC Nürnberg.«
»Entschuldigung, vielleicht hätte ich mich erst einmal richtig vorstellen sollen.«
»Keine Ursache. Aber wie Sie wissen, lebe ich in Barcelona. Das ist von Nürnberg nicht der nächste Weg. Ich bin ja gelegentlich in Deutschland, vielleicht melde ich mich dann einfach einmal?«
»Ich weiß nicht.«
»Ich denke, es ist das Vernünftigste.«
»Ja, das Vernünftigste.«
Eine Stunde später:
»Hallo.«
»Herr Reng, hier ist Höher.«
»Herr Höher?«
»Herr Reng, ich habe jetzt einen Flug nach Barcelona gebucht. Ich komme diesen Donnerstag.«
»Diesen Donnerstag!«
»Und bleibe bis Dienstag.«
»Bis Dienstag!«
»Bitte, geben Sie mir nur ein paar Stunden Ihrer Zeit. Ich möchte Ihnen etwas erzählen. Ich muss Ihnen das erzählen.«
Er ist 38, jugendlich für einen Trainer: Heinz Höher. [Abb. 1]
15. Februar 1976
Glatteis im Strafraum
Gegen zehn Uhr am Abend sagt Heinz Höher zu seiner Frau, die schon daran gewöhnt ist, dass er seine Handlungen selten erklärt, er gehe noch mal kurz raus. Es hat null Grad in Bochum. Schnee- und Eisreste, von den Räumdiensten tagsüber mit 180 Tonnen Salz und Sand bekämpft, gefrieren wieder. In der vergangenen Nacht verunglückten 65 Autofahrer. In der Dorstener Straße schlitterte ein 18-Jähriger mit seinem Wagen geradeaus in einen Laternenpfahl, in Stiepel schleuderte ein 20-jähriger Fahrer, wie vom Katapult geschossen, gegen eine Garagenwand.
Heinz Höher schließt die Fahrertür seines silbernen 190er Mercedes auf. In den umliegenden Wohnungen leuchten hier und dort noch die Fernseher, obwohl die Übertragung der Schlussfeier der Olympischen Winterspiele von Innsbruck vorüber ist. Ein Österreicher hat am Nachmittag beim Skispringen von der Großschanze eine der letzten Goldmedaillen gewonnen, Heinz Höher hat sich den Namen nicht gemerkt, obwohl er das Springen gesehen hat.
In nicht einmal 15 Minuten erreicht er trotz der widrigen Straßenverhältnisse das Stadion an der Castroper Straße. Auto fährt er nach seinen eigenen Regeln. Niemals als Erster an einer roten Ampel zu stehen ist sein großer Ehrgeiz. Es geht ihm nicht darum zu rasen, sondern sich mit selbst gestellten Aufgaben die Zeit im Auto zu vertreiben. Einmal hat er auf der Autobahn versucht, permanent 150 km/h zu fahren, nicht im Schnitt, sondern durchweg, von Fürth bis Bochum, 440 Kilometer lang.
Seine Helfer sind pünktlich am dunklen Stadion, August Liese und Erwin Höffken, die als Obmänner vom neuen Stürmer bis zur Kiste Bier alles für die Profielf des VfL Bochum organisieren. Sie brauchen kein Licht im Stadion. Der Schnee, der den Fußballplatz noch geschlossen bedeckt, erhellt die Nacht. In zwei Tagen, am Dienstagabend um halb acht, soll hier der VfL gegen Schalke 04 in der Bundesliga spielen. Heinz Höher, im vierten Jahr Trainer des VfL, hat seine Mannschaft gewissenhaft auf die Partie vorbereitet. Nun wird er dafür sorgen, dass das Spiel gar nicht stattfindet.
Liese und Höffken wissen, wo der Platzwart, der alte Rickenberg, ein paar Eimer aufbewahrt. Sie füllen sie in den Duschen mit Wasser. Es gibt nur einen Duschraum im Stadion, nach dem Spiel müssen die Mannschaften zusammen duschen, Sieger und Verlierer, Treter und Getretene, wo gibt es das noch in der Bundesliga? Gibt es das überhaupt noch irgendwo in der Bezirksliga, im Jahr 1976?
Zu dritt schleppen sie die Eimer auf den Fußballplatz. Die Kälte beißt in die Hände. Heinz Höher glaubt, der Metallhenkel des Eimers friere an seinen Fingern fest. Es muss doch kälter als null Grad sein.
Sie fangen am rechten Strafraum an. Heinz Höher hat keinen detaillierten Plan. Er hatte einfach gedacht, sie würden das Spielfeld vereisen. Aber nun merkt er, welche Arbeit das ist. Er schüttet das Wasser aus, und es bildet sich gerade einmal eine Pfütze auf dem Schnee. Wie viele Eimer Wasser würden sie für den gesamten Fußballplatz brauchen? Zehntausend? Hunderttausend? Stumm laufen sie zwischen Duschraum und Strafraum hin und her, über 150 Meter für einen Eimer, für eine Pfütze. Wenigstens gefriert das Wasser in Windeseile auf dem Schnee.
Mitternacht ist vorbei, als sie beide Strafräume vereist haben. Das muss genügen.
Am nächsten Morgen gibt die automatische Telefonansage auf der Geschäftsstelle des VfL weiterhin Auskunft: »Das Bundesligaspiel des VfL gegen Schalke 04 findet am Dienstag, 17. Februar, um 19:30 Uhr statt. Stehplatzkarten sind an der Abendkasse noch zur Genüge zu erwerben. Ende der Durchsage. Danke für Ihren Anruf.«
20000 Zuschauer werden erwartet. In den Ruhr Nachrichten schreibt Sportredakteur Franz Borner: »Wenn es gegen den Schalker Rivalen ging, hat sich der VfL mehr als einmal selbst übertroffen. Also möge dieser Wunsch einem Befehl gleichkommen: Übertreffe dich selbst, VfL, und übertreffe nicht zuletzt die Schalker!« Wo kommt auf einmal der Enthusiasmus beim Borner her? Er nervt Höher schon seit Monaten mit seinen Sticheleien.
Im Wohnzimmer der Familie Höher in der Kaulbachstraße 26 klingelt das graue Telefon. Es gibt neuerdings auch bunte Telefonapparate, aber dafür verlangt die Deutsche Post 1,10 Mark zusätzlich im Monat. Liese ist dran. Um zwölf treffe sich die Kommission der Stadt Bochum im Stadion, um zu prüfen, ob der Fußballplatz bespielbar sei.
Noch immer dringt Kaltluft von den Alpen nach Nordrhein-Westfalen, aber Schneeregen oder Schneeschauer werden allenfalls noch vereinzelt erwartet, bei Temperaturen bis fünf Grad. Die meisten Bundesligaspiele am Dienstag und Mittwoch sollten stattfinden können.
Mach dir mal keine Sorgen, sagt Liese, das Glatteis im Strafraum wird schon halten, und die Platzkommission hat der Ottokar im Griff.
Er mache sich keine Sorgen, erwidert Heinz Höher.
Ottokar Wüst, der Präsident des VfL, hatte mit am Tisch gesessen, als Heinz Höher am Sonntagmorgen im Gasthaus Mense die Idee ausgesprach: Und wenn wir das Spiel ausfallen lassen?
Ohne das Einverständnis des Präsidenten hätte er sich nicht zu handeln getraut. Als Junge war Heinz Höher von einer ausgeprägten Autoritätsgläubigkeit durchdrungen gewesen. Auf Konrad Adenauer ließ er nichts kommen; ohne genauer zu wissen, wie Kanzler Adenauer das Land regierte. Als Trainer war der Vereinspräsident sein wichtigster Vertrauter, gleichzeitig sein Gehilfe und sein Beschützer. Ottokar Wüst, das Haar silber, nicht grau, in der Öffentlichkeit selten ohne Anzug und Krawatte zu sehen, Besitzer von Herrenbekleidung Wüst in der Brückstraße, ließ bei Präsidiumssitzungen des VfL Bochum bei wichtigen Fragen immer alle mitreden, ließ immer alle abstimmen; und am Ende wurde gemacht, was er entschied.
Welch tollkühne Idee verberge sich hinter seinen mysteriösen Worten, das Spiel ausfallen zu lassen, fragte Wüst Höher sonntagmorgens im Haus Mense an der Castroper Straße, nur drei Minuten zu Fuß vom Stadion. Höher und Wüst besprachen mit den Lizenzspielerobmännern Liese und Höffken die Lage. Die Worte schienen stets ein steifes Rückgrat zu haben, wenn Wüst redete, und faszinierenderweise fand er für seine salbungsvolle Sprache in diesem Milieu der Arbeiter und Fußballer große Bewunderung. Die Tische bei Mense waren aus grobem Holz. Tischdecken wurden nicht aufgelegt. Es gab schon Bier sonntagmorgens.
Sportlich wäre es sinnvoll, das Spiel durchzuziehen, der schwer bespielbare Schneeboden konnte Bochums kämpferischem Stil nur entgegenkommen, und der VfL verzehrte sich nach einem Sieg, als Viertletzter, mit nur einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegsränge. Aber selbst der Trainer sah sofort das große Ding, das sie mit einer Spielabsage drehen könnten: In drei Wochen, am 7. März 1976, würde das Stadion an der Castroper Straße wegen Umbaus für vier Monate geschlossen werden, sie mussten dann für die verbleibenden Heimspiele bis zum Saisonende in ein anderes Stadion ausweichen. Wenn das Spiel gegen Schalke nun ausfiel, konnten sie es im Frühling in Dortmund austragen. Dort fasste das Westfalenstadion 54000 Zuschauer, während an einem sibirischen Februarabend in Bochum allenfalls 20000 kämen.
In Dortmund konnten sie 400000 Mark verdienen. Vielleicht eine halbe Million.
Die Rekordeinnahme des VfL im Stadion an der Castroper Straße betrug rund 150000 Mark netto, bei einem Spiel gegen Bayern München. Wie alle Bundesligaklubs lebte der VfL nahezu ausschließlich von den Zuschauereinnahmen, wo sollte denn das Geld sonst auch herkommen?
Es sollte ihn als Trainer nicht interessieren, er sollte sich auf seine Aufgabe konzentrieren, aber natürlich hatte Heinz Höher die Zahlen im Kopf. Wenn er samstags aufwachte und es regnete, dachte er sofort, verdammt, 3000 Zuschauer weniger, 18000 Mark weniger; das Geld spürte ein Klub wie der VfL, das spürte er als Trainer die ganze Zeit, das nicht vorhandene Geld. Auf 3,5 Millionen Mark belief sich das gesamte Jahresbudget, wobei der Vorstand schon außerordentliche Maßnahmen ergreifen musste, damit das Geld reichte: Hotelrechnungen zum Beispiel wurden fast nie pünktlich und manchmal gar nicht bezahlt.
Eine halbe Million, dachte Höher. Eine halbe Million in einem einzigen Spiel. Wahnsinn.
Gegen halb zwölf am Montagmittag, dem 16. Februar 1976, zieht Heinz Höher zur marineblauen Hose mit Schlag den gleichfarbigen Mantel mit Militärklappen an, den seine Frau für ihn ausgewählt hat. Früher ging er nicht ungern einkaufen. Seit einiger Zeit allerdings wehrt er die Versuche seiner Frau, ihn zum Kleiderkauf zu bewegen, mit einem panischen »Ich habe doch alles!« ab. Sie dachte, es könne am Trainerstress liegen. Ihre Bekannten sagten ihr, es liege wohl in der Natur der Männer, wenn sie älter werden.
Er ist 38, jugendlich für einen Trainer. Ohne eine Anstrengung dafür zu unternehmen, sieht er auf verwegene Art gut aus. Es muss der Blick aus zusammengekniffenen Augen unter buschigen, blonden Augenbrauen sein. Leger bindet er sich den langen weißen Schal um und lässt den Marinemantel offen, als er sich auf den Weg ins Stadion zur Platzbesichtigung mit der städtischen Kommission macht. Sie müssen das Spiel doch ausfallen lassen, so schnell kann trotz steigender Temperaturen die Eisschicht in den Strafräumen nicht geschmolzen sein. Und wenn sie misstrauisch werden, warum nur die Strafräume vereist sind?
37 Jahre lang wissen nur die vier Beteiligten von der Sabotage im Stadion. Erwin Höffken stirbt mit dem Geheimnis, August Liese stirbt, Ottokar Wüst stirbt, ehe Heinz Höher im November 2011 zum Entschluss kommt, dass die Erinnerung fortleben soll. Er sagt seiner Frau, er reise nach Barcelona. Was macht er in Barcelona, fragen die Kinder und die Freunde seine Frau Doris. Aber sie weiß es doch auch nicht.
Er ist 73. Auf dem Rücken trägt er einen neongelben Adidas-Rucksack aus den Achtzigern. Darin hat er einen Stapel Unterlagen mitgebracht, fünfzig Jahre alte Zeitungsartikel über seine Zeit als Bundesligaprofi beim MSV Duisburg, Notizen über Juri Judt, den er ganz alleine vom Kind zum Bundesligaprofi formte, Briefe von Banken, in denen es um Millionenschulden geht, Interneteinträge über Alkoholismus: sein Leben als Mann des Fußballs in einem Rucksack. Er verspürt einen diffusen Drang, über all das zu reden, und wählt als Gesprächspartner einen Schriftsteller in Barcelona, den er noch nie gesehen hat. Aber er fühlt sich ihm nahe, denn er hat seine Bücher gelesen. Heinz Höher hat sich in den Büchern, die er las, immer besser wiedererkannt, besser selbst verstanden als in Gesprächen. Es fiel ihm immer leichter, sich schriftlich als mündlich auszudrücken.
So beginnen wir zu reden, schon bald nach dem ersten Abend in Barcelona auch in Briefen. Gleichzeitig tauchen die ersten Ankündigungen von Büchern zum 50-jährigen Jubiläum der Bundesliga auf, die tollsten Anekdoten, die denkwürdigsten Spiele, die größten Stars. Mit jedem Brief von Höher scheint die Diskrepanz größer zwischen dem, was ein Protagonist wie er in fünf Jahrzehnten Bundesliga erlebt hat, und den Schnipseln, die wir in Jubiläumsbüchern von 50 Jahren Bundesliga als vermeintlich repräsentativ bewahren möchten. Erfährt man nicht viel mehr über die Bundesliga, wenn man die Geschichte eines einzigen Mannes erzählt, als wenn man noch einmal all die Typen, Tore und Tabellen aufreiht?
Heinz Höher war Bundestrainer Sepp Herbergers unerfüllte Hoffnung, als die Bundesliga 1963 startete, ein Außenstürmer, der für seine Pausen genauso bekannt war wie für sein elegantes Spiel. Er wurde der einzige Trainer, für den ein Präsident lieber die halbe Mannschaft feuerte statt wie üblich den Trainer, 1984 beim 1. FC Nürnberg, als die Spieler gegen Höher putschten. Er fiel nach Medikamentenmissbrauch auf dem Trainingsplatz um, er schrieb ein Kinderbuch. Als ihn die Arbeitslosigkeit erwischte, das unvermeidliche Zwischenschicksal eines Trainers, verdiente er sein Geld mit Skatspielen. Menschen, die ihm begegneten, sagen oft, sie könnten seine Ideen schwer nachvollziehen, der Heini Höher denke und lebe irgendwie auf einer anderen Ebene. Sie glauben, er sei komisch. Ich habe oft das Gefühl, er ist hochintelligent.
Er hat in 50 Jahren Bundesliga Einzigartiges erlebt (und angestellt, wenn wir nur an die vereisten Strafräume in Bochum denken), und gleichzeitig verstand zumindest ich durch Heinz Höhers sehr eigenwillige Geschichte zum ersten Mal wirklich, wie sich die Bundesliga in den verschiedenen Epochen anfühlte, wie sich der Fußball veränderte und wie der Fußball einen Menschen verändern kann.
Scheinbar unverändert liegt die dünne Schneedecke am Montagmittag, dem 16. Februar 1976, über dem Rasen des Stadions an der Castroper Straße. Nur ein paar Fußspuren sind im Schnee zu sehen. Das muss wohl der Platzwart gewesen sein. Mit den Schuhspitzen stochern die Männer der Platzkommission im Schnee und treten mit der Ferse besonders fest auf, die Gesichter in scheinbarer Konzentration auf den Boden gerichtet. Neben Dr. Johannes Freimuth, dem Sportdezernenten, und Walter Mahlendorf, dem Sportdirektor der Stadt Bochum, ist auch Max Merkel anwesend, der Trainer des FC Schalke 04. Heinz Brämer, der Wirtschaftsratsvorsitzende des VfL, nutzt die in Bochum seltene Kälte, um seine russische Fellmütze vorzuführen. Ottokar Wüst trägt als Einziger einen hellen Mantel, seinen ewigen Trenchcoat. Heinz Höher hat die Hände in den Manteltaschen vergraben. Alle warten darauf, dass Max Merkel sein Urteil abgibt. Ohne es selbst zu wissen, ist Merkel der Einzige, der ein Interesse daran haben könnte, das Spiel auszutragen. Schalke ist in Form, die jüngsten zwei Partien hat es gewonnen, 3:1 in Duisburg, 5:1 gegen Essen.
»Hier könnten bestenfalls die olympischen Winterspiele fortgesetzt werden«, sagt Merkel. Alle lachen laut. Hört Merkel heraus, dass die anderen nicht nur über seinen Schmäh lachen? Sondern auch aus Erleichterung?
Die Medien werden über die Absage informiert. Heinz Formann, der Sportchef der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung in Bochum, tippt in seine Triumph Adler: »›Schaulaufen kannst du auf dem Platz, nicht Fußball spielen‹, sagte Schalkes Trainer Max Merkel. Womit hoffentlich auch die überzeugt sind, die angenommen hatten, dem VfL sei es daran gelegen gewesen, die Partie zu verschieben. Das Gegenteil war der Fall. Der VfL wollte die Chance nutzen, wenigstens dieses Spiel noch als echtes Heimspiel vor dem Stadionumbau zu nutzen.« So hat es ihm sein Freund, Trainer Heinz Höher, versichert.
Der erste Freitag im April 1976 ist ein herrlich lauer Frühlingsabend. Auf der Bundesautobahn von Bochum nach Dortmund bilden sich 21 Kilometer Stau. Zu einer Zeit, in der das Wort noch gar nicht existiert, ist das Bundesliganachholspiel zwischen dem VfL Bochum und Schalke 04 ein Event. Der Umzug ins Dortmunder Westfalenstadion gibt der Partie etwas Besonderes, Exotisches, ein Gefühl von Pokalfinale. Rainer Holzschuh, der Bochum-Berichterstatter des Kicker, schätzt mit bloßem Auge, dass über 50000 der 54000 Plätze besetzt sind. Das Stadion wäre voll gewesen, wenn alle Fans rechtzeitig dem Stau entkommen wären. Der VfL Bochum nennt 41000 als offizielle Zuschauerzahl. Das Finanzamt muss nicht ganz genau wissen, wie viel Geld man einnahm. Gut 450000 Mark brutto fließen in die Kasse des VfL, so viel wie bei vier gewöhnlichen Heimspielen in Bochum zusammen.
Das Spiel geht 1:4 verloren, und keiner im Bochumer Präsidium kann sich so richtig ärgern. Ottokar Wüst begleitet Heinz Höher in den Presseraum, der in Dortmund ein richtiger Konferenzsaal mit Podium und Stuhlreihen ist, nicht nur ein Zimmer mit hereingeschobenem Tisch und ein paar Stühlen wie in Bochum. Die Reporter lassen sich nicht anmerken, dass sie nicht so recht kapieren, was Wüst meint, als er sagt: »Ich danke Heinz Höher vom Herzen für die Courage, in solch einem schweren Spiel wie gegen Schalke auf das echte Heimrecht in Bochum zu verzichten.« Welche Courage? Das Spiel in Bochum fiel doch einfach wegen Schnee und Eis aus? Heinz Höher lässt Wüsts Dank mit unbewegtem Gesicht über sich ergehen. Er lächelt, wie immer, wenn er sich besonders freut, nach innen.
Ein wirbelnder Außenstürmer, bekannt für seine Dribblings und Verschnaufpausen im Spiel: Heinz Höher war Amateur-Nationalspieler, hier, am Boden sitzend, in einem Testspiel in Bonn 1959. [Abb. 2]
1963
Mitfahrgelegenheit in die Bundesliga
Morgens fuhr Heinz Höher von Leverkusen nach Köln, setzte sich in ein Kaffeehaus in der Nähe des Doms und wartete, bis es Zeit war, wieder nach Hause zu fahren. Er tat es für seine Mutter. Ihr gehe es besser, sagte er sich, wenn sie weiter glauben konnte, ihr jüngster Sohn studiere an der Hochschule Köln eifrig Sport und Englisch.
Heinz Höher hielt sich für äußerst ehrgeizig. Es war bloß so, dass sein Ehrgeiz außerhalb des Fußballplatzes für die anderen manchmal schwer erkennbar war. Für sein Abitur am Carl-Duisberg-Gymnasium zu Hause in Leverkusen hatte er sich ein großes Ziel gesetzt: es zu bestehen, ohne ein einziges Mal zu lernen. Für die Lehrer blieb Heinz Höher im Abitur deutlich unter seinen Möglichkeiten, mit vielen Befriedigend und Ausreichend im Zeugnis. Aber er war zufrieden. Sein Ziel hatte er erreicht.
Bald, im August 1963, wurde er 25, ein Alter, in dem langsam das Gerede vom ewigen Studenten beginnen würde. Doch er war sich sicher, so wie das Abitur würde er, irgendwie und irgendwann, auch sein Lehramtsstudium bewältigen. Er sah nur im Moment keinen Anlass, zu den Vorlesungen zu erscheinen. Dieser Moment dauerte nun schon zwei Jahre an.
Dafür, dass kein anständiger Mensch morgens um elf im Kaffeehaus saß, war es immer recht gut besucht. Er sah sich die jungen Ehefrauen mit Brigitte Bardots Ponyfransen in ihren Etui-Kleidern ohne Kragen an. Wenn er wegsah, schauten vermutlich sie ihn an. Er hatte die Frisur stets frisch blondiert. Bis vor Kurzem hatte er die Wasserstofflösung noch mit der Zahnbürste auf die Haare aufgetragen. Mit der schmalen Bürste ließ sich die Lösung ideal aus dem kleinen Fläschchen holen. Nun aber gab es richtige Färbemittel aus Kamille, hatte ihm seine kleine Schwester Hilla verraten, sie hatte es von Waldtraud gehört, der Frau seines Mitspielers bei Bayer 04 Leverkusen, Werner Röhrig.
Manchmal brachte er sich auch ein Buch ins Kaffeehaus am Dom mit. Er versuchte sich an Dostojewski, wenngleich dieser nicht sein Geschmack war, wenn er ehrlich war. Am liebsten saß er einfach da.
Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der noch nie gearbeitet hat, sagte ihm Fredy Mutz, der alte Torwart in Leverkusens Oberligamannschaft. Aus dem spöttisch gemeinten Spruch klang volle Bewunderung. Der Heinz, leck mich am Arsch, sagten die Mitspieler, wenn er nicht in Hörweite war, den juckte gar nichts. Er war nicht nur ein Student der hohen Kunst des Nichtstuns, der einzige Hochschüler in der Mannschaft unter Buchbindern, Chemielaboranten und Lagerarbeitern, sondern auch Leverkusens unbestrittener Star, ein wirbelnder Außenstürmer, der mit seinen Pässen »Ohs!« und »Ahs!« hervorrief. Bei Fehlpässen pfiffen ihn Leverkusens Zuschauer besonders gerne aus. Sie wollten sich nicht vorstellen, dass auch einer wie er es manchmal nicht besser konnte, sondern waren sich sicher, dass er nicht wollte.
Zu Hause schrieb er nach solch unglücklichen Spielen Briefe an sich selbst. Einmal begann er mit der Überschrift: »Ich, der Fußballspieler.« Darunter notierte er: »Manche meinen, ich sei Weltklasse. Andere sagen, ich sei lahm, feige und selbstbewusst. Die anderen sind in der Überzahl.« Den anderen werde er es zeigen, endete der Brief. Als er ihn Wochen später erneut las, erschrak er, wie kurz die Vorsätze nur gehalten hatten.
Wie jeder anständige Junggeselle wohnte Heinz Höher noch zu Hause. Sein Bruder Manfred hatte 1959 für die ganze Familie ein Haus auf der Moltkestraße gebaut, am Stadtpark, wo Leverkusen neu und nach eigener Anschauung mondän war. Betten-Höher auf der Hauptstraße, vom Vater aufgebaut und von Manfred übernommen, war in Leverkusen ein Begriff, Polster, Gardinen, Bettwäsche. Der Vater war kurz vor der Fertigstellung des Eigenheims gestorben, die älteren Brüder waren schon fern, Johannes verheiratet, Edelbert nach Amerika ausgewandert, aber die Mutter, die Schwester und Heinz zogen bei Manfred mit ein. Zum ersten Mal im Leben hatte er ein Zimmer für sich alleine. Die Mutter ließ ihn morgens bis nach neun schlafen. Er studierte und trainierte doch so hart.
»Was ich mir vorgenommen habe«, schrieb er in einem der Briefe an sich selbst und nannte unter Punkt 6: »Mehr Herzlichkeit gegenüber der Mutter. Denk daran, dass Mutter auch einmal ein Mädchen von 21 Jahren war.«
Was die Mädchen von 20 betraf, so wurde in Leverkusen getratscht, Heinz Höher, der Star von Bayer 04, habe die Liebe gefunden. Manch einer wollte ihn mit einer grazilen jungen Frau aus den Farbenfabriken gesehen haben, kurze schwarze Haare und lange Beine, aber verlobt waren sie wohl noch nicht, sonst würden sie sich offensichtlicher zeigen.
Geld war, dank des Fußballs, kein Thema. Mit Siegesprämien und Handgeld kam er bei Bayer 04 auf knapp 2000 Mark im Monat. Ein Arbeiter in den Farbenfabriken Bayer erhielt 500 Mark, ein junger Chemieingenieur 1200 Mark. Für Vertragsfußballer schrieb das Gesetz eigentlich eine Gehaltsobergrenze von 400 Mark vor, schließlich waren Sportvereine gemeinnützige Einrichtungen und keine Betriebe, die Profis beschäftigten. Die Zahlungen wurden Höher von Fußballobmann Peter Röger in kleinen Briefumschlägen zugesteckt.
Andere hätten gesagt, so kann das Leben weitergehen. Heinz Höher dachte mit 24 wenig darüber nach, wie irgendetwas weitergehen würde, als die Gründung der Fußballbundesliga sein eingespieltes Leben durcheinanderwirbelte.
»Wir brauchen die gesamtdeutsche Liga, um international noch mithalten zu können«, hatte Bundestrainer Sepp Herberger geschrieben. Das war 1936 gewesen, in einem Brief an den Fachamtsleiter Fußball im Deutschen Reichsbund für Leibesübungen, Felix Linnemann.
Überall in Europa, wo Fußball leidenschaftlich und herausragend gespielt wurde, in England, Spanien, Italien, maßen sich die besten Klubs jedes Wochenende, und die Spieler wurden als Berufsspieler beschäftigt, um sich entsprechend vorzubereiten. In der Bundesrepublik trainierten die Fußballer 26 Jahre nach Herbergers Brief weiterhin dreimal die Woche nach Feierabend, und die Klubs traten noch immer in fünf regionalen Oberligen an, deren Beste dann jeden Sommer zum Saisonende im K.-o.-System den deutschen Meister ermittelten.
Der Zweite Weltkrieg hatte die Bundesliga zwangsläufig aufgehalten. Was der Gründung der Liga aber auch 17 Jahre nach Kriegsende im Wirtschaftswunderland im Wege stand, waren die deutschen Lieblingsthemen: Geld und Moral.
Aus der tiefen Schuld, die Deutschland im Zweiten Weltkrieg auf sich geladen hatte, war das nationale Streben entstanden, moralisch bloß nichts mehr falsch zu machen. So wurden auch apolitische Entscheidungen wie die Bundesligagründung unter das Diktat der Moral gestellt. DieMänner aus derTorstangenzeit hießen die Mahner gegen die Bundesliga. Man würde den hehren Sport durch die Einführung des Profitums unkontrolliert in die materialistische Verdorbenheit führen, zeterten sie und schwärmten von der Zeit, als die Sportler noch ihre Torstangen selbst aufgestellt hatten. »Es lächert mich«, sagte Herberger, »wenn Veteranen, die Torstangen auf die Plätze trugen, wie eitle Pfauen ihren Idealismus herausstreichen. Sie haben Stangen hingetragen, weil es sonst niemand für sie tat. Und Geld haben sie keines genommen, weil keines da war. So einfach ist das.«
Doch auch in den Vereinen und Regionalverbänden, wo jeder Herbergers sportliche Dringlichkeiten verstand, sperrten sich viele gegen die Eliteliga. Denn werde mit der neuen Liga Fußball zum Beruf, müssten die Klubs selbstverständlich wie jede Firma Gewerbesteuern, Kranken- und Rentenversicherungen begleichen, hatte das Bundesfinanzministerium angekündigt. So scheiterten zwischen 1955 und 1960 mehrere Initiativen an den Spitzenvereinen selbst, die eigentlich eine Bundesliga wollten, aber bitte nicht dafür bezahlen.
Angesichts all dieser Bedenken wurde die Bundesliga am 28. Juli 1962 auf dem Verbandstag des Deutschen Fußball-Bundes mit überwältigender Mehrheit als verdruckster Kompromiss geboren. Ab August 1963 würde die landesweite Liga starten, aber nicht mit Vollprofis, sondern mit Lizenzspielern. Diese seien etwas ganz anderes als Profis, behaupteten die Bundesligaväter, nämlich nur ein bisschen Berufsfußballer. Um dies zu untermauern, wurde das Gehalt der Bundesligalizenzspieler vom DFB-Verbandstag auf höchstens 1200 Mark beschränkt. An Ablöse durften allenfalls 50000 Mark pro Spieler entrichtet werden, und kein Verein durfte mehr als drei Fußballer von anderen Klubs anwerben.
Auf diese Weise verhindere man solchen Wahnsinn wie in Italien, wo gerade der FC Modena dem deutschen Nationalspieler Albert Brülls ein Jahresgehalt von 150000 Mark geboten habe, erklärten die Vereinsvertreter stolz der moralischen Republik. So überzeuge man das Finanzministerium, sie weiter in Ruhe zu lassen, hofften sie.
Heinz Höher verstand die neue Regelung so, dass den Fußballspielern in der Bundesliga deutlich höhere offizielle Gehälter gezahlt würden und dass demnach sicher auch noch deutlich bessere Schwarzgeldzahlungen als bisher draufgelegt würden.
Es gab nur ein Problem: Bayer 04 Leverkusen würde sich nicht für die Bundesliga qualifizieren. Das ließ sich schon acht Monate vor dem Start absehen. 44 Vereine bewarben sich um die 16 Plätze. Leverkusen fehlten entscheidende Qualifikationspunkte, weil sie bis Juni 1962 nur in der Regionalliga, der zweiten Liga des alten Systems, gespielt hatten. Heinz Höher sagte sich, er werde bleiben und dann eben mit Bayer 04 den Aufstieg im nächsten Jahr versuchen. Und manchmal glaubte er sich auch.
Er war fast 25. In dem Alter unternahm man keine Abenteuer mehr. Realistisch betrachtet, hatte er vielleicht noch fünf Jahre als erstklassiger Fußballer vor sich. Über 30 spielten nur noch die Glücklichen und Weisen.
Mit 20 hätte er den Verein wechseln können. Beim Spiel zur Einweihung des neuen Bayer-Stadions an der Bismarckstraße hatte er Panik in der Abwehr des 1. FC Kaiserslautern gesät, und um sich für den feinen Auftritt selbst zu belohnen, suchte er nach dem Schlusspfiff die Nähe von Kaiserslauterns Weltmeister Fritz Walter. So, wie er aufgespielt hatte, konnte er den großen Fritz einmal im Leben von Star zu Star ansprechen. Vielleicht würde ihm Fritz Walter sogar ein Kompliment schenken.
Willst du nicht zu uns kommen?, fragte der Fritz.
Heinz Höher glaubte, er schwebe.
Diese Anfrage von Fritz Walter war eine der höchsten Auszeichnung seiner Karriere. Aber Heinz Höher wäre nicht darauf gekommen, Walters Offerte anzunehmen. Es reichte ihm das Wissen, dass er Angebote bekam.
Vereinswechsel waren etwas für Nationalspieler, die von den Italienern in Geld gebadet wurden, oder für Halunken, die sich nicht mehr zu Hause sehen lassen konnten. Auch wenn alle prophezeiten, dies würde mit Gründung der Bundesliga anders werden. Die Vereine würden nun auch die besseren Oberligaspieler von Bremen nach Nürnberg oder von Saarbrücken nach Braunschweig locken. Doch warum sollte er, fragte er sich, wenn er in Leverkusen doch alles hatte, die Freunde, die Familie, die Doris, von der noch wenige wussten; das gemachte Bett, ausreichend Geld, die Blicke der Mädchen in der City-Bar und die Kapitänsbinde sonntags im Stadion.
Wenn ihr das Handgeld von 5000 auf 12000 Mark erhöht, dann bleibe ich, sagte er jovial zu Bayers Fußballobmann Peter Röger, wochentags nach dem Training, beim ersten Bier im Gasthaus Krahne, wo die Mitspieler nicht mehr so viel tranken wie noch vor drei, vier Jahren. Heinz Höher hatte sich, in einem seiner Briefe an sich selbst, auch vorgenommen: »Zwei Tage vor dem Spiel keinen Alkohol mehr und überhaupt den Flüssigkeitshaushalt regeln!«
»Einen Tag vor dem Spiel keine Frau!«, schrieb er noch darunter.
Heini, bei allem Verständnis, 12000 auf die Hand, das können wir nicht zahlen, sagte Röger. Wenig später wurde daraus eine offizielle Absage des Vorstands: Es würden bei Bayer 04 keine höheren Beträge fließen, nur weil andernorts die Vereine wegen der Bundesligagründung finanziell durchdrehten. Das gelte für alle Spieler, auch für den Kapitän, den Amateurnationalspieler, den Vereinshelden mit der Nummer 7.
Die Ablehnung trifft dich nicht, sagte sich Heinz Höher, das juckt dich nicht. Wenn sie dich nicht mehr wollen, dann gehst du halt weg. Ihm würde keiner etwas anmerken, was sollte man ihm anmerken, er war doch nicht verärgert.
Als Heinz Höher überlegte, wie man es am besten anstellte, den Verein zu wechseln, erinnerte er sich daran, wie er vor gut einem halben Jahr, im Juni 1962, in das leere Haus in der Moltkestraße gekommen war. Seine Mutter, die in die Kirche oder sonst wohin gegangen war, hatte ihm einen Zettel auf der Schuhkommode am Eingang hinterlegt.
Lieber Heini!
Fisch ist im Eisfach. Tue ihn in das Wasser mit der Zitrone. Wenn es kocht, ist er fertig. Ich hoffe, dass du das hinbekommst. Briefe in Deinem Zimmer. Mutter.
Er hatte die Post aus dem Zimmer geholt, bevor er den Fisch kochte, und ein Schreiben mit fremder Briefmarke in den Händen gehalten. Auf einem DIN-A5-Blatt mit rotem Briefkopf, das aussah wie eine Restaurantrechnung, wandte sich der Football Club de Metz an ihn. Sie hatten ihn beim Spiel der deutschen Amateurnationalelf gegen Frankreich in Merlebach gesehen und würden ihn gerne zu einem Engagement in Metz bewegen. »Möchten Sie bitte so freundlich sein, um uns mitzuteilen, ob Sie Interesse hätten, nach Frankreich zu kommen zum F. C. Metz als Profispieler und eventuell zu welchen Bedingungen.«
Er hob den Brief als stolzen Beweis seiner Klasse auf und antwortete nie. Jetzt, acht Monate später, schimpfte er sich, wie unhöflich er gewesen war.
Er konnte nicht warten, dass vielleicht noch ein Brief eintreffen würde, er musste sich aktiv um einen neuen Verein bemühen. In Leverkusen konnte er auf keinen Fall mehr bleiben, er hatte mit Manglitz und dem verrückten Klima geredet, denen wollte Bayer auch nicht das Handgeld oder Gehalt erhöhen, obwohl sie bereit waren, für Leverkusen auf die Bundesliga zu verzichten. Dann sind wir weg, hatten Manfred Manglitz, der Torwart, und Halbstürmer Uwe Klimaschefski gesagt. Da musste er mitziehen. Heinz Höher schickte ein Bewerbungsschreiben an Bayern München. Auf seinen Reisen mit der Amateurnationalelf hatte er einen Bayern-Spieler kennengelernt, Werner Olk. Ihn bat er, seinen Brief an Bayern Münchens Präsidenten Wilhelm Neudecker zu überreichen. Wenige Tage später erhielt Heinz Höher Post aus München.
München, den 5. 2. 1963
Sehr geehrter Herr Höher!
Unser Vertragsspieler Herr Werner Olk hat mir Ihren freundlichen Brief übergeben.
Als Vorsitzender des FC Bayern München teile ich Ihnen nach Rücksprache mit meinem Spielerausschuß-Vorsitzenden und unserem Trainer Herr Schneider mit, daß wir uns freuen würden, Sie als Spieler zu unserer Mannschaft zu bekommen.
Leider hängt ja für uns die Bundesliga-Lizenz auch noch sehr hoch. Andererseits bin ich aber überzeugt, daß, falls wir nicht in dieser Saison aufgenommen werden, wir uns sehr rasch in die Spitzenklasse hineinspielen würden.
Ich empfehle, daß wir in einigen Wochen, sobald die Lage sich geklärt hat, die Verbindung wieder aufnehmen.
Mit sportlichen Grüßen,
Wilhelm Neudecker
Heinz Höher ging es gleich etwas besser. Anderswo schätzte man ihn noch. Aber Neudecker hatte recht. Es war fraglich, ob der FC Bayern in die Bundesliga aufgenommen würde. Wie man hörte, sollte keine Stadt mehr als einen Platz erhalten, und die stärkere Mannschaft in München war der TSV 1860. Heinz Höher wollte sehen, ob er nicht doch noch etwas Besseres als die Bayern fand.
Ein Gegenspieler vom Wuppertaler SV hatte ihm in der vergangenen Sommerpause zugeredet, zu ihnen zu wechseln. Erich Ribbeck hieß er. Er konnte doch einmal vorbeischauen. Heinz Höher fuhr als Zuschauer zum Training nach Wuppertal. Nach kurzer Zeit überlegte er, wie er wieder unauffällig verschwinden könnte. Trainer Zapf Gebhardt ließ die Spieler Runden laufen. Mit Medizinbällen unter den Armen. In welchem Jahrzehnt lebte der denn noch?
Sechs Monate vor Beginn der Bundesliga war die Vereinssuche für Heinz Höher ein aufregender Zeitvertreib, den er exzellent während seiner Scheinbesuche an der Hochschule Köln erledigen konnte. Er saß im Kaffeehaus am Dom, studierte den Kicker oder das Sport-Magazin und überlegte sich, welcher Klub einen dribbelstarken, passsicheren Halbstürmer wie ihn gebrauchen könnte. Es hatte geschneit im Bergischen Land, das Training ruhte weitgehend, das gab ihm das Gefühl, der Sommer, die Bundesliga, sei noch weit weg.
Der Schnee war eine Sensation. Schnee im Bergischen Land, wann gab es das schon einmal? Die unschuldige Schönheit der weißen Haut über den Feldern machte die Leute verrückt. Sie mussten raus, den Schnee spüren. Komm, wir gehen Skifahren, sagte seine Schwägerin Ruth. Heinz Höher war sofort dabei. Auch wenn er weder Ski besaß noch Ski fahren konnte.
Bei Heinz Wachtmeister stand noch ein altes Paar im Keller. Wachtmeisters Eltern führten die Konditorei am Ebertplatz, das Kellerlokal darunter hatte man sie gezwungen mitzumieten, als sie nach dem Krieg aus Soest nach Leverkusen gezogen waren. Sie ließen nicht erkennen, wie gekränkt sie waren, dass man ihnen, etablierten Konditormeistern, eine Bierkneipe aufzwang. Die Kneipe wurde ihr großes Glück. Eine Konditorei hatte es schwer in Leverkusen. Die wenigen Bürger, die genug auf sich hielten, um bei Kaffee und Kuchen in einer Konditorei die Weltlage zu erörtern, hielten gleich so viel auf sich, dass sie dafür nach Köln fuhren. Die Schatzkammer dagegen, wie Wachtmeisters Vater das Kellerlokal taufte, brummte.
Der Rauch biss beim Betreten der Kneipe in den Augen. Skatspieler kniffen die Augen zusammen, wenn sie an der Zigarette saugten, ohne die Hände zu benutzen. Die Hände brauchten sie, um einen Trumpf auf den Tisch zu donnern. An der Bar hing grundsätzlich Mäc Scheller, Reporter des Westdeutschen Rundfunks. Er hatte Heinz Höher darüber aufgeklärt, dass Bier bestens geeignet war, um nach ausgiebigem Schnapsgenuss auszunüchtern. Jetzt trinke ich mich erst mal am Bier wieder nüchtern, sagte Mäc Scheller, der 70 kleine Bier hinunterkippen konnte, wenn er sich besonders schwertat, wieder nüchtern zu werden.
Der Konditorsohn Heinz Wachtmeister gehörte zu jenen jungen Leuten in Leverkusen, die keine Zuschauer mehr waren, sondern, wie sie es nannten, Fans. Mit einem guten Dutzend junger Männer reiste Wachtmeister sogar zu Bayers Auswärtspartien. »Bravo, Heinrich!«, skandierten sie nach seinen Zuckerpässen, Heinz Höher schaute dann erstaunt auf. Wer rief ihn?
Er lieh sich Wachtmeisters Ski. Sie waren aus Holz, dem Anblick nach seit mindestens 15 Jahren unbenutzt. Die Bindungen wurden mit Lederriemen geschlossen. Auch wenn die Hügel des Sauerlands näher lagen, bestanden sein Bruder Manfred und dessen Frau Ruth darauf, bis in den Westerwald zu fahren. Wenn man schon einmal einen Ausflug unternahm, dann richtig.
Nach anderthalb Stunden erreichten sie den Höllkopf. Aus den Bäumen tropfte es. Der Schnee klebte weich und wässrig an den Schuhen. Auf der Piste, kaum 300 Meter lang, schimmerten ein paar braungrüne Grasflecken.
Aber sie waren so weit gereist. Jetzt versuchten sie es einfach einmal.
Heinz Höher kam 50 Meter weit, vielleicht auch 150, er konnte nicht exakt unterscheiden, wann er noch schwankend fuhr, wann er bereits den Hang hinunterpurzelte. Auf jeden Fall konnte er nicht mehr aufstehen, als er zum Liegen kam.
Er habe Glück, sagte ihm der Arzt, die Bänder im rechten Knie seien nur überdehnt, nicht gerissen. Doch als Heinz Höher drei Wochen später bei Bayer Leverkusen wieder ins Training einstieg, wünschte er sich, die Bänder wären gerissen. Dann hätte er sich richtig auskurieren können. Das musste besser sein, als mit diesem Gefühl Fußball zu spielen, irgendetwas stimmte nicht.
Sein Antritt war weg. Schnell im Fußball zu sein bedeutete nicht, über 100 Meter schnell rennen zu können, sondern im Bruchteil einer Sekunde explosiv zu starten. Wer in diesem Moment schneller als der Gegner am Ball war oder den Ball passte, gewann.
Heinz Höher trainierte nach seinem Skiunfall wie besessen, um den Antritt wiederzufinden. Er liebte hartes Training; das Gefühl danach, alles getan zu haben, um nun ohne schlechtes Gewissen zwei Bier und einen Klaren trinken zu können.
Im Keller hatte er einen Punchingball. Er erschien zwar kaum noch zum Sportstudium in Köln, die Ideen aus der Trainingslehre anderer Sportarten aber hatte er sich in den ersten Semestern abgeschaut. Seine Fäuste trommelten auf den Punchingball, seine Füße tänzelten um ihn herum, die Vorstellung, ein Boxer zu sein, beschwingte ihn. Beim Fußball hatte er immer Angst, wenn er ohne Ball war. Hatte er den Ball, fürchtete er niemanden auf der Welt, dann dribbelte er schnurstracks auf die härtesten Verteidiger zu, er fühlte sich ihnen überlegen. Ohne Ball jedoch, wenn er einen Gegner angreifen sollte, überfiel ihn immer die Angst, er würde sich im Zweikampf wehtun.
Er kam körperlich mächtig in Form. Aber sein Antritt blieb weg. Oder bildete er es sich nur ein? In den Berichten des Kicker zu Leverkusens Oberligaspielen tauchte er quasi nur noch in der Mannschaftsaufstellung auf. Wie sollte ein Verein auf ihn aufmerksam werden, wenn er nie in der Zeitung stand?
Heinz Höher hörte, dass Bayer Leverkusens alter Trainer Raymond Schwab einen neuen Beruf hatte. So neu war die Beschäftigung in Deutschland, dass es dafür noch kein Wort gab. »Fußballmakler« taufte Die Zeit Schwab, als sie ihre gebildeten Leser in einem 200 Zeilen langen Aufklärungsbericht über die jüngste Absonderlichkeit des modernen Sports unterrichtete. Drei Männer gebe es mittlerweile in Deutschland, die ihr Geld als Fußballmakler verdienten.
»Wie geht Ihre Tätigkeit vor sich?«, fragte Die Zeit Schwab.
»Ich vermittle Fußballspielern Vereine und Fußballvereinen Spieler.«
»Haben Sie viel zu tun?«
»Mein Telefon klingelt den ganzen Tag.«
»Ist das ein gutes Geschäft?«
»Wenn ein Vertrag zustande kommt, erhalte ich eine bescheidene Provision. Ich habe hohe Unkosten.«
Raymond Schwab, die schwarzen Haare, wie es sich gehörte, ordentlich mit Wasser zurückgekämmt, hatte sich nach dem Krieg als Boxkampf-Promoter versucht. Vom Boxveranstalter zum Fußballspitzentrainer war es damals nicht so weit. Von einem Sportlehrer wurde verlangt, dass er alle Sparten beherrschte, und Schwabs großes Talent war universell einsetzbar. Er konnte den Leuten etwas erzählen. 1951, als Trainer in Leverkusen, hatte er schon eine innovative Aufstiegsprämie ausgehandelt: Falls er Bayer 04 in die Oberliga führte, würde ein Benefizspiel ausgetragen, den Gegner bestimme er, und die Einnahmen behalte auch er. Leverkusen stieg auf, trug ein Benefizspiel gegen Schalke 04 aus, Schwab strich wohl 5000 Mark ein, das Geld eines halben Jahres, und kündigte.
Wenig später gründete Schwab einen neuen Exporthandel: deutsche Fußballer für Italien. Bereits 1952 vermittelte er Karl-Heinz Spikofski nach Catania und Horst Buhtz zum AC Turin.
»Menschenhandel« sei das, zürnte Bundestrainer Herberger. Für Heinz Höher war es ein Glücksfall. Innerhalb weniger Wochen fand Schwab einen interessierten Verein für ihn, den VfB Stuttgart. Man musste allerdings nicht ausdrücklich Fußballmakler sein, um Fußballer zu vermitteln, man konnte auch einfach abends nach der Arbeit im Sport-Magazin die interessanten Spieler mit einem Stift markieren und sich an die Schreibmaschine setzen. »Sehr geehrter Herr Höher«, schrieb ein Hans-Günther Wolf aus Saarbrücken und beließ es, einem Makler wohl angemessen, bei eleganten Andeutungen: »Ich stehe in naher Verbindung zu einem Saarbrücker Verein, der sich für einige Spieler interessiert. Ich frage hierdurch bei Ihnen an, ob Sie eventuell an einem Wechsel nach hier Interesse haben. Für berufliches Fortkommen wird gesorgt.«
Das Interesse des 1. FC Saarbrücken endete allerdings nach einem Treffen. In einem sechs Zeilen langen Brief teilte Saarbrückens Geschäftsführer Reinhard Lenhof Höher hochachtungsvoll mit, dass »unser Club gewillt ist, unter allen Umständen die Bestimmung des Lizenzspieler-Statuts innezuhalten und daher außer Stande ist, Ihre finanzielle Forderung zu erfüllen«. So deutlich ließ sich über Schwarzgeld reden, ohne den Begriff zu benutzen.
Der VfB Stuttgart dagegen zeigte sich hartnäckig interessiert an Heinz Höher. In einem Brief vom 9. März 1963 kündigte Stuttgarts Zweiter Vorsitzender Konrad Rieker Höher den Besuch eines Herrn des VfB bei der Oberligabegegnung Leverkusen gegen Schalke 04 an. Riekers Sekretärin, die seine Briefe abtippte, war sich des Vornamens von Herrn Rieker nicht ganz sicher. Mal schrieb sie Konrad mit K, mal mit C. Vornamen zählten wenig, auch im Fußball, wo der Herr Zweite Vorsitzende Rieker mit dem Sportkameraden Höher korrespondierte und nie vergaß, am Ende sportliche Grüße zu übermitteln.
Würdest du mit mir nach Stuttgart gehen?, fragte Heinz Höher bei einem Spaziergang im Stadtpark eine junge Frau, deren Name, das war in Leverkusen mittlerweile bekannt, Doris lautete. Obwohl sie noch keinen Verlobungsring von ihm trug, durfte sie ihn angeblich schon in der Moltkestraße besuchen. Die Mutter tat so, als ob sie nichts merkte.
In Bayers Werkskantine hatte er zur Mittagspause plötzlich vor Doris gestanden. Natürlich wusste sie, wer er war. Sie hatte ihn schon als Jungen in der Hildegard-Kirche gesehen. Doris arbeitete als kaufmännische Angestellte bei Bayer, ihr Vater war bei Bayer, die Familie wohnte in einer der Mietswohnungen der Farbenfabriken. Einmal fragte man sie, ob sich nicht Modell stehen könne für eine Anzeige von Bayer, mit ihrer graziösen Figur.
Sie wollte niemals weg aus Leverkusen. Und nun fragte er sie, ob sie mit ihm nach Stuttgart ginge. Doris schluckte. Dann sagte sie Ja, und es fühlte sich wie ein richtiges Jawort an.
Leverkusen spielte gegen Schalke 0:0. Die Zuschauer pfiffen Heinz Höher aus, der es nach Meinung der einen mit den ständigen Dribblings übertrieb und nach Ansicht der anderen nur faul herumstand.
Danach wartete er jeden Tag gespannt auf eine Nachricht aus Stuttgart und fürchtete sich gleichzeitig vor ihr. Sein Bruder Manfred hatte bereits ein Telefon im Geschäft Betten-Höher auf der Hauptstraße. Aber der VfB Stuttgart meldete sich nicht mehr.
Fußballmakler Schwab hätte in Kürze herausfinden können, was los war. Aber Heinz Höher rief ihn nicht an. Er schämte sich zu sehr seines misslungenen Spiels gegen Schalke. Nach 14 Tagen hielt er es nicht mehr aus. Er schrieb dem Herrn Zweiten Vorsitzenden Rieker, um sich höflichst für sein unzulängliches Spiel gegen Schalke zu entschuldigen. Er könne es Rieker nicht verdenken, falls das Stuttgarter Interesse an ihm nach diesem traurigen Spektakel erloschen sei, wolle Rieker aber darauf hinweisen, dass er einfach einen jener unerklärlichen Tage erwischte, an denen die Beine nicht den Befehlen des Gehirns gehorchten.
Auf nichts konnte er so wütend sein wie auf sich selbst. »Hast du schon vergessen«, schrieb er an sich selbst, »was du dir am 12. September 1959 vornahmst, als dir vor dem Olympia-Qualifikationsspiel gegen die DDR die Röte ins Gesicht stieg, wie der Boden unter deinen Füßen wegsank, weil du nicht in der Elf standst?
1) Nicht mehr links und rechts schauen!
2) In jedes Spiel so hineinlegen, als ob es ein Länderspiel wäre!
3) In jedem Training die Organe zum Wachsen bringen!«
Nächsten Sonntag gegen Wuppertal würde er es allen zeigen. Er dachte auch daran, nicht mehr jeden Abend von Montag bis Donnerstag in die Gasthäuser zu gehen. Aber er trank doch zum Skat nur zwei Bier und einen Klaren.
Leverkusen verlor gegen Wuppertal 2:4, die Zuschauer pfiffen, am Ende der Woche erreichte ihn die Antwort von Konrad Rieker:
»Sehr geehrter Sportkamerad Höher! Über Ihre freundlichen Zeilen vom 2. April 63 habe ich mich sehr gefreut, mehr noch über Ihre Offenheit und geübte Selbstkritik. Ihre Zeilen haben mir gerade aus diesem Grund sehr imponiert.« Dass Heinz Höher seit dem angekündigten Besuch eines Stuttgarter Herrn beim Spiel Leverkusen gegen Schalke ohne Nachricht geblieben war, habe besondere Gründe. Die Mutter von Herrn Schnaitmann, dem Spielausschussvorsitzenden des VfB, der ihn im Westen treffen wollte, starb leider einen Tag vor der Reise, weshalb Herr Schnaitmann den Besuch in Leverkusen zurückstellen musste.
Der VfB Stuttgart sei weiterhin sehr daran interessiert, ihn zur Verstärkung seiner Mannschaft zu gewinnen. Der VfB lasse sich grundsätzlich weder in positiver noch in negativer Weise von Leistungsschwankungen in einem Spiel beeinflussen, vielmehr beurteile er das Können und konstante Leistungsvermögen. »Beides ist doch bei Ihnen vorhanden, denn anders wäre Ihre Verwendung in der deutschen Amateurauswahl und in der Oberligamannschaft von Bayer Leverkusen nicht erklärlich.« Zur genauen Abklärung der Dispositionen der Stuttgarter Herren werde sich Konrad Rieker bald wieder telefonisch mit ihm in Verbindung setzen.
Doris fragte nicht mehr danach, wie es mit Stuttgart stand. Sie hatte zu Hause gelernt, dass das meiste einfacher war, wenn sie Ja sagte und wartete, was geschah.
Die Saison ging dem Ende entgegen, in drei Monaten startete die Bundesliga. Rieker stellte weiter Besuche des Stuttgarter Herren in Aussicht, die sich dann verschoben. Von Bayern München hörte Höher nichts mehr, fragte aber auch nicht nach. Die Bayern mussten, als dritte Kraft in ihrem Bundesland hinter dem 1. FC Nürnberg und 1860 München, in die zweitklassige Regionalliga hinunter.
Bei Leverkusens letztem Saisonspiel in Aachen gab sich Stuttgarts Spielausschussvorsitzender Ernst Schnaitmann dann doch noch die Ehre, Höher zu beobachten.
Heinz Höher hatte öfter das Gefühl, schlecht gespielt zu haben, wenn seine Leistung alle anderen beeindruckt hatte. Es war die Fußballerkrankheit: Bei Spitzensportlern, die den Anspruch an sich selbst stellten, makellos zu agieren, brannten sich zwei, drei kleine Fehler immer tiefer ein als ein insgesamt ordentlicher Auftritt. In Aachen allerdings war Heinz Höher mit sich zufrieden, auch wenn sie 1:2 unterlagen. Er hatte einige elegante Momente geschaffen.
Am 21. Mai, zehn Tage nach dem Spiel, schrieb ihm Konrad Rieker plötzlich kurz und bündig: »Nach Überprüfung aller Fragen und Möglichkeiten ist der VfB Stuttgart nunmehr zur Überzeugung gelangt, dass er die Voraussetzungen für Ihren Wechsel für Sie nicht zufriedenstellend zu schaffen imstande ist.«
Aber hatte er denn in Aachen nicht ordentlich gespielt?
Erst viel später erfuhr er durch die stille Post der Fußballszene, was Schnaitmann in Stuttgart berichtet habe: Der Höher sei in Aachen mindestens fünfmal ins Abseits gelaufen. Solch dumme Spieler hätten sie selbst genug im Schwabenland.
Die letzte Oberligasaison war vorüber. Heinz Höher verabschiedete sich von den Mitspielern in Leverkusen.
Wohin wirst du wechseln?
Das ist noch nicht abzusehen.
Jetzt sage schon, über welche tollen Angebote verfügst du?
Heinz Höher lächelte nur.
Er schlief in den Tag hinein, trainierte im Keller am Punchingball, wartete auf der Schwimmbadwiese, dass Doris von der Arbeit kam, und spielte nachts in der Schatzkammer oder beim alten Bäcker Schramm in der Backstube Skat. So vergingen Wochen, in denen kein Verein nach ihm fragte. Zu Heinz Höhers großen Stärken gehörte es nach seiner eigenen Meinung, Gefühle wie Verzweiflung stets vor allen anderen zu verstecken.
Wenige Tage vor Trainingsbeginn zur ersten Bundesligasaison wurde Heinz Höher, der es nach Meinung der anderen verstand, das Leben mit einer unerhörten Leichtigkeit zu nehmen, vom Meidericher SV angeworben. Überraschend war der Sportverein aus dem Duisburger Vorort in die Bundesliga aufgenommen worden.
Rechtlich stand Leverkusen keine Ablöse zu, da Höher als Amateur geführt wurde, aber als Bayer 04 sich deswegen gegen den Wechsel sträubte, wurde das Problem auf kreative Art gelöst. Meiderich verpflichtete auch noch Leverkusens begabten Torwart Manfred Manglitz und bezahlte für ihn eben die doppelte Ablöse.
Manglitz, der in Köln lebte, könne ihn zum Training mitnehmen, schlug Heinz Höher vor, dann spare sich ihr neuer Verein einmal das Fahrgeld. Meiderichs Vorsitzender Walter Schmidt war begeistert: Was für ein vernünftiger Fußballspieler! Heinz Höher hielt es nicht für nötig, Schmidt oder Manglitz aufzuklären, warum er eine Mitfahrgelegenheit in die Bundesliga suchte. Er hatte wegen Trunkenheit am Steuer für ein halbes Jahr den Führerschein verloren.
Meiderichs Trainer Rudi Gutendorf steigt Weltmeister Helmut Rahn auf den Rücken, und eine Mannschaft und 5000 Fans staunen: Das ist also modernes Training. [Abb. 3]
Das Jahr null
Die Mannschaft des Wirts
Zum Trainingsauftakt des Meidericher SV brachte der neue Trainer Rudi Gutendorf zwei Dinge mit, um die Mannschaft und Zuschauer zu beeindrucken: ein schnelles Auto und einen übergewichtigen Stürmer.
Leck mich am Arsch, dachte sich Torwart Manfred Manglitz, als er Gutendorf in einem glänzend weißen Mercedes 190 SL mit roter Ledergarnitur vorfahren sah. Als wollten sie Spalier stehen, wichen die Zuschauer zurück. Es war ein warmer Tag im heißen Juli 1963, der sie entschädigte für den Graus vom Vorjahr, den kältesten Sommer seit 111 Jahren mit einem einzigen Tag über 25 Grad. Da fährt der mit einem Mercedes in der Arbeiterstadt Meiderich vor, dachte Manglitz. Leute, die sich was trauten, gefielen ihm. Er selbst trug in den Spielen immer das neueste Modell einer Schirmmütze.
Es riecht hier so komisch, dachte sich Heinz Höher, der mit Manglitz überpünktlich losgefahren war, um am ersten Tag nicht zu spät zu kommen.
Der Geruch, stechend, säuerlich, musste von der Hochofenschlacke in der Phoenixhütte stammen. Heinz Höher fragte sich, ob es in Leverkusen auch so penetrant roch, sicher musste es riechen, bei den Abgasen, die Bayer in die Luft jagte. Aber es war ihm nie störend aufgefallen. Es war normal.
Minuten nach Gutendorfs Auftritt im Sportwagen schwappte die Menge der Schaulustigen auf dem Stadionparkplatz wieder nach vorne. Noch ein Mercedes bog von der Westender Straße ein. Gutendorfs gewichtiger neuer Stürmer fuhr vor: Der Boss kam.
Als Helmut Rahn ausstieg, sah die Menge einen Mann, der älter war, als man mit 34 sein musste, die Haut faltig, der Torso breit. Aber wen die Schaulustigen genauso wie die neuen Mitspieler noch immer in ihm sehen wollten, war Helmut Rahn, der neun Jahre zuvor im Weltmeisterschaftsfinale 1954 gegen Ungarn aus dem Hintergrund das Tor zu Deutschlands 3:2-Sieg geschossen hatte.
Ich sitze neben Helmut Rahn, dachte sich Horst Gecks in der Umkleidekabine, ein 20-jähriger Floh von einem Außenläufer, 1,73 klein, 62 Kilo leicht, und selbst in Gedanken traute sich Gecks den Satz nur zu flüstern. Außer einem 31-jährigen Verteidiger waren sie alle mindestens zehn Jahre jünger als Rahn. Mit großen Jungenaugen hatten sie ihn 1954 schießen sehen, als Rundfunkreporter Herbert Zimmermann mit seinem Kommentar den ersten Gemeinschaftsmoment der jungen Bundesrepublik schuf: »Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen, Rahn schießt, Tooor!« 16-jährig hatte Heinz Höher damals vor dem Gasthaus Birkhäuser gestanden und versucht durch das Fenster einen Blick auf den Fernseher zu erhaschen, die Wirtschaft war überfüllt zur Übertragung des WM-Finales. Helmut Rahn würde nie einfach ihr Teamkollege werden. Er würde immer auch ihr Held bleiben.
Dass Rahn mit 34 seinem alten Helden-Ich sichtbar hinterherhechelte, war zweitrangig. Der Boss blieb der Boss.
Doch im Prinzip kam die Bundesliga für die Weltmeister von 1954 zu spät. Fritz Walter trat nun als Repräsentant für Adidas sowie als Fußballweiser in Funk und Presse auf, sein Bruder Ottmar Walter verdingte sich als Tankstellenbesitzer mit flottem Werbespruch: »Willst du unserem Ottmar danken, musst du fleißig bei ihm tanken.« Neben Helmut Rahn blieben nur noch drei Weltmeister am Ball, Hans Schäfer in Köln, Max Morlock in Nürnberg und Heinz Kwiatkowski als Ersatztorwart in Dortmund. Die Bundesliga schien ein neuer Anfang: Es war Platz für neue Namen, eine neue Zeit.
In Meiderich überlegte der Verwaltungsrat, ob er eine Mark Eintritt für das Training verlangen sollte. Er verwarf den Gedanken schnell wieder aus Angst, einen Volksaufstand zu provozieren. In Meiderich, 70000 Einwohner, durch den Fluss Wedau von Duisburg abgegrenzt, arbeiteten die Fußballer an der Seite ihrer Zuschauer auf der Stahlhütte Phoenix-Rheinrohre. Da konnte es sich der Fußballverein nicht erlauben zu vergessen, wie hart die Zuschauer für ihre Mark arbeiteten. Ein Gefühl von Wehmut blieb allerdings im Verwaltungsrat, was sie ohne ein bisschen Aufwand an den ersten drei Trainingstagen hätten einnehmen können. 8500 Zuschauer waren im Jahr zuvor durchschnittlich zu Meiderichs Spielen gekommen, nun pilgerten 5000 zu einem gewöhnlichen Training, um die neue Zeit zu spüren und den Boss zu sehen.
Als erste Übung ließ Trainer Gutendorf die Spieler nebeneinander einmal den Platz hoch und wieder runter gehen, 100 Meter vor, 100 Meter zurück. Dabei musste jeder einen Ball mit den Füßen in der Luft jonglieren. So eine Übung hatte noch nie einer von ihnen gesehen.
Unter Gutendorfs Vorgänger Willy Multhaup hatte der MSV dienstags im Training einfach zehn gegen zehn über den gesamten Platz gespielt, und am Mittwoch hatte Stürmer Werner Krämer gebettelt, gestern sei es doch 14:15 ausgegangen, Trainer, lassen Sie uns bitte mit denselben Mannschaften noch einmal spielen, wir wollen Revanche nehmen. Na gut, hatte Multhaup geseufzt. So hatten sie die gesamte Woche einfach gespielt. Multhaup ging dann während des Trainings irgendwann an den Rand und unterhielt sich mit den Rentnern. Sonntags zum Spiel zog er sich Monokel, Manschettenknöpfe und Schuhe aus italienischem Leder an. Willy Multhaup, ganz am Anfang des 20. Jahrhunderts geboren, war einer der erfolgreichsten und angesehensten Trainer in Deutschland.
Gutendorf war 37 und im Vorjahr mit dem TSV Marl-Hüls Letzter der Oberliga West geworden. Doch er hatte den Meidericher Vorsitzenden Herrn Dr. Schmidt bei dem Bewerbungsgespräch mit seinem jugendlichen Schwung, seinen modernen Ideen und seiner Weltläufigkeit beeindruckt. Gutendorf hatte schon in der Schweiz und, im Auftrag des deutschen Außenministeriums, als Entwicklungshelfer im Trainingsanzug in Tunesien gearbeitet.
Gutendorf musste dann spazieren gehen, während der Herr Dr. Schmidt den anderen Verwaltungsratsmitgliedern über den Bewerber Bericht erstattete. Beim folgenden Abendessen im Speiselokal Zum Marienbildchen setzte man Gutendorf nach alter Fußballtradition auf der Rückseite einer Speisekarte den Vertrag auf. Als nur noch die niemals leeren Gläser auf dem Tisch standen, verlangte Gutendorf auf der Speisekarte eine Klausel zu vermerken. Für den Gewinn der Bundesliga sei ihm eine Prämie von 100000 Mark, für den zweiten Platz von 30000 Mark gutzuschreiben.
Herr Gutendorf, wir sind schon froh, wenn wir nicht absteigen, sagte Herr Dr. Schmidt und schrieb die Klausel hin, denn das war wirklich ein guter Witz.
Von Helmut Rahns Verpflichtung überzeugte Gutendorf sie dann auch noch.
Aber sie hatten mit Heinz Höher doch schon einen erstklassigen Stürmer für die rechte Seite verpflichtet, argumentierte Herr Dr. Schmidt.
Es gehe nicht darum, einen erstklassigen Stürmer zu holen, sagte Gutendorf und holte Luft: Sie bräuchten eine Attraktion, jemanden, dessen Namen die Luft vibrieren ließe, der ganz Deutschland neugierig auf diesen unbekannten Flecken namens Meiderich blicken ließ, der ihnen das Stadion füllte.
Der Verwaltungsrat war beeindruckt. Das war eine neue Sichtweise für einen Trainer.
»Zuerst war ich dagegen, Rahn zu uns zu holen, nicht aus sportlichen Gründen wohlgemerkt«, sagte Herr Dr. Schmidt bei Rahns Präsentation den Journalisten, die ihn umringten. Die Reporter kicherten nach dem Zusatz: »nicht aus sportlichen Gründen wohlgemerkt«. Rahns Lust auf Bier war Teil seiner Legende.
»Aber«, fuhr Herr Dr. Schmidt fort, »wir sind unter den sechzehn Bundesligavereinen, hm, um es vorsichtig auszudrücken, sicherlich nicht der prominenteste. Wir mussten also etwas tun, um uns, na, sagen wir, aufzuwerten.«
Die Bundesligagründung machte die Welt auch in Meiderich größer. Mit Rahn, Manglitz und Höher heuerte der MSV erstmals Fußballer von weiter weg an. Sie kamen aus einem Umkreis von 75 Kilometern, Essen, Köln, Leverkusen. Wer beim MSV spielte, war bis dahin aus Obermeiderich oder Mittelmeiderich, eventuell noch aus dem Nachbarort Hamborn gekommen.
Horst Gecks, der leichtfüßige Linksaußen aus Mittelmeiderich, hatte bis 16 Handball gespielt. Nur in den Sommerferien war er jeden Tag die drei Kilometer zum Trainingsplatz des MSV gelaufen. Die Kinder durften dort ihre wilde Straßenmeisterschaft von Meiderich austragen, Kanalstraße gegen Gelderblomstraße, Weizenkamp gegen Herbststraße. Der Wirt der Vereinsgaststätte, Hugo Hesselmann, stand vor seiner Tür und sah zu.
Der Trainingsplatz war aus groben Kohlenstückchen. Horst Gecks riss sich die Beine auf. Nachts nässten die Schürfwunden und klebten am Bettlaken fest. Am nächsten Tag spielte er weiter. Irgendwann sprach ihn der Wirt an. Er solle doch mal zum MSV kommen. Der Wirt war der Talentjäger des Vereins, die A-Jugend trainierte er selber. Mit Gecks, Danzberg, Heidemann, Lotz, Nolden, Krämer, Versteeg, insgesamt 20 Mann, die sich quasi alle von der Schule kannten, die beinahe alle das Jugendtraining beim Wirt durchlaufen hatten, stürmte Meiderich in die Bundesliga. Nicht jeder konnte das fassen.
»Wo liegt eigentlich Meiderich?«, ließ eine Boulevardzeitung den Kapitän der Nationalelf, Uwe Seeler, fragen. Alemannia Aachen klagte vor einem ordentlichen Gericht gegen die Nominierung des MSV für die neue Eliteliga. Wie konnte dieser klapprige Vorortsklub der traditionsreichen Alemannia vorgezogen werden?
Selbst die Meidericher Spieler gaben die Aachener Verschwörungstheorien bald als Tatsachen weiter: Dem Franz Kremer, dem Präsidenten des 1. FC Köln und einflussreichen Verfechter der Bundesliga, hatten sie am Aachener Tivoli mal ein Bier über den Kopf geschüttet, erzählte Verteidiger Dieter Danzberg, »daraufhin sagte Kremer zu unserem Präsidenten: ›Diese Aachener will ich nicht in der Bundesliga sehen. Wenn ihr in der Oberliga Dritter werdet, garantiere ich, dass Meiderich in die Bundesliga kommt.‹«
Die Wahrheit war wohl langweiliger. Die DFB-Kommission, die über die 16 Bundesligaplätze verfügte, versuchte in einem Hochamt der Bürokratie, jeden Regionalverband zu berücksichtigen. Aus dem Fußballverband Niederrhein war der Sportverein aus dem Duisburger Vorort sportlich nachweislich der stärkste Klub. Alemannia Aachen, im Regionalverband Mittelrhein angesiedelt, hatte den 1. FC Köln vor sich.
Die Auswahl der Bundesligavereine musste zu Ungerechtigkeiten führen. Der 1. FC Saarbrücken als einziger renommierter, halbwegs wirtschaftsstarker Vertreter des Saarlandes wurde zugelassen, obwohl er selbst im dünn besiedelten Südwesten nur Fünfter der Oberliga geworden war. Bayern München blieb außen vor, obwohl es in der Oberliga Süd vor dem VfB Stuttgart, dem Karlsruher SC und Eintracht Frankfurt lag. Doch als Süd-Dritter war der FC Bayern eben auch nur die dritte bayerische Kraft. Es ging darum, dass die neue Spielklasse wirklich als Liga des ganzen Landes startete und nicht als Liga der momentan besten Mannschaften.
Am Freitag, dem 23. August 1963, traf sich die Mannschaft des Meidericher SV am Duisburger Hauptbahnhof. 17 Tickets zweiter Klasse nach Karlsruhe-Durlach waren für sie reserviert. Neben 14 Spielern reisten der Trainer, der Spielerausschussobmann und der Masseur mit. Falls sich ein Spieler ernsthafter verletzte, würde sich der Mannschaftsarzt des Karlsruher SC um ihn kümmern. Auf das Ehrenabkommen, dass der Arzt der Heimelf im Notfall auch die Auswärtsspieler versorgte, hatten sich alle Bundesligisten geeinigt, denn die Ärzte konnten doch nicht jedes Wochenende quer durch die Republik fahren, die Ärzte hatten zu tun. Und man benötigte den Arzt sowieso fast nie. Als sich Torwart Manglitz im allerersten Training in Duisburg bei einer Schussabwehr einen Finger ausgerenkt hatte, ging Trainer Gutendorf zu ihm, warf einen Blick auf den abstehenden Finger, und mit einem Ruck renkte er ihn wieder ein. Leck mich am Arsch, dachte sich Manglitz. Er trainierte dann die nächsten Wochen als Feldspieler mit.
Heinz Höher liebte die Fahrten mit der Fußballelf, wenn sie bereits einen Tag vor dem Spiel anreisten. Es gab ihm stets das Gefühl, etwas Besonderes, etwas Großes stehe bevor. Bislang hatte er solche Fahrten nur zu Spielen der Amateur- oder Juniorennationalelf unternommen. In der Oberliga West waren sie stets am Spieltag mit dem Bus zum Stadion gefahren, ausgestiegen und hatten sich aufgewärmt.
Im Zug nach Karlsruhe klopften ständig Passagiere an das Abteilfenster. »Helmut Rahn, der Helmut Rahn!« Der Meidericher SV übernachtete in einer Familienpension in Karlsruhe-Durlach.
Einer der Spieler hatte die Neue Ruhr Zeitung als Reiselektüre mitgebracht, Heinz Höher warf einen Blick hinein. Die NRZ wurde von einem frischen, offenen Geist getragen, sie druckte hintergründige Reportagen und, viele erfahrene Journalisten schüttelten den Kopf, gelegentlich sogar Interviews mit Fußballtrainern. Wie konnte man den Worten von ungehobelten Männern so viel Raum und Gewicht geben? Zum Bundesligastart schrieb die NRZ einen offenen Brief an die Bundesligavereine:
Liebe Vereine,
es ist erfreulich festzustellen, daß bei den meisten von Ihnen der Optimismus überwiegt und nicht das Nachtrauern an die Zeit, da man die Torstangen selbst zum Platz trug und Eintrittsgelder auf dem Suppenteller kassiert wurden. Vorbei, vorbei, überlassen wir es den braven, den echten Amateuren!
Der Realismus ist trumpf. Künftig muß mehr getan werden, um möglichst viele Zuschauer (lies: Geld) heranzuholen. Die Werbung der Spitzenvereine war bisher wie im Mittelalter des Fußballsports. Man verließ sich auf die vorschaufreudige Presse, man klebte Plakate an Litfaßsäulen, die in ihrem Charakter seit 50 Jahren unverändert geblieben sind.
Auch hier wäre ein Wandel nützlich und daher empfehlenswert. Ihr Vereinsbosse, schaut euch doch mal im Ausland um, wie es da gehandhabt wird!
Besucht Vereine in England, in Italien, in Spanien!
Dort können wir alle noch viel lernen, was es heißt, eine Profiabteilung zu haben.
Nun Mut also zum morgigen Bundesligastart! Wir alle haben mitgeholfen, sie zu schaffen, wir werden auch jetzt vornean sein, wenn es gilt, die Hindernisse des ersten Saisonabschnitts zu beseitigen.
Herzlichst,
Ihre NRZ
Horst Gecks fuhr am nächsten Tag mit vier Fans aus Meiderich im Auto nach Karlsruhe. Der Außenstürmer stand nicht im Aufgebot. Das erste Bundesligaspiel wollte er sich jedoch nicht entgehen lassen. Er erhielt vom MSV zwei Eintrittskarten, die restlichen drei mussten sie kaufen, 6,50 Mark der unüberdachte Sitzplatz.
Es war das Schicksal der halben Mannschaft, beim Spiel nur Zuschauer zu sein. Es wurden nur elf Spieler benötigt. Zur Sicherheit reisten noch der zweite Torwart sowie ein defensiver und ein offensiver Ersatzmann mit, falls einer der elf Auserwählten erkranken oder auf der Hoteltreppe umknicken würde. Doch wenn nichts Unvorhergesehenes geschah, saßen diese drei beim Spiel dann auch auf der Tribüne. Auswechslungen waren verboten.
Schon länger wurde darüber debattiert, ob nicht wenigstens der Torwart bei einer schlimmen Verletzung ausgetauscht werden dürfte. Aber das würde doch die Reinheit des sportlichen Wettkampfes zerstören. Wenn sich der Torwart verletzte, ging er in den Sturm, wo er herumhumpelte, so gut es ging, und ein Feldspieler vertrat ihn im Tor. Als Heinz Höher einmal in einem Olympia-Qualifikationsspiel bei einem Foul das Schienbein aufgeschlitzt wurde, schrie ihn DFB-Trainer Georg Gawliczek an: Wenn du rausgehst, operiere ich dich, und zwar sofort hier auf dem Platz! Das Blut strömte aus Höhers Bein, aber er rannte weiter, das ganze Spiel, aus Angst vor Gawliczek.