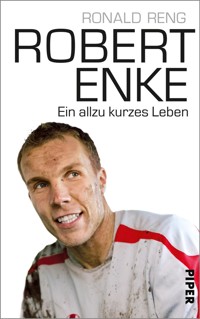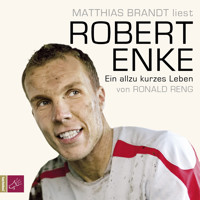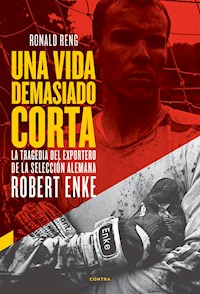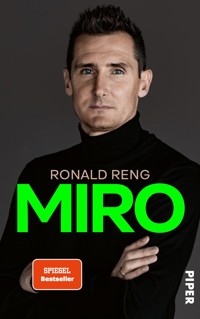13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Deutschland – Deutschland: ein historischer Moment Selten gibt es Augenblicke in der Geschichte, die wie ein Brennglas wirken. Das einzige Fußballspiel zwischen der DDR und der BRD ist ein solcher herausragender, brisanter und zugleich universaler Moment. Als sich am 22. Juni 1974 für neunzig Minuten die Bruderstaaten gegenübertraten und die DDR durch ein 1:0 von Jürgen Sparwasser den Sieg davontrug, brachten der Zufall und die Zeitläufte Menschen und Ereignisse zusammen, die Einfluss nahmen auf das Leben nicht nur der Beteiligten, sondern auf beide Länder und ihre Menschen. Davon erzählt Ronald Reng auf unvergleich fesselnde und kluge Weise. So wird sein Buch »1974« zu einem bestechenden Zeugnis gesamtdeutscher Alltagsgeschichte, lange bevor es ein wiedervereinigtes Deutschland geben sollte. O-Töne mit prominenten Zeitzeugen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
© Piper Verlag GmbH, München 2024Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, MünchenCovermotiv: WITTERSKonvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Text bei Büchern mit inhaltsrelevanten Abbildungen und Alternativtexten:
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Motto
PrologEine Büroklammer im deutschen Gedächtnis
1 Netzer
2 Haben Sie Spione zu den Spielen geschickt?
3 Dia-Abend
4 Radikal
5 Die Globalisierung schaut kurz vorbei
6 Keine Macht für Niemand
7 In der Haarmode einig Vaterland
8 Netzer? Overath!
9 Die alltäglichen Dinge der Weltrevolution
10 Im Rosenkeller
11 Die berauschenden Tastenschläge der Schreibmaschine
12 Schweinskopfsülze mit Ei
13 Rufe nach dem Heiland werden laut
14 Overath? Netzer!
15 Die unerträglich schöne Unberechenbarkeit des Spiels
16 André from Germany
17 Der gekreuzigte Karl Marx
18 Die kleinen Nilgänse starten ins Leben
19 Während die einen schlafen
20 Tolstoi ändert alles
21 Titos Geschenk
22 Die Abwesenheit von Rache
23 Natürlich Elfmeter
Epilog Ein Augenblick in ihrer Zeit
Anhang
Verwendete Literatur
Zeitungs- und Zeitschriftenarchive
Fernsehdokumentationen und -filme
Interviews
Bildnachweis
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Widmung
Für Theo, geboren 2006, der mich zu diesem Buch inspirierte, als er sagte: »Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es mal zwei deutsche Staaten gab.«
Und für Clara, geboren 2011, die fragte, von welcher Mauer ich rede
Motto
Ja. Man wird uns vergessen. Das ist unser Los, das lässt sich nicht ändern. Alles, was wir für ernst, bemerkenswert und wesentlich halten, wird mit der Zeit vergessen sein oder unwichtig erscheinen. Und das Interessante daran ist, dass wir jetzt überhaupt noch nicht wissen können, was man in Zukunft einmal bedeutend und wichtig nennen wird und was gering und lächerlich.
Anton Tschechow
PrologEine Büroklammer im deutschen Gedächtnis
Auf der anderen Seite der Gefängnismauer steht ein Kastanienbaum, das ist ihm schon in den ersten Tagen aufgefallen. Als Jugendlicher war er bei den christlichen Pfadfindern, sie verbrachten die Wochenenden im Wald, beobachteten die Vögel, und wenn sie eine Amsel mit Wurm im Schnabel sahen, versuchten sie, ihren Flug zu verfolgen, um das Nest zu entdecken und zu fotografieren. Der Blick für die Natur ist ihm geblieben.[1]
Manchmal fliegen Spatzen vor seinem Fenster über die Gefängnismauer, die Spatzen fliegen hier einfach rein und raus. Die Spatzen sind eine Sensation für Klaus Jünschke. Sie sind, neben dem Kastanienbaum und den Gefängniswärtern, an vielen Tagen das einzige Lebendige, das er sieht.
Das Fenster seiner Zelle ist direkt auf die Gefängnismauer der Justizvollzugsanstalt Zweibrücken gerichtet. Es ist eigentlich ein großes Fenster, dreiteilig, aber das Fenster macht Klaus Jünschke verrückt. Es lässt sich nicht aufreißen. Nur der Mittelteil kann einen Spalt weit gekippt werden.[2] Wenn er daran denkt, überkommt ihn wieder die Atemnot. Die Luft reicht nicht, wenn das Fenster nur wenige Zentimeter gekippt ist, glaubt er, die verbrauchte Luft kann doch durch den kleinen Spalt gar nicht abziehen. Er hat sich oft mit seinem Verstand gegen die Gedanken zu wehren versucht, dreh nicht durch, Klaus, hat er sich zuzureden versucht, aber die Gedanken waren stärker. Luft! Luft, Luft, Luft! Ich ersticke hier, ich gehe hier kaputt. Dann beginnt sein Herz zu rasen, und irgendwann rast alles, in ihm, um ihn herum, kein Gedanke lässt sich mehr zu Ende denken, die Gedanken rasen einfach davon, rasen um ihn herum. Luft! Luft!
Einmal hat er eine Colaflasche genommen und das Zellenfenster damit eingeschlagen.[3]
Die Cola bringt ihm gelegentlich heimlich ein Wärter, der es gut mit ihm meint, Berner. Ob Berner einfach aus Mitleid oder aus politischen Sympathien handelt, kann Klaus Jünschke nicht sagen. Einen Tag nachdem er das Fenster eingeschlagen hatte, als er endlich Luft bekam, erschienen zwei Glaser unter Aufsicht der Wärter und setzten eine neue Scheibe ein.
Bald werden es zwei Jahre sein, seit er hier ist. Am 8. Juli 1972 haben sie ihn geschnappt. Er hatte ehrlich gesagt nur noch auf seine Verhaftung gewartet, nachdem Andreas Baader und Ulrike Meinhof und fast alle anderen nacheinander im Juni 1972 gefasst worden waren. Er hatte weitergemacht und gleichzeitig gewusst, es war vorbei.
Die Fragen kommen: Was hast du getan? Wie bist du da reingeraten? War das nicht alles ein Irrsinn? Aber die Antworten lassen sich hier drin, mit dem Kastanienbaum auf der anderen Seite der Mauer, nicht zu Ende denken. Jedes Mal, wenn das Nachdenken beginnt, kommen der Trotz und auch die Verunsicherung: Zweifelst du nur an deinem Weg, weil die Schweine dich mit der Isolationshaft in die Enge treiben, weil sie dich umzudrehen versuchen?
Isolationshaft, das Wort haben er und seine Mitstreiter von der Roten Armee Fraktion geprägt. »Strenge Einzelhaft« ist der behördliche Terminus. So wie die Staatsanwälte und Politiker auch nicht »Rote Armee Fraktion« sagen, sondern »Baader/Meinhof-Bande«. Die einen wollen glauben machen, sie seien Teil einer weltweiten Befreiungsarmee. Die anderen wollen klarmachen, das ist nur eine miese kriminelle Bande. Um Ausdrücke, um Sprache wird leidenschaftlich gerungen, 1974. Was die strenge Einzelhaft beziehungsweise Isolationshaft betrifft, so wurde sie angeordnet, um jegliche Kommunikation der gefangenen Terroristen untereinander und mit ihren noch flüchtigen Mitstreitern zu unterbinden. Die Zellen neben und über Klaus Jünschke wurden geräumt, damit er niemandem etwas durch das Fenster zurufen konnte.
Eine Stunde Hofgang am Tag steht ihm zu, zunächst war es nur eine halbe Stunde gewesen.[4] Wenn er rausgeht, wird dafür gesorgt, dass der Hof menschenleer ist. Der zuständige Ermittlungsrichter Wolfgang Strack am Amtsgericht Kaiserslautern gestand Jünschke im Herbst 1973 zu, auf seinem Hofgang von einem einzelnen, von der Anstaltsleitung ausgewählten Mitgefangenen begleitet zu werden. Jünschke weigerte sich, die vermeintliche Lockerung anzunehmen. Er wolle keine Almosen, sondern wie alle anderen Gefangenen auch behandelt werden. Vor dem Haus von Strack deponierten RAF-Unterstützer eine Bombe. Sie konnte entschärft werden.
Zum ersten Mal sieht sich die junge Bundesrepublik in ihrem Innersten bedroht. Mit aller Härte bekämpfe man die Terroristen am besten, selbst wenn sie schon im Gefängnis sitzen, glauben Regierung und Justiz. Teile der bundesdeutschen Zivilgesellschaft erkennen ihren Staat nicht wieder. »Die Isolierung ist in ihrer Konsequenz als psychische Zerstörung der Häftlinge anzusehen«, hieß es im Juni 1973 in einer Resolution, die kein RAF-Sympathisantenkomitee verabschiedete, sondern der Deutsche Evangelische Kirchentag.[5]
Von psychisch zermürbender Vereinsamung könne im Fall Jünschke keine Rede sein, argumentiert Ermittlungsrichter Strack. Zu seiner Familie und zu seinen Anwälten ist dem Gefangenen selbstverständlich der Kontakt gestattet. Klaus Jünschke darf seine Angehörigen zweimal im Monat sehen, jeweils eine halbe Stunde.
Sie nehmen dann an den gegenüberliegenden Seiten des Tisches im Besucherzimmer Platz. Direkt hinter Jünschke sitzen in der Regel zwei Justizvollzugsbeamte, direkt hinter dem Besuch zwei Polizisten. Die Uhr läuft, und dann sollen sie sich unterhalten. Sich zu berühren ist nicht gestattet. Dabei könnte Jünschke heimlich ein Zettel oder Hehlerware zugesteckt werden. Zur Sicherheit muss sich Jünschke vor und nach jedem Treffen vor den Wächtern komplett ausziehen, damit sie seine Kleidung durchsuchen können.
Gestern, am 21. Juni 1974, war seine Verlobte Elisabeth von Dyck zu Besuch in der Justizvollzugsanstalt Zweibrücken.[6] Natürlich sind sie nicht wirklich verlobt. Sie haben sich damals an der Uni in Heidelberg über solche Rituale lustig gemacht. Nun haben sie ihre Verlobung erfunden, damit Elisabeth zu seiner Familie gezählt wird. Sonst dürfte sie ihn nicht im Gefängnis besuchen.
Der Kleinkrieg um seine Rechte nimmt einen guten Teil von Klaus Jünschkes Zeit in Anspruch. Das verstärkt einerseits das Rasen in ihm. Andererseits gibt es ihm etwas zu tun. Klaus Jünschke schreibt Briefe an die Anstaltsleitung und verschiedene Gerichte, alle Wörter kleingeschrieben. Die unorthodoxe Rechtschreibung soll die revolutionären Absichten der RAF symbolisieren. Andere revolutionäre Zellen überall auf der Welt kämpfen ja weiter, die Brigate Rosse in Italien, die Tupamaros in Uruguay, die Nihon Sekigun in Japan; sie teilen ihre Ziele, glaubt Klaus Jünschke. Es geht darum, das Kapital neu zu verteilen, die Großgrundbesitzer und Konzerne zu enteignen, um die Armen am Besitz zu beteiligen. Aber jetzt im Gefängnis geht es in den Briefen mit durchweg kleingeschriebenen Worten darum, ob er sich rasieren muss oder nicht. Die Hausordnung verlangt von den Gefangenen eine glatte Rasur. Klaus Jünschkes Einspruch dagegen wurde vom Amtsgericht abgelehnt. Er wurde zwangsrasiert. Vier Justizvollzugsbeamte hielten seinen Kopf, Arme und Beine fest, die Hände steckten bereits in Handschellen. Die vier Beamten schoben seinen Kopf fest nach hinten, während ein fünfter seinen Bart abrasierte und Jünschke schrie und spuckte, weil der Mund das Einzige war, was er noch bewegen konnte.[7]
Es gab auch kleine Siege. Seit dem 1. März 1974 erhält Klaus Jünschke die Zeitungen ohne Löcher. Das hat er gerichtlich durchgesetzt. Vorher waren alle Artikel mit Bezug zur RAF entfernt worden. Die Berichterstattung könnte Jünschkes Aussagen bei dem noch ausstehenden Strafprozess beeinflussen, fand Ermittlungsrichter Strack. Es musste eine fast schon kunstvolle Arbeit gewesen sein, die Artikel auszuschneiden, ohne die ganze Zeitungsseite zu zerstören; erst mit der Schere vorsichtig an einer Ecke des RAF-Berichts in das Papier stechen, dann die Schere langsam drehen und schneiden.
Klaus Jünschke hat vier Tageszeitungen abonniert, die Rheinpfalz, die Süddeutsche Zeitung, die Frankfurter Rundschau und die Neue Zürcher Zeitung. Dazu die Wochenzeitung der westdeutschen Kommunisten, Unsere Zeit, den Spiegel und eine satirische Monatsschrift namens Pardon, die sich über alles, was in der Bundesrepublik nach Macht riecht, lustig macht. Er bezahlt die Abonnements mit Geld, das ihm RAF-Sympathisanten überweisen. Manchmal, wenn das Rasen ihn in Ruhe lässt, schafft er es sogar, sich damit auseinanderzusetzen, was er da liest.
Am Tag nach Elisabeths Besuch, einem Samstag, sind die Beziehungen beider deutscher Staaten mal wieder das große Thema in den Blättern. Die Besuche bundesdeutscher Bürger in der DDR sind in den ersten fünf Monaten des Jahres offenbar um rund 40 Prozent eingebrochen, nachdem die Regierung der DDR im November 1973 den Mindestumtausch für »Besucher aus dem nicht-sozialistischen Ausland« von 5 auf 20 DM erhöht hatte. Und in Hamburg findet im Rahmen der Weltmeisterschaft zum ersten Mal ein Fußballspiel zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik statt.
Der Trainer der bundesdeutschen Nationalelf, Helmut Schön, hat aus diesem Anlass am Vortag mit der Presse über ein »viel diskutiertes Problem« gesprochen, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet. Es ging dabei allerdings nicht um die Beziehung zum anderen deutschen Staat, sondern zum anderen Geschlecht: »Wenn Spielerfrauen oder Spielerbräute zu uns ins Trainingslager kommen, um mit ihren Männern zu sprechen, werde ich natürlich nichts dagegen haben«, sagte Schön. »Darüber hinausgehende Kontakte sind allerdings nicht im Sinn dieser Weltmeisterschaft.« Darüber hinausgehende Kontakte? Redete er von Liebe und Sex?! Mit dem Thema gingen die jungen Leute seit ein paar Jahren doch deutlich offener um.
Klaus Jünschke ist kein Fußballfan. Als Kind ist er zu Hause in Mannheim ein paarmal zu Spielen des SV Waldhof mitgegangen, einfach weil es ihm gefiel, dabei zu sein, wenn etwas los war. Seit die Weltmeisterschaft läuft, hat er im Gefängnis einen neuen Ton entdeckt. Praktisch jeden Tag erklingt plötzlich, mit Urgewalt, ein vielstimmiger Schrei, den er selbst in seiner abgeschotteten Zelle hört. Er hat nicht lange gebraucht, um zu kombinieren, worum es geht. Ein Tor ist gefallen. Er mag den Schrei, es steckt nicht nur brachiale Kraft, sondern vor allem Freude, fast Ekstase darin. Ein kurzes Zeichen von Leben.
Vielleicht werden sie an diesem Samstag wieder schreien.
Mehr verbindet Klaus Jünschke nicht mit diesem Fußballspiel beider deutscher Staaten. Er weiß nicht, dass es bei dem Spiel in Hamburg auch um ihn geht.
Er wird es erst 50 Jahre später, im Rahmen der Recherchen zu diesem Buch, erfahren.
Am Tag vor dem Spiel, Freitag, dem 21. Juni, geht um 17.55 Uhr ein Aktenvermerk an vier Hamburger Polizeistellen, die rund um das Weltmeisterschaftsspiel im Einsatz sind.
»Mitteilung von K4 (Feske): Der zur Zeit in Zweibrücken einsitzende JÜNSCHKE, Mitglied der Baader-Meinhof-Bande, hatte heute Besuch von seiner Verlobten. Das Gespräch zwischen den beiden ist mitgehört worden. Darin hat sich J. darüber enttäuscht gezeigt, daß bisher im Rahmen der WM von den Raketen kein Gebrauch gemacht worden sei.
Er hoffe, daß von dem vorgesehenen Plan nicht abgegangen werde.
Über die Ernsthaftigkeit kann K4 nichts sagen.«[8]
Die Polizei behält ihre Erkenntnisse für sich. Es soll keine Unruhe geschürt werden. Tatsächlich ist das Spiel zwischen der Bundesrepublik und der DDR vor dem Anpfiff am 22. Juni 1974 in vielen Hinterköpfen präsent und in manchen Akten vermerkt, aber es hält gewiss keine Nation in Atem. Es ist ein Vorrundenspiel. Die Bundesrepublik ist nach zwei Siegen in den vorausgegangenen Gruppenspielen bereits für die nächste Runde qualifiziert. Von der DDR-Mannschaft, die zum ersten Mal an einer Weltmeisterschaft teilnimmt, wird nicht so viel erwartet. Selbst Terrorbedrohungen sind nichts Neues mehr, und, mal unter uns, auf diesen Aktenvermerk braucht man auch nicht viel zu geben, denn Raketen hat die RAF sicher nicht. Oder doch?
Trotz dieser Unaufgeregtheit wird es eines jener Fußballspiele werden, die ewig leben.
Manche Fußballpartien prägen sich wegen ihres wundersamen Verlaufs ins kollektive Gedächtnis einer Nation oder sogar der halben Welt ein. Der 7:1-Sieg der deutschen Nationalmannschaft im WM-Halbfinale 2014 über Brasilien ist solch ein Spiel. Völlig undenkbar, völlig irre war es, dass Brasilien, die erfolgreichste Fußballnation der Welt, von einem Gegner mit frecher Eleganz dermaßen bloßgestellt wurde. Das Spiel Bundesrepublik gegen die DDR dagegen überdauert nicht als sportliches Ereignis, sondern als ein nationaler Erinnerungspunkt, eine Büroklammer im deutschen Gedächtnis, die all die geschichtlichen Ereignisse und den Alltag jener Zeit zusammenhält. RAF-Anschläge. Die Entspannungspolitik zwischen Ost und West. Aber Selbstschussanlagen an der innerdeutschen Grenze. Der Siegeszug der Vorortsiedlungen. Jeans für das Volk. Ein DDR-Spion im Kanzleramt. Gastarbeiter, die bleiben. Frauen neben Männern im Beruf. Ein Recht auf Abtreibung. Ein Theaterstück als Schrecken der Sozialistischen Einheitspartei. Und natürlich: Günter Netzer.
All diese Erinnerungen hängen an dem Spiel, dem einzigen Mal in der Geschichte, dass die zwei deutschen Staaten auf höchstem Niveau gegeneinander Fußball spielten.
Der 22. Juni 1974 gehört in die Zeit, in der das vermeintlich Unnatürliche Normalität geworden ist: Deutschland ist in zwei Staaten geteilt. Niemand, den ich für dieses Buch sprach, konnte sich 1974 eine andere Realität vorstellen. Deutschland war geteilt, und das würde in ihrer Lebenszeit auch so bleiben. Der Status quo der Welt mit den konkurrierenden Systemen Kapitalismus und Sozialismus, mit den sich feindlich gegenüberstehenden Hegemonialmächten USA und Sowjetunion sowie jeweils einem deutschen Staat auf jeder Seite schien zementiert. Die Entspannungspolitik der Bundesregierung, die DDR nicht mehr zu verteufeln, sondern pragmatische Beziehungen anzustreben, war faktisch die Anerkennung, dass es zwei deutsche Staaten gab. 1973 waren Bundesrepublik und DDR daraufhin der UNO beigetreten. Die Teilung war amtlich besiegelt.
Dass ein Fußballspiel als zeitgeschichtliche Klammer für diese Epoche taugt, wäre Historikern in jenen Siebzigerjahren wohl frevelhaft erschienen. Denn damals war ein Fußballspiel meistens einfach ein Fußballspiel. Der Sport hatte seine Anhänger, aber auch seine entschiedenen Gegner, sodass sich kaum von einem Ereignis für die gesamte Gesellschaft sprechen lässt, wie es vierzig Jahre später die Partie Brasilien gegen Deutschland sein sollte. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die angesehenste Zeitung der alten Bundesrepublik, spürte deshalb gar den Drang, sich für ihre kompetente WM-Berichterstattung bei den Lesern öffentlich zu entschuldigen: »Der Entschluss, dem großen Sportfest in dieser Zeitung so viel Raum zu geben, ist uns nicht leichtgefallen.«[9]
In der DDR wurde Fußball von einem Teil der Bevölkerung ähnlich wie in der Bundesrepublik geliebt, aber von der Regierung misstrauisch beäugt. Sporterfolge sollten die Überlegenheit des Sozialismus über den Kapitalismus demonstrieren; dass Sportler für sich selbst siegten, »das kann ja wohl nicht Sinn und Zweck der Sache sein«, erklärte der ranghöchste DDR-Sportpolitiker, Manfred Ewald, Präsident des Deutschen Turn- und Sportbundes.[10] Aber diese Fußballer machten – anders als die Ruderer oder Leichtathleten – zu sehr, was sie wollten. Kassierten wohl Schwarzgeld von lokalen sozialistischen Betrieben, als wären sie im Kapitalismus, und »sehen bei dieser Lage keinen Grund, sich zur eigenen Weiterentwicklung besonders anzustrengen. Diese Tendenz zeigt sich auch bereits bei jüngeren Spielern wie Kreische, Irmscher, Löwe, Sparwasser«, hieß es Ende 1969 in einem Informationsschreiben aus Ewalds Büro an die Regierung der DDR.[11] Fußballer waren aus sozialistischer Sicht unsichere Kandidaten. Man musste vorsichtig sein, dem Fußball nicht zu viel Bedeutung zu geben.
Wenngleich Fußball also 1974 nicht die gesellschaftliche und politische Relevanz wie 50 Jahre später besaß, so scheint mir das Spiel der Deutschen am 22. Juni in Hamburg doch geradezu prädestiniert, an ihm Zeitgeschichte zu erzählen. Denn es war ein einmaliger Moment, der die Menschen im geteilten Deutschland kurz verband, ohne dass sie wirklich vereint waren.
Und tatsächlich, das Spiel ist an diesem Abend an den unwahrscheinlichsten Orten präsent, ganz im Westen, nur 40 Kilometer vor der französischen Grenze, in einer Gefängniszelle in Zweibrücken, genauso wie im Herzen des Ostens, in der Schumannstraße in Ost-Berlin, wo just zur selben Uhrzeit, als in Hamburg die Zuschauer das Volksparkstadion füllen, das Publikum ins hell erleuchtete Deutsche Theater strömt.[12]
Hinter der Bühne, in der Frauen-Garderobe, wurde schon öfter über Fußball geredet. Genauer gesagt darüber, wie gerne sich Bummi Fußballspiele im Fernsehen ansieht. Bummi ist der Kater von Elfriede Née. Ein Riesenviech, aber das darf man der Née natürlich nicht sagen. Nichts gegen Bummi, das haben die anderen Schauspielerinnen am Deutschen Theater schon verstanden.
Elfriede Nées Nachbarn draußen in Berlin-Biesdorf, fast schon in Brandenburg, hassen Bummi, weil er in den Gärten Singvögel reißt. Sie solle ihm ein Glöckchen um den Hals binden, damit die Vögel vor ihm gewarnt würden, hat ein Nachbar die Née aufgefordert. Sie hat es mit gebührend theatralischer Entrüstung in der Frauen-Garderobe erzählt. »Ich bitte Sie«, hat sie zu Jutta Wachowiak gesagt, »wenn Sie eine Amsel wären, würden Sie zu Fuß durch den Garten gehen?«
Darüber hatte Jutta Wachowiak noch nicht nachgedacht. Was sie als Amsel machen würde.
Klar scheint jedenfalls, was Bummi an diesem Abend macht. Elfriede Née hat ihm doch hoffentlich wie gewohnt den Fernseher eingeschaltet, bevor sie ins Theater fuhr. Bis zum Anpfiff ist noch ein wenig Zeit, aber Bummi wird es schon merken, wenn das Spiel beginnt. Er wird nachher nur nicht wissen, wie es ausgegangen ist, denkt Jutta Wachowiak.
Wenn sie an das Spiel denkt, spürt sie eine undefinierte Erwartung. Was wird da passieren? Es ist der Kitzel des Neuen, der sich in ihr regt. Dass es so etwas jetzt gibt, dass so etwas endlich möglich ist, dass die DDR und die BRD sich in einem Fußballspiel treffen.
Es ist natürlich Zufall, dass die beiden deutschen Staaten bei der Weltmeisterschaft in eine Gruppe gelost wurden. Doch kann solch eine Begegnung wirklich nur Zufall bleiben in einer Zeit, in der die bundesdeutsche SPD mit Willy Brandt und Egon Bahr an der Spitze ihre Entspannungspolitik zur DDR gegen alle Widerstände verwirklicht hat? Für Jutta Wachowiak ist das der einzige Weg: sich näherkommen. Deshalb hat dieses Spiel für sie eine schöne Symbolik.
Wie das Spiel ausgeht, ist ihr nicht wichtig. Fußball ist etwas für Männer, findet sie, 1974. (Und für einen Kater.)
Die Techniker in der Requisite werden fluchen und grummeln, dass sie an so einem Abend, bei diesem Spiel, im Theater arbeiten müssen!
Es gibt so viele Fragen vor diesem Spiel, natürlich auch hier: Wird Netzer diesmal in Szene treten? Wird er diesmal zumindest eingewechselt?
Selbstverständlich haben sie Netzer auch in der DDR schon im Fernsehen gesehen. Aber ihn gegen unsere Jungen zu sehen, das wäre wohl noch einmal etwas anderes; eine andere Nähe.
Es ist ein Spiel, von dem Reporter sagen: Das ganze Land sieht zu. Doch in den Kammerspielen am Deutschen Theater in Ost-Berlin machen Jutta Wachowiak, Dieter Mann, Elfriede Née und die anderen an diesem Abend, was sie seit einer gefühlten Ewigkeit machen. Sie führen Die neuen Leiden des jungen W. auf. Vor anderthalb Jahren, am 17. Dezember 1972, lief die Premiere in den Kammerspielen. Seitdem spielen sie das Stück wieder und wieder. 304-mal werden Die neuen Leiden schlussendlich am Deutschen Theater dargeboten.[13] Jede einzelne Aufführung ist ausverkauft. Die Erregung des Publikums lässt nicht nach. Dass es so etwas jetzt gibt; dass so etwas jetzt möglich ist.
Die Bühne der Kammerspiele ist ungewöhnlich niedrig. Allenfalls 50 Zentimeter, schätzt Jutta Wachowiak, steht sie über den 400 Zuschauern. Das scheint sie auf besondere Art mit dem Publikum zu verbinden. Sie begegnen sich, fast, auf einer Ebene. Nicht nur die Theatergäste schauen der bewunderten Schauspielerin gebannt zu, wie sie die weibliche Hauptrolle, die Charlie, gibt. Gleichzeitig lauscht Jutta Wachowiak dem Publikum. Das geschieht instinktiv, auf einer zweiten, parallelen Ebene, während sie mit voller Hingabe spielt.
Sie kann die Aufregung des Publikums zu Beginn des Stücks spüren. Als ob die Leute fürchten, die entscheidenden Anspielungen auf ihren Staat zu überhören, denn die werden doch wohl zwischen den Zeilen versteckt sein, anders geht es ja nicht bei ihnen. Was, wenn sie nach der Aufführung aus dem Theater kommen und sich eingestehen müssen, ich hab’s nicht gehört, ich hab’s nicht verstanden?
Es ist kein Fachpublikum, nicht in dem Sinne, dass da mehrheitlich Leute sitzen, die sich tiefer mit den epischen Elementen bei Bertolt Brecht oder Kants Einfluss auf Schillers Dramen beschäftigt haben. Im Sozialismus soll jeder Zugang zur Bildung haben, und das ist tatsächlich zu einer Errungenschaft der DDR geworden, findet Jutta Wachowiak. Zwölf Millionen Eintrittskarten haben die Theater der DDR im zurückliegenden Spieljahr 1973 verkauft, bei 17 Millionen Einwohnern. Größere Gruppen Betriebsausflügler kündigt Frau Müller vom Kartenverkauf des Deutschen Theaters ihren Schauspielern lieber vorher an. Jutta Wachowiak kommt es vor, als klinge dann immer ein »Achtung!« in Uschi Müllers Worten: Heute sitze eine Brigade des Volkseigenen Betriebs Elektrokohle Lichtenberg im Publikum. Falls da während der Aufführung irgendwelche merkwürdigen Geräusche zu hören seien, ein irritiertes Flüstern etwa oder ein Knarzen vom Auf-dem-Stuhl-Herumrutschen.
Für Jutta Wachowiak ist das stets ein Ansporn: auch für diese Menschen zu spielen. Mit 15 machte sie eine Ausbildung zur Stenotypistin und Sekretärin, das schien ihre Zukunft. Sie war 1,42 Meter groß, mit 15 Jahren. Eine verschleppte Tuberkulose wohl. Wie groß sie 1974 mit 34 ist, bleibt selbstverständlich unbekannt. Eine Grande Dame des Theaters muss ihre Geheimnisse haben.
Und dann irgendwann, eigentlich bei jeder der 304 Aufführungen der Neuen Leiden, lacht das Publikum. Befreit kommt das Lachen Jutta Wachowiak vor. Die Leute, versteht sie, sind einfach glücklich, weil Dieter Mann in der Hauptrolle als Edgar Wibeau ausspricht, was sie fühlen, weil dieser Edgar es quasi für sie endlich einmal laut sagt: wie sehr die permanente Bevormundung der Sozialistischen Einheitspartei nervt. »Wenn einer gleich ein Wüstling oder Sittenstrolch sein soll, weil er lange Haare hat, keine Bügelfalten, nicht schon um fünf aufsteht und sich gleich mit Pumpenwasser kalt abseift.«
Die Klagen des 17-jährigen Edgar Wibeau sprechen Leser überall auf der Welt an. Ob in Japan oder Polen, dieses jugendliche Auflehnen gegen gesellschaftliche Verhaltensnormen kommt jedem bekannt vor. So werden Die neuen Leiden des jungen W. des Ost-Berliner Autors Ulrich Plenzdorf ein Welterfolg. In mehr als 20 Sprachen erscheint der Roman. Allein auf der anderen Seite der Grenze, in der Bundesrepublik, werden bis Mitte der Achtzigerjahre 1,3 Millionen Exemplare verkauft.[14] Literarisch ist das Werk eine Entdeckung. Edgar W., der die Lehre schmeißt, aus der Provinz ausbricht und in Berlin in einer Gartenlaube nächtigt, spricht eine völlig neue, bezaubernd schnoddrige Sprache. »Alle forzlang kommt doch einer und will hören, ob man ein Vorbild hat und welches, oder man muß in der Woche drei Aufsätze darüber schreiben. Kann schon sein, ich habe eins, aber ich stell mich doch nicht auf den Markt damit.«
Da denken Jugendliche 1974 in Italien, Finnland oder der Bundesrepublik, Edgar W. spreche für sie. Aber in der DDR versteht wohl kaum jemand das Werk als universelle Darstellung eines rebellierenden Jugendlichen. Plenzdorf ist ein Autor der DDR, das Stück spielt in der DDR; »jeder«, denkt Jutta Wachowiak, »jeder in der DDR« empfinde den Ausbruch des Edgar W. aus der Gesellschaft als ein Auflehnen gegen die Allmacht und Willkür der Partei.
Mit ihrem Plan, eine klassenlose, gerechtere Gesellschaft aufzubauen, ermöglicht die Sozialistische Einheitspartei nicht nur breiten Schichten Theaterbesuche. Sie versucht, Menschen zu erziehen. Wer die Jugendweihe verweigert, den Schwur auf den sozialistischen Staat, wird nicht zum Abitur zugelassen. Das Mitmarschieren bei den Parteiparaden am 1. Mai wird in den Betrieben und Schulen angeordnet. »Ich hatte nichts gegen Lenin und die«, sagt Edgar W. auf der Bühne, »ich hatte auch nichts gegen den Kommunismus und das, die Abschaffung der Ausbeutung auf der ganzen Welt. Dagegen war ich nicht. Aber gegen alles andere. Daß man Bücher nach der Größe ordnet zum Beispiel.«[15] Wer bitte in den ausverkauften Kammerspielen des Deutschen Theaters wollte bei diesem Satz nicht gleichzeitig lachen und die Luft anhalten? Bücher der Größe nach ordnen. So eine Anweisung könnte denen in der Partei auch bald einfallen.
Die Frage war, wie es so etwas jetzt geben konnte, wie so ein Theaterstück jetzt möglich war. Wie waren Die neuen Leiden des jungen W. durch die Zensur gekommen? Jedes Bühnenstück oder Buch in der DDR musste vom Ministerium für Kultur eine Druckgenehmigung erlangen. Wie war Plenzdorfs Stück da durchgekommen? War das vielleicht sogar ein Zeichen, dass die Politik unter dem neuen Staatschef der DDR Erich Honecker toleranter wurde? Das vermochte 1974 niemand zu sagen. Vielleicht konnte irgendwer in einem Buch fünfzig Jahre später oder so der Sache nachgehen.
Hinter der Bühne, in den Garderoben, reden sie mit Natürlichkeit über die Zensur. Bei dem und dem Drama sei noch ein Dialog geändert worden, bei jenem Spielfilm habe der Regisseur doch noch eine Szene retten können.
Jutta Wachowiak hat sich an solche Nachrichten gewöhnt. Man regt sich unter Kollegen in der Garderobe oder Kantine darüber auf, und dann sind sie schon beim nächsten Thema, dass Dieter Mann offenbar eine neue Verehrerin oder eine Was-weiß-ich hat, beim Reisebüro der DDR. Irgendwas haben ja immer alle, denkt Jutta Wachowiak. Dann muss sie an den meisten Tagen schon los, sie dreht tagsüber Spielfilme in den volkseigenen Filmstudios Babelsberg, abends die Theateraufführung, dazwischen schnell nach Hause in die Binzstraße zu ihrer zweijährigen Tochter Anja und ihrem Mann. Und immer meldet sich das schlechte Gewissen: Du solltest bei Anja sein, du solltest mehr Zeit mit Klaus verbringen, ruft es, wenn sie am Theater ist. Ich will ans Theater, brüllt es, wenn sie zu Hause in der Wohnung ist.
Für Juli 1974 hat sie einen Urlaub mit ihrem Mann auf der Krim gebucht. So einen Urlaub zu kriegen ist ein Geschenk in der DDR. Über die Bekannte oder die Was-weiß-ich von Dieter Mann ging das. Den Urlaub brauchen ihr Mann und sie jetzt, fühlt Jutta Wachowiak. Ihr Mann ist so ein toller Vater, sagen die Freunde. Ja, denkt sie: Wenn ich nicht aufpasse, liebt er das Vatersein bald mehr als mich.
Ihr Leben 1974 ist ziemlich voll und ziemlich gut. Sie hat doch nicht Zeit, jeden Tag daran zu denken, dass sie hinter einer Mauer lebt.
Geschichte wird oft von oben erzählt, anhand der Machthaber und des politischen Systems eines Staates. So wurde die DDR nach wissenschaftlichen Kriterien als Diktatur definiert. Es gab keine wirkliche Gewaltenteilung, kein frei gewähltes Parlament, keine unabhängige Justiz. Menschenrechte wie die Meinungsfreiheit, Reisefreiheit, teilweise die Berufsfreiheit und die politische Betätigung waren eingeschränkt. Das bekannteste Wahrzeichen der DDR im Ausland war die Mauer. Aber sehr viele Menschen, die in der DDR lebten, fühlen sich instinktiv verletzt, wenn ihnen so pauschal an den Kopf geworfen wird, ihre Heimat sei eine Diktatur gewesen. Solch einen düsteren, grausamen Rahmen verbinden sie nicht mit ihrem eigenen Leben.
Denn die meisten Menschen sind, egal, in welches politische System der Zufall sie gesetzt hat, vor allem damit beschäftigt, ihr Leben zu leben.
Geschichte wird greifbarer, wenn die wissenschaftlichen Analysen durch die Geschichten individueller Menschen ergänzt werden. An persönlichen Lebensgeschichten lässt sich erkennen, welche Auswirkungen der staatliche Rahmen hatte und welche nicht; wie unterschiedlich Menschen nicht nur in verschiedenen Staaten, sondern auch in ein und demselben System lebten. Zeitzeugen geben der Geschichte, was nur Menschen vermögen: Sie füllen sie mit Leben.
1 Netzer
Es wurde im Aktuellen Sportstudio des ZDF zunächst nicht verraten, wer dieser Zwölfjährige war. Im Hintergrund ein stolzer Fußballvater. [1]
In einem Garten mit blühenden Obstbäumen auf dem Bonner Venusberg hatte Günter Netzer während der Weltmeisterschaft unverändert große Auftritte. Netzer passte den Fußball mit dem Außenrist auf Müller, auf Beckenbauer, auf Overath, Netzer ging explosiv ins Dribbling, eine Finte hier, eine Körpertäuschung da. Netzer schoss. Die Stimme des Kommentators, der das alles lautstark verkündete, geriet gelegentlich wohl ein wenig außer Atem, denn der Kommentator musste gleichzeitig Netzer, Müller, Beckenbauer sein. Manchmal löste er diese Aufgabe, indem er seinem eigenen Pass hinterherlief, um ihn anzunehmen. Er rannte als Netzer los und kam als Beckenbauer am Ball an. Manchmal dribbelte er einfach auf der Stelle. Netzers vielfältige heroischen Aktionen, von denen der Kommentator erzählte, existierten dann nur in seiner Fantasie.
Im Garten der Familie Brenke auf dem Venusberg stand vor dem 22. Juni 1974 fest: Der Bundestrainer musste Günter Netzer nur endlich spielen lassen, dann wäre der Sieg gegen die DDR sicher.
Wenn Herr Brenke abends mit seiner Aktentasche von der Arbeit in der Versicherung zurückkehrte, kam er manchmal kurz in den Garten, um seinem Sohn Andreas und dessen Freund Matthias bei ihren WM-Partien einen Blick zuzuwerfen. Sie spielten immer zu zweit, einer im Tor zwischen zwei Obstbäumen, der andere Netzer, Beckenbauer, Fernsehkommentator. Es war ihr Ritual. Es wäre fast schon merkwürdig gewesen, wenn Matthias bei passablem Fußballwetter nicht da gewesen wäre.
Ohne Ankündigung erschien Matthias an den meisten Tagen auf seinem Fahrrad. Kinder verabredeten sich nicht. Sie schauten einfach nach, ob der Freund da war. Matthias klingelte auch gar nicht mehr bei den Brenkes, er kannte den direkten Weg in den Garten, hinten herum, an der Garage vorbei, und dann war er einfach da. Er war zwölf, und die Brenkes boten ihm, was in seiner Vorstellung die anderen Kinder alle hatten: eine ganz normale Familie. Das war ja zum Beispiel auch ein üblicher Beruf, dem Herr Brenke nachging, Versicherungskaufmann, nicht so wie sein Vater. Bundeskanzler.
Wobei der Junge im Juni 1974 nicht genau wusste, was er neuerdings antworten müsste, falls er nach dem Beruf seines Vaters gefragt würde. Am 7. Mai 1974 war Matthias Brandts Vater als Bundeskanzler zurückgetreten.
Matthias war mit seiner Mutter auf der Rückfahrt von ihrem jährlichen Osterurlaub in Norwegen gewesen, als er an der jähen Stille der Erwachsenen im Auto erkannte, dass etwas Schlimmes passiert war. Eben noch hatten sie die Lieder im Autoradio mitgesungen, erzählte seine Mutter später, die Ausgelassenheit verweilte noch, als die Nachrichten im Radio kamen.[16]
Ein enger Mitarbeiter von Bundeskanzler Willy Brandt sei wegen Spionage für die DDR verhaftet worden, sagte der Nachrichtensprecher des Norddeutschen Rundfunks. Günter Guillaume habe als Brandts persönlicher Referent gearbeitet. Er solle dem Ministerium für Staatssicherheit der DDR vertrauliche Informationen aus dem Bundeskanzleramt zugeführt haben.
Die Stille nahm schlagartig den gesamten Raum im Auto ein.
Sie saßen zu dritt im Wagen. Fritz Sorg, Matthias’ liebster Personenschützer, begleitete ihn und seine Mutter. Nicht lange zuvor waren sie von der Fähre Oslo–Kiel gerollt, sie wurden von der Nachricht regelrecht begrüßt, willkommen zurück in Deutschland.
Erwachsenenprobleme waren das. Seine Mutter versuchte, sie von Matthias fernzuhalten.
Rut Brandt lag viel daran, ihrem Jüngsten genau wie ihren zwei anderen, mittlerweile erwachsenen Söhnen Peter und Lars eine unbeschwerte Kindheit zu ermöglichen. Tatsächlich konnte Matthias’ Freund Andreas auch einfach bei den Brandts zum Fußballspielen im Garten der Amtsvilla vorbeikommen. Manchmal war dort dann irgendein ausländischer Regierungschef mit gehörigem Tross zugegen. Dann grüßten Andreas und Matthias den halt kurz, ehe sie weiterspielten. Hätten sie bei einem Arbeitskollegen von Andreas’ Vater genauso gemacht.
Wie andere Kinder auch sollte Matthias, ordentlich frisiert und angezogen, nachmittags ab und an einem gebrechlichen Nachbarn beim Kuchenessen Gesellschaft leisten. Dass in seinem Fall dieser ältere Nachbar, Herr Lübke, einmal Bundespräsident gewesen war, machte keinen Unterschied. Wie die meisten älteren Nachbarn, zu denen Kinder zur Aufmunterung geschickt wurden, starrte Herr Lübke beim gemeinsamen Kuchenessen die meiste Zeit stumm auf seinen Teller.
Matthias’ Mutter kam aus Norwegen. Sie vermittelte ihren Kindern die skandinavische Idee einer Gesellschaft: Menschen aller Schichten sollten sich, ohne Hierarchiegehabe, auf gleicher Ebene begegnen. Ihr Mann schien diesem Gedanken einiges abgewinnen zu können. So wurde auch der Trainer der D-Jugend des Bad Godesberger Fußball-Vereins 08 von Willy Brandt völlig selbstverständlich über die Abwesenheit seines Sohnes in den Osterferien 1974 informiert; mal abgesehen davon, dass im Briefkopf des Schreibens stand: Bundesrepublik Deutschland. Der Bundeskanzler.
Darunter schrieb der Bundeskanzler dem Jugendtrainer:
»Sehr geehrter Herr Magka,
da Matthias in letzter Zeit viel krank gewesen ist, halten meine Frau und ich es für richtiger, die Osterferien zur Erholung und Kräftigung zu nutzen. Er wird also die von Ihnen vorgesehene Osterfahrt nicht mitmachen, sondern mit meiner Frau nach Norwegen reisen. Ich hoffe, Sie haben dafür Verständnis. Matthias wünscht aber allen Teilnehmern eine recht vergnügte Reise.
Mit freundlichen Grüßen, Willy Brandt.«[17]
Zwanzig Tage später, am Ende des Urlaubs, erschien der Brief wie ein Dokument aus einer vergangenen Zeit. Die Stille der Erwachsenen im Auto nach den Radionachrichten, kurz hinter Kiel am 24. April 1974, kündigte Probleme an.
Matthias Brandt kann 50 Jahre später nicht mehr sagen, wie viel er damals von der Staatsaffäre um den Spion verstand. Als Kind, glaubt er, spürte er vor allem Verunsicherung.
Wie ging es seinem Vater? Was würde mit seinem Vater passieren?
War jetzt das Leben, das er kannte, zu Ende? Wie würde es weitergehen?
Würde sein Vater mit ihm noch ein Weltmeisterschaftsspiel besuchen können, wie er es sich ausgemalt hatte?
Aus Erwachsenensicht verging erstaunlich wenig Zeit, bis die Situation nach der Enttarnung des DDR-Agenten Günter Guillaume klarer wurde.
Seit mindestens 14 Jahren stand Guillaume im Verdacht, für die DDR zu spionieren.[18] Am 1. Februar 1960 hatte der Verfassungsschutz der Bundesrepublik Geburtstagsglückwünsche der DDR-Staatssicherheit per Funk an einen »Georg« abgefangen. Der Geburtstag, recherchierten die Verfassungsschützer, passte auf Günter Guillaume. Er war 1956 als angeblicher DDR-Flüchtling mit 29 Jahren in Frankfurt am Main eingetroffen. Seitdem engagierte er sich in der Frankfurter SPD. Er fiel dort vielen auf, weil er die Organisationsarbeit fleißig, redlich, geradezu engstirnig erledigte und weil er leidenschaftlich über die äußere Linke der SPD schimpfte. Der Parteilinken rechneten sich in den Sechzigerjahren in der Frankfurter SPD-Spitze nahezu alle zu.
Guillaume war eben vom DDR-Sozialismus traumatisiert, erklärten sich die Kollegen seine Linkenphobie. Sie beschrieben ihn als SPDler des alten Schlags, ein Kleinbürger mit vehement nach hinten frisiertem Haar und zusammengekniffenen Lippen. Guillaume wurde im SPD-Unterbezirk Frankfurt als Geschäftsführer fest angestellt und organisierte den Wahlkampf für den lokalen Bundestagsbewerber Georg Leber mit großem Erfolg. Leber empfahl ihn in der Bundeszentrale der SPD. Unterdessen fing der Verfassungsschutz weitere Funksprüche der DDR-Staatssicherheit ab, die an Guillaume gerichtet schienen. Warum Guillaume trotzdem ungehindert 14 Jahre lang in der SPD Karriere bis hinauf ins Kanzleramt machen durfte, war eine gute Frage.
Man habe Guillaume bei der Arbeit observieren wollen, um Beweise für seine DDR-Geheimdiensttätigkeit zu sammeln, erklärte der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Günter Nollau. Man ließ einen Spion wissentlich bis zum Bundeskanzler vor? »So abgebrüht sind wir eben«, sagte Nollau.[19]
Oder waren sie einfach nur sorglos?
Am 29. Mai 1973 hatte Nollau Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher informiert, dass ein Verdacht gegen Guillaume bestehe. Genscher hatte noch am selben Tag Willy Brandt in Kenntnis gesetzt. Und trotzdem durfte Guillaume fast ein weiteres Jahr im Bundeskanzleramt arbeiten. Er war Brandts Referent für alle Themen rund um ihre Partei, die SPD.
Brandt mochte ihn nicht besonders. Zu beflissen, zu wenig Kreativität und Weltläufigkeit, na ja, vermutlich zu sehr wie viele altgediente Parteigenossen. Aber das durfte man ja nicht laut sagen.
Der Verdacht, der sich abgebrüht gebende Verfassungsschutz sei einfach nachlässig gewesen, wurde verstärkt, als herauskam, dass erst Informationen des französischen Geheimdienstes über Guillaume dessen Festnahme in Gang gesetzt hatten. Als der Spion schließlich verhaftet war, ergab sich jedoch schnell ein recht lückenloses Bild. Guillaume hatte in seinem Arbeitsfeld keinen Zugang zu sicherheitspolitisch relevantem Material gehabt. Er beschäftigte sich mit SPD-internen Fragen sowie Gewerkschafts- und Sozialthemen. Die 24 Berichte und Dokumente, die er heimlich aus dem Kanzleramt geliefert hatte, begeisterten die DDR-Staatssicherheit wenig. Keine seiner Informationen wurde als sehr bedeutend klassifiziert.[20] Die unbeantwortete Frage blieb, was er mündlich über den Bundeskanzler weitergegeben hatte.
Guillaume wird von Willy Brandts Frauengeschichten gewusst haben.
Die Annahme verbreitete sich schnell in den politischen Kreisen der Bundeshauptstadt Bonn. Konnte die DDR Willy Brandt damit erpressen?
Ja, Frauengeschichten, ein paar mögliche, lose Affären – das war doch kein Problem mehr, auch nicht für einen Bundeskanzler, im Jahr 1974! So schrieb es sinngemäß Rudolf Augstein, der Gründer und Herausgeber des Spiegels: »Viele heute amtierende Staatsmänner haben außer ihrer Ehefrau eine Freundin, im Vorzimmer oder sonstwo. Is was, Doc? Gar nichts ist, es darf sogar vielsagend geschwiegen werden.«[21]
Sachlich betrachtet schien der Schaden also begrenzt. Es hätte bloß großer Anstrengungen bedurft, diesen sachlichen Blick in der allgemeinen Aufregung durchzusetzen. Denn ein Spion im Kanzleramt, das war, unabhängig von den tatsächlichen Auswirkungen, der aufsehenerregendste Spionagefall im Kalten Krieg zwischen Ost und West.
Willy Brandt war auf Staatsbesuch in Kairo, als ihn die Nachricht von Guillaumes Festnahme erreichte. Auf solche Reisen nahm er gelegentlich seinen 22-jährigen Sohn Lars mit. Er gab Lars bisweilen auch seine Redenentwürfe, um zu hören, was der Sohn davon hielt.[22] Es schien für Willy Brandt leichter, über die intellektuelle Arbeit eine Beziehung zu den Kindern aufzubauen als über alltägliche Vater-Sohn-Themen.
Wie sehr ihm nach der Rückkehr aus Kairo die öffentliche Debatte über den Spion in seiner Nähe zusetzte, beschrieb er Jahre später: »Es war halt auch so, wissen Sie, da kommt man von einer Auslandsreise ein bisschen angeschlagen zurück. Dann kommen die ganz profanen Dinge des Lebens hinzu: Da geht man zum Zahnarzt und muss sich einen Zahn oder mehrere ziehen lassen. Und dann kommt dieser Mist dazu. Da ergibt sich dann eben die Situation, aus der heraus Sie sagen: Jetzt ist besser, ich höre auf.«[23]
Ganz so salopp formte er seinen Rücktrittsentschluss Anfang Mai 1974 wohl nicht. Aber im Kern kommt die Aussage dem wahren Grund für Brandts Rücktritt nahe. Die Spionage war wohl eher Anlass als alleinige Ursache. Brandt war politisch seit Monaten angeschlagen. In einem Moment der Erschöpfung erschien der Spion in seinem Büro der eine Konflikt zu viel. Er ließ sich dazu hinreißen zurückzutreten.
»Ein entschlossener Kanzler hätte den Fall Guillaume abreiten und überstehen können«, schrieb einer der Meinungsmacher der Republik, Theo Sommer, in seinem Leitartikel in der Wochenzeitung Die Zeit.[24] Die Mehrheit der Leser verstand wohl, auf welchem Wort in dem Satz der Schwerpunkt lag: ein entschlossener Kanzler. Im fünften Jahr als Bundeskanzler wurde Willy Brandt vor allem als Mann in Schwierigkeiten wahrgenommen.
Seine neue, zugewandte Außenpolitik gegenüber den sozialistischen Ländern Osteuropas war ein wahrhaft historischer Einschnitt gewesen. 25 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs fiel Willy Brandt in Warschau auf die Knie, um Polen um Vergebung für die deutschen Kriegsverbrechen zu bitten. Er schuf ein Klima für Versöhnung. Bilaterale Verträge mit der Sowjetunion und den meisten Ostblockstaaten sollten einen neuen, selbstverständlichen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Austausch zwischen Gegnern entstehen lassen. So wurde 1972 auch der Grundlagenvertrag für gleichberechtigte Beziehungen mit der DDR unterzeichnet. Diese neuen Leitlinien, die Brandts großer politischer Vertrauensmann Egon Bahr entworfen hatte, förderten ein vertrauensvolles Klima in der kalten Weltpolitik und verbesserten das Leben vieler Bürger. Ehemalige Bewohner der DDR, die sich in die Bundesrepublik abgesetzt hatten, durften dank des Grundlagenvertrages erstmals wieder ihre Heimat besuchen. Und das waren gut zwei Millionen.
Die Bundesrepublik wiederum bezog seit Oktober 1973 Erdgas in großen Mengen aus der Sowjetunion. Die Gasröhren waren zum Teil mit bundesdeutschen Krediten finanziert worden. »Wandel durch Annäherung« taufte Egon Bahr Willy Brandts neue Ostpolitik. Vielleicht würden sich sogar die sozialistischen Regime selbst wandeln durch den neuen Einfluss aus dem Westen; verbunden durch Gasleitungen.
Aber auch ein Mann, der Geschichte macht, hat seinen politischen Alltag. 1974 stagnierte die Wirtschaft der Bundesrepublik erstmals nach 14 Jahren Vollbeschäftigung. Die Arbeitslosigkeit, das deutsche Trauma seit der Weimarer Republik, kehrte mit einer Quote von 2,7 Prozent zurück. Und in den eigenen Reihen zogen Rivalen wie der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Herbert Wehner, Brandts Führungsstärke in Zweifel. »Der Herr badet gerne lau«, sagte Wehner öffentlich. Brandt hatte bei der jüngsten Kabinettsbildung teilweise Finanzminister Helmut Schmidt nachgegeben. Es wurde getuschelt – denn über Krankheiten redete man nicht, 1974 –, Willy Brandt leide an Depressionen. Seit seinem triumphalen Wahlsieg Ende 1972 war die Zustimmung für Brandt laut Wählerumfragen von 55 auf 35 Prozent eingebrochen.[25]
Er trage die politische Verantwortung dafür, dass ein Spion Zugang zu vertraulichen Akten der Regierung gehabt habe, sagte Brandt am 7. Mai 1974, deshalb trete er zurück. In einem persönlichen Brief an den Bundespräsidenten Gustav Heinemann klang es allerdings, als mache ihm ein größeres, allgemeineres Leiden am Amt zu schaffen. »Die jetzige Last muß ich loswerden«, schrieb er. »Sei mir bitte nicht böse, versuche, mich zu verstehen.«[26]
Matthias saß am 7. Mai abends im Wohnzimmer ihrer Villa im Kiefernweg alleine vor dem Fernseher.[27] Er war daran gewöhnt, dass er in dieser Familie mit zwei großen Brüdern und viel beschäftigten Eltern ein eigenes Leben unter Erwachsenen führte. Auf einmal erschien sein Vater in der Wohnzimmertür. Der Junge hatte ihn zwei Tage nicht gesehen.
Willy Brandt blieb an der Wohnzimmertür stehen und setzte aus der Distanz zu einer Erklärung an.
Es war 1974 viel vom neuen Typ Vater die Rede, der im Haushalt half und liebevoll, wie eine Mutter, mit den Kindern umging. Wie oft es diesen Typ Vater tatsächlich gab, war eine andere Frage. »Eltern sein bleibt ein Mutterberuf«, schrieben die Zeithistoriker Christopher Neumaier und Andreas Ludwig, nachdem sie eine Studie mit 7000 westeuropäischen Arbeitern analysiert hatten.[28]
Willy Brandt, geboren 1913, war nachsichtig mit seinen Söhnen. Matthias sägte zu Hause in den wertvollen Tisch, Peter schrieb in der Schülerzeitung gegen die Politik des Vaters an. Willy Brandt fand immer noch irgendwo Verständnis. »Werdet auch so tolerant/wie der Vater Willy Brandt«, reimte der Kabarettist Eckart Hachfeld. Aber die Söhne konnten sich an keine Umarmungen oder Küsse ihres Vaters erinnern. Willy Brandt selbst war ohne Vater aufgewachsen.
Seine Mutter habe ihm ja sicher schon alles gesagt, begann Willy Brandt am Abend des 7. Mai, von der Wohnzimmertür aus. Brandt brach ab. Im Fernsehen liefen die Nachrichten. »Nach dem Rücktritt von Bundeskanzler Willy Brandt aufgrund der Affäre um den enttarnten DDR-Spion im Kanzleramt …« Willy Brandt starrte den Fernseher an und fing an zu lachen. Er lachte, als könnte er gar nicht mehr aufhören. Dann drehte er sich um und ging aus der Tür. Matthias Brandt blieb auf dem Sofa zurück.
Er musste wieder mit nach Norwegen. Er kam doch gerade erst aus Norwegen. Die Osterferien lagen kaum einen Monat zurück. Matthias Brandt vermutet, dass er trotzdem nicht protestierte; auch wenn er die Endphase der erfolgreichen Bad Godesberger Saison in der D-Jugend-Kreisliga verpasste. Er verstand, dass etwas geschehen war, das größer war als er. Die Niedergeschlagenheit seines Vaters war allumfassend. Das war keine Traurigkeit, wie er sie mit zwölf kannte, die sich nach Minuten in Lachen auflösen konnte. Das war eher eine undurchdringbare Finsternis, die den Vater völlig einhüllte.
Norwegen war das einzig denkbare Ziel. Die Eltern hatten sich in Skandinavien lieben gelernt. Er kannte die Geschichte so ungefähr. Sein Vater war vor den Nazis geflohen, zunächst nach Norwegen, und als dieses besetzt wurde, weiter nach Schweden. In Stockholm war er seiner Mutter begegnet, die im norwegischen Widerstand tätig war. Sein Vater hatte sich damals zur Tarnung sogar einen anderen Namen zugelegt. Aus dem Lübecker Herbert Frahm wurde in Skandinavien Willy Brandt.
Neben den emotionalen Erinnerungen schienen die Eltern an Norwegen vor allem zu schätzen, dass es weit weg von allem war. Sie wohnten im Wald, in einer Ferienhütte bei Hamar, die Rut Brandt 1962 gekauft hatte, um immer eine Heimat zu haben. Sie hatte das Gefühl, ihr Mann verweile ungern dort, aber das war nur so ein Gefühl.[29] Gesprochen wurde darüber wohl nicht. Aus Kindersicht war es einfach so eine typische Erwachsenenidee, dort fast jede Ferien zu verbringen.
Im Sommer 1973 hatten sie zum Urlaub vier Wochen im Wald gesessen. Das schien in Deutschland auf weitreichendes Einverständnis zu treffen: Wenn ein Bundeskanzler schon so weit reiste, bis Norwegen, dann lohnte es sich doch nicht, nur zwei oder drei Wochen dort zu weilen. Der Sinn eines Urlaubs war es, sich durch Nichtstun zu entspannen. Mit anderen Worten, denen eines Zwölfjährigen: Es war todlangweilig.
Im Sommer 1973 war sein Vater mit ihm gelegentlich im Wald angeln und Pilze suchen gegangen. Aber die Reise im Mai 1974 war natürlich kein Urlaub, eher eine Flucht.
Matthias Brandt versuchte, sich selbst zu beschäftigen. Er war es gewohnt. Er ging durch den norwegischen Wald zum Fußballplatz der Jugendherberge auf dem Ormseter. Er war stundenlang Günter Netzer, alleine auf dem Fußballplatz.
Gelegentlich gelang es ihm, die Personenschützer seines Vaters für eine Fußballpartie zu gewinnen. Zu Hause im Kiefernweg in Bonn schlich er sich oft in ihr Wachhäuschen an der Einfahrt. Die Tür war der Eintritt in eine andere, aufregende Welt. Aus dem Kassettenrekorder des Wachhäuschens dröhnte Musik, die zu Hause nicht lief, ein Orchester spielte mit Schwung und Fröhlichkeit, ohne die Melancholie klassischer Musik, die Trompeten schienen regelrecht zu springen, selbst der Bass war beschwingt, bumsfallera, was war das denn Lustiges? Na, James Last natürlich, sagten die Personenschützer. Sie ließen ihn in ihrem Wachhäuschen sogar die Zeitung lesen, die zu Hause verboten war. Die BILD schrieb böse über seinen Vater, das sollte er nicht erfahren. Die Personenschützer taten so, als merkten sie nicht, dass Matthias die Zeitung las. Das war ein herrliches Gefühl. Er hatte 30-jährige, verwegene Männer als Komplizen. Ihn interessierten in der BILD sowieso nur die Fußballberichte.
Die Personenschützer mussten auch auf ihn aufpassen. Er hatte die Fahndungsplakate in der Stadt gesehen. »Anarchistische Gewalttäter. Baader/Meinhof-Bande« lautete die Überschrift, in kräftigem Rot gehalten, als sollten die Worte den Betrachter anspringen. Darunter die Schwarz-Weiß-Passfotos von Menschen, die in ihren Zwanzigern waren und uralt aussahen, bleich, mit zusammengepressten Lippen, der Sechste etwa, Zweiter in der zweiten Reihe, Jünschke, Klaus. Sein Schnurrbart zog den Mund nach unten.
Viele Gesichter auf den Fahndungsplakaten waren durchgekreuzt. Wird nicht mehr gesucht, hieß das Kreuz, schon gefangen. Die Plakate hingen überall. Wer die Gesichter durchkreuzte, war ein Rätsel. Gingen Polizisten extra durch die Städte, um Ordnung walten zu lassen und einen soeben Festgesetzten auszukreuzen? Oder strichen Passanten die Terroristen durch, zufrieden, dass etwas, wenigstens etwas, in diesem Leben abgehakt war?
Matthias Brandt wusste schon, dass das mit dem Personenschutz ernst zu nehmen war. Er dachte nur nicht so oft daran. Es war ein besonderer Spaß, sich mit dem Fahrrad durch einen Nebenausgang vom Grundstück zu stehlen und dann so fest in die Pedale zu treten, dass er die Oberschenkel spürte, den Espenweg hinauf. Als ob ihm die Personenschützer hinterherrennen würden. In nicht einmal drei Minuten war er bei Andreas. In Worte fasste er das Gefühl fünfzig Jahre später: »Dann war ich frei.«
In Norwegen wohnten die Personenschützer in der Jugendherberge. Es gab keine bessere Unterkunft in der Nähe der Ferienhütte. Sie waren zu sechst im Dienst, zwei hatten Schicht, vier hatten theoretisch Zeit für eine Fußballpartie. Hinzu kam ein Fahrer, sein Vater konnte ja nicht Auto fahren. Wenn er den Tross animierte, bekam Matthias Brandt eine passable Fußballpartie an der Jugendherberge zusammen. Auf eine Idee kam er dabei nie. Seinen Vater zu fragen, ob er mitspielte.
Sein Vater hatte einen schwerfälligen Körper, aber das war es nicht einmal. Fußball passte nicht zu ihm. Mit Fußball beschäftigten sich möglicherweise normale Väter, so wie Herr Brenke, der auch als Betreuer der D1-Jugend des Godesberger FV 08 aushalf. Und doch wurde der Fußball zu einem Bindemittel zwischen Willy Brandt und seinem jüngsten Sohn.
Der Vater brauchte ihn, wenn es um Fußball ging. Der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland holte sich bei ihm Rat, wenn er etwas öffentlich zum Fußball sagen musste. Matthias erschien das logisch, mit zwölf. Mit seinen großen Brüdern debattierte der Vater irgendwelche politischen Dinge, und so musste der Vater natürlich ihn fragen, wenn es um Fußball ging. Er war der Einzige in der Familie, der sich auf dem Gebiet auskannte. Der Fußball gehörte ganz ihm.
Am 13. März 1974 nahm ihn der Bundeskanzler mit ins Aktuelle Sportstudio des ZDF. Jeder Studiogast der großen Samstagabendshow musste auf die Torwand schießen, das war ein Ritual. Eine größere Blamage für Willy Brandt war kaum auszudenken, jedenfalls nicht am 13. März 1974, fünf Wochen bevor in der Bundeshauptstadt ein Spion verhaftet wurde. »Kannst du nicht für mich auf die Torwand schießen?«, bat der Vater Matthias.
Mit Trompeten und Posaunen erklang die berühmte Erkennungsmelodie des Sportstudios. Sie konnte fast von James Last sein, war aber von Max Greger und seiner Big Band. Der Moderator Hanns Joachim Friedrichs begrüßte die Zuschauer mit der Erinnerung, dass »letzte Woche Harry Valérien hier einige Yoga-Übungen vorgeführt hat«. Das habe ihn sehr beeindruckt, »deswegen habe ich beschlossen, auch so etwas zu machen, aktiv im Studio Sport zu treiben. Ich darf Sie gleich am Anfang der Sendung mit der Disziplin bekannt machen, in der ich mich heute üben werde: dem Kreuzworträtsel.«
Die Kamera zeigte das Publikum im Studio, das schon eifrig Kreuzworträtsel löste. Das Bild streifte einen Mann im schreiend grünen Hemd mit riesigem Kragen unter einem weiten, karierten Sakko; gekleidet, wie sich das gehörte.
Sport war nach Definition des Sportstudios Unterhaltung, auch wenn das einige im Land immer noch nicht wahrhaben wollten. Zwölf Prozent der Haushalte schalteten 1974 an einem gewöhnlichen Samstag das Sportstudio ein.[30] Diese Plattform konnte man auch als Bundeskanzler nicht verschmähen, wenngleich ein Bundeskanzler sich auch nicht zu nah am Fußball zeigen sollte. Das Spiel war, in einem Jahrzehnt großer politischer Visionen, zumindest für gut die Hälfte der Nation doch eine zu profane Sache. Schon gingen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Leserbriefe zur ausführlichen WM-Berichterstattung ein: »Mußten Sie wirklich in die Niederungen der Fußballmeisterschaften herabsteigen und jene herb enttäuschen, denen es schwer genug fällt, sich mit einem Staat zu identifizieren, dessen Regierende den Kotau vor dem Fußballpöbel machen?«[31]
Willy Brandt ließ sich von seinem Sohn Tipps geben, wie es mit Netzer stand, wie die Bayern in Form waren, nur zur Sicherheit, denn er konnte doch davon ausgehen, dass er in der Sendung nicht danach gefragt würde. Das wäre unseriös, einen Bundeskanzler direkt zum Fußball zu befragen. Es sollte im Sportstudio wohl um Sportpolitik gehen.
Es dauerte 26 Minuten, bis die Spielberichte von drei Bundesligapartien gezeigt, der Präsident des Tabellenletzten Fortuna Köln interviewt und die Paarungen des nächsten Spieltages in aller Ruhe vorgelesen worden waren, ehe die Kamera abrupt auf einen Jungen im gelb-blauen Trainingsanzug des Godesberger FV 08 schwenkte.
Harte, überraschende Kameraschnitte waren ein Markenzeichen des Sportstudios. Diese alte, spröde Sportberichterstattung war doch nichts für sie, fanden die Redakteure, sie waren die Avantgarde der neuen Zeit, fast schon literarisch in ihrer Herangehensweise; jedenfalls in ihrer Selbsteinschätzung.
Es wurde deshalb auch nicht verraten, wer dieser unbekannte Junge war, der da auf die legendäre Torwand schoss. Er schoss einfach.
Übrigens sah er aus wie ein junger Günter Netzer, mit seinen schulterlangen, hellen Haaren und den netten, weichen Gesichtszügen.
Drei Treffer hatte Netzer bei seinem Besuch im Sportstudio an der Torwand erzielt, glaubte Matthias sich zu erinnern. Sicher war er sich nicht, aber wenn man es nur oft genug wiederholte, dann wurde es wahr: Netzer hat dreimal getroffen, Netzer hat dreimal getroffen. Und nun hatte Matthias Brandt die Chance, ihn zu übertreffen, vielleicht sogar von Netzer gesehen zu werden.
Der erste Schuss, mit Innenrist auf das untere Loch in der Torwand, war gut platziert, aber zu flach. Er prallte von dem kleinen Stück Torwand unter dem Loch zurück.
Sechs Versuche hatte jeder Gast an der Torwand.
Den zweiten Schuss bereitete Matthias Brandt mit Ruhe vor. Er legte sich den Ball konzentriert hin, nahm Anlauf und – perfekt. Das Publikum im Studio stieß erstaunte Freudenjauchzer aus.
Der dritte Schuss war ebenso ein Treffer. Das Publikum schrie. Der Moderator hatte immer noch nicht verraten, wer da eigentlich schoss.
Noch ein Treffer, und er war so gut wie Netzer! Vor Aufregung vergaß Matthias, dass die Regel drei Schüsse unten, drei Schüsse oben vorsah. Er zielte auch den vierten Schuss auf das untere Torloch und, die Aufregung steuerte seinen Fuß, deutlich vorbei.
Er musste über ein Kamerakabel hinweg Anlauf nehmen, das war kompliziert.
Beim fünften Schuss verpasste er dem Ball nicht genug Unterschnitt, er erreichte nicht die Höhe des oberen Torlochs. »Die Chance, auf die Torwand zu schießen, verdankt der Junge der Großzügigkeit seines Vaters«, sprach der Moderator Hanns Joachim Friedrichs aus dem Off, »der ihm den Vortritt überließ, anstatt es selber zu versuchen.« Da blendete die Kamera auf Willy Brandt, der neben Friedrichs zum Interview bereitsaß.
Sie zeigten gar nicht mehr Matthias’ sechsten Versuch! Man hörte ihn nur noch gegen die Torwand klatschen.
Matthias konnte sich nicht daran erinnern, dass bei einem Erwachsenen jemals der letzte Schuss auf die Torwand ausgeblendet worden war. Das erlaubten die sich nur bei einem Kind! Aber das war irgendwie auch normal. Matthias wurde auch nicht interviewt. Einen Zwölfjährigen im Sportstudio interviewen, das wäre doch unseriös. Matthias nahm still, wie ihm bedeutet wurde, in der ersten Reihe hinter seinem Vater Platz und strengte sich an, nicht zu lachen. Es passierte nichts Lustiges. Das Lachen kam einfach und wollte raus, weil er hier war und zweimal getroffen hatte, nur einmal weniger als Günter Netzer.
Günter Netzer hatte noch gar nicht im Sportstudio auf die Torwand geschossen, stellte sich allerdings bald heraus. Er tat es erst wenige Wochen nach Matthias, im Mai 1974, kurz vor der WM. Er war der erste Schütze, der bei fünf von sechs Versuchen traf.
Günter Netzer war die wichtigste Person in Matthias Brandts Leben. Also, das hätte er natürlich nie gesagt, wenn ihn einer der Erwachsenen gefragt hätte: Wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Er wusste, was die Erwachsenen hören wollten. Und wenn er einmal ganz ruhig nachdachte, hätte er vielleicht auch gesagt, dass seine Mutter, sein Vater, seine zwei Brüder, sein Freund Andreas, die Familie Brenke und sein Fußballtrainer Herr Magka natürlich wichtiger für ihn waren, wahrscheinlich wären ihm da sogar noch einige mehr eingefallen, vielleicht sogar ein Mädchen. Aber trotzdem. Manchmal, eigentlich sehr oft, schien ihm niemand so nah wie Günter Netzer.
Netzer war ständig in seinem Kopf. Netzer konnte alles, in seinem Kopf, nicht nur die Pässe anschneiden, sodass sie eine Kurve zeichneten. Netzer war über das Fußballspiel hinaus so großartig, wie man nur sein konnte, in seinem Kopf. Er war einfach lässig. Netzer hatte einen Ferrari, eine Diskothek, eine Lederjacke, Hosen mit Schlag, lange Haare und einen eigenen Kopf.
Matthias Brandt hatte Netzers Einmaligkeit leibhaftig erlebt. Er durfte sich im Sommer 1973 mit Herrn Magka und dessen Sohn das DFB-Pokalendspiel in Düsseldorf anschauen. Zu einem Fußballspiel in eine andere Stadt fahren, das machte niemand, den er kannte, das an sich war schon surreal. Genauso hätte er den Freunden erzählen können: Ich bin am Samstag zum Mond geflogen.
Aber er war da gewesen. Herr Magka wollte das Endspiel unbedingt sehen, Köln gegen Mönchengladbach, Overath gegen Netzer, also rief Herr Magka im Bundeskanzleramt an, er kannte da ja jemanden, ob sie nicht Eintrittskarten hätten. Natürlich nahm Herr Magka dann den Sohn dessen mit, der ihm die Karten verschaffte. Es waren Ehrenkarten, möglicherweise für den Bundeskanzler selbst gedacht, aber niemand sagte etwas, als da mitten auf der Ehrentribüne ein unbekannter Mann mit zwei Kindern saß. So war Matthias dabei, als es passierte.
Mönchengladbachs Trainer Weisweiler ließ Netzer zunächst nicht spielen. Der Trainer war beleidigt, weil Netzer zur neuen Saison zu Real Madrid wechseln wollte. Doch in der Verlängerung trat Netzer ins Spiel. Es stand 1:1, die beiden Mannschaften hatten sich 94 Minuten lang mit aller Kraft um den Sieg bemüht, und Netzer trat einfach ins Spiel, spielte Doppelpass mit Bonhof und jagte den Ball unfassbar wuchtig ins Kölner Tor. Das Publikum wurde hochgerissen, als ob Netzers Schuss erst den Magen heben würde, und auf einmal, vom Magen aus, wurden die ganzen Körper von den Tribünenplätzen gerissen. Zwei Tage danach las Matthias Brandt in den Zeitungen seines Vaters, die auf dem Küchentisch lagen, dass alles noch unglaublicher war. Netzer hatte sich selbst eingewechselt, ohne den Trainer zu fragen. Das machte das Überirdische der Szene komplett. Ein Erwachsener müsste man sein, um Worte für die Wirkung jener Szene zu finden. Fünf Jahrzehnte später versucht es Matthias Brandt: »Das war für mich ein ikonischer Moment.«
Und jetzt würde Netzer gegen die DDR auf der Ersatzbank sitzen.
Wenn Matthias Brandt nachdenkt, jedenfalls wenn er es fünfzig Jahre später tut, dann ging die ganze Misere der WM 1974 mit dem Rücktritt seines Vaters los. Seitdem hing über dieser Weltmeisterschaft für ihn eine dunkle Wolke. Dass dann auch noch Netzer auf der Ersatzbank saß, war die logische Folge.
Über seinem Bett hatte Matthias das Poster der bundesdeutschen Nationalmannschaft aufgehängt, die, angeführt von Günter Netzer, mit einer tollkühnen Darbietung 1972 Europameister geworden war. Er konnte das Foto endlos lang betrachten. Dabei hatte er sich ausgemalt, wie die Nationalelf bei der Weltmeisterschaft noch mitreißender spielen und sein Vater als Bundeskanzler nach dem Sieg im Endspiel dem strahlenden WM-Star Günter Netzer gratulieren würde. In seiner Gedankenwelt, beim Spiel im Garten, waren die Dinge so klar gewesen, bis diese Weltmeisterschaft tatsächlich begann.
Ihr Spielfeld in Andreas’ Garten war ungefähr acht mal fünf Meter groß. Welch kleiner Radius Kindern für ihre Fußballschlachten genügte. Wenn sie als Erwachsene an den Ort zurückkehrten, staunten sie in der Regel nicht schlecht: So winzig war das Spielfeld gewesen? In der Erinnerung war es ein Stadion! Acht mal fünf Meter genügten, damit Netzer aus der Tiefe des Raums kam.
Vom gepflegten Rasen der Brenkes war vor den zwei Obstbäumen kaum noch etwas geblieben. Das machte dieses Fußballstadion nur authentischer. Auf allen Sportplätzen, die die Jungen kannten, war im Torraum der Rasen brauner Erde gewichen, selbst in der Bundesliga, 1974. Wie sollte auch ein Platzwart so schnell wieder richten, was die Stollen der Fußballer zertrampelten?
Seine Künste mit dem Ball, seine Versuche, genauso zu schießen wie Netzer im Pokalfinale, nahm Matthias sehr ernst. Er versuchte es Dutzende Male hintereinander, jeden Tag, vor den Obstbäumen. Aber noch wichtiger war, was sich beim Spiel in seinem Kopf abspielte. Dort verschmolz er mit Netzer, für lange Momente wurde er ganz und gar Netzer. Der Fußball, das Spiel seiner Kindheit, fand hauptsächlich in seiner Fantasie statt.
Es gab bis 1974 kaum Möglichkeiten, ein Fußballspiel anzuschauen. Das war einmal etwas, was in der DDR und der Bundesrepublik völlig gleich war. Die ARD Sportschau wählte am Samstagabend drei der neun Bundesligaspiele aus und zeigte von ihnen kurze Zusammenfassungen. DDR1 präsentierte, nahezu zeitgleich, eine kleine Auswahl der besten Szenen aus zwei, drei DDR-Oberligaspielen. Ein paarmal im Jahr wurden bedeutende Länderspiele und Europapokalpartien live übertragen. Danach waren die Bilder weg, für immer. Nur in der Fantasie der Jungen lebten Momente wie Günter Netzers sagenhafter Weitschuss im Pokalfinale noch weiter. In ihren Fantasiespielen in Gärten und auf Bolzplätzen wurde der Weitschuss wieder und wieder imitiert, variiert, kommentiert.
Wie Matthias Brandt spielten die meisten Jungen irgendwo in ihrer Siedlung und im Fußballverein. Und wie bei ihm sind bei vielen die Erinnerungen an den freien, wilden Kick stärker, wärmer als an die Vereinsspiele. Das mag auch daran liegen, dass in den Siebzigerjahren Kinder aller Altersklassen im Verein auf dem riesigen Männerspielfeld spielen mussten, wo die Mehrzahl der Jungen angesichts des gehörigen Ausmaßes des Platzes minutenlang den Ball nicht sah. Der Hauptgrund, warum dem unkontrollierten Spiel in der Siedlung ein tieferer Zauber innewohnte, war aber wohl ein anderer. Dort übernahm die Fantasie die Regie.
Die Weltmeisterschaft 1974 war die erste, die vom Fernsehen regelrecht inszeniert wurde. Mehrere Spiele am Tag wurden live übertragen, dazu kamen am Abend sogenannte Extrasendungen mit Zusammenfassungen und Experten, die ihre Meinung über die gezeigten Leistungen kundtaten. »Selbst als Fußballfreund kann unsereins zu viel kriegen«, stöhnte die Frankfurter Allgemeine Zeitung. »Das Fernsehen erklärt uns, was ein Ball ist.«[32]