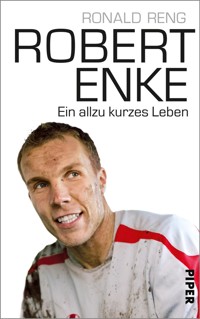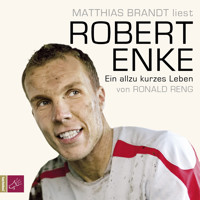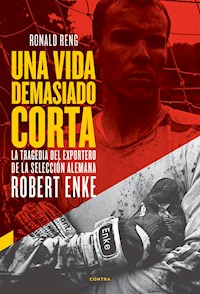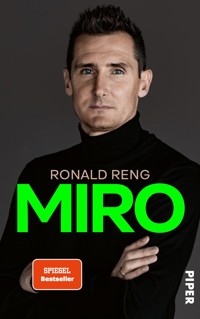3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Lars Mrosko ist Fußballer mit Haut und Haaren. Als ihn eine Knöchelverletzung zwingt, die eigene Karriere an den Nagel zu hängen, will er um keinen Preis seine Leidenschaft aufgeben. Er wird Jugendtrainer bei TeBe Berlin, dann Talentscout für St. Pauli, Wolfsburg und schließlich sogar den FC Bayern. Er weiß, dass viel Geld im Spiel ist, wenn es um Talente für eine der besten Ligen der Welt geht. Aber das ist ihm egal, er ist glücklich über einen Trainingsanzug in Vereinsfarben, über Anerkennung durch seine Vorgesetzten. Lars Mrosko kommt aus einfachen Verhältnissen, aufgewachsen in Neukölln schlägt er sich mit Ladendiebstählen durch, bis seine Fußballkenntnisse ihn an die richtige Stelle katapultieren - ins Büro von Felix Magath, der Mroskos Leidenschaft erkennt und ihm glaubt, dass Edin Dzeko der richtige Stürmer für Wolfsburg sein könnte ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
ISBN 978-3-492-97167-6
Dezember 2017
© Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2015
Litho: Lorenz & Zeller, Inning am Ammersee
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Covermotiv: Giorgio Fochesato/Getty Images
Datenkonvertierung: Tobias Wantzen, Bremen
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
PrologMonopoly
Seit er sich erinnern kann, haben Frauen versucht, ihn zu verändern, seine Mutter, Yvonne, Antje, und weil es Frauen waren, dachte Lars Mrosko, er würde sich ändern. Das Problem war nur, dass es so langweilig war, stets vernünftig zu sein.
»Du schon wieder!«, begrüßte ihn Entes Vater, als Lars abends bei seinem Freund in der Tür stand. Er war sich sicher, dass ihn Entes Vater eigentlich mochte. Der Vater schloss das Wohnzimmer vor ihnen ab und nahm den Schlüssel mit, wenn er ein Bier trinken ging und die Wohnung Ente und seinen Freunden überließ.
Lars kletterte aus Entes Fenster hinüber auf den Wohnzimmerbalkon. Er war klein, muskulös, mit enormer Körperspannung und wachen Augen gesegnet. Er empfand es als Kompliment, wenn die anderen sagten: Der Lars kennt keine Angst.
Die Wohnung lag im ersten Stock des Hochhauses, nah genug an der Straße, dass ihn jeder Passant beobachten konnte. An der Johannisthaler Chaussee wunderte es allerdings niemanden, wenn ein junger Mann abends aus einem Fenster auf den Balkon nebenan kletterte. Lars klaute Entes Vater ein paar Satin-Unterhosen von der Wäscheleine am Balkon.
Entes Vater würde das nächste Mal ein bisschen schimpfen, wo seine Unterhosen waren, Lars würde sagen, das waren doch unsere Unterhosen, die hattest du dir nur unter den Nagel gerissen, als wir sie mal morgens vergessen haben. Beide würden meinen, recht zu haben, und dann ein Bier miteinander trinken. Entes Vater konnte Lars doch nicht wirklich böse sein. Denn Lars Mrosko, sagten alle, hat einen guten Kern; eigentlich, fügten manche hinzu. Er hatte, mit 23, auf dem Abendgymnasium versucht, sein Abitur nachzuholen, weil Antje das wollte. Er erinnerte sich dann bloß immer wieder daran, was er am liebsten wollte: mit den Jungs abhängen.
Sie bauten in Entes Zimmer das Monopoly-Spiel auf dem Teppichboden auf, um die Stunden totzuschlagen, bis im Fun was los war. Neben der üblichen Clique, Shergo, Bodden, Ente und Lars, war an diesem Abend auch Hotze zu ihnen gestoßen. In der Disco hatte Hotze einmal auf der Tanzfläche Anlauf genommen, einen Rückwärtssalto geschlagen und war auf einer Erhöhung gelandet. »Wo haste das denn gelernt?«, fragte ihn Lars. Gelernt gar nicht, sagte Hotze, das habe er im Fernsehen gesehen und gedacht, er probiere es mal aus.
Zu fünft war es ein wenig beengt in Entes Zimmer, das unverändert wie in Kindertagen eingerichtet war, obwohl sie mittlerweile alle über 20 waren. Am Fenster stand der Schreibtisch, mit Tags und Graffiti bemalt, und in dem schmalen Kinderbett würden nach der Disco zwei von ihnen schlafen; zwei im Bett, drei auf dem Fußboden, wer wo liegen durfte, würden sie ausschnicken, sching-schang-schong. Vielleicht würde aber auch einer im Fun bei einer Frau landen.
Lars nahm heimlich ein paar Geldscheine aus den Stapeln des Monopoly-Spiels und sagte den Jungs, er müsse mal kurz auf Toilette. Im Bad versteckte er das Spielgeld hinter der Shampooflasche und im Zahnputzbecher. Im Zimmer drehten sie das Volumen der Musik hoch. Ente besaß eine kleine Stereoanlage mit sechs CD-Laufwerken im Regal, topmodern, sodass sie sechs Interpreten hintereinander hören konnten, ohne eine CD wechseln zu müssen. Doch dann hörten sie wieder nur die eine. Sie sangen mit, »einfach geil – endlichfrei, denn die Woche ist vorbei«. Rap oder Techno, der ganze harte Scheiß, war schon auch in Ordnung, aber bei den Schlagern von Wolle Petry wurde Lars von innen warm, und zügig breitete sich die Euphorie im ganzen Körper aus.
Es gab Wodka und Bier. Geld war beständig knapp, aber sie trieben doch immer genug auf, um was zu trinken zu haben, um in die Disco reinzukommen. Bodden jobbte als Cocktailmixer, Shergo spielte bei den Reinickendorfer Füchsen in der vierten Liga Fußball. In der Sprache der Erwachsenen, zu denen sie sich in ihrem Alter nun zählen sollten, waren das Nebenjobs. Aber sie konnten von 600 Mark im Monat leben, wenn sie noch im Kinderzimmer wohnten. Warum sollten sie mehr, warum etwas Langweiliges arbeiten? Manchmal dachte Lars an die 75000 Mark. Die Zahl klang gigantisch, aber so groß war sie doch gar nicht mehr, er hatte dank Antjes Insistieren schon ein paar Tausend Mark von den Schulden abgetragen, die er zwischen 20 und 22 aufgehäuft hatte, beim Vermieter, Sozialamt, bei den Banken, Versicherungen, überall. Im Prinzip unterschied das echte Geld sich nicht vom Monopoly-Geld: Man brauchte nur genug, dann blieb das Leben ein Spiel.
Lars’ Ziel beim Monopoly war, Ente und Bodden in die übliche Streiterei zu treiben. Shergo unterstützte ihn dabei ohne Absprache, aus Gewohnheit.
»Mann, Ente, merkst du es nicht, wann immer du in die Nähe von Boddens Straßen kommst, baut er schnell Häuser, damit du eine höhere Miete löhnen musst.«
»Meinste, das fällt mir nicht selber auf? Der will mich fertigmachen, der Pleitegeier, aber dem zeig ich’s!«
»Blas dich nicht so auf, du Osterhase! Sonst mache ich dich ruck, zuck alle.«
Falls Bodden und Ente wider Erwarten beim Monopoly erfolgreich über die Runden kamen, ging Lars auf Toilette. Hinter der Shampooflasche oder im Zahnputzbecher fand er, was er brauchte, um dem Spiel die Wende zu geben.
Er konnte sich keine besseren Freunde vorstellen. Als er noch nicht bei Antje, sondern wie die anderen in der Gropiusstadt gewohnt hatte, klingelte Bodden oft bei ihm. Er solle rauskommen, Fußball spielen. Um ein Uhr in der Nacht. Sie spielten dann auf dem Bolzplatz am Theodor-Loos-Weg »Rüberschießen«. Jeder stand in einem Tor und schoss über den gesamten Platz auf das Tor des anderen, Ballstoppen nur in der Luft, und Ballvorlegen gar nicht erlaubt, beide Spieler grimmig entschlossen, diese Partie unbedingt zu gewinnen. An diesem Spiel, an jedem Spiel hing die Welt.
Bodden hieß in Wahrheit Daniel. Sie hatten ihn nach Olaf Bodden umbenannt, dem schweren Bundesligastürmer, der jede Menge Tore erzielte, aber ihrer Meinung nach doch kein guter Fußballer war, einer, der mit Kopfbällen und Kampfgeist bestand. Ein echter Fußballer war einer wie Shergo, feinfüßig, mit Körperfinten, und beim ersten Körperkontakt ging er zu Boden, schindete einen Elfer. Ein echter Köter. Shergo spielte vierte Liga für 630 Mark im Monat und außerdem auf jedem Freizeitturnier, bei dem ihn die Jungs brauchten, für Sporting Mutante, Juve Rudow oder den Hertha-Fanklub. Shergo, der mit dem ganzen Gesicht lachen konnte, und dann mochte ihn jeder, rauchte eine Zigarette vor dem Spiel, aber am Abend vor der Partie blieb er zu Hause, also, er versuchte es zumindest. Er würde Profifußballer werden, war doch klar.
»Noch ein Spiel«, sagte Bodden in der Nacht zu Lars, nach drei verlorenen Partien Rüberschießen auf dem von Straßenlaternen nur streifenweise beleuchteten Bolzplatz. »Nur noch ein Spiel, jetzt mach ich dich platt, du Aas.« Der Verlierer sagte immer: Nur noch ein Spiel.
Wenn ein Schuss danebenging, schepperte der Zaun. Gegen halb zwei in der Nacht schrien die ersten Nachbarn von den Hochhäusern herunter: »Habt ihr ’ne Macke? Haut sofort ab!« Nach zwei Uhr schmissen Nachbarn mit Flaschen nach ihnen. Sie spielten weiter. Sie machten, in ihrer Wahrnehmung, keinen Ärger. Nur wenn ihnen einer zu blöd kam, schlugen Lars und Ente mit der Faust zu; sie schlugen immer nur zurück, in ihrer Wahrnehmung.
Mit dem Monopoly waren sie zu früh fertig, es war erst zehn, halb elf, vor Mitternacht brauchtest du dich im Fun nicht sehen zu lassen.
Was nun?
Im Keller bei Ente fanden sie immer etwas. Der Vater bewahrte dort sein Arbeitsmaterial auf. Er war Malermeister. Von seiner Frau lebte Entes Vater seit Längerem getrennt, Lars kannte nicht die Details, aber auch die vage Lebensgeschichte nötigte ihm Hochachtung ab: Drei Kinder, Ente und zwei Töchter, hatte der Vater alleine großgezogen. Der kleinste Sohn wuchs wohl bei der Großmutter auf.
Sie nahmen eine von Vaters Dosen aus dem Keller und füllten sie in einen Frühstücksbeutel um. Dann fuhren sie in den elften Stock.
Entes Hochhaus war das höchste in der Gegend. Wie ein weißer Turm erhob es sich an der Johannisthaler Chaussee, selbst das Einkaufszentrum Gropius Passagen wirkte neben ihm schmächtig. Ganz oben, auf dem Balkon im 19. Stock, wurde einem von der bloßen Aussicht schwindlig. Die Lichter Berlins schwankten unter ihnen, die ganze Stadt lag ihnen zu Füßen, seit elf Jahren tatsächlich grenzenlos.
Manchmal zeigten sie im Fernsehen Bilder von den Hochhäusern der Gropiusstadt. Die Jungs mussten nicht genau hinhören, das Gequatsche des Sprechers kannten sie schon, ursprünglich 90 Prozent Sozialwohnungen, Leerstand, Jugendkriminalität, Problembezirk Neukölln. Sie sahen nur genau hin, ob sie jemanden in dem Filmbeitrag erkannten.
Von ganz oben, vom 19., ließ sich nicht so gut zielen. Also drängelten sie sich auf dem Treppenhausbalkon im Elften.
Der Parkplatz am Straßenrand direkt unter ihnen war noch frei. Das Fun befand sich im Souterrain der Gropius Passagen, 150 Meter von Entes Hochhaus entfernt. Die Diskothekengäste würden sich über den leeren Parkplatz freuen.
Sie mussten nicht lange warten, bis ein schwarzer Mercedes 420 SEL die Fahrt verlangsamte und einparkte. Bei Autos genügte ihnen ein Blick, um das Modell zu erkennen.
»Der steht perfekt.«
»Direkt unter uns.«
Hotze ließ den Arm mit dem Frühstücksbeutel durch die Luft kreisen. Aus dem Mercedes stiegen zwei junge Frauen und Männer aus.
»Optimal! Glatzen.«
»Mit scharfen Ost-Bräuten!«
Hotze warf den Frühstückbeutel so, dass er vom Balkon aus aufstieg und für eine ewige Tausendstelsekunde in der Luft stillzustehen schien, ehe er hinuntersauste.
Frauen schrien spitz auf. Ein Mann brüllte: »Ihr Schweine!«
»Hör auf zu lachen!«, herrschte Lars auf dem Balkon Hotze an, während er selbst kichern musste. Schnell fuhren sie mit dem Aufzug vom elften in den ersten Stock hinunter und schlichen im Dunkeln in die Wohnung von Entes Vater. Vom Fenster hatten sie einen guten Überblick, ohne selbst gesehen zu werden.
Der Fahrer des Mercedes hatte einen Baseballschläger aus dem Kofferraum geholt und schlug damit wie von Sinnen gegen den nächsten Laternenpfahl.
»Kommt runter, ihr Schweine! Ich komme hoch, ihr Wichser, ich mach euch kalt!«
»Hotze, hör endlich auf zu lachen, du verrätst uns noch!«, zischte Lars.
Ihre blaue Lackbombe war prächtig auf dem Dach des schwarzen Mercedes gelandet und hatte auch die vier jungen Leute, die gerade ausgestiegen waren, vollgespritzt.
Sie warteten eine gute halbe Stunde, bis der Mercedes wegfuhr, und dann noch mal 40 Minuten, um sicher zu sein. Dann gingen sie ins Fun. Die Glatzen würden sicher nicht da sein, die mussten sich sauber machen.
Mittwochs war im Fun Schlagernacht, ihre Nacht. Beim ersten eingängigen Lied startete Lars eine Polonaise, und schon bald zogen sie die halbe Disco hinter sich her.
»Alter«, sagte einer seiner Jungs zu Lars Mrosko, »ich kann nicht glauben, dass du bei Bayern München arbeitest.«
1
Der göttliche Gatzweiler
Lars Mrosko, der mit seinen Freunden Lackbomben aus dem elften Stock feuerte, legte Wert darauf, bei seiner Arbeit äußerst seriös aufzutreten. Er war jung genug, darin keinen Widerspruch zu sehen. Ihm war es wichtig, verlässlich zu sein; beim Blödsinnmachen mit den Freunden genauso wie beim Talentesuchen für Bayern München. Nur für die anderen in Neukölln war es schwer zu begreifen, wie das zusammenging; dieser 23-jährige Junge im Kapuzenpulli, der bislang Ausbildungen als Kindergärtner, Dachdecker und Elektriker abgebrochen hatte, und der deutsche Fußball-Rekordmeister.
Bayern München, ja ja, sagte sein Opa Locke.
Wenn Lars zu erklären versuchte, was er tat, wurde es nicht besser.
Was biste, Scout? Was is’n das, Pfadfinder oder was?
Wenn die Verwandten und Freunde, die nicht glauben konnten, dass er beim FC Bayern arbeitete, in Neukölln auf der Straße auf ihn angesprochen wurden, wussten sie allerdings plötzlich voller Stolz ganz genau, was er machte: Er stellt für die großen Bayern die Mannschaft der Zukunft zusammen!
Ganz genau genommen, war er einer von über einem Dutzend Scouts auf Honorarbasis, die im Jahr 2000 in ganz Deutschland nach Talenten für die Nachwuchsmannschaften des FC Bayern suchten. Mrosko sah sich jede Woche vier bis acht Spiele von Jugendteams an und meldete seine Eindrücke nach München. In Momenten, in denen ihn etwas bedrückte, fand er: Er war das kleinste Licht. Aber die Verzagtheit wich schnell wieder, wenn er bei der Arbeit war.
Schon das Fahrtziel seiner Scoutingtour auf der Landkarte zu suchen versetzte ihn in Stimmung. Neuerdings gab es wohl elektronische Geräte zu kaufen, die die Route automatisch vorgaben, Navigationssysteme oder so. Das war sicher praktisch, aber er dachte, da würde auch etwas verloren gehen: diese Vorfreude, wenn er die Landkarte studierte; dieses Gefühl, auf große Fahrt zu gehen. Aber er brauchte auch nicht weiter darüber nachdenken: Er konnte sich den Navigator sowieso nicht leisten.
Für 3000 Mark, die keiner von ihnen besaß, hatte ihm der Vater einen gebrauchten roten Mazda V6 für den Job bei den Bayern gekauft. Das Auto musste rot sein, die Farbe von Ferrari, die Farbe der Bayern. Mrosko fuhr raus aus Berlin, auf der neu gebauten A9 Richtung Süden, blühende Landschaften entstanden da ja, waren in Wirklichkeit zwar meist nur Felder in blassen Farben, aber das spielte keine Rolle; Wolle Petry lief im CD-Spieler, einfach geil – endlich frei, und Mrosko dachte sich, dass er doch erst am Anfang war, mit 23 Scout bei Bayern München. Er würde der beste aller Scouts werden, unbedingt.
Der Beruf war in Deutschland so jung, dass es keine deutsche Bezeichnung für ihn gab. Späher, Talentejäger, das hätte nach alten Zeiten geklungen, und dies war doch die Epoche des modernen Fußballs, alles wurde systematischer, wissenschaftlicher und vor allem größer. Talente sollten nicht mehr zufällig von einem befreundeten Kleinstadttrainer empfohlen werden, sondern jeder Winkel des Landes nach begabten Kindern durchforstet werden, jeder potenzielle Zugang in einer Datenbank erfasst. Wohl erst nach 1990 hatten die ersten Bundesligaklubs feste Stellen für Nachwuchsscouts geschaffen, und erst seit Neustem, seit 2000, wurden spezialisierte Scouts in allen Profiklubs eine Selbstverständlichkeit. Mrosko musste bei Gelegenheit Jürgen Rehberg von Schalke oder Wolfgang Geiger vom VfB Stuttgart nach den Anfängen fragen; wobei, wahrscheinlich musste er nicht danach fragen. Sie würden es gewiss von selbst erzählen. Obwohl es ein junger Beruf war, gab es selbstverständlich schon Kollegen, die wie Veteranen auftraten.
Sie standen zusammen hinter der einfachen Blechbalustrade am Fußballplatz der thüringischen Sportschule Bad Blankenburg, Rehberg mit der aufrechten Haltung und den sportlich-schicken Freizeithosen eines Tennislehrers, Geiger mit den melancholisch tief hängenden Augenlidern, Bernd Pfeifer von Werder Bremen, Peter Frahm vom HSV. Die 15, 20 üblichen Nachwuchsscouts waren zum DFB-Trainingslehrgang der besten 15-Jährigen Deutschlands gekommen.
Sie waren Konkurrenten. Sie traten stets als Gemeinschaft auf. Sie wohnten im selben Hotel, sie saßen bis nachts im Restaurant zusammen, sie standen beim Training in der Gruppe am Spielfeldrand. Es gab bei Lehrgängen und Länderspielen der Jugendnationalteams für alle dasselbe zu sehen, da brauchten sie sich nicht zu bekriegen. »Das ist kein James-Bond-Job, auf geheimer Mission hinter Hecken«, sagten die Veteranen zu Mrosko, und er nickte. Aber am nächsten Morgen schlich er trotzdem um acht aus dem Hotel Am Goldberg.
Er konnte zu Fuß gehen, über den Fluss Schwarza hinüber, in Bad Blankenburg hatte er das Gefühl, im Urlaub zu sein, das Hotel, gelb gestrichen, im Fachwerkstil am Waldesrand, die Abwesenheit von jeglichen Maschinengeräuschen. Sogar die Sportschule lag noch still, als er um zehn nach acht eintraf. Training war erst um neun. Er stellte sich an den Rand des Wegs zum Fußballplatz und versuchte, eine beiläufige Haltung einzunehmen, Hände in die Jeans, Hände aus der Jeans, doch besser in die Jeans. Es machte ihm nichts aus zu warten.
Gatzweiler kam in der Gruppe Frankfurter Spieler zum Training geschlendert, zwischen Daniyel Cimen und Joseph Mensah. Mrosko setzte sich in Bewegung, schnell genug, damit er nicht verdächtig wirkte, langsam genug, damit ihn die Frankfurter überholen konnten.
Er fing nur Fetzen des Gesprächs auf. Aber er hörte den einen Satz, für den sich der James-Bond-Einsatz schon gelohnt hatte.
»Jetzt macht euch doch nicht so einen Kopf«, sagte Marian Gatzweiler, »spielt einfach Fußball.«
Selbstverständlich konnte es bloß der banale Spruch eines 15-Jährigen sein, der vor seinen Mitspielern echt lässig wirken wollte. Doch jetzt gerade euphorisierte der Satz Mrosko. Nur er hatte ihn gehört, er hatte ihn ganz für sich allein, ein weiteres Mosaiksteinchen im Bild von Marian Gatzweiler, dem 15-jährigen Offensivspieler von Eintracht Frankfurt, der Fußball mit einer unverschämten Leichtfüßigkeit spielte. Der Junge war druckresistent, daran gab es immer weniger Zweifel, der Spruch musste ein weiterer, kleiner Beleg dafür sein.
Die Bayern hatten Marian Gatzweiler schon im Visier, das hatte ihm Chefscout Wolfgang Dremmler vor der Fahrt nach Bad Blankenburg erklärt, auf den Jungen sollte er besonders achten. Bayerns Honorarscout in Hessen hatte Gatzweiler bereits über ein Dutzend Male beobachtet, Mroskos Bewertung würde nur eine Komponente unter vielen sein, wenn Nachwuchsleiter, Chefscout und B-Jugendtrainer in München die Entscheidung trafen, ob sie versuchen sollten, den Jungen zum FC Bayern zu lotsen oder nicht. Aber in Bad Blankenburg am Spielfeldrand, da gab es nur noch Gatzweiler und ihn. Mit einer Körperdrehung schirmte der Junge den Ball vor dem Gegner ab und passte ihn weiter, alles in einer Bewegung, alles aus einem Guss, und in Mrosko pochte es. Er hatte gedacht, so ein Hochgefühl gebe es nur beim Anblick von Frauen, etwa als er ein WG-Zimmer gesucht hatte, und in Lichterfelde hatte Antje mit diesen dunklen Augen die Tür geöffnet. Einen Jungen mit graziöser Natürlichkeit am Ball zu sehen und zu spüren, der ist es, der wird mal einer, war eine neue Art, sich zu verlieben.
Gatzweiler täuschte mit dem Oberkörper an, als würde er außen am Verteidiger vorbeigehen, und war schon auf dessen Innenseite entschlüpft, nicht einmal 1,75 Meter groß, drahtig, aber mit einem gottgegebenen Gleichgewichtssinn, der ihn beim Körperkontakt mit robusteren Verteidigern auf den Beinen hielt, Gatzweiler beschleunigte, eine ästhetische Geradlinigkeit in den Bewegungen, er schoss, dem Ball mit dem Innenrist noch einen Tick mitgegeben, damit er sich in einer wunderschönen Flugkurve auf den letzten Metern von dem Torwart wegdrehte. Aber dieser Torwart schaffte es, dass Mrosko in dem Moment, in dem der Ball aufs Tor flog, Gatzweiler vergaß und nur noch an den Torwart dachte.
Der Torwart wurde beim Sprung immer länger. Wo holte er die Spannung aus seinem Körper? Er lenkte Schüsse mit den ausgestreckten Fingerspitzen um den Torpfosten, sodass Mrosko nur noch denken konnte: Leck mich am Arsch.
René Adler hieß der fliegende blonde Torwart.
Gatzweiler beschleunigte, Adler flog. Es war der Morgen eines beliebigen Wochentags, auf einem windanfälligen Sportplatz in der thüringischen Provinz, ein alltägliches Training von 15-Jährigen, eine merkwürdig eng zusammenstehende Gruppe von 15, 20 Männern als einzige Zuschauer; und wer in der Gruppe hatte nicht das Gefühl, dass gerade etwas Großes begann und sie die Ersten waren, die es sahen. Wer in der Gruppe konnte sich in solchen Momenten gegen das Gefühl wehren, dass alles Große in der Bundesliga auch mit ihnen begann.
Mrosko kannte René Adler nur zu gut. Er hatte den Jungen vor einem Jahr, 1999, beim DFB-Schülercamp in Berlin gesehen. Scout-Liebe auf den ersten Blick: Wie der Junge den Strafraum dominierte, wie er, als gäbe es keine Schwerkraft, den Ball beim Abwurf 40 Meter weit schleuderte, genau in den Lauf des Mitspielers.
Scout-Liebe auf den ersten Blick: Diesen 16-jährigen Torwart wollte Mrosko sofort, unbedingt verpflichten. René Adler hieß er. [1]
Mrosko wollte ihn sofort haben. Er arbeitete damals noch für den Zweitligisten Tennis Borussia Berlin, wo er als Jugendtrainer in dieses neue Ding Scouting reingeraten war, wo ihn einer der Honorarscouts des FC Bayern kennenlernen und den Münchnern empfehlen würde. Nachdem Mrosko den Nachwuchskoordinator von Tennis Borussia überzeugt hatte, dass sie diesen 14-jährigen Torwart haben mussten, dass es so einen Torwart nur einmal alle paar Jahre gebe, eilte er aufs Postamt, wo er sämtliche Telefonbücher von Deutschland fand. Er musste die Eltern des Jungen anrufen. Gut 60 Adlers waren in Leipzig registriert, okay, Café Adler und Adler-Apotheke konnte er streichen, aber er würde alle 58 Adlers anrufen, bis er die richtigen hatte.
Irgendwann, er hatte den Überblick verloren, ob beim 19. oder 25. Adler, war der Junge selbst dran. Höflich entschuldigte Mrosko die Störung und erkundigte sich, ob denn die Eltern auch zu Hause seien. So wie der Junge aussah, die weichen Züge im Gesicht, so zurückhaltend, aber aufgeschlossen, wie er sich auf dem Fußweg zum Training in der Gruppe der Mitspieler gab, glaubte Mrosko zu wissen, dies war ein ordentliches Elternhaus, da war es wichtig, die Form zu wahren: Nicht den 14-Jährigen anbaggern, sondern erst mit den Eltern reden. Ein guter Scout musste alles sehen, und er sah alles, fand Mrosko.
»Vati und Mutti sind gerade spazieren«, flötete der Junge, und Mrosko kombinierte, wie er »Vati und Mutti« sagt, das klingt nach einer engen Beziehung zu den Eltern; das wird nicht einfach, die Familie zu bewegen, René in Berlin auf ein Internat gehen zu lassen. Eine Stunde später rief Mrosko wieder an.
Er traf die Eltern in einem Hotel am Leipziger Bahnhof. Der Nachwuchskoordinator von Tennis Borussia hatte gesagt, fahr du hin, sprich du erst einmal mit den Eltern. Das war eine Beförderung: Er durfte, zum ersten Mal, den Klub bei Gesprächen mit Eltern repräsentieren, und dann gleich bei solch einem herausragenden Spieler. Mrosko wusste nicht, war er so glücklich, war er so aufgeregt? Vermutlich war er beides.
Hotels, dachte er sich, waren als Kulisse für solch ein Gespräch passender, seriöser als Cafés. Auch wenn das Hotel, das er am Bahnhof auswählte, ein Ibis war.
»Sie sind ja auch noch ganz schön jung«, sagten die Adlers.
Mrosko verstand es nicht als Zweifel an seiner Autorität, sondern als Einladung zu erzählen, von seiner Fußballkarriere in ambitionierten Amateurvereinen, von der Auszeichnung, in jungen Jahren schon einen derart verantwortungsvollen Job bei Tennis Borussia auszuüben.
Und René müsste in einem Sportinternat in Ost-Berlin wohnen und zum Training durch die ganze Stadt nach Charlottenburg fahren, hakten die Eltern nach. Es gäbe natürlich auch die Möglichkeit, den Jungen in einer Gastfamilie unterzubringen, meinte Mrosko spontan. Er wusste nicht, ob diese Möglichkeit tatsächlich bestand. Aber dann musste sie eben geschaffen werden.
Wie schnell das alles selbstverständlich geworden war: Kinder, die für den Fußball allein von Hamburg nach München, von Leipzig nach Berlin zogen, mit deren Eltern gefeilscht wurde, ob die 15-Jährigen 500 oder 600 Mark im Monat erhielten.
Als sie sich verabschiedeten, hatte Mrosko den Eindruck, das wird schwer, aber wir haben eine Chance. Die Jugendteams von Tennis Borussia waren die besten im ganzen Nordosten, und ihr Nachwuchskoordinator, Mirko Slomka hieß er, war eine Persönlichkeit, eloquent, pädagogisch, kompetent. Er musste Slomka gleich bitten nachzuhaken. Sie mussten dranbleiben. Einige Wochen später kam die Nachricht, der 14-jährige Torwart René Adler wechsle zu Bayer 04 Leverkusen.
So eine Scheiße, dachte Mrosko, oder murmelte er es schon, ich war da zuerst dran!
Rational betrachtet, hatten sie mit Tennis Borussia keine Chance, wenn einer der großen fünf deutschen Vereine einen Jungen lockte. Und natürlich hatte nicht nur er, sondern jeder Scout René Adler beim Schülercamp in Berlin gesehen. Doch das linderte den Liebeskummer nicht. Spieler, die er einmal entdeckt hatte, blieben seine Spieler. Es schmerzte, wenn sie ihm ein anderer Verein wegschnappte, wenn ein anderer offiziell sagen konnte: Ich habe ihn entdeckt.
»Niemand entdeckt einen Spieler«, sagten die Veteranen zu Mrosko. Das sei nur so ein blödes Etikett der Presse: der Entdecker von Rummenigge, Dettmar Cramer; der Entdecker von Lothar Matthäus, Hans Nowak. Das Talent eines Fußballers wie Matthäus entdecke jeder, der ihn sehe. Und dann brauchte es immer – auch bei einem Spieler wie Matthäus – etliche Förderer, nicht den einen: seine Jugendtrainer, den Mann mit den Kontakten, der ihn Borussia Mönchengladbach empfahl, seinen ersten Profitrainer, der ihn trotz seines zarten Alters schon in der Bundesliga einsetzte. Das klang logisch. Abends im Speisesaal des Hotels Am Goldberg bestellten die Scouts dann eine Schlachtplatte und erzählten, wer von ihnen welchen Klassespieler entdeckt hatte.
Vieles konnte ein Scout lernen. Technische Kriterien zur Spieleranalyse ließen sich von Trainern und Kollegen aufschnappen, geht der Rechtsaußen immer nur rechts am Gegner vorbei, weil er den Ball mit links gar nicht spielen kann, solche Sachen. Aber den Blick, glaubte Mrosko, den hatte man oder man hatte ihn nicht. »Ich erkenne in fünf Minuten, ob einer geradeaus laufen kann«, hatte er dem Reporter der B. Z. gesagt, als die einen Artikel über ihn veröffentlichten, war ja eine Story, Bayern München holt 23-jährigen Berliner. »Ich erkenne in fünf Minuten, ob einer Profi wird«, machte die Boulevardzeitung dann aus seinem Zitat. Las sich natürlich ein bisschen großspurig und war auch großer Quatsch. Ob einer Profi wurde, erkannte kein Mensch, bis der Junge wirklich einen Profivertrag unterschrieb. Aber alles in allem war der Artikel trotzdem cool. Denn der Text bestätigte doch, was Mrosko ahnte: Er hatte den Blick, für die Frauen wie für die Fußballer, Yvonne, Antje, René Adler, Marian Gatzweiler.
Zu Hause in Berlin, zurück vom Trainingslehrgang in Bad Blankenburg, trug Mrosko seine Bewertungen säuberlich in die vorgedruckten Analysebögen des FC Bayern ein. Die Kategorien waren vorgegeben, Größe, Fuß, Schnelligkeit, Passspiel, Zweikampfverhalten, Charakter, einiges mehr, Gesamteindruck. Für jede Eigenschaft musste er neben der Beschreibung Punkte auf einer Skala von 0 bis 10 vergeben. Angstfrei, notierte Mrosko neben etlichen Höchstnoten bei Gatzweiler, Marian. Per Fax reichte er seine Empfehlungen an die Klubzentrale weiter und erfuhr nie, ob seine Meinung irgendeinen Einfluss hatte.
»Ein Scout ist immer nur ein Zulieferer«, sagt er und versucht, emotionslos zu klingen. Er trägt Motorradkleidung in der Sonne, ein Bekannter hat ihm seine Yamaha geliehen. Lars Mrosko besitzt gerade kein Fahrzeug. Aber irgendjemand leiht ihm immer ein Auto oder Motorrad, in Berlin-Neukölln. Es ist September 2014, er hat Fieber. Zu unserem Treffen ist er trotzdem gekommen. Verlässlich zu sein bedeutet ihm weiterhin sehr viel. Wir sitzen auf Plastikstühlen im Eiscafé di Russillo an der Johannisthaler Chaussee; direkt unter dem 19-stöckigen Hochhaus, aus dem einmal eine Lackbombe flog. Heimat bedeutet in seinem Fall auch die Sehnsucht, immer wieder in die Jugend zurückzukehren. Der Berliner Südwesten ist sein Kiez geblieben, selbst wenn das Fußballgeschäft ihn nach Hamburg oder Wolfsburg verschlägt.
Seit 16 Jahren arbeitet er im Profifußball. Es war just die Zeit, als der Sport, befeuert vom Fernsehen und der Werbeindustrie, zum großen Unterhaltungsspektakel des angehenden 21. Jahrhunderts mutierte. Abend für Abend wird der Fußball nun für ein Millionenpublikum in Szene gesetzt. Dutzende Kameras fangen jede Bewegung auf dem Rasen ein und holen uns die Gesichter, die atemlosen Statements, die Gefühle der Fußballer ganz nah heran. Nur ab und an fragen sich manche von uns, wie es wohl hinter dieser inszenierten Oberfläche wirklich zugeht.
Die Lebensgeschichte von Lars Mrosko, den keiner der Millionen Fußballfans kennt, erlaubt uns einen Blick hinter die Kulissen der Bundesliga.
So oft sagen Teambetreuer, Mannschaftsärzte, Spielerberater: »Ich könnte ein Buch schreiben.« Und dann erzählen sie hinter vorgehaltener Hand ihre Geschichten. Aber ein Buch schreiben sie nie. Die Furcht, ihren Platz in der Bundesliga zu verlieren, ist stets der stärkere Impuls. Trotz oder gerade wegen all der Kameras wird im Fußballbetrieb das Gesetz des Schweigens geachtet: Was in der Branche passiert, bleibt in der Branche.
Bücher, die einen Blick in solch eine abgeschottete Szene werfen, blasen oft gewollt oder ungewollt die unerhörten und niederträchtigen Ereignisse auf. Dieses Buch will alles andere als eine Skandalschrift sein. Lars Mrosko nimmt uns mit in den Alltag der Bundesliga, zu Startrainern und Hilfsarbeitern, und hoffentlich wird dabei beiläufig klar, wie der moderne Profifußball funktioniert.
Er ist als Scout 220 Tage im Jahr unterwegs, wenn der Rücken schmerzt, nimmt er eine Ibuprofentablette, und noch eine. Und noch eine. Er erlebt einen Trainer wie Felix Magath, der seine Spieler drillt, der ihn, den Scout, aber mit Zuneigung und echtem Vertrauen einbindet wie niemand zuvor und danach. Zusammen mit den Scouts der anderen Vereine schmuggelt er bei einer Junioreneuropameisterschaft ihren Fahrer ins Stadion. Er steht bei einem seriösen Verein wie dem VfL Wolfsburg eines Morgens fassungslos in der Bürotür: Sein Schreibtisch wurde über Nacht komplett leer geräumt; er glaubt, um ihm zu zeigen, du hast hier keinen Platz mehr. Er – wie kann er es erklären? – liebt dieses Spiel, diese Welt wahnsinnig.
Wer, wie die meisten von uns, in einem mehr oder weniger geordneten Umfeld aufgewachsen ist, wird nicht nur einmal staunen über Lars Mrosko und seine Freunde und Bekannte, die sich in der Halbwelt des Profifußballs unter dessen glamouröser Oberfläche tummeln; und mit Halbwelt meine ich keine kriminelle Handlungen, sondern ein Leben, in dem viele mit kleinen Rollen, kargen Gehältern und vagen Aussichten über Jahre ausharren, um irgendwie, wenigstens halb, dazuzugehören. Und sich einige wenige mit ungeheurem Fleiß und Talent etablieren.
Stendal war eines der nächsten Reiseziele nach dem DFB-Trainingslehrgang in Bad Blankenburg. Lars steuerte den roten Madza, und Hotze schlug ihm bei 180 Stundenkilometern vom Rücksitz mit der Zeitung ins Gesicht. So war die Fahrt ein bisschen aufregender.
Sie besuchten Shergo.
Shergo war im Juni 2001 zu Altmark Stendal gewechselt, weiterhin vierte Liga, offiziell Amateurfußball, aber Stendal hatte ihn als den Stürmer aus Berlin geholt, als Shergoal, da war er König, da gab es 2000 Mark, Wohnung und Auto gratis. Den Großteil des Geldes erhielt Shergo nicht vom Verein, sondern vom Arbeitsamt. Altmark Stendal hatte eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme beantragt und ihn offiziell als Gärtner angestellt, damit der Staat den Stürmer unwissentlich mit ABM-Geldern finanzierte. Einmal musste Shergo tatsächlich schnell in die grüne Latzhose schlüpfen und den Fußballrasen harken. Es kam eine Kontrolle. Bei der Bleibe, die der Klub ihm stellte, handelte es sich um eine Einzimmerwohnung in der Plattenbausiedlung. Sein Dienstwagen war ein gebrauchter Toyota Corolla mit 325000 Kilometern und einer Öllampe, die permanent leuchtete.
Shergo schlug die Tür des Corolla ständig mit Gewalt zu, er rollte beim Parken mit der Stoßstange gegen Mauern, damit die alte Kiste endlich kaputtging und er einen neuen Wagen fordern konnte. Aber der Corolla hielt stand.
Sie hatten sich ein paar Wochen nicht gesehen, das Wiedersehen musste gefeiert werden, bis vier im Miami, und Shergo ging am nächsten Morgen um halb zehn trainieren, das war ein echter Fußballer, bis zum Ende der Nacht dabei, und am nächsten Morgen schoss er seine Tore. Die anderen verschliefen den Morgen.
Sching-schang-schong, wer verlor, musste als Erster aufstehen und die Rollläden hochziehen.
»Oh, guckt mal hier«, sagte Bodden, als er gegen elf, halb zwölf aus Shergos Fenster schaute.
Im Innenhof der Plattenbausiedlung hielten sich zwei junge Frauen auf. Die Jungs pfiffen. »Hallo«, rief Bodden, »ich komm gleich runter und suche mir eine von euch aus!« Die Frauen lächelten, wie um das Bemühen der Jungs anzuerkennen, und schauten gleichzeitig angestrengt zur Seite. Die Jungs mussten sich steigern. Bodden ließ die Unterhose herunter und schwenkte seinen nackten Hintern im Fenster.
War nur ein kleines Vergnügen, längst vergessen, als Shergo vom Training zurückkam und sein Telefon klingelte. Jürgen Döbbelin war dran, der Präsident von Altmark.
»Shergo Biran!«
»Ja, Herr Präsident?«
»Elisabeth Berninger hat hier angerufen.«
»Wer?«
»Du gehst sofort zu ihr und entschuldigst dich.«
»Ich verstehe nichts.«
»Deine Nachbarin! Sie hat dich gesehen, wie du vorhin deinen nackten Arsch aus dem Fenster gestreckt hast!«
»Aber ich war doch gar nicht zu Hause, ich war doch beim Training.«
»Sie hat dich erkannt. Südländischer Typ, schwarze Haare.«
Shergo versuchte, ernst zu schauen, als er sich wieder seinen Freunden zuwandte, und musste lachen. »Seid ihr bescheuert?«
Sie kauften gemeinsam Pralinen und Blumen. Sie kamen sich richtig gut vor, wie Schauspieler, das war mal eine Unternehmung, Blumen kaufen.
»Hallo?«, krächzte die Frauenstimme in der Sprechanlage im Plattenbau gegenüber von Shergos Wohnung.
»Frau Berninger, hier ist Shergo Biran von Altmark Stendal. Ich wollte mich bei Ihnen entschuldigen. Da gab es wohl ein Missverständnis. Können Sie mir bitte aufmachen?«
»Eine Unverschämtheit war das, du Ferkel!«
»Ja, Frau Berninger, lassen Sie mich doch bitte hochkommen, um es zu besprechen.«
»Da gibt’s nichts zu besprechen!«
»Bitte. Meine Freunde haben sich nur einen kleinen Spaß erlaubt. Aber es liegt ein Missverständnis vor, wenn Sie glauben, einer meiner Freunde hätte Ihnen sein Gesäß entgegengestreckt.«
»Gesäß? Den Pillermann habe ich gesehen!«
Antje nannte es »deine Welt«, wenn Lars mit den Jungs loszog. Damit war klar zum Ausdruck gebracht, es war nicht ihre Welt. Sie studierte Medizin. Einmal hatte sie einen Brief von Lars aufgemacht, schließlich waren sie zusammen, und der graue Brief sah so offiziell, so besorgniserregend aus mit der Aufschrift »Amtsgericht Neukölln«. »Vollstreckungsbescheid«, stand fett gedruckt auf dem grauen Papier.
Es war auf gewisse Weise auch eine Erleichterung, dass ihr Lars daraufhin von den 75000 Mark erzählen musste. Er habe einfach zwei Jahre lang nichts bezahlt, keine Miete, kein Telefon, nichts, und dazu bei der Sozialhilfe beschissen. Was er sich dabei gedacht habe? Nichts. Er habe gedacht, irgendwann werde er schon wieder zahlen. Aber das liege hinter ihm, fand Lars, auch wenn die Schulden zum größten Teil noch vor ihm lagen. Er führte nun ein anderes Leben.
Als er das Abendgymnasium abbrach, nahm es Antje persönlich. Er wollte doch ein anderes Leben führen!
Die Schule habe sich einfach nicht mit seiner Arbeit für Bayern München vereinbaren lassen, sagte Lars, und weil das stimmte, musste er auch nicht zu erkennen geben, wie erleichtert er war, die Schule aufzugeben.
Über einige Wochen hatte er auf dem Charlotte-Wolff-Kolleg in Berlin-Wilmersdorf Faxe von Bayern München vorgelegt. Wolfgang Dremmler, Chefscout des FC Bayern, bat Herrn Mrosko am Dienstagabend und dann am nächsten Mittwoch und wieder am nächsten Donnerstag zu entschuldigen, weil er für den Verein seiner Sichtungsarbeit nachgehen müsse.
Es freue ihn, dass er solch einer bedeutenden Arbeit nachgehe, sagte der Kollegdirektor eines Abends zu Lars, aber die Schule dürfe keinen Unterschied machen, ob einer beim Friseursalon Schmitz oder beim FC Bayern arbeite. Wer die Anwesenheitspflicht nicht erfülle, könne kein Abendabitur machen.
»Ich habe doch gar keine Wahl«, sagte Lars zu Antje und strengte sich an, nicht zufrieden zu klingen. »Oder soll ich etwa für die Schule meinen Posten bei Bayern München aufgeben?« Für einen ganz kurzen Moment kam ihm der Gedanke, dass es vielleicht sogar Verrückte gab, die eine gute Schulbildung einem Nebenjob beim Fußballmeister vorzogen; in ihrer Welt.
In jenen Tagen, als er im Briefkasten schon keine guten Nachrichten mehr erwartete, traf ein Päckchen von Bayern München für Mrosko ein. Die Sekretärin schickte ihm einen offiziellen Klubtrainingsanzug und schrieb, man freue sich, ihn bei den FC-Bayern-Talenttagen in München zu begrüßen. Mrosko hielt den Trainingsanzug in der Hand und war ergriffen. Er stand schon seit Monaten ständig als Mann des FC Bayern bei Jugendspielen am Spielfeldrand, aber das Gefühl, zum FC Bayern zu gehören, war doch ziemlich abstrakt geblieben, in Jeans und Carlo-Colucci-Pullover auf dem Nebenplatz der Reinickendorfer Füchse. Zumal dort gerade niemand wissen sollte, dass er von den Bayern kam. Der Trainingsanzug dagegen machte für ihn die Größe des Klubs greifbar: ein Verein, der seinen Angestellten für einen zweitägigen Einsatz beim Kinderfußball selbstverständlich einen 120 Mark teuren Trainingsanzug schenkte.
Ein-, zweimal im Jahr kam Mrosko in die Klubzentrale an der Säbener Straße, zur Scoutingsitzung oder eben zu den Talenttagen. Rund 500 Kinder zwischen sieben und elf Jahren durften an zwei Tagen beim FC Bayern vorspielen. Im Klubrestaurant, von dessen Terrasse im ersten Stock der Blick wunderbar über alle Fußballplätze ging, kamen die Kellner nicht mehr hinterher, Eltern mit roten Köpfen zu bedienen. Heiner Schuhmann, der damalige Nachwuchskoordinator des FC Bayern, hatte die Idee der Talenttage Mitte der Neunzigerjahre von Ajax Amsterdam abgeschaut. Der deutsche Fußball spürte, irgendwie war er plötzlich ins Hintertreffen geraten mit seinen jahrzehntealten Gewissheiten, dem Libero, der Manndeckung, den Predigten vom »Zweikampf gewinnen!«, und in ihrer tiefen Verunsicherung kopierten die Deutschen einzelne Ideen von anderen Fußballnationen. Irgendwas mussten sie tun. Auch wenn sie noch nicht so ganz genau wussten, was.
Die Jugendtrainer des FC Bayern organisierten Übungen für die 500 Kinder, alle 16 Nachwuchsscouts waren aus ganz Deutschland angereist, standen in ihren neuen Trainingsanzügen am Spielfeldrand und sichteten das Gewusel. Es hatte keine Vorsichtung stattgefunden, die Kinder kamen teilweise auf Empfehlung von Provinztrainern oder aber auch nur mit den Träumen von ehrgeizigen Eltern aus der ganzen Republik, Kiel, Essen, Oberliederbach. Am Ende der Talenttage wurden von den 500 vielleicht ein oder zwei Kinder in die Nachwuchsteams des FC Bayern aufgenommen.
Als Werbeaktion waren die Talenttage ein Coup. Die Kinder und Familien würden den FC Bayern fest ins Herz schließen. Aber ob es wirklich eine sinnvolle Art war, Talente zu finden? Was brachte es überhaupt, ein achtjähriges Talent aus Kiel zu entdecken, wenn es aufgrund der Entfernung frühestens in sieben Jahren zum FC Bayern ziehen konnte; wer wusste schon, ob es dann noch ein Talent war.
Mit Bayerns Chefscout Wolfgang Dremmler konnte Mrosko über solche kritischen Gedanken offen reden. Schon die Augen bewegten sich bei Wolfgang Dremmler mit einer ansteckenden Ruhe.
Mrosko musste innerlich lachen, wenn er an den ersten Kontakt zurückdachte, im Sommer 2000. Dremmler rief nicht bei ihm, sondern bei seinem Vater an, keine Ahnung, wie er an die Nummer gekommen war, der FC Bayern würde doch nicht auch die Nummern von neuen Kontakten im Ausschlussverfahren aus dem Telefonbuch herausfiltern?
Der Vater überbrachte Mrosko die Nachricht sofort aufgeregt: »Wolfgang Dremmler hat angerufen!«
»Wer?«
»Mann Gottes, Lars, habe ich dir überhaupt was beigebracht! Kennst du Wolfgang Dremmler nicht.«
»Und wer ist das jetzt?«
»Der hat für Deutschland im WM-Finale 1982 gespielt.«
»Ist ja schön für ihn. Aber was will er von mir?«
»Was weiß ich! Aber er ist jetzt bei Bayern München! Du sollst ihn zurückrufen. Mach das sofort. Damit ich wenigstens sagen kann: Alles macht mein Sohn doch nicht falsch.«
Mrosko wählte die Nummer, die ihm der Vater diktiert hatte.
Er habe aufgrund einer Empfehlung von Ralf Kohr angerufen, der für den FC Bayern Nachwuchstalente in Hessen sichte, sagte Dremmler. Kohr habe Mrosko als Scout von Tennis Borussia bei Jugendspielen kennengelernt und ihn wärmstens empfohlen. Der FC Bayern suche noch einen Nachwuchsscout für den Großraum Berlin, ab und an auch Fahrten zu Auswahllehrgängen. Könnte sich Mrosko vorstellen, für den FC Bayern zu arbeiten?
»Vorstellen kann ich mir sehr viel«, sagte Mrosko.
Ein paar Tage später, August 2000, holte er Dremmler am Flughafen Berlin-Tegel ab. Dremmler war Mitte 40, das korrekte Karohemd kombinierte er gerne mit der jugendlichen Lederjacke. Er hatte 13 Jahre Bundesligafußball für Braunschweig und Bayern vorzuweisen, ein Scout der ersten Generation, seit 1995. Mrosko erzählte seinem Vater nicht, dass er schwitzte, ob er Dremmler am Flugsteig erkennen würde.
Dremmler wollte den Amateurklub FC Schönberg 95 bei einem Auswärtsspiel in Brandenburg an der Havel beobachten. Es war der Gegner der Bayern in der ersten Runde des DFB-Pokals. Nebenbei konnten sie sich kennenlernen.
Was wolle er denn verdienen, fragte Dremmler auf der Autofahrt durch Wälder und Felder.
Das ist der FC Bayern, dachte Mrosko, jetzt musste er ein richtig hohes Gehalt nennen, allein schon, um sich nicht lächerlich zu machen – und vor allem auch, um es zu kriegen. »6000 Mark«, sagte er.
Das war ein ordentliches Gehalt für Festangestellte wie einen Großhandelskaufmann oder den Redakteur einer Lokalzeitung, die schon zehn, 15 Jahre in einem Betrieb arbeiteten.
Also, die Hälfte sei dann doch eher realistisch, sagte Dremmler. Er schien in keiner Weise irritiert über die überzogene Forderung. Er hatte es sich, nach so vielen Jahren im Fußball, angewöhnt, die aberwitzigsten Ideen und Taten von jungen Männern stoisch zu registrieren.
Dremmlers ruhige Reaktion gab Mrosko den Mut, auch eine noch ungewöhnlichere Gehaltsvorstellung vorzutragen: Wäre es möglich, dass er offiziell nur 630 Mark verdiene?
Das war der steuerfreie Höchstsatz. Von allem, was er darüber hinaus verdiente, würde ihm das meiste gepfändet, er habe da noch einige Zwangsvollstreckungen am Hals, Jugendsünden. Den Rest des Gehalts würde er dann über das Kilometergeld abrechnen, sagte Mrosko und wartete nervös auf die Reaktion.
Naja, üblich sei das ja nicht, sagte Dremmler, aber er solle sich keine Sorgen machen, irgendeinen Weg würden sie schon finden, um ihm zu helfen.
Für Dremmler würde er durchs Feuer gehen, schwor sich Mrosko. Und falls er fiktive Kilometer abrechne, um auf sein Gehalt von 3000 Mark zu kommen, dann werde er keinen fiktiven Kilometer zu viel abrechnen. Korrekt zu sein war wichtig, auch beim Schwindeln.
Wenn er Dremmler bei seinen Besuchen in der Klubzentrale sah, blühte Mrosko auf. Dremmler fragte ihn, er war aufrichtig an seiner Meinung interessiert. »Lars war ein vernünftiger Kerl, sehr fleißig, sehr gewissenhaft in seiner Arbeit«, sagt er noch heute.
Das Sichtungssystem der Bayern im Nachwuchsbereich mit den 16 Regionalscouts sei überdimensioniert, sagte Mrosko Dremmler: »Jeden Montag erhaltet ihr 16 Berichte, über 300 Spielerbewertungen, das könnt ihr doch gar nicht verarbeiten.«
95 Prozent des Scoutings, erklärte ihm Dremmler, diene dazu, Spieler auszuschließen, Fehleinkäufe zu verhindern.
Dremmler fragte weiter. Mrosko habe doch seinen Besuch bei den Talenttagen genutzt, sich auch die Nachwuchsmannschaften der Bayern anzuschauen. Wer habe ihm gefallen?
Piotr Trochowski! Ein 17-Jähriger, der schon in der zweiten Männerelf spielte. Der konnte Abwehrriegel mit seinem Dribbling sprengen, der machte unvorhersehbare Dinge; den hätte man auch in Neukölln beim Spiel auf der Straße gebrauchen können.
Und Philipp Lahm, der zentrale Mittelfeldspieler der A-Jugend?
Der war in Ordnung, bissig, sauberer Pass. Warum fragte Dremmler?
Nur so, weil manche im Klub meinten, der FC Bayern sollte Lahm abgeben. Der werde nie ein Spitzenspieler, viel zu klein, gerade mal 1,70 Meter.
Wer nicht mindestens 1,85 Meter groß sei, könne nichts werden, glaubten viele, glaubte 2001 vermutlich sogar eine klare Mehrheit im deutschen Fußball.
Obwohl Mrosko Dremmlers Wertschätzung spürte, antwortete er in ihren Gesprächen fast nur. Er dachte, es stehe ihm nicht zu, auch zu fragen. Zum Beispiel: Holt ihr Gatzweiler?
In seinem Bestreben, ein anderer Mensch zu werden, fuhr Mrosko sogar mit Antje nach Saalbach-Hinterglemm in den Snowboardurlaub. Oh Mann, dachte er, zum ersten Mal Silvester ohne die Jungs. Aber er sagte nichts.
Ein befreundetes Pärchen, beziehungsweise ein Pärchen, mit dem Antje befreundet war, begleitete sie. Abends vergnügten sie sich mit Würfelspielen. Mit den Jungs spielte er doch auch immer Monopoly oder Risiko. Was fehlte ihm jetzt also?
»Antje, ich muss noch mal vor die Tür«, sagte er.
Es war halb elf in der Nacht. Durch das Fenster einer Skihütte sah er Leute auf Sitzbänken tanzen und war schon drin. Ein paar Mädchen luden ihn ein, einen Kleinen Feigling mit ihnen zu trinken. Als er schließlich irgendwann meinte, so, er gehe jetzt, war es 7:30 Uhr am Morgen.
»Was denn?«, sagte er, als sich Antje aufregte. »Du hättest doch einfach mitkommen können.«
Abends, während des Jugendländerpokals in Wedau, unterhielt er die Nachwuchsscouts am langen Tisch im Mamma Leone mit seinen Geschichten. Auf den doppelt gelegten, steifen Tischdecken des Restaurants am Duisburger Hauptbahnhof waren schon ein paar Flecken, es wurde noch Wein nachbestellt, und Mrosko erzählte von Lackbomben, nackten Hintern im Fenster oder Après-Ski-Partys, auf denen er sich bei den Mädels mit dem Entree vorgestellt hatte: »Ich bin der Olove.« – »Wie heißt du? Olaf?« – »Nein, Olove.« Manches klang ein wenig pubertär, aber wenn Mrosko es erzählte, mussten die Scouts, nicht ohne Zuneigung, lächeln. Er war ihr Jüngster, er hatte, was man wohl eine Berliner Schnauze nannte. Er platzte geradezu vor Lebensfreude. Da war es natürlich, dass der jugendliche Enthusiasmus manchmal mit ihm durchging.
Wenn er außer Hörweite war, bestätigten sich die Veteranen, dass Mrosko nicht nur ein Typ, sondern ein Talent war. »Wenn junge Leute so dynamisch sind und Bock haben, gefällt mir das«, sagte der große Rehberg von Schalke 04. »Du merkst sofort: Er hat einen Blick für Fußballer, und er ist überall«, sagte Andreas Bergmann, der Jugendkoordinator des FC St. Pauli. Mit der großen Klappe und dem Umfeld, aus dem Mrosko offensichtlich kam, war es gut möglich, dass er auch mal Ärger mit der Polizei gehabt hatte, dachte sich Bergmann. Aber sicher nichts Ernsthaftes, keine Gewalttaten, nein, gewiss nicht.
Oder?
Im Mamma Leone wandte sich das Gespräch wieder dem Fußball zu.
»Der Cimen hat schon Bartwuchs, mit 15, da muss man vorsichtig sein, ob der sich körperlich überhaupt noch entwickelt.«
»Da musst du mal seinen Vater und seine Mutter treffen. Dann weißt du, welche Statur du bei ihm erwarten kannst.«
»Ich versuche, die Eltern von interessanten Spielern immer zu Hause zu treffen: Da kannste auch ins Kinderzimmer von den Jungs schauen, welche Poster hängen da, nur von Mehmet Scholl und Lars Ricken oder auch von Christina Aguilera? Da kriegst du schon einen Eindruck, ob der Junge auf Fußball fokussiert ist.«
»Ich war letztes Jahr bei einem Jungen in Waltrop, Alexander Baumjohann«, sagte der große Rehberg, »bei dem hing das ganze Zimmer voller Dortmund-Poster. Und ich sollte ihn überzeugen, zu Schalke zu kommen! Aber ich habe ihn tatsächlich gekriegt. Tjaaaa«, er zögerte die Pointe noch ein wenig heraus: »Glück gehabt. Die Dortmunder waren erst 14 Tage später da.«
Bei den Scouts fühlte sich Mrosko glücklich. Was heißt glücklich, aufgehoben war das bessere Wort. Glücklich würde er sich erst fühlen, stellte er sich vor, wenn er einmal erzählen konnte, wie er den und den Bundesligaspieler entdeckt hatte.
Fast genau zehn Jahre, nachdem er die Eltern von René Adler im Ibis-Hotel vergeblich umworben hatte, würde das ganze Fußballland René Adler von Bayer Leverkusen entdecken. 2008 wurde Adler Nationaltorwart. Marian Gatzweiler spielte zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr Fußball.
Bayern München hatte den 15-jährigen Gatzweiler schließlich nicht unter Vertrag genommen, die Gründe erfuhr Mrosko nie. Mit 18, als Jugendnationalspieler, verschwand Gatzweiler dann schlagartig aus dem Fußball. Pfeiffersches Drüsenfieber, sagte man Mrosko.
Mrosko verstand, niemand konnte bei einem 15-Jährigen erkennen: Der wird Profi. Trotzdem dachte er weiterhin beim Anblick von 15-Jährigen: Der ist es, der wird es! Ohne diese Überzeugung war ein Scout verloren, orientierungslos.
Nach dem Länderpokal für 16-Jährige in Wedau im Juni 2001 war eine Woche Pause, dann würden sich die Nachwuchsscouts beim DFB-Schülerlager in Kaiserau schon wiedersehen. Für eine Woche lohnte es sich gar nicht, nach Hause zu fahren, sagte sich Mrosko und fragte Uwe Vester, der ihm mit 29 vom Alter her unter den Nachwuchsscouts noch am nächsten kam: Fahren wir in den Urlaub?
Mrosko hatte eine Sonderprämie von 5000 Mark erhalten, weil Bayern München im Finale von Mailand gegen den FC Valencia die Champions League gewonnen hatte. Ist ja irre, dachte er sich, dieser Verein hatte Stil: Offenbar partizipierte jeder Mitarbeiter des FC Bayern am Erfolg der Profis, selbst wenn er, so wie Mrosko, gar nichts dafür getan hatte. Mit den unverhofften 5000 Mark konnte er seine Schulden reduzieren. Nur das Geld für ein Campingzelt zweigte Mrosko ab und reiste mit Uwe Vester nach Sylt.
Vester hatte zu Hause in Halle an der Saale höherklassige Amateur-Jugendmannschaften trainiert, in Leipzig Sport studiert und nach dem Abschluss einen ganzen Stapel blinder Bewerbungen an die Fußball-Profiklubs geschickt, um einfach mal reinschnuppern zu können. Er wollte keine konkrete Stelle. Er wollte irgendwie rein in die Bundesliga.
Einer antwortete auf die rund 30 Bewerbungen. Schalkes Nachwuchsleiter Helmut Schulte bot ihm an, Vester solle halt einfach einmal eine Woche vorbeikommen. Das war alles, was er an Kontakten in den Profifußball hatte, ein einwöchiges Praktikum. Daraus musste er seine Karriere zimmern. Vester versuchte, den Kontakt zu Schalke zu halten, ohne aufdringlich zu erscheinen. Er rief mal an, er kenne jemanden, der ein Softwareprogramm für Scoutingdaten entworfen habe, und irgendwann riefen Schulte oder der große Rehberg auch mal zurück, kenne er diesen 14-Jährigen da aus Rostock. Zwei Jahre wartete Uwe Vester, ehe ihm Schulte tatsächlich so etwas wie eine Stelle anbot: Vester wurde Assistenztrainer der C-Jugend, dazu Assistent von Rehberg in der Scoutingabteilung – Datenbank pflegen, mal einen 13-Jährigen beobachten, einfach ans Telefon gehen –, und sollte mithelfen, an der Gesamtschule Berger Feld einen speziellen Zweig für Fußballtalente aufzubauen. Drei Aufgaben, mehr als ein Vollzeitjob, für ein Teilzeitgehalt. Das bot der moderne Profifußball, vom dem es in Zeitungsberichten immer hieß, er schwimme nun im Geld, üblicherweise jenen, die im Nachwuchsbereich am Fundament arbeiteten.
Mrosko und Uwe Vester bauten das Zelt auf dem Campingplatz auf Sylt an einer abschüssigen Wiese auf. Ein anderer Platz war nicht mehr frei. Morgens wachten sie beide im unteren Eck des Zeltes auf. Sie waren im Schlaf die Schräge heruntergerutscht.
In einem Internetcafé riefen sie ihre E-Mails ab. Sie waren auch im Urlaub im Dienst. Antje schrieb ihm, sah Mrosko. Sie machte ein Praktikum in Amerika. Sie teilte ihm mit, dass ihre Beziehung vorüber sei. Er überflog die Zeilen, er war sich irgendwann nicht mehr sicher, hatte sie das Folgende wirklich geschrieben, oder hatte er die Botschaft nur aus ihren Sätzen destilliert: »Ich habe dich nicht hingekriegt, Lars.«
Scheiße, sagte Mrosko zu Uwe Vester. Aber gut, dann hatte er jetzt auch keinen Grund mehr, so zu leben, wie es Antje für ihn vorgeschwebt hatte. Sie tranken Cocktails und gingen in ein Sportgeschäft, wo sich Mrosko Turnschuhe, Fußballschuhe, T-Shirts, Kapuzenpullover, Trainingsjacken kaufte und zur Verkäuferin sagte: »Alles, was ich nehme, bitte zweimal.« Die komplette Montur, die er sich ausgesucht hatte, schenkte er auch Uwe Vester. Mrosko bestellte mehr Cocktails, kaufte mehr Klamotten, bis die 5000 Mark weg waren.
2
Die Gropiuslerche
Die Töne des Synthesizers wurden heller, dramatischer, gleich musste Stevie B mit dem Gesang einsetzen. Doch es erklang ein Röhren. Mrosko sang zu Because I Love You von Stevie B mit. Die drei Jungs bei ihm im Auto lachten, Alexander Jakowitz, Gökhan Senol, Ifet Taljevic. Sie waren im Mai 2001 auf dem Weg von Berlin zu einem dreitägigen Probetraining bei Bayern München.
»Bejos I love juuu«, schmetterte Mrosko in einer neuen Sprache, die Berlinglisch sein musste. »Was lacht ihr, ich war mal in einem Chor!«, protestierte er, und die Jungs lachten noch lauter.
Er hatte wirklich in einem Chor gesungen, mit zehn, elf, bei Herrn Jahn und den Gropiuslerchen. Einmal waren sie mit dem Dirigenten James Last sogar im Fernsehen aufgetreten, in einer Show von Michael Schanze. Der Schanze war vielleicht unfreundlich gewesen. Mrosko schüttelte die Erinnerung an seine Kindheit ab. Er wollte sich nicht die Laune verderben lassen.
»I’ll jive ju my heart, my everyding«, sang er weiter. Die schmalzigsten Lieder wurden zu Hymnen, wenn er sie in einem erhabenen Moment hörte, wenn er sie für immer mit dem Moment verband. Von Berlin nach München waren es 585 Kilometer, bei dem Tempo, das er draufhatte, würden sie in weniger als fünf Stunden dort sein. In fünf Stunden hörten sie das Stevie-B-Album sechsmal.
Das, fühlte Mrosko, war sein Moment. Die Jungs hatte er entdeckt. Wenn er es genau nahm, waren Jakowitz und Senol wahrscheinlich sogar die ersten Talente, die er jemals gescoutet hatte; mal abgesehen davon, dass er vor zwei Jahren noch nicht gewusst hatte, dass man das Scouting nannte. Als Jugendtrainer von Tennis Borussia hatte er sie im Sommer 1999 beim Fußball beobachtet und zu TeBe gelotst. Jakowitz hatte er sogar getauft: auf den Spitznamen Sparwasser. Keine Ahnung, ob Jürgen Sparwasser so gespielt hatte wie Alex Jakowitz. Es war bloß der einzige DDR-Angreifer, der Mrosko eingefallen war. Um Senols Kosenamen brauchte er sich nicht zu kümmern. Alle riefen ihn Diego. Senol selbst wusste wahrscheinlich gar nicht mehr, dass er eigentlich Gökhan hieß.
Wenn Bayern die Jungs nehmen würde, seine Jungs, da würde er ’ne Rakete starten, dachte sich Mrosko. Nichts machte ihn so glücklich wie das Gefühl, anderen zu helfen. Wenn er nur noch 20 Mark hätte, würde er ihnen trotzdem 19 geben, bestätigten Shergo, Bodden und Ente; ey, so war der Lars, loyal bis zur Selbstaufgabe. Und kaum einer merkte, dass Mrosko abhängig war von dem Drang, anderen Gutes zu tun. Er musste sich immer wieder aufs Neue das Gefühl sichern, dass andere ihm dankbar waren, ihn schätzten.
Schon wieder fiel Mrosko der blöde Kinderchor ein. Eines Winters hatten sie Besuch von einem russischen Knabenchor gehabt, jede Gropiuslerche nahm einen russischen Jungen auf. Mit dünnem Jäckchen stand der Junge vor ihrer Wohnung im Berliner Schnee. Mrosko konnte mit ihm nur per Lachen reden, aber er verstand auch so, wie arm der Russe sein musste. Er schenkte ihm seine Fußballschuhe. Er dachte gar nicht daran, dass er dann keine Fußballschuhe mehr hatte und am folgenden Samstag einen Riesenärger mit dem Trainer bekäme.
»I’ll be right by your side, to be your light, to be your guide«, sang Stevie B schon wieder, irgendwo hinter Hof, bald schon in Nürnberg. Die Jungs hatten sich längst von Mroskos Euphorie anstecken lassen. Mitzusingen trauten sie sich trotzdem nicht. Aber ausgelassen über Mroskos Späße zu lachen passte sowieso besser zu ihrem Verhältnis. Mrosko, erst 23, aber fünf, sechs Jahre älter als Diego und Sparwasser, war der Erwachsene für sie. Er hatte immer den Arm um Alex Jakowitzs Schulter gelegt und gefragt, wie läuft’s im Internat, Sparwasser, sollen wir morgen mal ins Kino gehen, als der Junge, Sohn eines Handelsvertreters, mit 16 alleine aus Neubrandenburg in die große Stadt gekommen war, um es als Fußballer zu schaffen. Mrosko hatte immer nach dem Training bei Tennis Borussia zu Gökhan Diego Senol gesagt, komm, wir kicken noch eine Runde, wenn er in Diegos Gesicht gesehen hatte, dass das Training wieder zu verschult für den Jungen gewesen war, einen Sohn türkischer Arbeiter aus dem Wedding, der doch einfach Fußball spielen wollte.
Alle riefen ihn Diego: Mrosko mit seiner Entdeckung, Gökhan Senol, so klein, so ein Gefühl im Fuß, dass die Zuschauer an Diego Armando Maradona dachten. [2]
In Gedanken sah Mrosko Diego und Sparwasser und natürlich auch Ifet schon im berühmten roten Trikot. Hermann Gerland, der nach der Sommerpause die zweite Mannschaft der Bayern, die höchste Nachwuchself, trainieren würde, war eine Woche zuvor in Berlin gewesen und hatte an der Seite von Mrosko die drei Jungs in ihren Spielen für Tennis Borussia studiert. »Können vorbeikommen«, hatte Gerland geraunzt, und das hätte er doch nicht gesagt, wenn er nicht an sie glaubte. In Gedanken stellte sich Mrosko Diego im Training der Bundesligaprofis vor, Diego, wie er schwerelos an Stefan Effenberg vorbeizog, wie das aussehen würde. Diego war 1,61 Meter klein.
Wenn Mrosko eine tolle Möglichkeit sah, wie einen Wechsel der drei Jungs zum FC Bayern, dann begann er zu träumen, dann wurde er enthusiastisch, dann wurde die Möglichkeit in seinem Kopf schon Realität. Dann vergaß er, dass der Traum auch noch platzen konnte.
In München an der Säbener Straße sollten die Jungs gleich mit der zweiten Mannschaft mittrainieren. Viele Jahre später forschte Alex Jakowitz aus Neugierde einmal im Internet nach, mit wem sie da im Mai 2001 in Bayerns höchster Nachwuchsmannschaft eigentlich trainiert hatten, Michael Rensing, Markus Feulner, Stephan Kling. Damals spielte Ifet Taljevic beim Aufwärmspiel im Kreis den Bayern-Jungs gleich mal den Ball durch die Beine. Und nicht nur einmal.
Sollten doch gleich mal sehen, wer hier der Herr im Hause war, die Berliner waren da, von der Straße, wenn die Bayern wussten, was das war, die Straße.
Was willste, soll ich dich gleich umtreten?, zischten die Bayern-Jungs, mach hier mal nicht den Dicken!
Die Augen unter den dicken, pechschwarzen Brauen zu Schlitzen zusammengekniffen, konnte Ifet einfach weitermachen, als ob er nichts gehört hätte. Er hatte mit 17 schon einen Profivertrag bei Tennis Borussia erhalten, genug, um seinen Vater und die Geschwister zu unterstützen, was wollten die Bayern-Jungs denn. Im Gegenwind surfte er.
Am Rand des Trainingsplatzes glaubte Mrosko vor Scham zu versinken. Hatte Ifet denn gar kein Gefühl, dass nicht nur sein Fußballtalent auf der Probe stand, sondern auch seine Fähigkeit, sich ins Team einzufügen? Und gleichzeitig empfand Mrosko, er versuchte es zu unterdrücken, Stolz auf Ifet.
Diego glitt durch die Abwehrreihen, Mrosko hatte es schon tausendmal gesehen und musste trotzdem innerlich wieder vor Glück lachen, dieser kleine Kerl, dessen Wangen sich beim Fußball röteten, es sah aus, als ob ein Kind Männern entwischte. Sparwasser versuchte, im Mittelfeld die Aktionen einfach zu halten, die Lücke zu schließen, gleich abspielen, keinen Fehler machen, sehr gut.
Mittags saßen sie beim Essen stundenlang auf der Terrasse des Klubrestaurants und warteten, was passieren würde, ob einer der Profis vorbeikommen würde, Effenberg, Kahn, Scholl. Einmal kam Carsten Jancker und grüßte freundlich. Abends sagte Mrosko, »kommt, wir fahren noch mal in die Stadt«. Die Jungs konnten doch sowieso nicht schlafen. Besser, er organisierte den Ausflug, dann würde Ifet wenigstens nicht in die Nacht abhauen.
Auf der Leopoldstraße sollte was los sein. Sie waren direkt an der Säbener Straße, am Wettersteinplatz, untergebracht, im Süden der Stadt, wo München eine einzige Siedlung ist, Wohnhaus an Wohnhaus. Mrosko fuhr los, da musste doch bald die Abfahrt kommen, oder hatte er sie schon verpasst? Sie fuhren weiter, und irgendwann gab er auf. Dann würden sie eben nur durch die Stadt kreuzen, zwei Stunden im Auto, Stevie B sang, »just let me reassure you that you can count on me«. Mrosko, Sparwasser, Diego, vielleicht sogar Ifet, jeder fühlte inmitten der anderen eine unerklärliche Leichtigkeit. Dann klingelte Alex Jakowitz’s Handy.
Der Trainer.
Musik aus, alle still. Es musste auch keiner eine Regung unterdrücken, sie waren vor Schreck stumm.
»Ja, Trainer, es geht schon besser«, sprach Alex Jakowitz ins Telefon, »ich bin noch im Bett, aber das Fieber ist schon runtergegangen, ich hoffe, am Donnerstag bin ich wieder im Training.«
Diego und Alex hatten sich bei Claudio Offenberg, ihrem A-Jugendtrainer bei Tennis Borussia, mit dem Hinweis abgemeldet, sie seien krank. Alex hatte es nicht geschafft anzurufen und seinen Vater gebeten, für ihn zu lügen.
Mrosko fand nichts dabei, dass die Jungs ihren Trainer belogen hatten. Die Wahrheit war keine Option. Tennis Borussia hätte sie niemals zum Probetraining nach München gelassen. Mrosko verstand dieses Denken nicht: Er war doch, da konnste Shergo, Bodden oder Ente fragen, der loyalste Mensch der Welt; wenn er für einen Verein arbeitete, gab er dem Verein alles. Aber in dem Fall musste die oberste Loyalität des A-Jugendtrainers doch nicht seinem Verein Tennis Borussia gelten, sondern seinen Jungs: Man durfte ihnen nicht die Chance nehmen, für Bayern München zu spielen.
Ein Jahr zuvor, als Mrosko noch als Scout bei Tennis Borussia angestellt gewesen war, wollte der große Rehberg von Schalke 04 seine Meinung zu zwei Berliner Jugendspielern wissen. Würde Mrosko Schalke eher zu Charles Takyi oder Sahr Senesie raten? Beide Jungs waren in Afrika geboren, da siehste mal, wie sich Berlin veränderte, afrikanische Jungs, die gleichzeitig Berliner Jungs waren. Sahr Senesie spielte bei Tasmania, Takyi bei Tennis Borussia. Mrosko riet Rehberg vehement zu Takyi – ja, sollte er Takyi schlechtreden, nur damit der Junge bei Tennis Borussia blieb? Mrosko fuhr Takyi sogar zum Gespräch nach Schalke.
Tennis Borussias Präsident Klaus Schumann kochte. Es war nur so ein Gefühl, aber es würde nicht mehr weichen, es würde sein Misstrauen gegen Mrosko auf Jahre zementieren: »Fängt der Mrosko jetzt an, unsere Spieler zu anderen Vereinen zu transferieren?«
Mrosko war fassungslos, als er davon hörte. Das war das Allerletzte, ihm zu unterstellen, er würde hinter dem Rücken Geschäfte machen, Spieler seines Vereins verticken. Er war loyal! Was wollte Schumann denn, auf der zweiten Fahrt nach Schalke hatte Tennis Borussias Ärztin Judith Bahjat Takyi chauffiert, wolle er die etwa auch verdächtigen? Schumann sollte doch stolz sein, dass ein Verein wie der FC Schalke einen Jungen von TeBe für sich reklamierte. So wie Mrosko stolz darauf war, dass der große Rehberg ihn nach seiner Meinung fragte. Jürgen Rehberg war der erste Scout gewesen, der Mrosko seine Visitenkarte gegeben hatte. Die Karte hütete Mrosko. Er selbst hatte keine. An so etwas dachte Schumann natürlich nicht, was so eine kleine Karte für Eindruck machte. Der große Rehberg hatte Mrosko sogar sein Notizbuch gezeigt, schau mal hier, da stand noch die Nummer von Sebastian Deisler, Deutschlands größtem Talent. Den habe er entdeckt, als er noch für Borussia Mönchengladbach und nicht Schalke gesichtet habe, erzählte ihm Rehberg.
Nachdem ihn Mrosko über Charles Takyi fachkundig informiert hatte, rief ihn der große Rehberg jedes Mal wieder an, wenn ihn ein Berliner Jugendspieler interessierte. »Der kennt alle«, sagte sich Rehberg beeindruckt.
Permanent kommt im Profifußball der Verdacht auf, dass dieser und jener krumme Geschäfte mache. Dieser Sportdirektor verpflichte fast nur Fußballer von jenem Spielerberater. Dieser Trainer habe denselben Berater wie der Rechtsaußen, den er immer aufstelle. Lars Mrosko war 22, als er Scout wurde. Er ahnte damals nicht, wie schnell in diesem Geschäft Gerüchte entstehen. Er handelte einfach nach seinen eigenen, Neuköllner moralischen Vorstellungen, und wenn ihm die Schalker ein paar Euro für den Tipp in Sachen Takyi angeboten hätten, hätte er ziemlich sicher abgelehnt. Auch aus einem Ehrgefühl heraus, dass er nicht käuflich war, aber vor allem, weil er für eine Hilfe unter Kollegen, unter Freunden kein Geld nahm!
»Der Junge hat einen guten Kern, ehrlich, geradeaus, keiner, der seine Freunde beklaut«, beobachtete Thomas Westphal, der als Teambetreuer bei Tennis Borussia arbeitete: »Hoffentlich wird er nicht ausgenutzt.«
An einem trainingsfreien Vormittag während des Probetrainings beim FC
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: