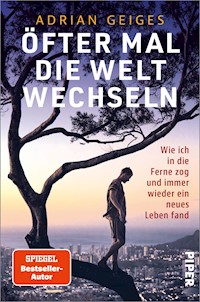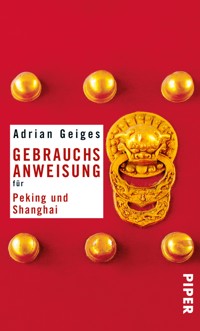
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Futuristische Architektur hier und alter Kaiserpalast da, die Verlockungen des Kapitalismus und eine junge Kulturszene: Adrian Geiges, lange in Shanghai und zuletzt fünf Jahre in Peking sesshaft, erzählt von zwei faszinierenden Gesichtern eines Weltreichs. Von Shanghai als legendäre Vergnügungsmeile der 30er-Jahre und Schauplatz moderner Großveranstaltungen wie der Expo. Von Peking, Spielstätte minutiös geplanter Olympia-Inszenierungen und Anziehungspunkt frecher Designer. Vom Straßenverkehr in den Metropolen, der jeden Westler in den Irrsinn treibt. Von Nachbarn, die am helllichten Tag im Schlafanzug spazieren gehen. Vom Verhältnis der Chinesen zu uns Langnasen. Von betrunkenem Huhn und haarigen Krabben. Und von einer Sprache, in der »Papa« so klingt wie »Staudamm« und »Mama« fast so wie »fluchen«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
2. Auflage 2011
ISBN 978-3-492-95012-1
© Piper Verlag GmbH, München 2009
Umschlaggestaltung: Birgit Kohlhaas
Umschlagabbildung: age fotostock/LOOK
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Dank an den Hanser Verlag für die Genehmigung des Abdrucks aus Pu Yi, »Ich war Kaiser von China. Vom Himmelssohn zum Neuen Menschen.« Herausgegeben und aus dem Chinesischen übersetzt von Richard Schirach und Mulan Lehner, © 1973 Carl Hanser Verlag, München, auf Seite 38f. und an den Ullstein Verlag für die Genehmigung des Abdrucks aus Wei Hui, »Shanghai Baby«, © 2001 Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin, auf Seite 175f.
Chinesen sind nicht alle gleich
In diesem Buch geht es um eine komplizierte Liebesbeziehung. »Gefällt Ihnen Peking oder gefällt Ihnen Shanghai?«, wird man in China immer wieder gefragt – und stößt dann auf geradezu religiösen Fanatismus. Denn nach Ansicht der meisten sind die beiden Metropolen so unterschiedlich, dass man nur eine von beiden lieben kann. Es erübrigt sich hinzuzufügen: Für die meisten Pekinger ist das Peking, und für die Shanghaier, nun…
Als ich von Shanghai nach Peking umzog, bedauerten mich die einheimischen Freunde dort: Das wird schwierig für dich werden. Dort kann man sich nicht auf die Leute verlassen, außerdem ist der Service schlecht. Umgekehrt sahen sich die neuen Bekannten in Peking als meine Retter: Wie hast du es in Shanghai ausgehalten? Sicher fühltest du dich einsam, dort ist es schwer, Freunde zu finden. Die Shanghaier denken nur ans Geschäft. Bei denen muss man verdammt aufpassen, bestimmt haben sie dich ständig übers Ohr gehauen!
Wie soll ich also meinen wahren Gefühlen Ausdruck geben, ohne die Eifersucht und den Unmut entweder der einen oder der anderen zu wecken? Wo doch sowohl in Peking als auch in Shanghai für viele Jahre mein Bett stand, und ich es nie lassen konnte, dann immer wieder für mehrere Tage oder Wochen in die jeweils andere Stadt zu fliegen.
Beginnen wir mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner: Chinesen sind nicht alle gleich. Das würde jeder Pekinger unterschreiben (und als Beispiel die Shanghaier nennen) und jeder Shanghaier…
北京Beijing* (Peking)
* In China habe ich Pragmatismus gelernt. So nutze ich in diesem Buch die alte Schreibweise »Peking«, da sie in Deutschland nach wie vor gebräuchlicher ist als »Beijing«. Ansonsten halte ich mich aber meist an die offizielle Pinyin-Umschrift für die chinesischen Schriftzeichen.
Nicht wiederzuerkennen: Der rasante Wandel einer Stadt
Das waren noch Zeiten. Nachdem ich China 1986 zum ersten Mal besucht hatte, notierte ich staunend: »1949 lebten 1,6 Millionen Menschen in Peking, derzeit sind es 9,5 Millionen.« Während ich dieses Buch schreibe, hat Peking bereits 17,4 Millionen Einwohner, mehr als doppelt so viele wie New York. Und wahrscheinlich kann kein deutscher Verlag so schnell Bücher produzieren, als dass die Zahl nicht bis zum Druck überholt wäre.
Einmal fragte ich eine Pekinger Freundin, die Paris, London und Berlin besucht hat, wo es ihr am besten gefalle? Sie sagte, wenn es ums Wohnen ginge, würde sie am liebsten nach Berlin ziehen. Warum das? »Ich habe mein ganzes Leben in der Großstadt verbracht. Da würde ich gern zur Abwechslung einen kleineren Ort kennenlernen.«
Trotz der Ein-Kind-Politik wächst Chinas Bevölkerungszahl weiter. Viele der jetzigen Eltern wurden noch in Zeiten geboren, als Mao glaubte: Je mehr Untertanen er beherrscht, desto mehr Macht erlangt er. Er selbst formulierte dies allerdings zynischer, so etwa bei einem Besuch in Moskau 1957: »Wir sind bereit, 300 Millionen Chinesen für den Sieg der Weltrevolution zu opfern.« Das war damals etwa die Hälfte der chinesischen Bevölkerung. Pekings Einwohnerzahl explodiert auch deshalb, weil Chinesen aus allen Provinzen gern in die Hauptstadt übersiedeln – obwohl sie dafür mehr Hürden überspringen müssen als bei einem olympischen Hindernislauf, wie ich noch erzählen werde.
Ich habe immer wieder in Peking gewohnt, habe es verlassen und bin wieder zurückgekehrt. Auf den ersten Blick fällt es natürlich nicht auf, dass wieder so viele Bürger hinzugekommen sind wie in Hamburg oder München dauernd leben. Was jedoch ins Auge sticht: Die Metropole wird jedes Mal eine andere.
Über meinen ersten Landeanflug vor gerade einmal 23 Jahren schrieb ich: »Unter uns mischt sich das Feuerrot der Palastdächer mit dem Grau von Betonhochhäusern. Das Alte und das Neue sind willkürlich ineinandergeschachtelt, die prunkvollen Stätten der Privilegierten von einst und die zweckmäßigen, aber nicht gerade schönen Bauten für die arbeitenden Menschen heute.« Mittlerweile experimentieren Architekten aus aller Welt in Peking mit eleganten und futuristischen Bauten, die wie Ufos, Wasserwürfel oder Eier aussehen. Der Flughafen selbst ist inzwischen von Villenvierteln umgeben.
Wie ein Bericht von einem anderen Planeten erscheint im Vergleich zu heute auch, was mir damals bei der Fahrt vom Flughafen ins Zentrum auffiel: »Auf der Straße vom Flughafen in die Stadt begegnen wir vor allem Lastwagen und Personenwagen japanischer Herkunft: ›Alles Dienstwagen‹, erklärt man mir. Privatautos sind in China zwar nicht mehr verboten, aber praktisch unbezahlbar – es gibt einige wenige Ausnahmefälle neureicher Bauern und Privathändler, die jeweils so sensationell erschienen, dass die chinesische Presse darüber berichtete.« Wäre das heute noch so, hätten die Reporter viel zu tun – pro Tag werden in Peking 1000 neue Autos zugelassen, natürlich fast alles Privatwagen. Auf sechsspurigen Straßen stauen sie sich manchmal noch um Mitternacht. Bei meinem ersten Besuch sah das noch deutlich anders aus. Selbst auf den großen Prachtstraßen im Zentrum drängten sich die Verkehrsmittel, die man in China erwartete: Fahrräder, Fahrräder und noch mehr Fahrräder. Soweit es spezielle Spuren nur für Autos gab, waren sie schmaler als die parallel verlaufenden Radwege. Wer hingegen heute nach vollen Radwegen sucht, dem empfehle ich eine Reise nach Münster in Westfalen.
1986 aß ich im Restaurant in einem Raum, meine Dolmetscherin musste in einem anderen essen. Zu enger Kontakt sollte verhindert werden. Als ich elf Jahre später in Peking Chinesisch studierte, verursachte es keine Komplikationen mehr, wenn Einheimische und Ausländer gemeinsam ausgingen. Viele Jugendliche in Peking suchten nun den Kontakt zu Europäern und Amerikanern, um ihr Englisch aufzufrischen. Gute Sprachkenntnisse versprachen eine bessere Zukunft, etwa ein Studium im Ausland oder eine Stelle in einem der Joint Ventures von internationalen Unternehmen gemeinsam mit chinesischen Partnern, die inzwischen auch in der Hauptstadt gegründet worden waren.
Um Englisch zu üben, trafen sich Studenten und Berufsanfänger zu Hunderten in sogenannten 英语角yingyujiao, English corners. Wenn sich westlich aussehende Menschen daruntermischten, scharten sich alle um sie, selbst wenn sie, wie ich, Englisch mit badischem Akzent sprachen. Ich suchte dort nach Austausch, um mein Chinesisch zu praktizieren. Doch die »englische Ecke«, die ich entdeckt hatte, lag weit von meiner Hochschule entfernt. Dann hörte ich, es gebe auch einen solchen Treff in der nahe gelegenen 人民大学remin daxue, wörtlich »Volkshochschule«, die kein Weiterbildungsverein ist, sondern eine der Pekinger Universitäten. Am Eingangstor fragte ich zwei hübsche Studentinnen nach dem Weg. Sie erklärten mir, die English Corner habe gerade Ferien. So entschieden wir uns, unsere eigene Sprachaustausch-Bewegung zu gründen, und ich lud die beiden ins Restaurant ein. Eine von ihnen heiratete ich anderthalb Jahre später.
Anders als in Russland (in den Neunzigerjahren) oder auf den Philippinen sind Westeuropäer in China nicht per se begehrte Ehepartner. Noch mehr als heute glaubten viele Chinesen damals, ihre Kultur unterscheide sich so stark von allen ausländischen Kulturen, dass solche Beziehungen nicht funktionieren könnten. Pekinger Taxifahrer warfen mir in jener Zeit vor, ich würde ihnen die Frauen »wegnehmen«. Wie könnte ich! Zwar mangelt es in China zunehmend an Frauen, aber nicht weil einige von ihnen Ausländer heiraten, sondern weil Eltern in ländlichen Gebieten männliche Nachkommen bevorzugen und deshalb weibliche Föten abtreiben.
Die Restaurants, die wir besuchten, waren einfach: Kahle Holz- oder Plastiktische, leere weiße oder graue Wände; die Gäste warfen Knochen, Gräten und Fleischreste einfach auf den Tisch oder spuckten sie auf den Boden. Etwas eleganteres Ambiente zeichnete die ersten Restaurants mit europäischen Speisen aus, die damals eröffnet wurden. Dort schmeckte aber das Essen weniger gut. So war ich sehr stolz, als ich meiner heutigen Ehefrau kurz nach unserem ersten Treffen erzählen konnte: »Ich habe ein chinesisches Restaurant entdeckt, das sehr geschmackvoll eingerichtet ist. Alles tipptopp sauber, und man kann sogar mit Kreditkarte bezahlen. Lass uns mal zusammen hingehen.«
Auch sie fand das eine gute Idee. Junge Chinesen wussten damals sehr genau, dass sich ihre Gaststätten nicht auf Weltniveau befanden. Der Gedanke, etwas Neues, Schickes kennenzulernen, gefiel ihr gut, zumal trotzdem die von Chinesen bevorzugte eigene Küche angekündigt war. Leider hatte ich mein Chinesisch-Studium gerade erst begonnen, so hatte ich die Zeichen am Eingang noch nicht lesen können. Sie erstarrte, als wir vor dem Restaurant angelangt waren, schwieg eine Minute lang, während die Wut in ihrem Gesicht immer unverkennbarer wurde. Schließlich sagte sie: »Das ist ein japanisches Restaurant.«
Sie ärgerte sich, gestand sie mir später, nicht so sehr deshalb, weil sie die Japaner wegen ihrer Kriegsverbrechen an den Chinesen hasste. Vielmehr schämte sie sich, weil ich ihr – wenn auch ohne Absicht – vorgeführt hatte: In den chinesischen Lokalen fehlte es an Ästhetik, Romantik und Hygiene. Aus heutiger Sicht ist der Vorfall lustig: Denn jetzt, gut zehn Jahre später, stülpen Kellner in vielen Pekinger Restaurants Schutzbezüge auf Jacken, die über dem Stuhl hängen, und manchmal sogar auf Handys. Vor und nach dem Essen reichen sie warme Waschlappen. Der Gast sitzt an Designertischen in gediegenem Braun oder knalligem Rot. An der Wand hängen moderne Gemälde, im Speisesaal sprudeln Springbrunnen.
Manchmal ändert Peking sein Gesicht innerhalb weniger Wochen. So geschah es im Frühjahr 2003, als sich die Lungenkrankheit SARS ausbreitete. Fast alle Hauptstadtbewohner verließen das Haus nur noch mit weißer Schutzmaske. Die sonst so quirligen Restaurants und Bars blieben leer. Die Kaufhäuser wirkten wie Geisterhäuser, maskierte Verkäuferinnen bewachten Kleider und Spielsachen, Kunden kamen keine. Die Metropole stand still. Selbst in der Fußgängerzone Wangfujing ging kaum noch jemand, dort drängen sich sonst die Menschen. SARS verschwand so plötzlich, wie es gekommen war.
Ebenso radikal verwandelten die Olympischen Spiele Peking. Kurz davor reiste ich für zwei Wochen nach Deutschland. Als ich zurückkam, erkannte ich die Stadt kaum wieder: Die Zahl der Autos war halbiert, weil Tag für Tag abwechselnd nur Wagen mit gerader beziehungsweise ungerader letzter Ziffer auf dem Kraftfahrzeugkennzeichen fahren durften. Auch zu Fuß bewegten sich deutlich weniger Menschen als sonst. Auf den Baustellen, wo sonst 24 Stunden am Tag gehämmert, gebohrt und geschweißt wird, war Ruhe eingekehrt. Die Wanderarbeiter, die dort schuften, waren nach Hause gefahren. Aufs Land geflohen waren auch die Intellektuellen, die sich weder für Sport noch fürs Vaterland begeistern. Die Polizei hatte »aus Gründen der nationalen Sicherheit« die Tibeter vertrieben, die sonst in ihren Trachten auf der Straße hocken und Ohrschmuck, Halsketten und Fingerringe verkaufen. Weggesperrt waren die Bettler, die in Peking manchmal sehr aufdringlich sein können, ein »Nein« nicht für ein Nein nehmen und sich an einem festklammern. Um Diebstahl und Proteste zu verhindern, patrouillierten alle 100 Meter Rentner mit roten Armbinden, Freiwillige aus den Nachbarschaftskomitees, die es in Peking vorher auch gab, die aber gewöhnlich nicht solche Präsenz zeigten. Geschlossen waren die Stände in den Straßen, an denen man Klöße oder Schaschlik essen kann. Die Eingänge der kleinen Massagesalons, in denen als Friseurinnen getarnte Prostituierte ihre Dienste anbieten, waren mit Kettenschlössern zugesperrt.
Verschwunden waren auch die Straßenhändler, die Blumen, Unterhosen oder Raubkopien von DVDs anbieten. Manchmal verändert sich aber mehr der Schein als das Sein. In einem Laden, in dem ich oft DVDs kaufe, war die Fläche plötzlich um drei Viertel geschrumpft, in den Regalen standen nur zwei Dutzend Filme. Als ich die Verkäuferin darauf ansprach, lächelte sie. Da ich Chinesisch sprach, konnte ich kein Olympia-Tourist sein. Da ich europäisch aussehe, wusste sie, dass ich nicht für die Polizei arbeite, die beschäftigt hier noch keine Ausländer. Sie zückte einen Schlüssel und öffnete eine Tür zum Hauptteil des Geschäfts – dahinter war die übliche Angebotspalette versteckt.
Pekinger zu sein ist nicht schwer, Pekinger zu werden dagegen sehr
Pekinger zu werden ist nicht leicht – auch nicht für Chinesen. Für jede chinesische Stadt braucht man einen 户口hukou, einen »eingetragenen ständigen Wohnsitz«. Den erbt man. Erben? Eine meiner Töchter beispielsweise ist in Mianyang in der Provinz Sichuan im Südwesten Chinas eingetragen, obwohl sie dort nicht wohnt. Sie ist sogar noch nie dort gewesen. Sie hat den Wohnsitz von meiner Frau bekommen, die ihn wiederum von ihren Eltern hat…
In China wählt man den eingetragenen Wohnsitz nicht selbst. Und auch nicht die Nationalität. Nach der Geburt unserer Tochter in Peking gingen wir eigentlich davon aus, sie sei Deutsche, wegen des deutschen Vaters. Das sehen chinesische Behörden aber nicht so. Ein Elternteil chinesisch und in China geboren macht nach den Gesetzen der Volksrepublik eine Chinesin. So hatte die Kleine schon als Säugling zwei Pässe, einen deutschen und einen chinesischen. Einer der wenigen Fälle, in denen die sonst diesbezüglich auch nicht sehr offenen deutschen Behörden eine Doppelstaatsangehörigkeit akzeptieren, da es sich um eine besondere Rechtslage handelt.
So offen, dass meine (unter anderem) deutsche Tochter einfach so nach Deutschland einreisen könnte, sind die Deutschen nun aber wiederum auch nicht. Die Komplikation beginnt auf der chinesischen Seite. Zwar dürfen Chinesen im Prinzip frei aus China ausreisen. Die chinesischen Grenzschützer schauen aber, ob im Pass das Visum eines anderen Landes eingetragen ist. Da unsere Tochter nach chinesischem Recht nur Chinesin ist, muss sie deshalb den chinesischen Pass vorzeigen – mit deutschem Visum. Diese Sonderfälle kennend, erteilte die deutsche Botschaft in Peking dieses früher unbürokratisch, kostenfrei und gleich für ein ganzes Jahr, ein sogenanntes »Courtesy-Visum«, wie es auf Neudeutsch heißt, also ein Höflichkeits- oder Gefälligkeitsvisum. Das galt, bis in der Visastelle jemand die Verantwortung übertragen bekam, der fand, gegenüber Kindern mit doppelten Papieren, die weder blond noch blauäugig sind, dürfe man sich so zuvorkommend nicht verhalten. Er schikaniert seither die »Mischlinge« (wie er wahrscheinlich sagen würde), zum Beispiel indem er vorschlägt, sich bei einer Pekinger Behörde eine »Ausreisegenehmigung« zu besorgen. Dazu aber braucht man den hukou, »den eingetragenen ständigen Wohnsitz«. Auf dieses Problem aufmerksam gemacht, sagte der Herr von der Botschaft allen Ernstes: »Warum haben Sie Ihre Tochter denn nicht in Peking angemeldet?«
Nun, liebe Mitarbeiter der Botschaft, mit diesem Buch können Sie lernen, was man Ihnen offenbar bei der Vorbereitung auf Ihren China-Aufenthalt nicht erzählt hat. Oft wird behauptet, einen »eingetragenen ständigen Wohnsitz« für Peking zu bekommen ist ungefähr so schwer wie die Erlangung einer Greencard für die USA. Das stimmt aber nicht. Amerikanischer Staatsbürger zu werden ist viel einfacher. Es wird ja jeder, der in den USA geboren ist. Eine Geburt in Peking berechtigt aber noch lange nicht dazu, dort einen ständigen Wohnsitz einzutragen.
Derzeit gibt es für Chinesen folgende Wege, Pekinger zu werden (es muss wohl nicht extra erwähnt werden, dass ein Ausländer niemals Pekinger werden kann):
Einen Pekinger oder eine Pekingerin heiraten. (Nicht dass man damit automatisch den »eingetragenen ständigen Wohnsitz« bekäme, aber nach ein paar Jahren…)
Einen Offizier der Volksbefreiungsarmee heiraten, der in Peking stationiert ist. (Die Offiziere selbst haben nirgendwo einen »eingetragenen ständigen Wohnsitz«, da sie in China in vielerlei Hinsicht über dem Gesetz stehen. So rasen ihre Autos, am roten Zeichen
军
jun
für »Streitkräfte« auf dem Nummernschild erkennbar, auf Seitenstreifen und Fahrradspuren, da die Polizei sie nicht anhalten darf.)
An einer renommierten Pekinger Universität einen Doktortitel erlangen und zusätzlich nach Studienabschluss einen für die Volkswirtschaft wichtigen Arbeitsplatz in Peking finden.
In eine hohe Position in einem Staatsunternehmen berufen werden oder ein gesuchter Experte für die Pekinger Hightech-Zone
中关村
zhongguancun
sein.
Unsere kleine Tochter kann da noch lang schreien, es hilft alles nichts: Sie ist nicht im heiratsfähigen Alter und ihr Kindergarten verleiht keine Doktortitel.
»Eingetragene ständige Wohnsitze« soll es in China schon während der 夏朝xia chao, der Xia-Dynastie vor mehr als 4000 Jahren gegeben haben, falls es die gab, was auch umstritten ist. Sicher aber ist: Seine restriktivste Form erlebte dieses System unter 毛泽东 Mao Zedong (Mao ist sein Familienname, kommt im Chinesischen immer zuerst, sein persönlicher Name Zedong bedeutet wörtlich »auf den Osten scheinen« – offenbar erwarteten also schon seine Eltern einiges von ihm). Bis in die Achtzigerjahre hinein war es für Chinesen so gut wie unmöglich, in einen anderen Landesteil umzuziehen – es sei denn, sie wurden vom Staat dorthin entsandt oder als 反革命fangeming, »Konterrevolutionäre«, verbannt. Wer nicht das Familienbuch mit dem »eingetragenen ständigen Wohnsitz« für den jeweiligen Ort vorweisen konnte, durfte dort nicht arbeiten. Das war illegal und damit strafbar. Er bekam buchstäblich nichts zu essen, denn ihm standen keine Lebensmittelmarken zu. Ihm fehlte die medizinische Versorgung, er wurde im Krankenhaus nicht behandelt. Und Bildung enthielt der Staat seiner Familie ebenfalls vor, ließ die Kinder nicht zur Schule zu. Das Umzugsverbot erleichterte es der Partei, die Menschen perfekt zu kontrollieren. Verhindert wurde damit aber auch die Entstehung von Slums um die großen Städte, wie man sie aus vielen anderen Ländern der Dritten Welt kennt.
Eine der wichtigsten Reformen von 邓小平 Deng Xiaoping, dem starken Mann nach Mao: Er gab den Chinesen die Freiheit, in andere Landesteile umzuziehen und dort eine »vorübergehende Aufenthaltsgenehmigung« zu bekommen. Die »eingetragenen ständigen Wohnsitze« schaffte er allerdings nicht ab. So sind Chinesen, die in Peking leben, ohne Pekinger zu sein, nach wie vor zahlreichen Diskriminierungen ausgesetzt – die Probleme unserer Tochter erscheinen im Vergleich dazu geringfügig:
Zwar gibt es kein generelles Arbeitsverbot mehr, aber viele gute Stellen werden nur an Bewerber mit »eingetragenem ständigen Wohnsitz« für Peking vergeben.
Die Kinder von »echten« Pekingern werden bevorzugt zu den Pekinger Universitäten zugelassen.
Obwohl Chinesen aus anderen Provinzen im Normalfall ein geringeres Vermögen als die alteingesessenen Einwohner besitzen, müssen sie für fast alles mehr bezahlen: vom Wohnen, da sie keine preisgeschützten Apartments aus dem sozialen Wohnungsbau kaufen dürfen, bis zum Schulgeld, weil ihre Kinder von vielen staatlichen Schulen und Kindergärten nicht aufgenommen werden und sie deshalb in private Einrichtungen müssen.
Wer als Zugezogener in Peking zum Arzt geht, muss die Behandlungskosten selbst bezahlen (es sei denn, er hat eine Privatversicherung abgeschlossen, die vielfach mehr kostet als die öffentliche Versicherung für die mit »eingetragenem ständigen Wohnsitz«).
Aber von all den bürokratischen Besonderheiten abgesehen: Wodurch zeichnet sich der alteingesessene Pekinger aus? Bestimmt nicht durch das, was mir einmal einer der Deutschen erzählte, der gerade ein paar Tage in China weilte, doch bereits alles besser wusste: Die Pekinger seien nicht so locker (etwa im Vergleich zu den Shanghaiern), weil Peking im Norden liege. Das Gegenteil ist wahr. Zwar heißt 北京 Beijing »nördliche Hauptstadt«, im Unterschied zur ehemaligen Hauptstadt 南京 Nanjing, »südliche Hauptstadt«. Im chinesischen Vergleich liegt Peking also nördlich, aber immer noch auf dem 40. Breitengrad, das wäre in Europa zwischen Neapel und Sizilien. Und die Italiener sind ja auch nicht gerade für mangelndes Temperament bekannt.
Pekinger können zunächst einmal mürrisch wirken, müssen wie alle Chinesen erst mit einem warm werden, aber das passiert bei den nördlichen Hauptstädtern sehr schnell. Nach drei Gängen Essen oder zwei Flaschen Bier zählt man oft schon als 老朋友lao pengyou, »alter Freund«, und das ist keinesfalls immer geschäftlich gemeint, wie Shanghaiern in ähnlichen Situationen oft unterstellt wird. Pekinger sind 贫pin, »schwatzhaft«, kommen schnell von einem Thema zum nächsten und plaudern ohne Ende, manchmal ohne tiefen Gehalt, nur um die Zeit totzuschlagen oder sich mit anderen anzufreunden. Aber sie erzählen oft mit Witz und Humor.
Pekinger zeichnen sich durch 大话dahua, »große Worte«, aus, prahlen gern ein bisschen und machen sich wichtig. Ihre Kritiker in anderen Teilen Chinas behaupten, sie redeten lieber, als etwas zu tun. Sie sprechen über China und die Welt, oft auch über Politik. Ein Shanghaier Journalist dagegen sagte mir einmal: »Wir Shanghaier sind da ganz anders als die Hauptstädter. Nicht einmal im Kollegenkreis diskutieren wir über Politik. Wir unterhalten uns vor allem über die Aktienkurse.«
Pekinger sind 大方dafang, wörtlich »großquadratig«, was natürlich und ungezwungen bedeutet, aber auch freigebig und großzügig. Das heißt: Pekinger sind gute Kumpel. Oft streiten sie sich lautstark um die Restaurantrechnung, halten den anderen an den Armen fest – um zu verhindern, dass er bezahlt, weil sie selbst einladen wollen. Die Rechnung zu teilen, ist überall in China verpönt, in Peking aber besonders. Wenn Ausländer das hier tun, kommentieren die Kellnerinnen oft lautstark: »怪guai!«, das bedeutet »sonderbar!«.
Pekinger nehmen alles nicht so genau, sind unzuverlässig in Alltagsdingen. 不靠谱bu kaopu, »sich nicht an ein Register anlehnen«, ist der Pekinger Ausdruck dafür. Man sollte es ihnen nicht übel nehmen, wenn sie überschwänglich ankündigen: »Nächste Woche müssen wir uns unbedingt treffen! Ich rufe dich gleich am Montag an.« Bis dahin ist das längst vergessen.
Um Details kümmern sie sich ungern, manche von ihnen gelten deshalb als 马虎mahu, »nachlässig«. Gewöhnungsbedürftig ist es für deutsche Manager hier, wenn ihnen die Buchhalterin erfreut verkündet: »Bei der Monatsabrechnung haben wir nur einen Fehlbetrag von 1000 Yuan, es stimmt also 差不多chabuduo, mehr oder weniger.« Oft ist das aber auch sehr angenehm. Wenn etwas im Laden 10,20 Yuan kostet, man einen Zehnyuanschein übergibt und dann nach Kleingeld kramt, sagt die Verkäuferin meist: »Ach, lassen Sie es stecken.« Selbst Taxifahrer runden hier manchmal ein, zwei Yuan vom Preis ab, falls der Fahrgast nur große Scheine hat. Da es in China kein Trinkgeld gibt, wird auf keinen Fall aufgerundet.
»Das Land ist groß, der Kaiser ist weit weg«, sagt man in Chinas Provinzen. Daraus lässt sich aber nicht umgekehrt schließen, die Hauptstädter handelten besonders buchstabengetreu. Jeden Morgen ging ich beim Betreten des Gebäudes, in dem unser Stern-Büro untergebracht war, an einem Schild vorbei mit der Inschrift: »1. In diesem Gebäude dürfen keine Räume an ausländische Journalisten vermietet werden. 2. Hunde größer als 350 Millimeter sind verboten.« Das hatte eine merkwürdige Komik, da zu Kolonialzeiten in manchen chinesischen Parks die Regel galt: »Hunde und Chinesen müssen draußen bleiben.« Doch während dies schlimmer Ernst war, hatte Peking das Gesetz, das ausländische Journalisten nur in wenigen, leicht zu kontrollierenden Siedlungen wohnen ließ, längst aufgehoben. Es hatte sich nur einfach keiner die Mühe gemacht, das Schild abzuhängen. Die Vorschrift mit den Hunden galt weiterhin. Aber es hielt sich keiner daran. Deutlich größere schwarz-weiß gefleckte Doggen und Afghanische Windhunde wurden auf dem Gelände Gassi geführt.
»Außerörtliche Menschen«
Es gehört zu den im Westen verbreiteten Vorstellungen, Peking sei weniger international als Shanghai. Stimmt das? Das hängt davon ab, was man unter »international« versteht. Nimmt man die Zahl der Ausländer als Maßstab – von denen leben in beiden Metropolen jeweils etwas mehr als 100000 (es gibt keine klaren Statistiken, beide Städte jonglieren mit Zahlen, die einander widersprechen). Ein Großteil davon sind Mitarbeiter internationaler Firmen. In Peking residieren viele Diplomaten, natürlich wegen der Botschaften hier mehr als in Shanghai, dort gibt es nur Konsulate. Ausländische Journalisten wählen eher Peking als ihren Sitz, da es die Hauptstadt ist. Hinzu kommen die Sprachstudenten. Sie bevorzugen Peking, da sie hier auf der Straße Mandarin hören, in Shanghai überwiegt das örtliche Shanghainesisch.
Wer mich in Peking am meisten begeistert (was mir alles in Shanghai gefällt, das erzähle ich im zweiten Teil dieses Buchs): Die Einwanderer aus anderen Teilen Chinas, die hier leben. Von den 17,4 Millionen Menschen im Verwaltungsgebiet Peking sind 5,4 Millionen Chinesen von woanders mit vorübergehender Aufenthaltsgenehmigung (hinzu kommt eine unbekannte Zahl von Illegalen, die sich nicht angemeldet haben). Die Pekinger nennen die Zugezogenen, manchmal mit etwas abschätzigem Unterton, 外地人waidiren, wörtlich »Außerörtliche Menschen«. In China herrscht nach offiziellem Selbstverständnis der »Sozialismus mit chinesischen Besonderheiten«, doch in Wahrheit ist das Land gespalten in Klassen, die sich krass unterscheiden. Und so ist »außerörtlicher Mensch« nicht gleich »außerörtlicher Mensch«. Unter diesen Begriff fallen Wanderarbeiter, die in einer Blechhütte hausen oder im Hinterraum des Restaurants schlafen, in dem sie arbeiten. Aber es gehören auch hochqualifizierte Neueinwohner dazu, die hier große Karriere machen oder diese anstreben.
Ob ich als Manager Schlüsselpositionen besetzte oder als Stern-Korrespondent mit einheimischen Reportern zusammenarbeitete, das meiste Engagement und Talent zeigten immer die, die erst in den letzten Jahren nach Peking gekommen waren. Was New York, Sydney oder Toronto für die Welt sind, ist Peking für China. Wer etwas werden will, geht auch mal nach Shanghai, eher aber nach Peking, weil es das politische Zentrum des Reichs der Mitte ist. Davon hängt viel ab in einem Land, in dem man ohne politische Beziehungen nichts bewegen kann. Trotz der großen Rolle von Shanghai als Businesscenter haben deshalb viele Unternehmen ihre Zentralen oder zumindest große Repräsentanzen in der Hauptstadt. Vor allem aber ist Peking das kulturelle Zentrum Chinas. Hier wohnen die meisten Regisseure, Schauspielerinnen und Künstler. Hier sitzen die alten und die neuen Medien.
Chinesen kommen von überall nach Peking und bereichern es mit ihrer Kreativität, machen die Hauptstadt dadurch zu einem offenen Ort, wie die Chinesen sagen 多元duoyuan, »viel und weit«. Die Einwanderer, die in Peking ihr Glück suchen, sind beseelt vom gleichen Geist, den Frank Sinatra in »New York, New York« besang: »If I can make it there, I’ll make it anywhere.« Im Chinesischen heißt es: Sie haben 活力huoli, »Lebenskraft«, sind engagiert und energisch.
Pekinesisch
Chinesen sprechen Chinesisch? Das ist etwa so richtig wie die Aussage: Europäer sprechen Europäisch. Landesteile, manchmal sogar Städte, haben in China eigene Sprachen, sie unterscheiden sich voneinander so stark wie europäische Sprachen.
Identisch sind die Schriftzeichen – fast überall, denn die Volksrepublik führte unter Mao vereinfachte Schriftzeichen ein, während in Hongkong und Taiwan noch die traditionellen Zeichen geschrieben werden. Jedes Zeichen steht für einen Begriff, wird aber in den verschiedenen Dialekten ganz unterschiedlich ausgesprochen. 再见 etwa sind die Zeichen für »wieder« und »treffen«, also »auf Wiedersehen«. Ein Pekinger liest das »zai jian«, ein Shanghaier »zei wei« und ein Hongkonger »joi gin«. Früher brauchten die Chinesen die Schriftzeichen, um sich zu verständigen, weshalb sie auch als »zweite Große Mauer« bezeichnet wurden, die China zusammenhielt.
Heute aber beherrschen 53 Prozent der Chinesen das 普通话putonghua, wörtlich die »allgemeine Sprache«, also das Hochchinesisch oder Mandarin. Das ist nicht nur dem verbesserten Bildungswesen zu verdanken, sondern vor allem dem Fernsehen. Es strahlt Sendungen in Mandarin bis ins hinterste Bergdorf aus. Zu Maos Zeiten konnten die meisten Chinesen die Staatssprache noch nicht. Nicht einmal Mao selbst. Er sprach den Dialekt seiner Heimatprovinz Hunan und wurde von vielen nicht verstanden. Deng Xiaoping, der starke Mann nach ihm, sprach Sichuanesisch und war auf seine Töchter angewiesen, die für ihn ins Hochchinesische dolmetschten.
Die gute Nachricht für die Pekinger und alle nach Peking Zugereisten: Der Pekinger Dialekt und die anderen nordchinesischen Dialekte entsprechen weitgehend dem Mandarin. Allerdings gibt es einige Besonderheiten des 京片儿jing pian’er, des »Hauptstadt-Platt«, an denen man den Ureinwohner Pekings erkennt. So hängt er gern an jedes dritte Wort ein 儿er, wobei man das »E« kaum hört, betont wird das »R«. Das übrigens auch zum Märchen, Chinesen würden kein »R« kennen und es deshalb als »L« aussprechen, worüber gern auch Karikaturisten und Olympia-Kolumnisten mit gepflegtem Halbwissen ihre Scherze reißen. Der Pekinger etwa macht aus dem hochchinesischen 北边beibian, Norden, 北边儿beibian’er, was dann wie »beibiar« klingt. Daran erkennt man eine zweite Besonderheit des Pekinesischen: Laute zu verschlucken. Wobei mir das nach einer linguistischen Entschuldigung für die Faulheit der Pekinger Taxifahrer klingt, die beim Sprechen ungern den Mund öffnen.
Ansonsten stimmt die Peking-Sprache mit dem Mandarin überein. So gibt es vier verschiedene Töne, hoch und gleichbleibend, steigend, fallend-steigend und fallend. Was in der lateinischen Umschrift gleich aussieht, kann ganz verschiedene Bedeutung haben. Ba etwa kann in den verschiedenen Aussprachen 八 »acht« heißen, 拔 »ziehen«, 把 »ergreifen« oder 爸 »Papa«. Um es noch komplizierter zu machen: Es gibt jeweils auch mehrere Schriftzeichen, die völlig gleich ausgesprochen werden. So klingt beispielsweise 疤ba »Narbe« wie das ba in »acht« oder 坝ba »Staudamm« wie das ba in »Papa«. Beim Sprechen kommt es also immer auf den Kontext an, und selbst dann entstehen noch Missverständnisse, auch unter Chinesen. Deshalb malen sie in Konversationen manchmal Schriftzeichen mit dem Finger in die Luft, um klarzustellen, was sie meinen.
Ende der Leseprobe