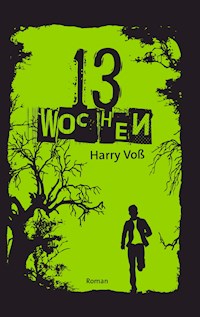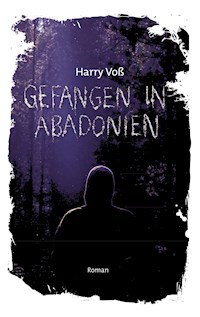
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bibellesebund
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Für seine jüngere Schwester Hanna ist Alexander der große Held: Er kann Geschichten erzählen, bis Hanna ganz im Reich der Träume versinkt. Doch plötzlich verschwindet Hanna. Verzweifelt macht sich Alex auf die Suche. Was geht hier vor sich? In einer völlig anderen Welt, Abadonien, macht sich Akio zusammen mit seiner Nachbarin Silva auf den Weg, um seine von Räubern entführte Schwester zu befreien. In Abadonien weiß man nichts von Alexanders Welt. Aber als Alexander und Silva sich plötzlich gegenüberstehen, wird klar, dass Alex eine Reise antreten muss, die ihn und sein Leben völlig aus der Bahn wirft …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Harry Voß
Gefangen in Abadonien
Roman
Harry Voß, Jahrgang 1969, ist Referent für die Arbeit mit Kindern beim Bibellesebund. Bekannt wurde er durch die Buchreihe „Der Schlunz“, die 2010 und 2011 auch verfilmt wurde. Seine Kinder sind inzwischen aus dem Schlunz-Alter rausgewachsen.
Für sie und alle anderen Teenager hat er sich mit »13 Wochen« auf neues Land gewagt, und nach dem erfreulichen Erfolg legt er jetzt mit »Gefangen in Abadonien« noch einmal nach.
Mit seiner Familie lebt Harry Voß in Gummersbach.
Impressum
© 2015 by Verlag Bibellesebund Marienheide
SCM-Verlag GmbH & Co. KG, 58452 Witten
© 2019 der eBook-Ausgabe
Bibellesebund Verlag, Marienheide
https://shop.bibellesebund.de/
Cover: Luba Siemens, Gummersbach.
ISBN 978-3-95568-310-8
Bei den angegebenen Bibelversen handelt es sich um eine freie Übertragung des Autors
Hinweise des Verlags
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf - auch teilweise - nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des Textes kommen.
Noch mehr eBooks des Bibellesebundes finden Sie auf
www.ebooks.bibellesebund.de
Inhalt
Titel
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 1
»Am Anfang ist das Wort. Mein Wort. Das Wort in mir. In meinen Gedanken. Meine Gedanken werden Wort. Und das Wort kommt durch meine Hand zu Papier. Sobald es aufgeschrieben ist, lebt es. Alle Dinge auf dem Papier sind durch mein Wort erschaffen. Ohne mein Wort gäbe es nichts von all dem, das erschaffen ist.«
Akio ließ seinen Stift sinken und blinzelte in die Sonne. Ihm gefiel das Gefühl, Welten erschaffen zu können, Menschen zu erfinden, sie kämpfen und siegen zu lassen. Zwar nur auf einem Blatt Papier, aber immerhin. Über die Welt, die er auf seinem Papier erschaffen hatte, war er allein der Herr. Er entschied, wann und wie jemand siegte. Er konnte Helden gewinnen, Bösewichte verlieren lassen. Oder umgekehrt. Und niemand konnte ihn dafür zur Rechenschaft ziehen. Zumindest nicht die Helden und Bösewichte seiner Geschichte.
Ein Grinsen machte sich auf Akios Gesicht breit. Wenigstens hier auf dem Papier konnte er beeinflussen und lenken, dass das Gute über das Böse siegte. Ganz anders als in der Welt, in der er und seine Familie lebten.
Akio verbrachte den sonnigen Nachmittag auf einem großen, warmen Stein außerhalb des Dorfes, während Pollum, sein kleiner, geschuppter salamanderartiger Dracolepidus eifrig über den Stein und den Erdboden darunter hin und her kletterte, um nach Insekten und Blutwürmern zu suchen, die er verschlingen konnte. Die Arbeiten im Stall und in der Schmiede seines Vaters waren heute schnell erledigt gewesen. Die paar verbleibenden Stunden bis zum Sonnenuntergang wollte Akio hier draußen verbringen. Weg von den Menschen, die oft misstrauisch, launisch und eigensinnig waren. Außerdem hatte er hier in der Einsamkeit die seltene Gelegenheit, wenigstens für kurze Zeit seine drückende, enge Lederhaut auszuziehen. Die maßgeschneiderte zweite Haut, die seinen kompletten Oberkörper bis kurz vor die Handfläche und seine Beine vom Knöchel bis zum Oberschenkel bedeckte, sollte verhindern, dass ihm jemand in die Haut stach und sein wertvolles Blut stahl. Akios Blut war schon in seiner Kindheit vom Dorfpriester als außergewöhnlich hochwertig eingestuft worden. »Golden« nannten es die Priester, obwohl es natürlich nicht wirklich aus Gold bestand. Aber es war wertvoll genug und damit gewinnbringend für Bluträuber, die es in Abadonien in großer Zahl gab. Darum trug Akio diese zweite Haut wie einen Ganzkörperanzug unter seinem Hemd und unter der Hose, auch wenn sie furchtbar drückte. Hier draußen, weit weg von Dieben, Räubern und anderen Menschen, hatte er sein Hemd und seine Lederhaut ausgezogen und genoss mit geschlossenen Augen, wie die Sonne Brust und Rücken wärmte. Dabei konnte er in aller Ruhe nachdenken, träumen und Geschichten erfinden. Aus Gedanken Worte formulieren, aus Worten Welten erschaffen, aus seinen eigenen Welten Kraft und Hoffnung schöpfen. Hoffnung darauf, dass alles irgendwann auch in dieser Welt besser sein könnte. Ohne Neid, Missgunst, Angst oder Streit.
Akio atmete einmal tief aus, öffnete die Augen und blinzelte in die Ferne. Die Landschaft in Abadonien bestand zum größten Teil aus trockenem Fels und Sand. Rotbraune Erde, wohin man schaute. Gras oder Blumen kannte Akio nur vom Dorfpriester. Der brachte manchmal bestimmte Blumen oder Pflanzen mit, wenn er von weiten Reisen in abgelegenen Bergen zurückkam. Um Berge zu erreichen, musste man sich allerdings von Akios Dorf aus auf einen mehrtägigen Weg machen. Wenn Akio von hier aus in die Ferne sah, konnte er viele Kilometer weit schauen, bis der sandige Boden zu einer verschwommenen Linie unter dem blauen Himmel wurde.
Eine Staubwolke am Horizont erregte seine Aufmerksamkeit. Er sah Staub aus Sand, der durch eine Gruppe galoppierender Pferde aufgewirbelt wurde. Schwarze, gefährliche Hunde rannten laut bellend neben ihnen her. Akio kannte diese Erscheinung und ahnte, dass das nichts Gutes zu bedeuten hatte. Die schwarzen Pferde, die dunklen Reiter, die blutgierigen Hunde – alles klare Zeichen: Bluträuber waren im Anmarsch.
Lautlos glitt Akio von seinem Stein herunter, griff nach der Lederhaut und ging in Deckung. Während er Haut und Hemd anzog, beobachtete er die Horde der dunklen Reiter auf ihrem direkten Weg in sein Dorf: Eisendorf.
»Pollum, komm her«, flüsterte er und streckte seinem Tier den Arm entgegen. Sofort sprang Pollum auf den Arm und verschwand unter dem weiten Ärmel seines Herrchens. Akio steckte Papier und Stift in seinen Gürtel.
Was die Reiter vorhatten, war klar. Sie wollten plündern, morden und vor allem Menschen gefangen nehmen für den Moloch. Menschen mit wertvollem, goldenem Blut. Im selben Augenblick wurde ihm klar, dass nicht nur er, sondern erst recht seine kleine Schwester Adelia mal wieder in großer Gefahr war.
Kapitel 2
»Alexander, hast du aufgepasst?«
Herr Neumann, der Lateinlehrer, stand an der Tafel und sah streng in die letzte Reihe der Klasse.
»Klar«, antwortete Alexander schnell. »Pronomen. Der Relativsatz wird mit einem Pronomen übersetzt.«
»Nein, so kann man das nicht sagen.« Der Lehrer seufzte und begann, sein Thema über Relativpronomen noch einmal aufzurollen. Offensichtlich hatte er durch Alexanders Antwort immerhin den Eindruck bekommen, er hätte aufgepasst. Das war schon mal gut. Alexander schaute auf die Uhr. Noch zehn Minuten, dann war er von Latein erlöst. Danach Mathe. Auch nicht viel besser.
Seine Mutter versuchte ihm fast täglich einzureden, er müsste sich mehr für die Schule interessieren, immerhin sei er schon 15 Jahre alt und er lernte ja fürs Leben und er brauchte nach der neunten Klasse ein gutes Abschlusszeugnis und so weiter. Aber diese Einstellung fand in seinem Kopf einfach keinen Platz. Konnte man sich denn zwingen, sich für etwas zu interessieren, das absolut überflüssig war? Wann um alles in der Welt brauchte er in seinem weiteren Leben Relativpronomen, binomische Formeln oder Zellbiologie?
Alexander stützte den Kopf auf seine Hand und kritzelte in seinem aufgeschlagenen Block herum. Er musste an seine Schwester Hanna denken. Die würde sich niemals mit solchen Themen herumschlagen müssen. Sie war jetzt sechs Jahre alt, aber an Lesen und Schreiben war bei ihr nicht zu denken. Von ihrer Entwicklung her war sie auf dem Stand einer Dreijährigen, befanden die Ärzte. Für Buchstaben und Zahlen hatte sie jetzt zumindest noch keinen Sinn. Und mit Relativpronomen würde sie sich garantiert auch mit 15 Jahren niemals beschäftigen müssen. Und? War Hanna unglücklich? Nein, war sie nicht. Im Gegenteil. Alexander hatte in seinem Leben noch nie einen Menschen gesehen, der so viel Glück, Freude und Zufriedenheit ausstrahlte. Sobald Alexander ins Zimmer kam und sich neben sie setzte, ging ein Leuchten von ihr aus, das heller war als jede Lampe. Immer wenn sie ihn mit ihrer stürmischen Art umarmte, floss spürbare Wärme von ihrem Körper in seinen. Gemeine Gedanken, Neid, Misstrauen – dafür war in ihrem Herzen kein Platz. Ihr Inneres war bis zum Rand gefüllt mit Liebe, Wärme und Lebensfreude. Jeder, der schlechte Laune hatte, musste sich nur fünf Minuten lang mit ihr beschäftigen und die schlechte Laune war wie weggeblasen. Und das ganz ohne Latein und all den Blödsinn, den einem die Lehrer als so lebenswichtig verkaufen wollten.
»Hast du es jetzt verstanden, Alexander?«, schloss Herr Neumann seinen kleinen Vortrag ab.
»Klar«, antwortete Alexander wie vorhin. »Relativpronomen sind sehr wichtig fürs Leben.«
»Da hast du allerdings recht«, gab der Lehrer zurück und war mit dieser Antwort zufrieden. Alexander grinste und schaute wieder auf die Kritzeleien in seinem Collegeblock.
»Achtung, Alex!«, hörte er plötzlich eine laute Stimme vom anderen Ende der Klasse. »Fang auf! Hier kommt ein Feuer-Pronomen!«
Und noch bevor Alex überhaupt reagieren konnte, hatte Marcel ein dickes Stück Kreide mit voller Wucht in seine Richtung geworfen. Das Kreidestück zischte direkt auf Alex’ Gesicht zu. Alex war wie gelähmt. Mehr als die Augen aufzureißen, gelang ihm in dieser Schrecksekunde nicht.
Doch plötzlich änderte sich etwas.
Das Kreidestück bremste kurz vor Alex’ Gesicht ab, flog im Zeitlupentempo einen Bogen um seinen Kopf herum, zischte hinter ihm in der vorherigen Geschwindigkeit weiter und knallte in irgendeiner Ecke auf den Boden.
Nicht jeder in der Klasse hatte das mitbekommen. Und auch Alex hätte nachträglich geglaubt, er hätte sich das nur eingebildet, wenn nicht Marcel in der anderen Ecke des Raumes mit weit aufgerissenem Mund dagestanden hätte. Auch die wenigen anderen, die den Flug der Kreide zuerst amüsiert verfolgt hatten, hatten jetzt vor Erstaunen die Kinnlade nach unten geklappt.
Alex schaute kurz zu dem Kreidestück, das reglos auf dem Boden lag. Dann zurück zu Marcel, der regungslos vor seinem Stuhl stand. »Wie hast du das gemacht?«, hauchte Marcel mit belegter Stimme.
Alex hatte keine Ahnung. Er hatte nichts gemacht.
Kapitel 3
Akio sprang hinter seinem Felsen hervor und rannte Richtung Dorfeingang. Immer versteckt hinter einzelnen Häusern, Holzfässern oder Pferdewagen. Hatte er recht mit seinem Verdacht? Das ließe sich ja schnell herausfinden. Wenn die Männer nicht nur Essensvorräte, Schmuck oder Gold an sich rissen, dann wusste er, was ihr Ziel war. Sie waren darauf aus, Menschen mit hochwertigem, goldenem Blut zu verschleppen. Und falls es gut ausgebildete Bluträuber waren, dann schnappten sie sich nicht einfach blind die erstbesten Bürger. In diesem Fall hatten sie schon Tage oder Wochen vorher Blutspäher vorausgeschickt. Die nämlich waren in der Lage, Menschen mit besonders goldenem Blut ausfindig zu machen und diese dann mit einem bestimmten Duft zu bestäuben, der für Menschen kaum wahrnehmbar war, für die Hunde der Bluthäscher jedoch umso leichter aufzuspüren. So konnten die Hunde die Räuber gezielt zu den Häusern führen, die von »Goldblütern« bewohnt waren. Goldblüter – so nannten sie Menschen mit gewinnbringend hochwertigem Blut. Sollte das alles genau so zutreffen, dann mussten die Männer wissen, dass es in Eisendorf inzwischen nur noch genau drei Personen gab, deren Blut so golden war, dass man damit das Blut von vier bis fünf anderen Menschen aufwiegen konnte: Akio selbst, seine sechsjährige Schwester Adelia und ein kleiner Junge ein paar Häuser weiter. Alle anderen waren bei früheren Überfällen schon verschleppt worden. Weil die verbliebenen drei wussten, dass sie in ständiger Gefahr gegenüber Bluträubern lebten, hielten sie sich meistens versteckt und trugen obendrein Lederhäute, damit kein Späher ihnen heimlich Blut abnehmen und es auf seinen Goldgehalt untersuchen konnte.
Akio hatte in den letzten Tagen keinen dieser Späher entdeckt. Aber das musste nichts heißen. Diese Kerle waren inzwischen so geschickt und gerissen, dass man manchmal erst merkte, dass man beobachtet wurde, wenn die Bluträuber schon hinter einem standen und einen mitrissen.
Akio näherte sich seinem Haus. Schwarze Hengste standen unruhig auf der Straße und schnaubten. Bluthunde trabten gefährlich bellend zwischen ihnen auf und ab und warteten auf neue Befehle. Wie bei den letzten Malen, als Bluträuber im Dorf waren, um ihn und Adelia mitzunehmen. Bisher war es immer so gelaufen, dass Akio sich mit Adelia im hinteren Bereich der Schmiede in einem extra dafür gebauten Versteck eingesperrt hatte, während der Vater mit Schwert, Axt und roher Gewalt auf die Räuber einschlug. Die Kämpfe dauerten unterschiedlich lang und der Vater trug nach jedem Kampf einige gefährliche Wunden und Hundebisse mehr an seinem Körper. Aber bisher hatten sich die Räuber anschließend immer ohne ihre Beute davongemacht.
Heute schien es anders abgelaufen zu sein. Auf der Straße war kein kämpfender Schmied zu sehen. Die Männer kamen aus verschiedenen Richtungen zusammengelaufen und sprangen auf die Pferde. Erst als sie ihre Reittiere mit festen Tritten zum Aufbruch antrieben, bemerkte Akio auf einem der Pferde ein in Decken gehülltes Bündel Mensch. Ein Schrecken durchfuhr seine Glieder: Das musste Adelia sein. Oder war es der Junge aus der Nachbarschaft? Am liebsten hätte Akio laut aufgeschrien, die Räuberbande wütend von ihren Pferden gezogen, sie verprügelt und seine Schwester zurück ins Haus getragen. Aber das tat er nicht. Er blieb im Schatten eines der Nachbarhäuser stehen und schaute ängstlich auf das, was da vor seiner eigenen Haustüre vor sich ging. Akio trug keine Waffe bei sich. Die Männer auf den Pferden hingegen waren mit Dolchen, Säbeln und Schwertern bis an die Zähne bewaffnet. Akio war allein, die Männer waren mehr als zehn. Außerdem hatte Akio nie gelernt zu kämpfen. Er besaß zwar ein Schwert, aber das stand irgendwo in der Schmiede herum und war nie wirklich benutzt worden. Dazu war er längst nicht so stark wie sein Vater. Und schließlich: Akio durfte sich auf keinen Fall so offen zeigen. Denn wenn die Räuber Adelia gefunden hatten, waren sie selbstverständlich auch auf der Suche nach Akio. Sie würden ihn ohne Mühe überwältigen und ebenso mitnehmen. Akio fühlte sich hilflos und elend.
Staub wirbelte auf. Die Räuber donnerten davon. Als sie weit genug weg waren, rannte Akio zum Haus seiner Eltern. Er zog seinen Kopf ein, um durch die niedrige Haustür ins Innere zu gelangen. Dann brauchte er eine Weile, bis sich seine Augen an das schwache Licht in dem dunklen Wohnraum gewöhnt hatten. Trotzdem erkannte er schnell, dass die Räuber hier wirklich gründlich gesucht hatten. Tische und Stühle waren umgestoßen, Geschirr zerschlagen, der Fußboden lag voller Scherben. Pollum kam aus Akios Ärmel herausgekrochen und flitzte über den schmutzigen Boden, um auch hier nach leckeren Würmern oder Käfern zu suchen.
Adelias Bett hinter dem Ofen in der Mitte der Stube war grob durchwühlt worden, die Bettdecke aufgeschlitzt, das Kissen achtlos in eine Ecke geworfen. Es war leer. Einzig ihre Stoffpuppe lag auf dem Bett, als wäre sie die einzige Überlebende nach einer furchtbaren Schlacht. Akio griff nach der Stoffpuppe und drückte sie an sich. Er selbst hatte sie vor einem Jahr für seine Schwester hergestellt. Er hatte sich Stoff beim Leinweber im Nachbardorf besorgt und über mehrere Wochen mit viel Mühe und unter Anleitung seiner Mutter Arme, Beine, einen Körper und einen Kopf zusammengenäht. Er hatte ein Gesicht auf den glatten Kopf gestickt und echte Haare aus dem Schweif seines Pferdes oben angenäht und zusammengeflochten. Zum Schluss hatte er sogar noch ein Kleid für die Puppe geschneidert. Adelia hatte vor Freude geweint, als Akio ihr die Puppe überreichte. Sie hatte ihr den Namen Jasmin gegeben. Seitdem trug sie die Puppe stets mit sich herum, spielte mit ihr »Mutter und Kind«, fütterte sie und brachte sie abends liebevoll ins Bett. Tja. Und dort im Bett lag sie jetzt immer noch, während Adelia gerade irgendwo weit weg Todesängste ausstand. Akio hielt sich Jasmin dicht ans Gesicht, schloss die Augen und roch an dem Stoff der kleinen Puppe. Er roch nach Adelia. Nach ihrem goldreinen Herzen, nach ihrer liebevollen Art, nach ihrem Lachen. Akio merkte, wie Tränen in seine Augen schossen.
Als er die Augen wieder öffnete und sich weiter in dem Wohnraum umschaute, sah er die Beine seines Vaters, die unter dem Schutt aus Tischen und Stühlen herausschauten. Der Vater stöhnte.
»Vater, was ist los?« Akio legte Jasmin zurück aufs Bett, setzte sich auf die Knie und krabbelte zu ihm unter die Bank. »Was ist passiert? Warum hast du nicht gekämpft?«
»Ich habe gekämpft«, brachte der Vater mühsam hervor. Erst jetzt sah Akio, dass sein Gesicht voller Blut war. »Ich habe gekämpft, so gut ich konnte. Aber sie waren zu viele. Und ihre Hunde …« Er zeigte auf seine Beine. Die Hose war aufgerissen. Klaffende Wunden hatten dreckige Blutspuren hinterlassen.
»Ich habe alles gegeben«, schluchzte er, »aber ich habe versagt. Ich hätte noch mehr kämpfen müssen! Ich hätte Adelia schützen müssen!«
Akio neigte sich zum Vater und legte ihm seine Hand auf die Schulter. »Beruhige dich. Du hast alles gegeben. Ich bin stolz auf dich!«
Auf einem Hocker neben dem Ofen saß die Mutter, hielt ihr Gesicht hinter den Händen vergraben und schluchzte leise: »Sie haben sie mitgenommen! Sie haben unser geliebtes Kind mitgenommen!«
Akio richtete sich wieder auf und fühlte sich machtlos. Seinen Vater so niedergeschlagen zu sehen – das war ein Bild, das er nicht kannte und das er auch nicht hinnehmen wollte. »Jemand muss sie zurückholen!«, rief er laut und aufgeregt. »Das ist doch wohl klar!«
»Aber wer?«, weinte die Mutter in ihre Hände hinein. »Sie sind zu stark!«
»Wir sind auch stark! Vater ist stark! Vater war immer stark! Die Hundebisse machen ihm nichts aus!« Akio wandte sich dem stöhnenden Mann auf dem Boden zu. »Nicht wahr, Vater?«
»Meine Wunden sind zu viele«, kam die Stimme des Vaters unter den umgestoßenen Möbeln hervor. »Meine Beine tragen mich kaum noch. Und die Kraft, die ich einmal hatte, ist schon lange von mir gewichen. Das siehst du doch.«
»Du hast immer noch genug Kraft!«, tönte Akio laut. »Außerdem bin ich auch noch da! Ich komme mit dir!« Akio setzte sich auf seine Knie und rief noch lauter in Richtung Vater: »Ich helfe dir! Wir gehen zusammen!«
»Du kannst nicht gehen«, krächzte der Vater, »das weißt du doch.«
»Ich werde meine Schwester retten, das weiß ich!« Akios Stimme sollte fest und entschlossen klingen, aber sie war voller Angst und Hilflosigkeit.
»Du bist ein Goldblüter«, pflichtete die Mutter bei und ließ ihre Hände in den Schoß sinken. Akio konnte ihre verweinten Augen sehen. »Die Späher werden dein goldenes Blut aufspüren. Sie werden dich gefangen nehmen. Sie werden dich wie Adelia dem Moloch vorwerfen.« Sie schüttelte den Kopf und schloss ihre Augen. »Es hat keinen Zweck.«
Keinen Zweck? Akio fühlte sich elend. Wie konnten seine Eltern sich so ihrer Mutlosigkeit ergeben? Man musste doch etwas tun! Man konnte immer etwas tun! Vater hatte sich bisher nie unterkriegen lassen! Warum jetzt? War er wirklich mit seiner Kraft am Ende? Nein. Akio wollte sich nicht von seiner Traurigkeit und Hilflosigkeit überwältigen lassen. Er erhob sich und merkte dabei, wie sich eine gehörige Portion Wut in ihm ausbreitete: »Das werden wir ja noch sehen, ob es keinen Zweck hat!« Er drehte sich um, ging nach draußen und trat unterwegs lautstark einen Topf aus Metall zur Seite. Pollum quiekte auf, dann flitzte er Akio hinterher, sprang ihm von hinten an sein Hosenbein und krabbelte unter sein Hemd.
Kapitel 4
Nach der Schule war Alex jedes Mal so erschlagen, dass er das Gefühl hatte, er müsste erst mal für mindestens zwei Stunden ins Bett, obwohl er heute schon um kurz nach eins zu Hause ankam. Aber heute hatte er auch noch so viele Hausaufgaben aufbekommen, dass er fast befürchtete, erst um Mitternacht schlafen gehen zu können.
An der Wohnungstür im dritten Stock empfing ihn bereits Hanna: »Alex kommt!« Noch bevor er seine Jacke ausgezogen hatte, umarmte sie ihn stürmisch. Ihre dichten, dunklen, naturgelockten Haare wippten dabei auf und ab: »Alex lieb!«
Alex ließ sich die Umarmung gefallen und drückte seine Schwester an sich. »Ich hab dich auch lieb.« Schon durchfuhr eine wohlige Wärme seinen Körper. Alex hatte die gleichen Haare wie seine Schwester: dunkel, fast schwarz – das ging ja noch – und voller Locken, die mit keiner Bürste dieser Welt zu bändigen waren. Während das bei Hanna ganz süß aussah, fand er diese lockigen Haare, die seitlich in alle Richtungen abstanden, an seinem eigenen Kopf total widerlich. Dadurch wirkte sein sowieso schon viel zu schmales Gesicht mit der kleinen Nase noch schmaler. Fast krank, dachte er manchmal, wenn er sich morgens im Spiegel betrachtete.
»Alex eine Geschichte erzählen!«, forderte Hanna ihn auf.
»Ja, warte.« Alex ging mitsamt der ihn umklammernden Hanna durch die Tür in die Wohnung hinein. »Lass mich doch erst mal ankommen.«
»Ach, da bist du ja!«, rief Alex’ Mutter aus dem Badezimmer. »Kannst du euch beiden eine Pizza warm machen? Ich bin nicht zum Kochen gekommen! Und ich muss auch jetzt gleich wieder weg! Wir haben noch Teambesprechung, das kann etwas länger dauern.«
Teambesprechung. Was hatte seine Mutter in dieser kleinen Arztpraxis, in der höchstens fünf Leute arbeiteten, so oft im Team zu besprechen? Ganz häufig kam es vor, dass sie nachmittags noch mal in die Praxis musste, obwohl sie eigentlich nur halbtags arbeitete.
»Ja, okay«, gab er trotzdem nach. Er warf seine Schultasche in den Flur, hängte seine Jacke auf und zog die Schuhe aus.
»Alex eine Geschichte erzählen«, wiederholte Hanna und schob Alex ins Wohnzimmer.
Alex lachte. »Sollen wir nicht zuerst was essen?«
»Nein, nicht essen. Alex eine Geschichte erzählen.« Hanna strahlte übers ganze Gesicht, schob ihn bis ans Sofa und gab ihm dann noch einmal einen Stoß, sodass er lachend auf die Polster plumpste. Sofort setzte sich Hanna neben ihn und kuschelte sich an seine Seite. Alex legte wie ein großer Papa seinen Arm um sie. Wenn sie schon keinen wirklichen Papa hatte, der sich um sie kümmerte, versuchte Alex so oft wie möglich, ihr ein bisschen Papa-Geborgenheit zu geben. So eine, wie er sie selbst vermisste, seit sein Vater vor fünf Jahren die Familie verlassen hatte, ohne dass Alex wusste warum. Er war eines Tages einfach weg gewesen und die Mutter hatte nie eine Erklärung gegeben. Und weil sie nichts sagte, fragte Alex nicht nach, obwohl ihm eigentlich tausend Fragen durch den Kopf gingen. Dass sein Vater ihm damals noch kurz vorher aus einem Buch vorgelesen hatte, dann ohne eine Verabschiedung verschwunden war und sich seitdem nur noch an Alex’ Geburtstagen mit einem kurzen, peinlichen Telefonat bei ihm meldete, tat Alex so weh, dass er sich zwingen musste, möglichst selten daran zu denken. Die Mutter tat immer ganz tapfer und hatte den Alltag gut im Griff. Er hatte sie nie weinen gesehen. Und er selbst hatte, als der Vater weg war, immer nur abends im Bett geweint. Aber dann hatte er beschlossen, das Spiel »Alles ist gut, alles läuft weiter« mitzuspielen und auch den Tapferen zu mimen. Mit seiner Schwester Hanna versuchte er seitdem noch mehr Zeit zu verbringen. Ihre Liebe tat ihm gut. Und er spürte, dass sein Großer-Bruder-Arm um ihre Schulter auch ihr guttat.
»Also«, wollte er seine Geschichte beginnen.
Die Mutter kam zur Wohnzimmertür und hatte ein Handtuch um ihren Kopf gebunden. »Hör mal, kannst du vielleicht auch mit Hanna zum Logopäden gehen? Sie hat heute wieder ihren Termin, aber ich hab beim besten Willen keine Zeit.«
»Zum Logopäden? Wo ist der denn? Ich kenn den gar nicht.«
»Klar kennst du den. In der Mühlenstraße am anderen Ende der Stadt.«
»Wie soll ich denn da hinkommen?«
»Mit dem Bus natürlich. Du hast doch eine Busfahrkarte. Und Hanna fährt mit ihrem Ausweis frei, das weißt du doch.«
»Aha.«
Die Mutter ging von der Wohnzimmertür zurück ins Bad. Dabei redete sie weiter: »Um halb drei hat sie den Termin. Nächste Woche kann ich wieder hingehen. Aber heute wär es mir echt eine Hilfe, wenn du gehen würdest.«
Puh. Mit Hanna Bus fahren? Den Logopäden finden? Wieder nach Hause? Wie lange sollte das denn dauern? Schaffte er das überhaupt? Was, wenn er Hanna unterwegs verlieren würde? Auf dem Spielplatz hier im Wohnblock war er schon oft mir ihr gewesen. Das war eigentlich kein Problem. Aber auch da war es einmal vorgekommen, dass sie plötzlich verschwunden war. Sie hatte irgendwo eine Taube gesehen, der sie so lange nachgelaufen war, bis vom Spielplatz nichts mehr zu sehen war. Er hatte eine ganze Weile wie verrückt nach ihr gerufen, bis er sie endlich in einer Seitenstraße gefunden hatte.
Und jetzt bis ans andere Ende der Stadt? Andererseits – das wäre eine willkommene Ausrede, keine Hausaufgaben machen zu müssen.
Alex drehte seinen Kopf Hanna zu: »Was meinst du, Hanna: Sollen wir zwei in die Stadt zum Logopäden fahren?«
»Ja!«, freute sich Hanna und klatschte in die Hände. »Hanna, Alex Stadt fahren!«
Ob das gut ging? Alex spürte allein bei dem Gedanken daran eine gewisse Aufregung. Auf der anderen Seite war es ja auch gut, mal etwas Neues zu wagen. In grübelnden Gedanken verhangen schaute er sich im Wohnzimmer um, als suchte er eine Antwort auf seine Unsicherheit. An der Wand neben dem Fernseher hing ein großer Monatskalender, auf dem immer irgendein schlauer Spruch stand. In diesem Monat war ein Jugendlicher mit einem Kind an der Hand abgebildet, die gemeinsam über eine sonnige Wiese schlenderten. Darüber stand in großen Buchstaben: »Tu’s einfach! Du wirst einen unvergesslichen Tag erleben!«
Alex schloss die Augen, legte seinen Kopf zurück auf die Rückenlehne des Sofas und grinste. Dieses Bild und der Spruch auf dem Kalender waren ja wie auf ihn zugeschnitten! Das hätten Hanna und er sein können. Und der Spruch war eine Mut machende Antwort für ihn. Mit einem Mal war der Nachmittag für ihn eine beschlossene Sache. Er entschied sich, dieses Bild und diesen Spruch als Motto für den Tag zu nehmen. Er grinste noch breiter und fühlte sich nun richtig motiviert für seinen Ausflug. Schon krass, wie manchmal Erlebnisse so genau zusammenpassten, als hätte jemand ein Drehbuch für den »Film deines Lebens« geschrieben, in dem einfach ein paar Zufälle zusammenzuspielen schienen, die aber nur dazu dienten, den Film zu einem Happy End zu bringen. Alex öffnete die Augen, um sich das Bild und den Spruch noch einmal anzuschauen. Beim Blick auf den Kalender fror sein Grinsen auf der Stelle ein. Der Kalender zeigte immer noch dasselbe Foto wie vorher: ein Jugendlicher mit einem Kind auf der Wiese. Aber der abgedruckte Spruch lautete nun plötzlich: »Dies ist kein Film. Dies ist dein Leben!«
Kapitel 5
»Was machst du denn hier?«
Das Mädchen mit den dicken, lockigen roten Haaren warf Akio einen scharfen Blick zu, während sie zwei Häuser entfernt ihrem Pferd eine Decke über den Rücken legte und einige Gepäckstücke daran befestigte. Ihr Name war Silva.
»Was soll die Frage?« Akio blieb auf der Straße in der Nähe seiner Haustüre stehen. »Ich wohne hier.«
»Wieso haben sie dich nicht mitgenommen?« Wut und Verachtung lagen in ihrer Stimme. Sie ging um ihr Pferd herum und legte ihm mit schnellen Griffen das Zaumzeug an.
Silva war die Schwester von Agnus, dem dritten Goldblüter im Dorf neben Akio und Adelia. Während Agnus wie Adelia liebevoll und freundlich war, war Silva grob und kaltschnäuzig. Sie war genauso alt wie Akio: fünfzehn. In ihrer Kindheit hatte Akio sie oft auf der Straße mit Jungen Fußball spielen und manchmal sogar im Dreck raufen sehen, während Akio eher von ferne zugesehen und dabei über die Welt nachgedacht hatte. Silva schimpfte und fluchte ohne Hemmungen. Einmal hatte Akio sie mit einem toten Hasen ins Dorf kommen sehen, den sie mit Pfeil und Bogen selbst erlegt hatte. Meistens versuchte Akio, ihr aus dem Weg zu gehen.
»Ich habe mich versteckt«, antwortete er ihr. Pollum schaute mit seinem Kopf kurz aus dem Hemdkragen heraus, als wollte er nachschauen, mit wem sich sein Herrchen unterhielt.
»Glückwunsch!«, keifte sie zurück. Mit flinken und sicheren Bewegungen zog sie die Riemen rund um den Kopf des Pferdes zu. Ein Rucksack lag fest verschnürt auf der Straße.
Akio ging ein paar Schritte auf sie zu: »Du verreist?«
»Verreisen kann man das wohl kaum nennen!« Sie griff nach dem Rucksack und warf ihn sich auf den Rücken. »Ich hol mir meinen Bruder zurück!«
»Agnus!«, entfuhr es Akio erschrocken. Also doch – auch er war mitgenommen worden! Die Blutspäher hatten ganze Arbeit geleistet.
»Natürlich Agnus!«, raunzte Silva. »Ich hab nur einen Bruder.« Dann hielt sie in ihren Bewegungen inne, deutete mit dem Kinn auf Akios Haus und fügte hinzu: »Deine Schwester haben sie doch auch mitgenommen!«
»Ja.« Akio nickte.
»Und du? Willst du sie ihnen überlassen?«
»Nein! Natürlich nicht!«
»Warum zum Henker sitzt du dann nicht längst auf deinem Pferd und reitest ihnen hinterher?«
Tja, warum? Weil seine Eltern meinten, er würde das nicht schaffen? Weil er selbst es sich nicht zutraute? Weil er Angst um sein eigenes Leben hatte? Weil er wusste, dass Räuber wie diese auch nach seinem Blut lechzten?
»Schon klar«, gab sich Silva selbst die Antwort. »Du sitzt ja lieber in der Sonne und schreibst Gedichte. So jemand stürzt sich nicht in einen Kampf mit Räubern. Richtig?«
»Ich bin selbst ein Goldblüter«, erwiderte Akio. Doch in diesem Augenblick klang das nicht wie eine gute Ausrede. Trotzdem redete er weiter: »Sie suchen nach Leuten wie mir. Wenn ich ihnen hinterherreite, dann reite ich in den Tod.«
»Ich will dir mal was sagen, mein zarter Goldblut-Popo.« Silva kam ein paar Schritte auf Akio zu. »Selbst wenn mein Blut das goldenste Gold der Welt wäre, würde ich keine verdreckte Sekunde zögern, um meinen Bruder aus den Händen dieser Vollidioten zu befreien! Und wenn ich dabei mein Leben verlieren würde, dann würde ich selbst im Angesicht des Todes noch denken: Ich hab es für meinen Bruder getan! Und dann, zum Henker, würde ich voll Stolz und erhobenen Hauptes sterben!« Sie zog einmal fest und geräuschvoll den Rotz aus ihrem Hals nach oben. »Und es wäre eine Schande für mich und meine Familie, wenn ich mit einem Blatt Papier auf dem Schoß vor meiner Haustüre sitzen würde, süße Geschichten schriebe und dabei genau wüsste, dass irgendwo anders mein Bruder – mein eigenes Fleisch und Blut – einem gierigen Drachen zum Fraß vorgeworfen würde! Das kannst du mir glauben, verdreckt und zugenäht!« Damit spuckte sie den Rotz, den sie gerade hochgezogen hatte, mit einem festen Schuss Akio direkt vor die Füße, drehte sich um und ging auf ihr Reittier zu. Im nächsten Augenblick sprang Pollum aus Akios Hosenbein heraus und beschnupperte neugierig, was Silva dort hingespuckt hatte.
Akio wusste genau, warum er die Nähe von Silva mied. Ihre kalte, forsche und viel zu laute Art verunsicherte ihn und gab ihm das Gefühl, klein und unfähig zu sein. Aber wenn er ehrlich war, musste er zugeben, dass sie – wenn auch in unangemessenem Ton – recht hatte. Seine über alles geliebte Schwester war weg. Adelia erschien ihm mit ihrer unschuldigen und liebevollen Art fast schon wie eine Heilige. Und nun stand er hier auf der Straße und war zu feige, sich auf den Weg zu machen, um sie zu retten. Gleichzeitig machte sich die ungehobelte Nachbarin ohne zu zögern auf den Weg, um den Menschen zu retten, den sie liebte. Wer von ihnen beiden hatte nun das goldenere Blut?
»Ich komme mit!«, entfuhr es ihm plötzlich.
Silva blieb stehen und drehte sich zu ihm um. »Was willst du?«
»Ich komme mit!« Akio wunderte sich über seinen Mut, aber der feste Entschluss, der soeben in ihm gereift war, fühlte sich gut an.
Silva grinste verächtlich. »Weißt du überhaupt, wie man reitet?«
»Natürlich weiß ich das.« Diese überhebliche Frage ärgerte ihn. Aber er beschloss, sich davon nicht runterziehen zu lassen. Stattdessen sagte er: »Ich wette, ich bin auf meinem Berber schneller als du auf deinem Araber.«
Jetzt grinste Silva wie jemand, den man zu einem Duell herausgefordert hatte. »Das will ich sehen.«
Mit diesem Grinsen konnte Akio besser leben. Sofort musste auch er grinsen. »Ich pack nur schnell meine Sachen. Warte noch fünf Minuten!«
Kapitel 6
Hanna trug Jacke und Mütze, als Alex mit ihr um kurz nach zwei das Haus verließ. Es war Mai. Viel zu warm für eine Mütze. Aber Alex wollte auf Nummer sicher gehen. Und Hanna hatte sich natürlich nicht beschwert. Sie beschwerte sich überhaupt nie, wenn Alex irgendwas mit ihr machte. Ob er sie durchkitzelte, auf eine zwei Meter hohe Mauer stellte oder sie einfach mal zehn Minuten am Esstisch warten ließ, während er im Nebenraum telefonierte – nie zweifelte sie an dem, was er tat. In ihren Augen war er immer der Größte und machte es immer richtig. Wenn er aufhörte mit der Kitzel-Attacke, umarmte sie ihn sofort wieder und rief: »Alex lieb!« Wenn er ihr auf der Mauer zugerufen hätte: »Spring!«, dann wäre sie gesprungen, auch wenn er sie mit ihren sechs Jahren aus dieser Höhe niemals hätte auffangen können. Wenn er sie im Zimmer allein gelassen hatte und nach einer bestimmten Zeit wieder zurückkam, dann strahlte sie ihn an, als hätte sie die ganze Zeit nur auf seine Rückkehr gewartet. Vorwurf? Misstrauen? »Wo warst du so lange?« Fehlanzeige. So was kannte Hanna nicht. Dass in einem menschlichen Herzen Gut und Böse miteinander im Streit liegen, wie er es mal irgendwo gehört hatte, das konnte man von Hanna wirklich nicht sagen. Das Gute in ihrem Herzen hatte sich so breit gemacht – da passte nichts Böses mehr rein.
»Alex, Hanna Stadt!«, freute sich Hanna, während sie zur Bushaltestelle gingen.
»Ja«, bestätigte Alex. »Aber nicht weglaufen, ja? Immer schön bei mir bleiben.«
»Ja.« Hanna nickte mit großen Bewegungen. »Immer schön bei Alex bleiben.«
»Gut so.«
An der Bushaltestelle setzten sie sich auf die kleine Bank. »Alex Geschichte erzählen«, bat sie ihn erneut und kuschelte sich an seine Seite. Alex musste grinsen. Wenn es nach Hanna ging, dann konnte er den ganzen Tag Geschichten erzählen. Am liebsten Geschichten mit Pferden und Mäuschen. Oder mit lieben Mädchen, die Hanna hießen und die ausschließlich Schönes erlebten. Und weil Alex Geschichten ebenso liebte, fiel ihm auch immer wieder eine neue ein. Manchmal erzählte er auch Geschichten, die ein bisschen spannender waren. Zum Beispiel, dass ein Böser kam und Hanna ihre Puppe wegnehmen wollte. Dann saß Hanna mit aufgerissenen Augen kerzengerade da, wedelte hektisch mit ihren Händen vor ihrem Körper und konnte sich erst wieder entspannen, wenn die Geschichte ein gutes Ende genommen hatte. Aber niemals sagte sie: »Nein, nicht so eine spannende Geschichte erzählen!« Alex konnte erzählen, was er wollte – für Hanna war es immer eine Heldengeschichte. Und das machte Alex noch mal besonders stolz.
Vor einiger Zeit hatte Alex begonnen, in einem Notizbuch alles aufzuschreiben, was ihm Schönes einfiel. Einen Handlungsstrang, eine witzige Begebenheit, ein kluger Spruch. Dann konnte er etwas davon in seiner nächsten Geschichte einflechten. In diesem Notizbuch schrieb er manchmal auch nachträglich eine der Geschichten auf, die er Hanna erzählt und die ihm selbst beim Erzählen so gut gefallen hatte, dass er sie nicht vergaß. Dabei stellte er sich vor, wie irgendwann alle seine Pferdchen-, Mäuschen- und Hannageschichten als Buch veröffentlicht würden. Dieser Gedanke reizte ihn so, dass er manchmal alle möglichen wilden und abstrusen Gedankengänge, Überschriften oder Personenbeschreibungen aufschrieb, auch wenn er noch gar nicht wusste, wie das alles zusammenpassen könnte. Er nahm sich vor, irgendwann all seine wirren Gedanken zu sortieren und daraus eine ausführliche Geschichte zu verfassen. Die Geschichte von der lieben Hanna. Nein. Doofer Titel.
»Alex Geschichte erzählen!« Hanna riss Alex aus seinen Tagträumen heraus. Sie klopfte mit ihrer kleinen Hand auf seine Jacke und wiederholte: »Alex Geschichte erzählen!«
»Ja doch!« Alex lachte und setzte sich auf der Bank gerade hin. Dabei fiel ihm sein Notizbuch aus der Jackentasche. Sofort sprang Hanna auf und hob es auf: »Was ist das, Alex?«
»Das ist mein geheimes Geschichtenbuch«, grinste Alex.
Hanna strahlte, als hätte sie Geburtstag. »Vorlesen!«, juchzte sie.
»Das geht nicht, Hanna.« Die Geschichten stehen hier nur in wirren Stichpunkten, dachte Alex. Aber zu Hanna sagte er: »Die Geschichten sind noch geheim.« Dabei legte er bedeutungsvoll den Zeigefinger vor den Mund. »Pssst. Geheim.«
Hanna machte es ihm nach: »Pssst. Geheim.« Und sofort danach flüsterte sie verschwörerisch: »Alex geheime Geschichte vorlesen!«
»Ja«, flüsterte er zurück. »Wenn sie fertig sind.«
»Wann sind Geschichten fertig?«
Vermutlich werden sie nie fertig, dachte Alex. Wie so vieles in seinem Leben, das er irgendwann mal angefangen und nie zu Ende gebracht hatte. Wie etwa tausend Abenteuergeschichten, die er mal zu schreiben begonnen und dann doch nie beendet hatte, weil er entweder keine Lust mehr hatte oder weil er nicht wusste, wie die Geschichte weitergehen sollte. Zu Hanna sagte er: »Ich sag dir Bescheid, wenn sie fertig sind. Ja?«
»Ja.« Hanna nickte heftig.
Sein Notizbuch war in den letzten Wochen zu einer unübersichtlichen Lose-Blatt-Sammlung angewachsen. Oft war ihm nämlich genau dann was Schönes, Lustiges, Spannendes oder sonst wie Passendes eingefallen, wenn er sein Notizbuch nicht zur Hand hatte. Dann hatte er seine Idee auf irgendeinen Zettel geschmiert, der gerade herumflog, und später diesen Zettel in das Notizbuch gesteckt. Inzwischen schauten so viele Schmierzettel aus allen Seiten des Notizbuches heraus, dass Alex bezweifelte, jemals wieder Ordnung in diesen Wust zu bekommen. Er müsste sich einfach mal einen ganzen Abend oder Nachmittag Zeit nehmen, um das alles zu sortieren. Aber wann?
»Warte nicht mehr länger damit!«, hörte er plötzlich eine Stimme direkt neben ihm. Erschrocken drehte sich Alex um und sah einen Mann an der Bushaltestelle stehen, der vor einer Minute noch nicht da gestanden hatte.
»Was ist?«, fragte Alex verwundert nach.
»Fang endlich an damit!«, sagte der Mann.
»Womit?«
»Das alles aufzuschreiben!«
Alex schaute den Mann neben ihm misstrauisch an. »Woher wissen Sie, dass ich was aufschreiben wollte?«
Der Mann schaute Alex nicht an, als er sagte: »Tu’s einfach. Ja? Schieb die guten Dinge in deinem Leben nicht länger vor dir her. Setz sie um. Fang heute damit an.«
»Heute?«
»Ja.«
Alex ärgerte sich ein bisschen. Wie kam dieser fremde Mann dazu, ihm Anweisungen zu geben? Er kannte ihn doch gar nicht. »Heute kann ich nicht. Ich bin mit meiner Schwester beim Logopäden.«
»Für das, was einem wichtig ist, findet man immer Zeit.«
Das stimmte natürlich. Trotzdem fand er es merkwürdig, dass ihm irgendein wildfremder Mensch an der Bushaltestelle Tipps für sein Leben gab. Und noch merkwürdiger war, dass er wusste, was Alex gedacht hatte! »Wer sind Sie überhaupt?«
»Frag nicht weiter. Fang heute an. Okay?«
So langsam nahm sich dieser Kerl aber wirklich zu wichtig. »Können Sie mir bitte sagen, wer Sie sind und woher Sie mich kennen?«, fragte Alex etwas lauter und tippte dabei dem Mann, der bisher beim Reden immer noch an Alex vorbei in die Luft starrte, an die Jacke, damit er ihn mal anschaute.
Endlich drehte sich der Mann ganz zu Alex um. Mit der Hand, die Alex bis eben gerade nicht sehen konnte, weil der Mann seitlich zu ihm stand, hielt er sich ein Handy ans Ohr: »Bitte, was? Ich heiße Frank Weinheim. Warum?«
Alex spürte, wie er knallrot wurde. »Haben Sie gar nicht mit mir gesprochen?«
»Nein. Ich telefoniere mit meiner Verlobten.«
Alex wurde heiß und kalt auf einmal. Hanna schien diese Verwechslung kapiert zu haben, denn sie lachte laut auf und klatschte wie wild Beifall. »Entschuldigung«, sagte Alex. »Ich dachte, Sie hätten mit mir gesprochen. Das, was Sie gesagt haben, hat immer genau zu dem gepasst, was ich geantwortet hab.«
»Wirklich?« Der Mann zog die Augenbrauen hoch, behielt aber sein Handy am Ohr. »Lustiger Zufall.«
Alex fixierte das Gesicht des Fremden. »Glauben Sie an Zufälle?«
Der Mann lächelte. »Hm. Was würdest du sagen?«
»Dass Sie jetzt, ohne es zu wissen, mich praktisch dazu aufgefordert haben, meine Notizen zu einer Geschichte aufzuschreiben, das find ich schon interessant.«
»Wie ist es mit dir? Findest du auch, du solltest deine Notizen zu einer Geschichte aufschreiben?«
»Ja, schon.«
»Na, dann passt es doch. Tu’s einfach.«
Der Bus kam. Der Mann drehte sich um und stieg ohne ein weiteres Wort ein. Während sich Alex mit Hanna von der Bank erhob und auf den Bus zuging, las er die riesige Werbe-Aufschrift über der kompletten Seite des Busses: »Also zöger nicht länger und tu’s endlich!«
Alex blieb erschrocken stehen. So viele Zufälle konnte es doch eigentlich gar nicht mehr geben! Waren hier höhere Mächte im Spiel? Wollte hier jemand eine Botschaft an ihn weitergeben und nutzte dafür Menschen, Kalendersprüche und Busaufdrucke? Das konnte ja nicht wirklich sein. Oder erlaubte sich hier jemand einen Spaß mit ihm?
Immer noch den Kopf schüttelnd stieg Alex mit Hanna in den Bus. Ein merkwürdiger Tag war das.
Kapitel 7
Obst, Getränke, Brot. Wie viel? Schwer zu sagen. Akio stopfte in seinen Rucksack, was reinpasste. Wie lange würden sie überhaupt unterwegs sein? Mehrere Tage? Zu viel Gepäck war auch nicht gut. Pollum saß auf Akios Schultern und verfolgte mit großen Kopfbewegungen jedes einzelne Teil, das Akio in seinen Sack steckte, als wollte er genau überprüfen, was sein Herrchen mit auf die Reise nahm.
»Du reitest in den Tod«, jammerte die Mutter, die noch genauso wie vorher auf dem Hocker saß.
»Du wirst dem Moloch vorgeworfen wie deine Schwester«, fügte der Vater hinzu. Er stand mit schmerzverzerrtem Gesicht in der Stube und richtete unter Ächzen und Stöhnen die Möbel wieder auf.
»Adelia ist meine Schwester und ich werde nicht zulassen, dass fremde Männer sie in ihrer Gewalt haben«, sagte Akio laut und bestimmt. »Und wenn ich ebenfalls dem Moloch vorgeworfen werde, dann kann ich wenigstens sagen, dass wir den letzten Weg gemeinsam gegangen sind!«
Etwas unheimlich wurde ihm schon zumute, als er seinen Eltern diesen Satz so vorwarf. Aber er fand, dass dies in etwa so klang wie das, was Silva vorhin über sich und ihren Bruder gesagt hatte.
»Du bist erst fünfzehn«, knurrte der Vater.
»Was soll das heißen: erst fünfzehn?« Akios Augen blitzten böse, als er das fragte.
»Fünfzehn ist wenig von zehn entfernt. Vor Kurzem warst du erst zehn und hast in der Schmiede unterm Tisch gespielt.«
»Fünfzehn ist genauso weit von zehn weg wie von zwanzig!«, stellte Akio laut fest. »Stell dir einfach vor, ich bin fast zwanzig!«
»Ich wollte nur sagen, dass es sehr gefährlich ist«, warf der Vater ein. »Verstehst du das nicht? Bisher hab ich für die Familie gekämpft. Du nie. Wie willst du gegen die Häscher des Moloch ankommen, wenn du nie fechten, kämpfen oder Krieg führen gelernt hast?«
Die Mutter schluchzte: »Ich will nicht beide Kinder auf einmal verlieren.«
Dieses wehleidige Gejammer begann Akio zu nerven. »Vielleicht kriegst du ja auch beide Kinder auf einmal wieder zurück«, sagte er scharf. »Diese Möglichkeit gibt es immerhin auch noch.« Und zum Vater sagte er: »Ich tu es einfach, weil ich Adelia befreien will. Verstehst du das nicht? Wenn du zu schwach und verwundet bist, um für die Familie zu kämpfen, dann muss ich es doch tun, oder nicht? Ja, ich hab es nie gelernt! Aber ich hab einen festen Willen! Und der wird mich zur richtigen Zeit das Richtige lehren! Darauf vertraue ich!« Er griff nach dem Umhang mit der Kapuze und band ihn sich um die Schultern. Dann packte er seinen Rucksack und ging durch die Schmiede des Vaters in Richtung Stall.
In der Schmiede verlangsamte er seine Schritte und blieb vor dem großen Amboss kurz stehen. Wie oft hatte er hier dem Vater geholfen, das Feuer zu schüren, die Eisen zu beschlagen, Hufeisen zu formen, Schwerter, Spieße, Messer zu stählen und zu schärfen. Der Vater war schon immer ein kräftiger Mann gewesen, den Akio bewundert hatte. Aber er hatte auch oft kämpfen müssen. Und gerade in den letzten Jahren, seit die Priester des Moloch und die Späher der Bluträuber herausgefunden hatten, dass Adelia und Akio so wertvolles Blut in sich trugen, war die Familie häufigen Überfällen ausgeliefert gewesen. Heute also war es endgültig so weit: Die Räuber waren stärker als der Vater. Adelia war der Familie entrissen worden.
Akios Blick fiel auf das mittelgroße Schwert in der Ecke neben der Werkbank. Vor einigen Jahren, als er ein Junge von etwa zehn oder zwölf Jahren gewesen war, hatte er es mithilfe seines Vaters geschmiedet. Damals wollte er unbedingt ein eigenes Schwert haben. Und sie hatten gemeinsam eins hergestellt. Mit kunstvoll geschwungenem Querstück, lederumwickeltem Griff und stählerner Klinge. Akio war richtig stolz auf sein Erstlingswerk gewesen. Aber nach ein paar Monaten übertriebener Fechtübungen, bei denen er wild in die Luft gestochen und mit unsichtbaren Gegnern gekämpft hatte, war das Schwert hier in der Werkstatt gelandet, und irgendwann wurde es gar nicht mehr beachtet.
Jetzt fiel es ihm wieder auf. Unsicher nahm er den Griff in die Hand, hob das Schwert in die Höhe und betrachtete es vorsichtig, indem er es vor seinen Augen hin und her drehte. Pollum auf seiner Schulter reckte neugierig den Hals. Akio wusste nicht, wie man mit einem Schwert umging. Er wusste auch nicht, ob er mit Schwert überhaupt reiten konnte. Aber irgendetwas in seinem Inneren flüsterte ihm zu, er sollte es mitnehmen. Ein Krieger, der seine Schwester befreien wollte, brauchte ein Schwert. Hier hatte er eins. Er griff nach einem ledernen Schwerthalter aus einem der Regale, befestigte ihn an seinem Gürtel und ließ das Schwert hineingleiten. Ja, das fühlte sich gut an.
Kapitel 8
Alex und Hanna traten hinaus ins Freie und inhalierten die gute frische Luft des Frühlings, die sich in der Stadt ausbreitete. Den Logopäden hatten sie schnell gefunden und auch die Lerneinheit gut hinter sich gebracht. Die Sonne schien, die Spaziergänger liefen schon ohne Jacke draußen herum. Alles war gut.
»Komm, Hanna.« Alex setzte sich mit seiner Schwester in Bewegung. »Wir gehen zum Bus.«
»Ja.« Hanna strahlte. »Bus gehen.«
Diese vielen seltsamen Begebenheiten im Laufe des heutigen Tages waren schon merkwürdig gewesen, dachte Alex. Das Kreidestück heute Morgen in der Schule, das einfach mal um Alex’ Kopf herum eine Kurve geflogen war. Der Kalender, der seinen Spruch geändert hatte. Der Mann an der Bushaltestelle, der sich wirklich wie echt mit ihm unterhalten hatte. Und dann noch die Aufschrift auf dem Bus, die so wirkte, als wollte ihm zu guter Letzt der Bus auch noch etwas mitteilen.
Alex lachte vor sich hin. Schon krass, das alles. Das Gespräch und die Aufschrift an dem Bus konnte er sicher als Zufall verbuchen. Dass auf dem Kalender zweimal was anderes stand, war schon sehr merkwürdig. Eine Erklärung konnte sein, dass Alex beim ersten Mal nur grob auf den Kalender geschaut und den Spruch falsch gelesen hatte. Zum Beispiel, weil sich seine Gedanken irgendwie auf das, was er lesen wollte, übertragen hatten. Bestimmt gab es dafür irgendeine logische Erklärung. Und das mit der Kreide? Sicher hatte Marcel nur knapp an ihm vorbei geworfen und in seiner Wahrnehmung hatte Alex das Gefühl gehabt, als hätte die Kreide sich verlangsamt und eine Kurve genommen.
Ja, so könnte das alles gewesen sein. Alex grinste zufrieden, auch wenn ein letzter Rest von Unsicherheit in seinem Kopf blieb. Konnte jemand von außen Zufälle herbeiführen? Schicksal? Eine göttliche Macht? Alex blieb stehen, kniff die Augen zu und formulierte in Gedanken eine deutliche Frage: Hallo unsichtbare Macht! Waren all die Begegnungen heute Zufall oder geplant? Bitte melde dich!
Er öffnete die Augen und sah sich um. Irgendein Werbe-Plakat, das sich dazu äußerte? Eine Zeitung, ein Bus? Nein. Nichts. Alex schüttelte den Kopf und ging weiter. Jetzt bloß nicht verrückt werden.
In einiger Entfernung sah er, wie sein Bus an der Bushaltestelle einfuhr. »Los, Hanna, den müssen wir kriegen!« Mit Hanna an der Hand rannte er los. Aber Hanna war nicht so schnell. Sie konnte zwar, wenn sie wollte, wild auf der Stelle hopsen und eine Viertelstunde am Stück im Kreis durch das Wohnzimmer rennen. Aber die Geschwindigkeit zu erhöhen, um ein bestimmtes Ziel schneller zu erreichen, das war in Hannas Körper nicht einprogrammiert. Sie waren noch etwa hundert Meter entfernt, als der Bus losfuhr.
»Hanna Bus fahren!«, empörte sich Hanna und zeigte auf den Bus, von dem nur noch die Rücklichter zu sehen waren.
»Tja, ich glaub, heute fährt Hanna mit keinem Bus mehr.« An der Bushaltestelle angekommen, überflog Alex den Fahrplan. »Der nächste kommt erst wieder in einer Stunde.«
»Was heißt eine Stunde?«, wollte Hanna wissen.
»Das heißt, dass wir schneller zu Hause sind, wenn wir laufen.«
»Hanna Beine müde.« Hanna zeigte auf ihre Füße.
Alex lächelte. »Wir gehen schön langsam. Okay?«
»Okay.« Die müden Beine schienen wieder wach geworden zu sein. In gemütlichem Tempo schlenderten Alex und Hanna durch die Stadt. Schon bald kamen sie an einem Spielplatz vorbei, den Hanna natürlich sofort ansteuerte: »Da, Spielplatz! Hanna Spielplatz gehen!«
»Ist gut, Hanna. Wir gehen ja auf den Spielplatz.«
Hanna rannte sofort auf das Klettergerüst zu, Alex setzte sich auf eine Holzbank in der Nähe. Von hier aus hatte er den ganzen Spielplatz im Überblick. Etliche Kinder, mit und ohne Mütter, tobten über die verschiedenen Spielgeräte, warfen mit Sand, backten Sandkuchen oder jagten einander quietschend und juchzend über den Platz. Hanna begann, mit einer unbeschreiblichen Ausdauer das Klettergerüst hoch und wieder runter zu klettern. Nachdem Alex ihr eine Weile dabei genüsslich zugeschaut hatte, zog er sein Notizbuch aus der Jackentasche und las die Aufzeichnungen auf den Seiten und auf den dazwischengeschobenen Zetteln. Hier und da versuchte er, ein paar der Blätter zu sortieren, ein paar Gedankengänge zusammenzufassen und ein bisschen Ordnung hineinzubringen. Je mehr er sich damit beschäftigte, umso klarer formte sich in seinem Kopf ein Bild von einer recht schönen und spannenden Hanna-Geschichte. Glücklicherweise hatte Alex auch einen Kugelschreiber in der Jackentasche. So kam es, dass er direkt an Ort und Stelle begann, seine Geschichte aufzuschreiben.
»Alex, machst du da?«, fragte Hanna, als sie zwischendurch einmal bei ihm stand.
»Ich schreibe eine Hanna-Geschichte.«
Hanna hopste auf der Stelle, klatschte fröhlich und lachte laut: »Vorlesen!«
»Wenn sie fertig ist.«
»Ja.« Damit gab sich Hanna zufrieden und rannte zur Rutschbahn, wo sie ebenfalls ohne müde zu werden bestimmt hundertmal nacheinander die Leiter hochstieg und runter rutschte.
Alex vertiefte sich immer mehr in seine Geschichte. Er konnte gar nicht so schnell schreiben, wie ihn seine Gedanken nach vorne trieben. Zwischendurch vergaß er vollkommen, dass er eigentlich mit Hanna auf dem Spielplatz saß, so sehr lebte er innerlich in der Welt, die er gerade mit ungebremster Leidenschaft in seinem Notizbuch schuf.
Ein kalter Luftzug, der unter seine Jacke kroch, holte ihn dann doch wieder in die Realität zurück. Wie lange hatte er hier gesessen und geschrieben? Er schaute auf sein Handy: kurz vor sechs. Ein Blick auf den Spielplatz zeigte ihm, dass viele der Kinder, die hier vorhin noch gespielt hatten, inzwischen nach Hause gegangen waren. Auch Hanna war nicht mehr zu sehen.
»Hanna?«
Alex stand auf und ging einmal über den Spielplatz. »Hanna!«
Hanna war weg.