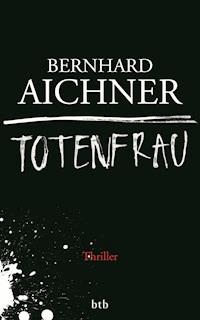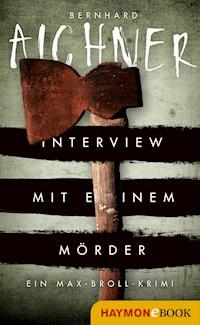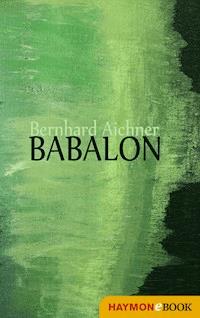12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Bronski Krimi
- Sprache: Deutsch
Es ist Sommer in Berlin. Ein Mann fällt vom Himmel. Ein blinder Passagier, versteckt im Fahrwerkraum eines Flugzeugs. Ein Leben, das im Garten einer hübschen Jugendstilvilla endet. Noch im Tod wird der Mann beraubt – und eine Geschichte aus Not und Gier nimmt ihren Anfang. Sie wird viele Leben kosten und manche Träume zerstören. Pressefotograf Bronski und seine Kollegin Svenja Spielmann recherchieren in einer Welt der Gewalt und des schönen Scheins.
Seit er denken kann, fotografiert Bronski das Unglück. Richtet seinen Blick auf das Dunkle in der Welt. Dort, wo Menschen sterben, taucht er auf. Er hält das Unheil fest, ist fasziniert von der Stille des Todes – und immer wieder auf der Suche nach einem Leben, das Sinn verspricht und auf die Liebe setzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zum Buch
Es ist Sommer in Berlin. Ein Mann fällt vom Himmel. Ein blinder Passagier, versteckt im Fahrwerkraum eines Flugzeugs. Ein Leben, das im Garten einer hübschen Jugendstilvilla endet. Noch im Tod wird der Mann beraubt – und eine Geschichte aus Not und Gier nimmt ihren Anfang. Sie wird viele Leben kosten und manche Träume zerstören. Pressefotograf Bronski und seine Kollegin Svenja Spielmann recherchieren in einer Welt der Gewalt und des schönen Scheins.
Seit er denken kann, fotografiert Bronski das Unglück. Richtet seinen Blick auf das Dunkle in der Welt. Dort, wo Menschen sterben, taucht er auf. Er hält das Unheil fest, ist fasziniert von der Stille des Todes – und immer wieder auf der Suche nach einem Leben, das Sinn verspricht und auf die Liebe setzt.
Zum Autor
BERNHARD AICHNER (1972) schreibt Romane, Hörspiele und Theaterstücke, er ist einer der erfolgreichsten Autoren Österreichs – aber er ist auch Fotograf. Bevor er sich der Werbefotografie zuwandte, war er jahrelang als Pressefotograf für den KURIER tätig. Bei der zweitgrößten Tageszeitung Österreichs erlernte er das journalistische Handwerk. Seine Aufgabengebiete waren vielfältig, im Besonderen war er von der Polizeifotografie fasziniert. Hier ging es um Unfälle, Mord und Naturkatastrophen. Aus diesem Grund siedelt Aichner nun seine neue Buchreihe genau in diesem Milieu an, in dem er sich jahrelang bewegt hat. Er weiß also aus erster Hand, worüber er schreibt. Für seine Kriminalromane wurde Aichner mit mehreren Literaturpreisen und Stipendien ausgezeichnet, zuletzt mit dem Burgdorfer Krimipreis 2014, dem Crime Cologne Award 2015 und dem Friedrich Glauser Preis 2017.
BERNHARD AICHNER
GEGENLICHT
EIN BRONSKI KRIMI
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2021 Bernhard Aichner by btb Verlagin der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: semper smile, München, nach einem Entwurf von Thomas Raab
Umschlagmotiv: © www.fotowerk.at, Ursula Aichner
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-27208-1V003
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
»Blumen wachsen auch im Dreck.«
FODAY KONEMA
EINS
Der schwarze Mann fiel vom Himmel.
Zwischen den Sonnenstrahlen flog er nach unten. Unbemerkt.
Acht Sekunden lang war die Welt noch in Ordnung. Klaus Rembrand und seine Geliebte saßen unbeschwert in ihren Liegestühlen, sie konnten noch nicht sehen, was auf sie zukam. Ahnten nicht, dass ihr Untergang unmittelbar bevorstand. Sie unterhielten sich ausgelassen, lachten und tranken.
Zwölf leere Bierdosen lagen auf der Wiese. Immer wenn sie eine Dose leergetrunken hatten, schleuderten sie sie, soweit sie konnten, durch den Garten der Jugendstilvilla, die Klaus kürzlich von seiner Mutter geerbt hatte.
Es war ein perfekter Nachmittag. Klaus Rembrand war mit sich und der Welt im Reinen. Er genoss die Stunden mit dieser wunderbaren Frau. Hemmungslos erfüllte er sich seine Wünsche.
Koste es, was es wolle, dachte er.
Oxana.
Sie war etwas Besonderes.
Wunderschön, geheimnisvoll, aufregend.
Klaus kümmerte sich immer rechtzeitig darum, dass sie an zwei Samstagen im Monat für ihn verfügbar war. Er fieberte diesen Tagen entgegen, die Zeit mit ihr zählte zum Kostbarsten, was er hatte. Es war ein Ritual, dem er voller Freude folgte, und das er beharrlich am Leben hielt. Wenn die Tage zwischen den Treffen endlich vergangen waren, legte er sich in die Badewanne und fuhr anschließend mit seinem hellblauen Mazda in die Waschstraße. Er sorgte dafür, dass der Wagen glänzte, er polierte und saugte ihn. Dann besorgte er Sushi und Bier im Supermarkt und holte Oxana wie immer am vereinbarten Treffpunkt ab.
Beim botanischen Garten.
Oxana hatte ihm nie gesagt, wo sie wohnte. Sie wollte nicht, dass er auf die Idee käme, sie irgendwann zu Hause zu besuchen, ihre Privatsphäre war ihr heilig. Sie kümmerte sich zwar mit Inbrunst um Klaus, aber sie genoss auch, dass ihre Beziehung zeitlich begrenzt war. Die zwei Samstage im Monat gehörten ihm, der Rest des Monats aber gehörte ihr. So hatte sie es ihm eingebläut.
Akzeptiere es, oder lass es, hatte sie zu ihm gesagt.
Bitte mach es nicht kompliziert, Klaus.
Es ist doch schön so, wie es ist.
Oxana war da ganz klar und deutlich.
Und Klaus stimmte zu.
Wobei er durch Zufall doch herausgefunden hatte, wie sie wirklich hieß und wo sie wohnte. Er behielt es für sich, beließ es bei ihrem Künstlernamen, wenn er sie traf, und tat so, als hätte er keine Ahnung von ihrem anderen Leben.
Tatsache war, dass er keinen Grund hatte, an dem bestehenden Arrangement etwas zu ändern. Klaus war zufrieden, so wie es war. Er trug keine Verantwortung, musste sich an den Oxana-freien Tagen nicht um sie kümmern. Sie hatte ihr eigenes Leben, er hatte seines.
Diese Art von Beziehung hatte sich bewährt.
Klaus wollte keine Kompromisse eingehen, um nichts in der Welt hätte er eine Frau bei sich einziehen lassen. Seine Freiheit war ihm heilig, der Singlehaushalt sein Paradies. Klaus Rembrand war glücklich. Auch wenn die Tage mit Oxana Offenbarungen waren, er mochte auch die Zeit dazwischen. Er liebte es, sich nach ihr zu sehnen, bereits Tage vor den Treffen zelebrierte er in Gedanken die Momente ihres Wiedersehens. Malte sich aus, was passieren würde. Zweimal im Monat feierte Klaus so das Leben. Sie völlerten, hatten Sex, betranken sich. Sushi, Viagra, Bier.
Und eine Ahnung von Liebe.
Hundertzwanzig Euro kostete eine Stunde Glück.
Klaus buchte Oxana gewöhnlich von mittags bis Mitternacht, machte zweitausendachthundertachtzig Euro pro Monat, zuzüglich Getränken, Verpflegung und kleinen Präsenten. Ein stattlicher Betrag, den er monatlich fix eingeplant hatte. Viele andere schöne Dinge hätte sich Klaus davon kaufen können, doch warum sollte er? Dieses Geld war für Oxana bestimmt. Sie lebte davon. Nicht ausschließlich, aber vermutlich zum größten Teil. Dass sie außer ihm noch andere Kunden hatte, war ihm natürlich klar, aus seiner Sicht war er aber definitiv ihre Nummer eins. Oxana fand ihn lustig, charmant und weltoffen, er war überzeugt davon, Klaus war zufrieden mit der Gesamtsituation.
Könnte nicht geschmeidiger laufen, sagte er sich.
Es war eine wunderbare Fügung des Schicksals gewesen, dass seine Mutter auf der Kellertreppe ausgerutscht war und sich das Genick gebrochen hatte. Von einem Tag auf den anderen hatte das jahrelange und durchaus mühsame Zusammenleben ein Ende gehabt. Klaus vergoss einige Tränen über ihren Tod, am Ende aber überwog die Freude über ihr Verschwinden. Die schöne Villa in Schmargendorf gehörte jetzt ihm, genauso wie die unzähligen Sparbücher, die er im hintersten Winkel ihres Kleiderschranks gefunden hatte.
Klaus Rembrand war endlich für seine Mühen belohnt worden.
Ein Leben lang war er mit einem von seiner Mutter gemachten Pausenbrot in der Aktentasche zum Finanzamt und wieder zurückgelaufen, er war Beamter mit Leib und Seele gewesen. Jetzt aber hatte er sich mit einem Lächeln im Gesicht in den frühzeitigen Ruhestand verabschieden können. Mit vierundfünfzig Jahren ein Glücksfall.
Mit Bedacht hatte Klaus durchgerechnet, wie lange er mit dem Geld seiner Mutter durchkommen würde, und was er sich alles damit leisten könnte. Eine ganze Woche lang hatte er diverse Szenarien durchgespielt, er hatte Betriebs- und Heizkosten für die nächsten fünfzig Jahre berechnet, er hatte die Kosten für einen Hausmeisterdienst addiert, genauso wie die Ausgaben für Unvorhergesehenes. Sanierungen am Haus, besondere Aufwendungen wegen Krankheit, Kosten für Pflegerinnen im hohen Alter, er dachte auch an die Anschaffung diverser Autos, von denen er träumte, und erfüllte sich in Gedanken noch einige andere Wünsche. Klaus dachte großzügig. Er rechnete sogar noch einen Puffer ein, durfte am Ende aber trotzdem feststellen, dass das Ergebnis seiner Berechnungen äußerst erfreulich ausfiel.
Klaus musste sich nie wieder Sorgen um Geld machen.
Er konnte sich die zwei Samstage im Monat ohne Probleme leisten, er hätte sogar damit weitermachen können, bis er hundertvier Jahre alt wäre. Geld spielte keine Rolle.
Nur dieses Lebensgefühl zählte.
Der Rausch, dem er sich mit Oxana hingab.
Ihre nackten Brüste, die er so liebte, der Geruch des Kokosöls, das er auf ihrem prachtvollen Leib verteilte, das Zischen, das aus den Dosen kam, wenn man sie öffnete.
Es war ein Nachmittag im Paradies.
Alles war perfekt.
Klaus wollte gerade aufstehen und etwas zum Knabbern aus dem Haus holen, da sah er zwischen den Sonnenstrahlen plötzlich etwas Schwarzes aufblitzen. Im Gegenlicht konnte er nicht erkennen, was es war, er wunderte sich nur. Er verstand es nicht. Versuchte zu begreifen, aber es ging zu schnell. Da war ein Geschoss, das auf sie zukam, etwas großes Dunkles, das schließlich vor ihnen auf der Wiese einschlug.
Kawummm.
Es war seltsam, aber Klaus hatte keine Angst. Ihm fiel in diesem Moment nur ein Comic ein, den er gerade gelesen hatte. Viele kleine schwarze Meteoriten waren auf der Erde eingeschlagen, einer direkt vor Dagobert Ducks Geldspeicher. Aliens hatten es auf die vielen glitzernden Taler abgesehen.
Was er gelesen hatte, wurde Wirklichkeit.
Was zur Hölle ist das, fragte Oxana.
Ein Außerirdischer, antwortete Klaus.
Ein schwarzer Mann war direkt vor ihre Füße gefallen.
Nur wenige Meter von ihnen entfernt.
Er lag im halbhohen Gras.
Klaus lachte.
Und auch Oxana begann zu lachen.
Noch realisierten sie nicht, was geschehen war. Es war eine Übersprunghandlung. Das Lachen nahm dem Drama für ein paar Augenblicke die Tragik. Während sie prusteten und sich gegenseitig mit ihrer hysterischen Fröhlichkeit ansteckten, versuchten sie das Unfassbare zu begreifen.
Der ist verdammt noch mal vom Himmel gefallen, sagte Oxana.
Muss ein verdammter Engel sein, sagte Klaus.
Wieder lachten sie. Aus Unsicherheit, aus Angst.
Beide wussten nicht, was jetzt zu tun war. Sollten sie aufspringen und hingehen? Oder lieber sitzen bleiben?
Lebt er noch, fragte Oxana.
Schaut nicht unbedingt so aus, sagte Klaus.
Das Lachen verebbte.
Oxana starrte den leblosen Körper an.
So wie es aussieht, haben wir großes Glück gehabt, sagte Klaus.
Ein paar Meter weiter, und einer von uns beiden wäre ebenfalls tot.
Oxana schluckte.
Klaus konzentrierte sich. Bemühte sich, trotz allem die Situation sachlich zu hinterfragen. So wie er sich in seinem Berufsleben nie hatte von Emotionen ablenken lassen, war es auch jetzt wichtig, die Fakten zu sammeln und dann die richtigen Schlüsse zu ziehen.
Wahrscheinlich ein Afrikaner, sagte Klaus.
Vielleicht zwischen dreißig und vierzig.
Muss wohl aus einem Flugzeug gefallen sein.
Oxana nickte.
Da ist aber nirgendwo Blut, stammelte sie.
Sieht so aus, als würde er schlafen.
Vielleicht lebt er ja doch noch.
Klaus schüttelte den Kopf. Soweit er das ohne Brille beurteilen konnte, war die Sache eindeutig. Die Positionierung des Körpers ließ keine Hoffnung mehr zu. Die verdrehten Beine, die verbogenen Arme, sämtliche Knochen mussten gebrochen sein. Wo auch immer dieser Mann hergekommen war, ob er aus einem Helikopter oder aus einem Heißluftballon gefallen war, er hatte den Sturz in die Tiefe definitiv nicht überlebt. Das Geräusch beim Aufprall auf die Erde war Beweis genug dafür gewesen. Genauso wie die Mulde in der Wiese, in der der Mann lag.
Das hier übersteht niemand, sagte er.
Oxana wurde sichtlich nervös. Mit keinem Witz der Welt hätte Klaus sie wahrscheinlich jetzt noch zum Lachen bringen können. Sie schien plötzlich hellwach, der Alkohol in ihr hatte sich verflüchtigt. Von einem Moment zum anderen wirkte sie völlig nüchtern. Oxana hatte verstanden, dass etwas Schreckliches passiert war.
Sie sprang auf.
Klaus wollte sie noch zurückhalten, aber zu spät. Es war so, als hätte sie den Sender im Radio gewechselt. Statt romantischer Schlagermusik, die Klaus so liebte, liefen jetzt die Nachrichten. Oxana war die Lust auf Dosenbier vergangen. Klaus musste einsehen, dass sie unter diesen Bedingungen nicht mehr wie gewohnt weitermachen konnten. Anstatt sie also ein weiteres Mal mit Küssen zu bedecken, musste er zusehen, wie Oxana die Leiche untersuchte. Faszination mischte sich mit Furcht.
Es schaut so aus, als wäre er tiefgefroren, sagte sie.
Obwohl Klaus sie davon abhalten wollte, war sie auf den Toten zugegangen und hatte ihn bereits angefasst. Absurderweise wollte sie sichergehen, dass der Mann mit den verdrehten Gliedmaßen nicht vielleicht doch noch lebte. Ein sinnloses Unterfangen, doch Oxana war ein guter Mensch. Reichlich naiv, wie Klaus fand, aber bestückt mit wunderbaren Brüsten und einem großen Herz.
Oxana wollte helfen.
Den schwarzen Mann irgendwie zurückholen.
Klaus war beeindruckt. Warum auch immer, aber Oxana hatte keine Berührungsängste. Sie schien zwar beinahe durchzudrehen, aber sie hatte offensichtlich keine Probleme damit, eine Leiche anzufassen. Sie tat etwas, zu dem Klaus niemals fähig gewesen wäre. Sie legte ihr Ohr ganz nah an den Mund des Toten, überprüfte, ob er noch atmete. Sie bewegte seinen Oberkörper hin und her, sie schüttelte ihn, wollte ihn wachrütteln, sie sprach sogar mit ihm.
Hallo, hören Sie mich?
Bitte, wachen Sie auf.
Klaus konnte ihre Verzweiflung geradezu spüren.
Während Oxana den Toten mit aller Gewalt wiederzubeleben versuchte, lag Klaus immer noch mit einer Bierdose in der Hand auf seiner Sonnenliege. Er trank und schüttelte den Kopf. Verstand nicht, was Oxana machte.
Hektisch begann sie in den Taschen des Toten zu wühlen, fast schaute es so aus, als würde sie ihn durchsuchen.
Was um Himmels willen machst du da, fragte er.
Vielleicht hat er einen Ausweis dabei,sagte sie.
Oxana fummelte weiter an der Leiche herum.
Was genau sie tat, sah Klaus leider nur verschwommen. Er hätte seine Brille holen, aufstehen und zu ihr hingehen müssen, um sie davon abzuhalten. Doch Klaus wollte nicht. Konnte nicht akzeptieren, dass sein wunderbarer Nachmittag mit Oxana zu Ende war. Er wollte das Schreckliche ausblenden, so tun, als wäre nichts passiert.
Komm, setz dich wieder zu mir, sagte er.
Das wird schon wieder.
Doch für Oxana war die Party vorbei.
Ich haue jetzt ab, sagte sie.
Damit will ich nichts zu tun haben, Klaus.
So gerne ich dich mag, aber da musst du jetzt alleine durch.
Klaus fluchte.
An Sex in der Abendsonne war nicht mehr zu denken. Oxana ließ sich auch mit einer Zusatzzahlung nicht zum Bleiben überreden. Sie bestand darauf, ein Taxi zu nehmen und diese Katastrophe so schnell wie möglich hinter sich zu lassen.
Mit den Bullen will ich nichts zu tun haben,sagte sie.
Ich will keine Fragen beantworten müssen.
Kann keine Probleme gebrauchen.
Trotzdem danke.
War schön wie immer, Klaus.
Wir sehen uns in zwei Wochen.
Sie küsste ihn auf die Stirn.
Und verschwand.
Klaus blieb allein zurück in seinem idyllischen Garten.
Er war jetzt allein mit dem Toten.
Verärgert und frustriert trank er sein Bier aus.
Und warf die Dose durch die Luft.
ZWEI
SVENJA SPIELMANN DAVID BRONSKI
– Schön, dass du rangehst. Ich habe es einige Male versucht in den letzten Tagen.
– Tut mir leid, Svenja.
– Eigentlich sollte ich sauer sein.
– Bist du aber nicht, oder?
– Ich weiß, ich sollte das nicht sagen, aber ich habe dich vermisst.
– Sehr?
– Warum hast du dich nicht gemeldet? Wir haben uns nur zweimal gesehen in den letzten drei Wochen. Das Pflänzchen, das wir gesetzt haben, ist noch ziemlich jung, wir sollten es nicht verkümmern lassen.
– Bitte hab etwas Geduld mit mir. Ist alles ein bisschen viel im Moment. Schwer, alles unter einen Hut zu bringen. Die Liebe. Das Vatersein. Ich weiß gar nicht, wie ich das hinkriegen soll.
– Das mit der Liebe? Oder das mit dem Vatersein?
– Beides.
– Deine Tochter und ich hätten es schlechter erwischen können. Als Liebhaber hast du nämlich durchaus Potenzial. Und das Familiending bekommst du bestimmt auch noch hin. Einen Vater wie dich zu haben ist bestimmt nicht das Schlimmste, das einem Kind passieren kann.
– Bin mir da nicht so sicher.
– Wie geht es ihr?
– Eigentlich ganz gut. Judith ist ziemlich robust. Steckt das alles fast besser weg als ich. Erstaunlich, wie sie das macht.
– Du klingst so deprimiert. Eigentlich solltest du doch glücklich sein.
– Bin ich ja auch. Ich weiß nur nicht, wie ich damit umgehen soll. Nach einundzwanzig Jahren ist sie plötzlich wieder da. Ich hatte nicht mehr damit gerechnet, sie lebend zu finden. Judith und ich lernen uns gerade erst kennen. Und die traurige Wahrheit ist, dass ich eigentlich keine Ahnung von Kindern habe.
– Du warst dabei, als sie geboren wurde. Du hast sie gehalten, als sie ein Baby war. Ihr seid miteinander verbunden. Genau aus dem Grund hast du sie am Ende auch wiedergefunden.
– Nichts habe ich mir in all den Jahren mehr gewünscht, als sie wieder in meine Arme zu schließen. Alles hätte ich dafür gegeben. Und jetzt sitzt sie drüben im Wohnzimmer und schaut fern.
– Klingt doch gut.
– Ich habe ständig das Gefühl, dass die Zeit nicht reicht.
– Wofür?
– Es gibt noch so viel, das ich nicht weiß. So viele Dinge, die ich ihr erzählen möchte. Ich habe Angst, dass sie plötzlich wieder verschwindet. Dass ich sie ein weiteres Mal verliere.
– Das wirst du nicht.
– Und was, wenn doch?
– Halt die Klappe, Bronski. Du musst endlich aufhören, dir Sorgen zu machen. Ihr bekommt das hin.
– Wir bemühen uns. Aber wir sind uns fremd. Zwanzig Jahre lang hat ihr ein anderer vorgemacht, er wäre ihr Vater. Ein Mörder. Und die Frau, die sie entführt hat, hat ihre liebende Mutter gespielt. Ist nicht ganz einfach, das zu verkraften. Für mich nicht und auch für Judith nicht. Alles, woran sie geglaubt hat, existiert nicht mehr. Ihr ganzes bisheriges Leben war eine Lüge.
– Gut, dass der Lügner jetzt im Gefängnis sitzt.
– Ja, das ist es.
– Ein Freund bei der Staatsanwaltschaft hat mir erzählt, dass er mindestens zwanzig Jahre bekommt. So wie es aussieht, wird Judith ihn so schnell nicht wiedersehen.
– Sie hat ihn vor ein paar Tagen in der Justizanstalt besucht.
– Was hat sie?
– Sie wollte es sich nicht nehmen lassen. Hat darauf bestanden, es ihm ins Gesicht zu sagen.
– Dass er ein Arschloch ist?
– Ja.
– Warum macht sie so was?
– Judith will das Ganze abschließen. Neu anfangen.
– Das verstehe ich. Auch dass es wichtig ist, dass ihr viel Zeit miteinander verbringt. Trotzdem würde es nicht schaden, wenn sie außer dir auch noch jemand anderen zu Gesicht bekommt.
– Du meinst dich, oder?
– Genau. Und natürlich deine Schwester. Sie hat sich bei mir ebenfalls beschwert, dass du sie ignorierst. Finde ich nicht gut, Bronski. Du solltest Anna und mich an deinem Leben teilhaben lassen. Wäre nur fair, oder?
– Ja, das wäre es.
– Mich mit dir einzulassen war etwas vom Unvernünftigsten, was ich je gemacht habe.
– Klingt so, als würdest du einen Rückzieher machen wollen. Ich könnte es dir, ehrlich gesagt, nicht verübeln. Wahrscheinlich bin ich kaputter, als ich mir eingestehe. Ist vielleicht wirklich besser, wenn du die Finger von mir lässt.
– Nichts da, Bronski. Auf ein einfaches, unkompliziertes Ende unserer aufkeimenden Beziehung brauchst du gar nicht erst zu hoffen.
– Das tue ich nicht, Svenja. Ich bin dir wirklich sehr dankbar dafür, dass du mir geholfen hast. Dass du deinen Job für mich riskiert hast.
– Ich habe das nicht nur für dich gemacht, mein Lieber. Meiner Karriere hat das ebenfalls ganz gutgetan.
– Wie meinst du das?
– Ich bin für einen der wichtigsten Journalistenpreise des Landes nominiert. Die haben mich vorgestern angerufen, die Reportage über dich und Judith hat ziemlich eingeschlagen.
– Wow.
– Und so wie es aussieht, hat das weitreichende Folgen für mein Berufsleben. Unsere Chefredakteurin hat mich zur obersten Reporterin gemacht. Von der geduldeten Kulturredakteurin zur Leiterin der Polizeiredaktion. Nicht schlecht, oder?
– Großartig, Svenja. Das muss gefeiert werden.
– Unbedingt. Wobei du dir Gedanken darüber machen solltest, welche Auswirkungen meine Beförderung auf dich hat.
– Auswirkungen? Wie meinst du das?
– Ich kann mir jetzt aussuchen, welche Geschichten ich mache. Und auch, mit wem ich sie mache. Ich bin jetzt quasi so etwas wie deine Chefin und kann über dich verfügen, ganz wie es mir gefällt.
– Damit kann ich leben.
– Sicher?
– Ja.
– Na, dann pack mal deine Sachen, mein Lieber. Dein Urlaub ist nämlich vorbei. Wir müssen nach Schmargendorf. Eine schöne Reportage über einen Mann machen, der vom Himmel fiel.
– Was bitte?
– Ein blinder Passagier, nimmt man an. Wahrscheinlich handelt es sich um einen afrikanischen Flüchtling, der sich im Fahrwerk eines Flugzeugs versteckt hatte. Ziemlich krasse Nummer. Als beim Landeanflug das Fahrwerk wieder ausgefahren wurde, muss er abgestürzt sein. Er ist dann direkt im Garten eines Frührentners gelandet.
– Das erfindest du gerade.
– Klaus Rembrand heißt der Mann. Er saß gemütlich in seinem Liegestuhl, als er beinahe von dem Flüchtling erschlagen worden wäre. War anscheinend richtig knapp. Aber das wird uns der Gute gleich alles selbst erzählen, er ist so freundlich, uns ein Exklusivinterview zu geben.
– Wann?
– Jetzt.
– Nicht dein Ernst, oder?
– Doch. Ich stehe unten vor deiner Tür und warte auf dich. Wenn du deinen Job nicht verlieren möchtest, solltest du also schnell zu mir runterkommen. Ich möchte nämlich nicht, dass es sich unser Rembrand anders überlegt, nur weil er zu lange auf uns warten musste.
– Du stehst unten vor der Tür?
– Ja. Schau raus, ich wink dir zu.
– Judith und ich wollten etwas kochen, uns einen schönen Abend machen.
– Kein Problem. Sie kann ja mitkommen, wenn sie mag. Wir beide erledigen unseren Job, und hinterher können wir zum Wannsee fahren und dort im Biergarten was Schönes essen gehen.
– Du willst, dass ich Judith mit zur Arbeit nehme?
– Warum nicht? Wenn du dich nämlich nicht bald dafür entscheidest, mich glücklich zu machen, werde ich es mir am Ende doch noch anders überlegen. Die Wahrheit schaut nämlich so aus, dass ich nicht ewig auf dich warten werde, Bronski.
DREI
Ich war dankbar für diesen Anruf.
Svenja wollte mich aus dem Loch holen, in dem ich mich seit Wochen verkroch. Sie ließ sich nicht auf Distanz halten, und das war gut so. Sie sorgte dafür, dass Judith und ich einen Weg fanden, mit allem zurechtzukommen. Sie bemühte sich, uns dabei zu helfen, so etwas wie Alltag zu leben. Sie wusste, wie schwer es mir fiel, mit der neuen Situation zurechtzukommen. Mit der Tatsache zu leben, dass ich nach all den Jahren wieder Vater war.
Svenja verstand mich.
Sie konnte nicht dabei zusehen, wie ich mich plagte.
Ist nicht leicht, mit dieser Nähe umzugehen, sagte ich.
Du musst dich eben ein bisschen anstrengen,erwiderte sie.
Und sie hatte recht. Alles war neu. Stand auf wackeligen Beinen. Ich durfte mein neues Glück nicht aufs Spiel setzen.
Nicht die Beziehung zu Svenja. Und auch nicht jene zu Judith.
Der Pressefotograf und die Chefreporterin.
Der Vater und die Tochter.
Wie schwer mir das alles fiel.
Jahrelang hatte ich allein gelebt. Hatte nicht mehr daran geglaubt, dass ich wieder Gefühle für jemanden entwickeln könnte. Eine Beziehung führen und ein Kind beim Erwachsenwerden begleiten. Es ging darum zu lernen, mich selbst zurückzunehmen und anderen Raum zu geben. Mit dem Schmerz umzugehen, der da immer noch war.
Ich war überfordert.
Und deshalb auch dankbar, dass Svenja sich nicht von meiner sperrigen Hilflosigkeit abschrecken ließ.
Sie suchte meine Nähe, spornte mich an, meine Angst vor dem Scheitern in den Griff zu bekommen.
Und so blieb ich.
Obwohl ich davonlaufen wollte.
Weil da so viel Vergangenheit war.
Jeder Tag mit Judith war eine Herausforderung für mich. Jede Erinnerung, die ich mit meiner Tochter teilte, riss eine Wunde auf. Die Gedanken an ihre Mutter. Meine Ehefrau, die irgendwann auch einfach verschwunden war. Was unserer Familie geschehen war, stellte sich vor die Gegenwart. Blockierte sie. Nahm uns die Luft. Brachte uns zum Weinen.
Judith und ich waren sprachlos.
Gemeinsam trauerten wir über das, was passiert war.
Kurz vor Weihnachten 1998 war Judith entführt worden. Sie war vier Monate alt, als meine Frau in einem Moment der Verzweiflung jemanden auf der Straße um Hilfe gebeten hatte. Mona hatte keine Kraft mehr gehabt. Sie hatte Angst gehabt, dass sie ihrem eigenen Baby etwas antun könnte. Sah den letzten Ausweg darin, eine Passantin anzuflehen, sich kurz um Judith zu kümmern. Sie wollte nur ihr Baby beschützen. Kurz Luft holen.
Aber anstatt Mona zu helfen, nahm die Fremde unser Kind einfach mit. Anstatt den Vorfall der Polizei zu melden oder Mona in ein Krankenhaus zu bringen, fuhr sie mit dem Baby nach Leipzig, täuschte dort eine Schwangerschaft vor und zog meine Tochter als ihr eigenes Kind groß.
Es war ein ungeheuerliches Verbrechen. Ein Drama, über das mittlerweile alle Bescheid wussten. Man hatte mir mein Herz aus dem Leib gerissen. Mein halbes Leben lang hatte ich befürchtet, dass ich mein kleines Mädchen nie wiedersehen würde. Ich dachte, sie wäre tot. War überzeugt davon gewesen, dass ich Judith vor einundzwanzig Jahren für immer verloren hätte.
Worüber Svenja geschrieben hatte, wofür sie einen Journalistenpreis bekommen sollte, es war meine Geschichte. Mein Leben, das sich wieder zum Guten gewendet hatte.
Ich glaubte wieder an eine Zukunft.
Und deshalb hörte ich auf mein Bauchgefühl.
Ich ging auf Svenjas Vorschlag ein. Fragte Judith, ob sie mitkommen wollte, um einen Mann zu fotografieren, der dabei zugesehen hatte, wie ein schwarzer Mann vom Himmel fiel.
Ein bisschen Ablenkung tut uns vielleicht gut, sagte ich.
Wird bestimmt lustig, sagte sie und zwinkerte mir zu.
Judith war genauso dankbar wie ich, die Isolation zu durchbrechen, in die wir uns begeben hatten. Es war ein Ausflug, den wir miteinander machten. Wir tauchten in das Schicksal eines Fremden ein. Judith saß auf dem Beifahrersitz und löcherte Svenja mit Fragen. Sie war offen für alles, Journalismus und Fotografie, beides faszinierte sie. Judith war neugierig, sie wollte etwas in ihrem Leben verändern, Neues ausprobieren, nachdem sie ihr Medizinstudium abgebrochen hatte.
Vielleicht wirst du ja ebenfalls Fotografin, meinte Svenja.
Bronski kann mir bestimmt einiges beibringen, sagte Judith.
Ich saß auf dem Rücksitz und schmunzelte. Zum einen, weil sich die beiden Frauen blendend verstanden, zum anderen, weil meine Tochter Bronski zu mir sagte. So wie alle anderen nannte sie mich beim Nachnamen. Nur manchmal sagte sie David. Wenn sie alleine mit mir war, wenn sie neben mir saß und weinte.
Ansonsten blieb sie dabei.
Bronski.
Mir gefiel es.
Zufrieden lehnte ich mich zurück, hörte den beiden zu und ließ die Landschaft an mir vorbeiziehen. Svenja brachte uns nach Schmargendorf, wo Klaus Rembrand uns vor seiner hübschen Jugendstilvilla empfing.
Er war gerade dabei, sich von den Einsatzkräften zu verabschieden, zwei Bestatter hoben einen Transportsarg auf die Ladefläche des Leichenwagens und fuhren los. Noch im Fahren fotografierte ich aus dem Fenster. Es war das perfekte Timing und das perfekte Bild. Noch bevor wir ausgestiegen waren, hatte ich bereits einen Volltreffer gelandet.
Bingo, sagte ich.
Judith schaute mich fragend an.
Ich wusste, dass sie nach Mitgefühl für den Verstorbenen in meinem Gesicht suchte. Dass sie es nicht fand, irritierte sie ein wenig.
Judith versuchte zu verstehen, wie ich dachte. Zu ahnen, was ich fühlte. Sie beobachtete mich, wie ich Rembrand die Hand schüttelte, wie ich ihm und Svenja in den Garten folgte. Die Kamera immer im Anschlag, immer bereit, sie hochzunehmen und abzudrücken.
Es war mein Job, Dinge zu sehen, die ein anderer vielleicht nicht sehen konnte, schnell zu reagieren, die entscheidenden Momente festzuhalten, besondere Blicke auf das Außergewöhnliche möglich zu machen. Und ich war gut darin.
Während Svenja es sich bereits mit Rembrand an einem Gartentisch in der Nähe der Einschlagstelle gemütlich machte, nahm ich Judith zur Seite und erklärte es ihr. Es ging nicht um sie oder um mich. Nicht um unser Mitgefühl, nicht darum, dass wir uns in den Lebensgeschichten der anderen verloren, es ging nur darum, diese Geschichten so gut wie möglich aufzubereiten und für ein breites Publikum nachzuerzählen. Während Svenja das Tragische in Worte fasste, hielt ich es in Bildern fest. Es war nicht unmenschlich, was wir taten.
Es war einfach nur unser Job.
Und er faszinierte mich.
Der Tod.
Immer schon.
Erst vor ein paar Tagen hatten wir darüber gesprochen.
Ich habe Judith die Fotos gezeigt. All die Aufnahmen, die ich in den letzten Jahren gemacht hatte.
Fotos von toten Menschen.
Bilder vom Verschwinden.
Post-Mortem-Fotografie.
Ende des neunzehnten Jahrhunderts war es völlig normal gewesen, die Angehörigen auf diese Weise in Erinnerung zu behalten. Bevor die Leichen verwesten, wurden sie noch einmal schön gemacht, sie wurden in Position gebracht, von Gestängen und Stativen gehalten, auf Papier gebannt und für immer konserviert.
Ich war immer fasziniert davon gewesen und hatte dann ebenfalls begonnen, die Stille festzuhalten, diese Ruhe in den Gesichtern der Toten.
In meinem Fall waren es Unfallopfer gewesen, Drogentote, Selbstmörder, Opfer von Gewaltverbrechen. Ich porträtierte sie. Meine Kontakte zur Polizei, zur Rettung und zur Feuerwehr waren gut, deshalb hinderte man mich nur selten daran, dem Tod so nahe zu kommen. Ich machte also nicht nur Bilder für die Zeitung, sondern auch diese Bilder für mich. Analog.
Ich entwickelte sie in meiner Dunkelkammer.
Kunst war es für mich. Abschreckend war es für andere.
Nicht aber für Judith.
Es war seltsam, aber sie verurteilte mich nicht dafür.
Sie mochte meine Bilder, nicht zuletzt deshalb, weil ich auch ihre Mutter nach ihrem Tod fotografiert hatte. Stundenlang hatte Judith sich dieses ganz besondere Foto angeschaut.
Sie hatte dabei gelächelt.
Meine Tochter.
Sie war der Grund, warum dieses bizarre Hobby plötzlich in den Hintergrund trat. Seit sie wieder bei mir war, hatte ich kein Bedürfnis mehr, mich mit dem Sterben auseinanderzusetzen.
Ich brauchte die Toten nicht mehr. Zumindest nicht mehr so dringend. Wegen Judith. Und auch wegen Svenja. Der Frau, für die ich nach Jahren der Stille wieder so etwas wie Liebe empfand. Mit der ich mir wieder vorstellen konnte, glücklich zu werden.
Svenja und Judith zogen mich wieder auf die Seite der Lebenden. Zeigten mir, dass es noch etwas anderes gab als diese Fotos, die ich jahrelang heimlich gemacht hatte.
Die Tragik rund um den Tod dieses Flüchtlings zum Beispiel. Und das Bedürfnis des kleinen Mannes vor uns, sich in den Vordergrund zu rücken, um ein einziges Mal im Leben in der Zeitung zu stehen.
Klaus Rembrand.
Der Mann, der der Polizei den Fund der Leiche gemeldet hatte.
Judith hing an seinen Lippen. Aufmerksam hörte sie zu, wie Svenja ihn zum Reden brachte, wie sie geschickt ihre Fragen stellte, ohne zu bewerten und zu urteilen. Svenja brachte Rembrand dazu, sich zu öffnen, Dinge zu verraten, die er wohl lieber vor uns verborgen hätte.
Wir hatten uns etwas abseits der beiden ins Gras gesetzt. Direkt neben der Mulde, in der kurz zuvor noch die Leiche gelegen hatte.
Rembrand lallte. Er war betrunken, und es war ihm egal.
Selbstbewusst und freudig bot er auch uns ein Bier an. Svenja lehnte ab, Judith und ich nahmen sein Angebot gerne an. Ich hatte noch Zeit, erst wenn Svenja mit dem Gespräch fertig war, war es an mir, ihn zu motivieren, für Fotos zu posieren.
Rembrand auf der Sonnenliege.
Schockiert auf die Unfallstelle zeigend.
Rembrand mit einer Dose Bier in der Hand.
Wie er auf das Leben trinkt.
Drei oder vier Motive zur Auswahl.
Ich überlegte mir, wo ich ihn platzieren würde, wo das Licht am besten war, ich wollte nichts dem Zufall überlassen. Sobald Svenja mit dem Interview fertig sein würde, musste ich schnell sein. Das war das Wichtigste in meinem Job. Nicht jeder konnte damit umgehen, fotografiert zu werden. Es war notwendig zu wissen, was man wollte. Den Ton anzugeben. Je klarer die Vorstellung von den Bildern war, die man machen wollte, desto besser wurden sie. Fotografenlatein war es, das ich für Judith übersetzte.
Während Rembrand noch einmal aufstand, um Knabbergebäck aus dem Haus zu holen, teilte ich meine Gedanken mit ihr.
Ich hatte wirklich den Eindruck, dass sie sich für meine Arbeit interessierte. Es fühlte sich gut an, ihr etwas beizubringen. Lenkte uns ab von allem anderen. Deshalb sagte ich ihr, was ich vorhatte. Beschrieb ihr die Bilder, die ich machen würde.
Klingt gut, sagte sie.
Wir zwinkerten uns zu. Lächelten.
Und verfolgten mit Freude, wie Svenja ihren Job machte.
VIER
SVENJA SPIELMANN KLAUS REMBRAND
– Wenn ich mir das alles hier so ansehe, bin ich beinahe sprachlos. Eine absolut unfassbare Geschichte.
– Stimmt. Ich kann immer noch nicht glauben, dass das wirklich passiert ist. Ich wollte mir einfach nur einen schönen Nachmittag machen, und dann das. Damit rechnet doch keiner, oder?
– Nein, wirklich nicht. Sie scheinen heute Nachmittag alle Schutzengel auf Ihrer Seite gehabt zu haben. Das sind nur fünf oder sechs Meter, oder? Verdammt knapp, würde ich sagen.
– Bin eben ein verdammter Glückspilz. Im Gegensatz zu diesem armen Teufel. Ich will mir gar nicht vorstellen, was der alles durchgemacht hat. Bei dem, was mir die Polizisten eben erzählt haben, bleibt einem echt die Spucke weg. Dass der Kerl es überhaupt in den Flieger geschafft hat, ist ein Wunder. Er muss wohl kurz vor dem Start über den Zaun geklettert sein. Hat sich wohl im Radkasten dieses Vogels versteckt, ist absolut lebensgefährlich, heißt es. Er hätte von den Rädern, die nach dem Start wieder eingezogen werden, zerquetscht werden können. Wenn man den Beamten Glauben schenkt, war die ganze Sache wohl von Anfang an eine Selbstmordmission.
– Er muss sehr verzweifelt gewesen sein.
– Stimmt. Sonst macht man so was nicht. Da oben in zehntausend Meter Höhe hat es nämlich minus fünfzig Grad. Mit großer Sicherheit ist er erfroren, er muss also schon tot gewesen sein, bevor er aus dem Radkasten fiel.
– Was war Ihre erste Reaktion?
– Ich wollte natürlich helfen. Bin zu ihm hin. Wollte Erste Hilfe leisten. Bin aber schnell zu dem Schluss gekommen, dass das sinnlos ist. Er war ja ganz kalt. Fühlte sich so an, als hätte man ihn direkt aus einer Tiefkühltruhe zu mir in den Garten gebeamt.
– Sie haben ihn angefasst?
– Natürlich. War doch meine Pflicht, alles zu tun, um zu helfen. Hätte ja sein können, dass er noch lebt. Dass ich ihn hätte zurückholen können. Ich war ja mal bei den Sanitätern, als ich jung war. Menschenskind, da könnte ich Ihnen Geschichten erzählen, da war das hier im Vergleich dazu der reinste Kindergeburtstag.
– Sie haben also versucht, ihn wiederzubeleben?
– Ich habe keine Sekunde gezögert. Bin von meiner Liege aufgesprungen und habe mich über ihn gebeugt. Aber da war nichts mehr zu machen.
– Das war sehr mutig von Ihnen.
– Ach, das hätte doch jeder getan, oder?
– Sind Sie nicht erschrocken? Hatten Sie keine Angst?
– Wovor hätte ich denn Angst haben sollen? Der Mann hat sich ja nicht mehr gerührt. War also keine Gefahr. Ich hatte alles unter Kontrolle. Wobei Sie natürlich recht haben.
– Womit?
– Man hört ja immer wieder, dass man sich vor Flüchtlingen in Acht nehmen muss. Wenn man da zu nachlässig ist, überrennen die uns. Liest man doch immer wieder in der Zeitung. Ich will wirklich nicht hetzen, aber wenn wir nicht aufpassen, fressen uns die womöglich noch die Butter vom Brot. Ist doch so, oder?
– So habe ich das nicht gemeint mit der Angst. Ich wollte wissen, ob Ihnen bewusst war, dass Sie hätten sterben können, wenn der Mann eine Millisekunde früher aus dem Flugzeug gefallen wäre oder wenn der Wind etwas stärker geweht hätte. Es muss Ihnen doch ein Schauer über den Rücken gelaufen sein, als Sie begriffen, was für ein Glück Sie gehabt haben.
– Ein Schauer. Genau so war es. Ich hätte es nicht schöner formulieren können. Mir ist sofort klar gewesen, dass auch ich hätte tot sein können. Deshalb bin ich am Feiern. Um ein Haar hätte man mich in einem Sarg aus dem Garten tragen müssen. Kaum vorstellbar, oder? Wir sollten alle gemeinsam noch ein Fläschchen Sekt aufmachen und auf das Leben anstoßen, was meinen Sie?
– Später vielleicht.