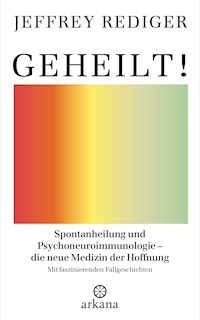
19,99 €
Mehr erfahren.
Ein Krebspatient, dessen Tumor verschwindet, ein Mädchen im Rollstuhl, das plötzlich wieder laufen kann: Spontanheilungen gibt es immer wieder, und doch weiß die Medizin fast nichts über sie. Ein sträflich ungenutztes Potenzial, meint der Harvard-Arzt Jeffrey Rediger, denn diese medizinischen »Wunder« bergen den Schlüssel zu einem fundamental neuen Verständnis unserer Selbstheilungskräfte.
So machte er sich auf die Suche nach Menschen, die trotz aussichtloser Diagnosen wieder genesen sind und erforschte erstmals wissenschaftlich fundiert die Gesetzmäßigkeiten von Heilung. Herausgekommen ist ein Wegweiser der Hoffnung, der die Formel zur Heilung selbst vermeintlich unheilbarer Krankheiten enthält: ein starkes Immunsystem, ein verändertes Mindset, Stressregulation und das Gefühl der Verbundenheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 672
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Autor
Der Mediziner und Theologe Jeffrey D. Rediger unterrichtet an der Harvard Medical School und leitet am McLean Hospital, einer der führenden Einrichtungen in den USA, ein Programm für Erwachsenen-Psychiatrie. Im Bereich der neurowissenschaftlichen Forschung spielt er eine zentrale Rolle. Insbesondere für sein Engagement im Bereich der ganzheitlichen Medizin wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Als Experte präsentierte Rediger seine faszinierenden Ergebnisse u. a. in den Shows von Oprah Winfrey und Dr. Oz.
JEFFREY REDIGER
GEHEILT!
Spontanheilung und Psychoneuroimmunologie – die neue Medizin der Hoffnung
Mit faszinierenden Fallgeschichten
Aus dem amerikanischen Englisch von Andrea Panster
Die US-amerikanische Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »Cured: The Life-Changing Science of Spontaneous Healing« bei Flatiron Books, New York, USA.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Die hier vorgestellten Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen geprüft. Dennoch übernehmen Autor und Verlag keinerlei Haftung für Schäden irgendwelcher Art, die sich direkt oder indirekt aus dem Gebrauch dieser Informationen, Tipps, Rezepte, Ratschläge oder Übungen ergeben. Im Zweifelsfall holen Sie sich bitte ärztlichen Rat ein.
Deutsche Erstausgabe
© 2020 Arkana, München
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Originalausgabe Copyright © 2020 by Jeff Rediger
Lektorat: Ralf Lay
Umschlaggestaltung: ki 36 Editorial Design, München, Daniela Hofner, unter Verwendung der Designvorlage der Originalausgabe: © Omar Chapa
Umschlagmotiv: © Daniela Hofner / ki 36
Textauszug Eingangszitat Kapitel 8 mit freundlicher Genehmigung durch SPACETIME PUBLICATIONS LTD.: Stephen W. Hawking: Eine kurze Geschichte der Zeit – Die Suche nach der Urkraft des Universums. Mit einer Einleitung von Carl Sagan, unterstützt von Bernd Schmidt. In der Übersetzung von Hainer Kober
© 1988, Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Trotz sorgfältiger Recherche und Nachforschungen konnten leider nicht alle Rechteinhaber ermittelt werden. Bei berechtigten Ansprüchen werden Sie sich bitte an den Verlag.
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-22619-0V001
www.arkana-verlag.deBesuchen Sie den Arkana Verlag im Netz
Einführung Ein Blick in die Blackbox der medizinischen Wunder
Man kann ja auf mancherlei Art betrogen werden; man kann dadurch betrogen werden, dass man das Unwahre glaubt, aber man wird doch wohl auch dadurch betrogen, dass man das Wahre nicht glaubt.
Søren Kierkegaard
Im Jahr 2008 hatte es den Anschein, als würde Claire Hasers weiterer Weg problemlos verlaufen. Die 63-Jährige hatte sich in den Rhythmus ihres Lebens eingefunden und meisterte dessen Höhen und Tiefen mühelos. Ihre Zukunft entfaltete sich wie geplant: In wenigen Jahren würden sie und ihr Mann in den Ruhestand gehen. Den erwachsenen Kindern ging es gut, und sie hatten eine Schar gesunder Enkel. Die meiste Zeit ihres Lebens hatten sie in der Stadt Portland im US-Bundesstaat Oregon mit ihrem sanften Regen, ihren üppig grünen Parks und ihren Backsteingebäuden verbracht. Und die meiste Zeit ihres Berufslebens war Claire im Gesundheitswesen in der Verwaltung tätig gewesen und hatte den lieben langen Tag unter riesigen Bergen von Schreibkram begraben im Neonlicht am Schreibtisch gesessen.
Claire und ihr Mann fanden Portland entzückend, aber sie träumten davon, ihren Ruhestand auf Hawaii zu verbringen. Jahrelang hatten sie geplant und gespart, und bald sollte es losgehen. Doch dann geriet Claires behagliches, normales Leben allmählich aus den Fugen. Unklare, aber beunruhigende Symptome trieben sie zum Arzt: Ihr wurde immer öfter übel, und stechende Schmerzen fuhren ihr in den Bauch. Ihr Arzt riet besorgt zu einer Computertomografie (CT). Claire lag mit über den Kopf gestreckten Armen auf der Liege des CT-Geräts und versuchte, normal zu atmen. Sie hoffte, das starke Magnetfeld, durch das ihr Körper gerade geschoben wurde, würde nichts Auffälliges zutage fördern. Doch die Untersuchung offenbarte eine etwa zwei Zentimeter große Geschwulst an der Bauchspeicheldrüse. Eine Biopsie machte auch ihre letzten Hoffnungen zunichte: Die Geschwulst war bösartig; es war Krebs. Die Diagnose lautete Adenokarzinom des Pankreas – eine grausame, unheilbare Form von Bauchspeicheldrüsenkrebs.
In unserer Kultur ist »Krebs« ein Reizwort, ein Schreckgespenst und mehr als viele andere Krankheiten mit der Vorstellung von Verlust und Tod verbunden. In Wahrheit jedoch unterscheiden sich Krebserkrankungen bezüglich ihrer Heilungsmöglichkeiten und Remissionswahrscheinlichkeit. Einige Krebsarten sind nicht tödlich, und in diesen Fällen sterben die Betroffenen nicht an Krebs, sondern mit dem Krebs, der sich viele Jahre lang unauffällig verhalten kann, bis sie durch etwas anderes zu Tode kommen. Manche Krebsarten wachsen langsam, aber stetig; bei anderen schwankt die Größe ein paar Jahre lang. Viele Krebsarten sind unbehandelt tödlich, sprechen aber hervorragend auf eine Behandlung an – ob Operation, Chemo- oder Strahlentherapie. Bestimmte Krebsarten verschwinden sogar von allein, andere reagieren auf keine Therapie und werden ausschließlich palliativ versorgt in der Hoffnung, die Symptome zu lindern. Und viele unterschiedlich schwerwiegende Krebsarten fallen zwischen alle diese Kategorien.
Über Claires Krebserkrankung ist Folgendes bekannt: Das Pankreaskarzinom ist die tödlichste Form des Bauchspeicheldrüsenkrebses. Die Erkrankung schreitet schnell voran und endet mit einem grausamen Tod. Jedes Jahr wird sie bei ungefähr 45000 Menschen in den Vereinigten Staaten und doppelt so vielen in Europa diagnostiziert. Die meisten von ihnen sterben innerhalb des ersten Jahres. Das Pankreaskarzinom steht sowohl bei Männern als auch bei Frauen an vierter Stelle der tödlichen Krebserkrankungen und wird vermutlich bald auf den dritten Platz vorrücken.
Diese Diagnose ist ein Todesurteil. Die Frage ist nicht, ob Sie an der Krankheit sterben werden, sondern wann. Warum ist Bauchspeicheldrüsenkrebs so tödlich? In den frühen Stadien verursacht die Erkrankung keine Symptome. Der Krebs schreitet heimlich, still und leise voran. Bei den ersten Anzeichen – Appetitverlust, Gewichtsverlust, Rückenschmerzen, gelegentlich auch eine leichte Gelbfärbung von Haut und Augen – ist es bereits zu spät. Zu diesem Zeitpunkt hat der Krebs meist schon gestreut. Eine Behandlung kann das Leben verlängern, aber nicht retten. Die Mehrzahl der Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs (96 Prozent) stirbt innerhalb von fünf Jahren an der Erkrankung, die meisten erliegen ihr aber schon viel früher. Nach Diagnosestellung werden die Überlebensaussichten mit einer Behandlung üblicherweise auf drei bis sechs Monate geschätzt. Daran gemessen hatte Claire noch Glück; die Ärzte gaben ihr ein Jahr.
Die Zukunft, der Claire entgegengesehen hatte – ihr Garten, Hawaii und ein beschaulicher Ruhestand mit ihrem Mann –, löste sich über Nacht in Luft auf. Wie ein Hurrikan fegte der Krebs hindurch und riss alles mit sich fort.
Nach der Diagnose musste Claire zwei Wochen auf einen Termin bei einem Chirurgen warten. Familie und Freunde waren über die lange Wartezeit entsetzt. Schließlich litt Claire an aggressivem Bauchspeicheldrüsenkrebs! Sollte der denn nicht so schnell wie möglich entfernt werden? Wie sollte sie wochenlang in dem Wissen weiterleben, dass sie diesen Krebs in sich trug, der möglicherweise weiterwuchs und sich vielleicht sogar ausbreitete? Doch Claire war froh um die Pause. Sie musste sich wieder fangen. Nach der tödlichen Diagnose erschien ihr alles wie ein bizarrer Traum. Mit einem Mal hatte ihr Leben ein klar definiertes Ende. Die Eisenbahnschienen liefen vor ihren Augen geradewegs auf einen Abgrund zu. Es war unwirklich. Hinzu kam die Art und Weise, wie sie von den Ärzten behandelt wurde: wie eine Aufgabe, die es abzuhaken galt; wie ein Körper, der zur nächsten Behandlung weitergeschoben werden musste. Als Patientin hatte Claire das Gefühl, in der Maschinerie des Gesundheitssystems gefangen zu sein und wie auf einem Fließband unerbittlich von einer Station zur nächsten befördert zu werden. Es fühlte sich vorgezeichnet, unpersönlich, wie reine Routine an.
Zu Hause stürzte sie sich mit ganzer Kraft in die Recherchen zu ihrer Krankheit. Sie verschlang Bücher, Artikel und Internettexte auf der Suche nach einem Hoffnungsschimmer – nach etwas, was ihre Ärzte unerwähnt gelassen hatten. Doch die ganze Lektüre bestätigte nur, was man ihr bereits gesagt hatte: dass niemand diesen Krebs überlebte. Claire durchforstete das Internet nach Geschichten von Remission oder Überleben und wäre schon mit einer einzigen zufrieden gewesen. Doch sie fand nichts.
Ihre einzige Überlebenschance war die sogenannte Kausch-Whipple-Operation, kurz »Whipple-OP«. Dabei würden die Ärzte einen Teil der Bauchspeicheldrüse, die Gallenblase, Teile des Dünndarms (Zwölffingerdarm und Leerdarm) sowie möglicherweise auch Teile des Magens und der Milz entfernen. Bei dieser Operation konnten ernste Nebenwirkungen und Komplikationen auftreten. Schließlich sollte ein Teil der Bauchspeicheldrüse entfernt werden, die wichtige Aufgaben erfüllte – unter anderem bei der Blutzuckerregulierung und der Aufspaltung der Nahrung. Pankreasenzyme sind sehr stark. Wenn sie durchsickern, was nach einer Whipple-OP häufig vorkommt, kann dies unerträgliche Schmerzen verursachen. Nach dem Eingriff musste Claire also mit dem schmerzhaften Austreten von Pankreasenzymen sowie Wassereinlagerungen, Magenkrämpfen und quälenden Blähungen rechnen. Es bestand die Gefahr, dass sich langfristig Diabetes, Anämie und Verdauungsstörungen einstellten, die Symptome wie Abgeschlagenheit, Schwäche sowie einen Vitamin- und Mineralstoffmangel verursachten.
Claire konnte nicht schlafen und notierte sich bis spät in die Nacht Fragen für die Besprechung mit ihrem Chirurgen.
Ist die Whipple-OP die einzige Möglichkeit? Werde ich Diabetes oder eine Magenlähmung bekommen, wenn ich mich für die Operation entscheide? Werde ich je wieder normal essen können? Werde ich Schmerzen haben? Wenn ja, wie lange? Wie lange wird die Genesung dauern? Geht die Erschöpfung, von der man so viel liest, irgendwann auch wieder weg? Wie oft haben Sie diese Operation schon gemacht? Mit welchen Ergebnissen? Wie oft wird diese Operation in diesem Krankenhaus durchgeführt? Wie sind die Resultate?
Die Ergebnisse der Operation, sagte Claires Chirurg bei ihrem Termin, seien nicht berauschend. Er war ehrlich und direkt, und das wusste sie zu schätzen. Sie bat ihn, aufrichtig zu ihr zu sein, und das war er. Ihr zwei Zentimeter großes Pankreaskarzinom sei resektabel, könne also mit der Whipple-OP chirurgisch entfernt werden. Dies sei ihre einzige Chance auf Heilung. Doch der Eingriff sei riskant – lang, unvollkommen und von zweifelhaftem Ausgang. Er legte seinen Operationsatlas auf den Tisch und schlug die Seite mit den Möglichkeiten auf, die Operationswunde zu schließen: Es war eine enzyklopädische Auflistung verschiedener Techniken, den Patienten wieder zusammenzuflicken, nachdem man ihn auseinandergenommen hatte.
»Sehen Sie, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt, diese Operation abzuschließen? Wissen Sie, was das heißt?« Er sah ihr fest in die Augen. »Es heißt, dass es keine guten Möglichkeiten gibt.«
Er sagte, der Eingriff könne bis zu acht Stunden dauern. Sollte sie einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall erleiden, dann auf dem Operationstisch. Die Statistiken widersprachen sich. Einige Quellen bezifferten Claires Risiko, bei der Operation zu sterben, auf lediglich 2 Prozent, andere auf 15 Prozent. Dem Chirurgen zufolge lag ihre Chance, danach noch fünf Jahre zu leben, bei ungefähr 5 Prozent. Die meisten Menschen mit ihrer Krebserkrankung würden auch mit einer Whipple-OP innerhalb dieses Zeitraums an der Krankheit sterben. An dieser Stelle warf der Onkologe ein, dass die Fünf-Jahres-Überlebensrate eher bei 20 Prozent liege, doch der Chirurg beharrte auf seinen Zahlen, und es kam zum Streit.
»Hören Sie«, sagte der Chirurg schließlich. »Manche Ärzte würden versuchen, Ihnen diese Operation zu verkaufen. Aber ich muss nichts mehr beweisen. Ich habe diesen Eingriff oft genug gemacht. Ich brauche das Geld nicht. Ich habe mein Boot.«
Claire merkte ihm an, dass er sie heilen wollte. Er war Chirurg und darauf geschult, »Dinge zu reparieren« und einen Zauber aus wissenschaftlicher Präzision zu wirken. Doch auf ihre Bitte hin sagte er ihr auch die ungeschminkte Wahrheit.
Daheim schaute sie sich YouTube-Videos an, in denen Patienten die furchtbaren Nebenwirkungen der Whipple-OP schilderten und sich dabei vor Schmerzen krümmten. Sie suchte nach statistischen Angaben zu den Überlebensraten. Sie weinte. Sie betete. Sie stellte sich schwierige Fragen: Wie viele Schmerzen halte ich aus? Wie viele Schmerzen will ich den Rest meines Lebens ertragen? Mit wie vielen Einschränkungen bin ich bereit zu leben? Kann ich damit leben, nie wieder in den Bergen zu wandern?
Am Ende entschied sich Claire gegen die Operation. Sie wollte ihre restliche Zeit nicht damit verbringen, einer aller Wahrscheinlichkeit nicht zu erwartenden Heilung nachzujagen und in den Sprech- und Wartezimmern von Ärzten herumzusitzen. »Ich wollte den Dingen ihren Lauf lassen«, sagt sie. »Ich wollte in der Zeit, die mir noch blieb, mit so viel Begeisterung und Freude leben wie möglich.«
Im Jahr 2013, fünf Jahre nach ihrer Diagnose und ihrer düsteren Prognose, musste Claire wegen einer Sache ins Krankenhaus, die nichts mit dem Krebs zu tun hatte und eine computertomografische Untersuchung ihres Bauchs erforderlich machte. Es war das erste Mal seit der Diagnose, dass irgendwelche Aufnahmen gemacht wurden. Sie war davon ausgegangen, dass sie sterben würde, und hatte sich einfach aufs Leben konzentriert. Und die Zeit war verstrichen. Die Ärzte hatten zwar nicht vorgehabt, sich die Bauchspeicheldrüse anzuschauen, doch sie war auf der Aufnahme ebenfalls zu erkennen – und sie war gesund. Von dem Tumor war nichts mehr zu sehen.
Ihre verblüfften Ärzte setzten eine Konferenz zur Prüfung ihrer Diagnose an und ließen die Gewebeschnitte ihrer Biopsie kommen. Sie waren überzeugt, dass ein Fehler passiert war. Doch die Diagnose war korrekt gewesen. Obwohl dies eigentlich unmöglich schien, war Claires Pankreaskarzinom ohne Behandlung oder Operation verschwunden.
Wie war das möglich? Das wusste keiner so genau, auch nicht Claire selbst. Ihre Ärzte wussten nur, was sie nicht gemacht hatte: keine Operation, keine Chemo- und keine Strahlentherapie. Wie ich von ihr wusste, hatte Claire nach der Diagnose durchaus wichtige Veränderungen vorgenommen, doch keiner ihrer Ärzte interessierte sich dafür. Sie sagten, ihre Erfahrung habe »keinerlei medizinischen Wert«. Sie gehöre schlicht zu jenen unerklärlichen Phänomenen, jenen Glücksfällen, die bei einer Million Patienten ein Mal vorkämen.
Viele Menschen würden einen Fall wie Claires als »Wunder« bezeichnen. Wir Ärzte sprechen in solchen Fällen von »Spontanremission«. Aber unabhängig von der Bezeichnung sind und bleiben solche Heilungen eine Blackbox, welche die medizinische Wissenschaft nur in den seltensten Fällen öffnet und untersucht.
»Spontan« bedeutet »ohne Ursache«, doch in Wahrheit suchen wir meist gar nicht erst danach. In der Geschichte der Medizin wurden außergewöhnliche Fälle der Heilung von unheilbaren Krankheiten bislang so gut wie nie mit streng wissenschaftlichen Mitteln untersucht. Der gesunde Menschenverstand würde uns sagen, dass wir diese Fälle unbedingt erforschen sollten; dass diese Menschen über tiefgreifende Heilungsstrategien gestolpert sein könnten, die uns interessieren sollten. Und doch sind Spontanremissionen ein beinah gänzlich unerforschtes Terrain. Wir stufen Menschen wie Claire als »Glücksfälle« und »Ausreißer« ein und akzeptieren die Geschichte von der Unerklärbarkeit ihrer Heilung. Ich aber betrachte Menschen, die eine außergewöhnliche Heilung erfahren haben, ebenso wenig als »Glücksfälle« oder »Ausreißer« wie Menschen, die in anderen Bereichen Außergewöhnliches leisten. Natürlich sind Serena Williams und Michael Jordan »Ausreißer« oder besser »Überflieger«. Aber sie sind auch leuchtende Beispiele menschlichen Könnens; und indem wir ihre Methoden und Techniken untersuchen, verstehen wir möglicherweise besser, wie wir die eigenen optimieren können.
Im Jahr 1968 nahm der amerikanische Weitspringer Bob Beamon bei den Olympischen Sommerspielen in Mexico City Anlauf auf die mit Sand gefüllte Sprunggrube und sprang in die Luft. In der Aufzeichnung des Wettkampfs hat es den Anschein, als fliege er mit der Brust voraus wie ein Vogel, ehe er die Füße nach vorn streckte, um nach dem Sand zu greifen. Er brach den Weltrekord um 55 Zentimeter: Die Menge war erschüttert, und der Wettkampf war damit im Grunde zu Ende. Beobachter sagten, der Sprung sei »unglaublich« gewesen. Er war weiter, als die Geräte messen konnten, und wurde als »Sprung ins 21. Jahrhundert« bekannt.
Sofort versuchten Sportler und Wissenschaftler herauszufinden, wie Beamon es gemacht hatte und wie man ihn schlagen konnte. Dennoch vergingen fast 23 Jahre, bis der neue Weltrekord gebrochen wurde. Wenn etwas Ähnliches im Gesundheitswesen geschieht – wenn es einem Menschen, den die Medizin im Grunde zum Tode verurteilt hat, mit einem Mal besser geht –, sind wir dagegen beinahe peinlich berührt. Man betrachtet diese bemerkenswerten Fälle weniger als Inspiration, sondern vielmehr als Bedrohung für das System, und geht ungeprüft darüber hinweg. »Rätsel«, »Wunder«, »Glücksfall«, »Ausreißer«: Wir haben viele Bezeichnungen, aber kaum Erklärungen dafür.
In der Geschichte der Menschheit gab es zahlreiche Vorstellungen über den Ursprung von Krankheit und Leiden. Vor nicht allzu langer Zeit – vor grob gesagt etwa zweihundert Jahren – dachte man in den meisten Kulturen, dass Krankheiten aus der Geistwelt kamen: Sie waren der Wille Gottes, vielleicht eine Strafe oder aber der Fluch eines bösen Geistes. Im alten Ägypten hätten Sie vielleicht ein Amulett zum Schutz vor Krankheiten getragen und Schnitt- und Schürfwunden mit Honig (einem natürlichen Antibiotikum) behandelt. Im Falle einer schweren Erkrankung hätte Ihr Arzt vielleicht entschieden, Sie zum Erbrechen zu bringen. Aufgrund der Theorie, dass der Körper von vielen Gängen durchzogen sei, konnte Ihre Erkrankung ein Hinweis auf eine Blockade sein, die beseitigt werden musste. Wären Sie zufällig im alten Griechenland zur Welt gekommen, hätten Sie geglaubt, der menschliche Körper bestünde aus Elementen, die im Gleichgewicht sein müssen. Krankheit galt als Hinweis darauf, dass das Gleichgewicht gestört war und wiederhergestellt werden musste. Möglicherweise hätten Sie sich dazu in eines der altgriechischen Asklepios-Heiligtümer (Asklepieia) begeben, um sich einer Katharsis (Reinigung), Traumtherapie und medizinischer Behandlung zu unterziehen – einer Mischung aus körperlichen und spirituellen Verfahren unter dem wachsamen Auge von Asklepios, dem Gott der Heilkunst.
Viele Kulturen des Altertums verließen sich in ihrer medizinischen Praxis stark auf Magie, Religion und Aberglauben. Es gab aber auch bedeutende Fortschritte: tiefgehendes anatomisches Wissen, durch Beobachtungen und Experimente gewonnene Theorien zu Krankheit und Gesundheit sowie wiederholbare Methoden zur Behandlung von Verletzungen und Erkrankungen, wobei man oft mit Heilpflanzen arbeitete, den Vorläufern der modernen Arzneimittel. Nur der Ursprung der Erkrankung blieb weiter im Dunkeln. Woher kam sie? Warum suchte sie sich ausgerechnet diese und keine andere Person aus? Während der Mensch auf Heilmethoden wie Aderlass und Astrologie baute, beobachtete er zunehmend, dass viele Krankheiten von Schmutz- und Abwasser verursacht wurden und dass es wichtig war, Körper, Städte und Wasserquellen sauber zu halten – wenngleich noch nicht ganz klar war, weshalb.
Im Jahr 36 v. Chr. veröffentlichte der römische Gelehrte Marcus Terentius Varro seinen praktischen Ratgeber Rerum Rusticarum (»Gespräche über die Landwirtschaft«). In einem Abschnitt über die Viehhaltung warnte er davor, Tiere in der Nähe von Sümpfen zu halten, »weil dort, wenn es nicht austrocknet, etliche winzige Lebewesen gedeihen, die die Augen nicht wahrnehmen können, über die Atemluft durch Mund und Nase tief in den Körper eindringen und ernste Krankheiten verursachen«.1 Eine interessante Hypothese, die zur damaligen Zeit aber nicht zu beweisen war.
Im Jahr 1546 erschien das Werk De contagionibus et contagiosis morbis et eorum curatione libri tres (»Drei Bücher von den Kontagien, den kontagiösen Krankheiten und deren Behandlung«) des italienischen Arztes Girolamo Fracastoro. Darin schilderte er ausführlich seine These, dass sich winzige und sich rasend schnell vermehrende krankheitserregende Tierchen – Mikroorganismen – mit dem Wind oder durch Berührung von Mensch zu Mensch verbreiten würden. Seine These wurde positiv aufgenommen, doch da es wieder keine stichhaltigen Beweise dafür gab, blieb sie letztlich auf der Strecke und geriet weitgehend in Vergessenheit. Erst der französische Chemiker Louis Pasteur erbrachte in den 1860er-Jahren den Beweis für die Keimtheorie und erfand das nach ihm benannte Verfahren zur Abtötung von Krankheitserregern: die Pasteurisierung. Dies war ein enormer Entwicklungssprung für die Medizin, kettete uns aber gleichzeitig an eine bestimmte Philosophie von Gesundheit und Krankheit, die auf dem Ethos »Tötet den Erreger« basiert. Konzentrieren wir uns heutzutage möglicherweise so sehr auf diesen Auftrag, dass wir wichtige Wege zur Gesundheit übersehen?
Ärzte lernen, die Geschichte eines Menschen und sein Privatleben zu ignorieren, um zu den grundlegenden Symptomen der Patienten vorzudringen, die an einer speziellen Krankheit leiden. Es schränkt uns ein, dass wir vom Krankheitsbild, dem Fehlenden oder Erkrankten ausgehen, statt all das zu sehen und zu aktivieren, was richtig, besonders und großartig im Leben jedes Einzelnen – in Ihrem Leben – ist. Infolgedessen unterlaufen uns regelmäßig tödliche Fehler bei dem Versuch zu heilen. Wir behandeln die Krankheit, nicht den Menschen. Dabei entgeht uns die umfassendere Lebensgeschichte des Patienten – gespickt mit Tipps und Hinweisen, wie wir ihn am besten zur Gesundheit führen können. Wir konzentrieren uns auf die Symptome, nicht auf die eigentlichen Ursachen, und verordnen Medikamente, die diese Symptome oft nur überdecken, statt uns auf den langwierigeren und schwierigeren Versuch einzulassen, Abwehrkräfte und Vitalität aufzubauen. Beharrlich trennen wir Krankheiten nach körperlichem oder geistigem Ursprung, statt die Verbindung von Körper und Geist zu verstehen und zu akzeptieren, in der die meisten Erkrankungen wurzeln.
Zu guter Letzt verdrängen wir ungewöhnliche Genesungsgeschichten, die nicht in unser Paradigma von einer Ursache und einer Lösung passen. Aufgrund meiner Erfahrung bin ich bereit zu wetten, dass den meisten Ärzten bereits außergewöhnliche Genesungsfälle begegnet sind. Wir wissen nicht, was wir davon halten sollen. Da sie nicht in unser Schema passen, stecken wir sie in eine geistige Schublade und vergessen sie. Vielleicht denken wir gelegentlich spätabends bei einer Tasse Kaffee im Stationszimmer oder ganz im Stillen privat darüber nach. Wir können sie nicht erklären. Wir scheuen uns davor, sie öffentlich zu machen, weil wir den Spott der Kollegen fürchten. Und wir wiederholen nichts davon gegenüber unseren Patienten, die an genau den gleichen Erkrankungen leiden. Wir wollen keine »falschen Hoffnungen« wecken.
Meine erste Begegnung mit Geschichten unerwarteter Heilung liegt siebzehn Jahre zurück. Damals hatte ich gerade die Facharztausbildung abgeschlossen und begonnen, als Psychiater zu arbeiten. Ich besetzte eine Doppelstelle am McLean Hospital und der Harvard Medical School, hatte eine kleine Privatpraxis eröffnet – und stand unter Druck. Ich verspürte den Drang, mich sowohl als Arzt wie auch als Professor zu beweisen.
Nikki war Onkologieschwester und arbeitete ein paar Häuser weiter am Massachusetts General Hospital (kurz: Mass General). Wir lernten uns kennen, als sie zu einer Sitzung mit ihrem erwachsenen Sohn zu mir kam. Sie hatte die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs bekommen und wünschte sich Unterstützung, wenn sie ihm die Nachricht überbringen würde.
Kurz darauf erzählte sie, sie habe sich auf unbestimmte Zeit beurlauben lassen. Ihr Gesundheitszustand hatte sich so stark verschlechtert, dass sie nicht mehr arbeiten konnte. Sie war erschöpft, konnte kaum etwas essen und verlor an Gewicht. Sie wollte nach Brasilien in eine winzige Stadt namens Abadiânia reisen, irgendwo auf dem Land, zu einem brasilianischen Heiler. Im Kampf gegen die Krankheit hatte sie alles ausprobiert, was die westliche Medizin zu bieten hatte, und war zu dem Entschluss gelangt, dass sie nichts zu verlieren hätte.
Ungefähr zwei Wochen nach ihrer Abreise klingelte das Telefon in meinem Büro. Es war Nikki aus Brasilien.
»Sie müssen unbedingt herkommen«, sagte sie. »Ich erhole mich, und ich sehe Unglaubliches.«
Sie erzählte eine Geschichte nach der anderen von Menschen, denen sie begegnet war, und Heilungen, die sie gesehen hatte. Es waren die Klassiker von den Lahmen, die anfingen zu gehen, und den Blinden, die ihr Augenlicht wiedererlangten. Eine an Brustkrebs erkrankte Frau spürte, wie bei der Berührung des Heilers eine »schwarze Wolke« aus ihrer Brust fuhr. Anschließend sah sie ihren Tumor schrumpfen. Monatelang kamen Anrufe und Briefe von Nikki aus Brasilien, aber ich blieb zu Hause. Es war viel los im Krankenhaus, ich musste Kurse unterrichten und war zudem zutiefst skeptisch. Ich verbuchte all diese Dinge als erklärbare Phänomene. Wahrscheinlich handelte es sich um vorübergehende Besserungen, um Fehldiagnosen und Menschen, die sich ohnehin erholt hätten.
Als Nikki wiederkam, schien sie neue Kraft geschöpft zu haben. Ihr Gesundheitszustand hatte sich dramatisch verbessert. Sie genoss das Leben, aß Steaks (eine ihrer Leibspeisen) und Salate. Der Aufenthalt in Brasilien hatte ihr Auftrieb gegeben. Sie sagte, sie habe neuerdings wieder das Gefühl, Liebe geben und empfangen zu können. Der quälende Kontrollzwang war von ihr abgefallen. Sie fühlte sich energiegeladen und freudvoll. Verglichen mit dem Zustand vor ihrer Abreise, war ihre Lebensqualität sprunghaft angestiegen. Leider endete ihre Geschichte anders als bei Claire. Ehrlich gesagt gilt das für die meisten Geschichten. Am Ende erlitt sie einen Rückfall und erlag ein knappes Jahr später ihrer Krebserkrankung. Davor aber hatte sie mich erneut gedrängt, die Vorgänge in Brasilien zu untersuchen.
In wissenschaftlichen Fachzeitschriften hatte ich gelesen, echte Fälle von Spontanremission seien selten und das Verhältnis liege bei ungefähr eins zu hunderttausend. Diese Zahlen wurden ständig in Zeitschriftenartikeln wiederholt – stets mit dem Anstrich absoluter Wahrhaftigkeit. Daher beschloss ich, sie zu ihrem Ursprung zurückzuverfolgen. Wie sich herausstellte, hatte man die Zahlen frei erfunden, für wahr gehalten und in späteren Artikeln immer wiederholt.
Als ich etwas tiefer grub und in der wissenschaftlichen Forschung nach aktuellen wie historischen Fällen von Spontanremission suchte, war ich schockiert von dem, was ich fand. In den letzten hundert Jahren ist sowohl die Zahl als auch die Häufigkeit der Berichte über die Spontanheilung allmählich gestiegen. Typisch sind Spitzen nach wichtigen Konferenzen, dem Erscheinen bedeutender Bücher oder großer Medienberichte. Im Jahr 1990 begann das Institute of Noetic Sciences alle Fälle von Spontanremission zusammenzutragen, die irgendwo in der medizinischen Fachliteratur beschrieben waren. Der im Jahr 1993 unter dem Titel Spontaneous Remission: An Annotated Bibliography2 veröffentlichte Datenbestand verzeichnete 3500 Hinweise auf Spontanheilung in achthundert Zeitschriften. Und die gemeldeten Fälle waren nur die Spitze des Eisbergs. In dem ersten Vortrag, in dem ich über Spontanremissionen sprach und was wir als Ärzte daraus lernen können, fragte ich das medizinische Fachpublikum, wer schon einmal Zeuge einer Genesung geworden sei, die aus medizinischer Sicht keinen Sinn ergab. Überall im Saal schossen Hände nach oben. Als ich fragte, wie viele diese Fälle niedergeschrieben und ihre Beobachtungen veröffentlicht hätten, gingen alle Hände wieder herunter.
Es war nicht so, dass Fälle von Spontanremission selten waren. Vielmehr hinderte uns eine Kultur der Angst und der Verurteilung daran, das Ausmaß zu erkennen. Wie viele Fälle gab es dort draußen, die aus Angst vor kollegialem Spott niemals Eingang in die medizinische Fachliteratur fanden? Als neuer ärztlicher Leiter am McLean Hospital, einer der altehrwürdigen psychiatrischen Einrichtungen der Vereinigten Staaten, war ich mir dieser Angst deutlich bewusst. Ich zögerte, meine Beobachtungen öffentlich zu machen oder mir in ärztlichen Kreisen Unterstützung zu suchen. Und doch erlebte ich jeden Tag, wie gut bestimmte Fälle von Spontanremission zu den Problemen meiner Patientinnen und Patienten im medizinischen und psychiatrischen Bereich sowie in der Notaufnahme passten. Jeden Tag sah ich Menschen mit den häufigsten und gleichzeitig tödlichsten Erkrankungen, die es gibt: Krebs, Diabetes, Herzkrankheiten, Autoimmun- und Lungenerkrankungen – mit jenen Krankheiten, die im Westen die meisten Menschen töteten. Inzwischen wird zunehmend bekannt, dass bei vielen von ihnen Aspekte der Lebensführung eine erhebliche Rolle spielen. Allmählich gelangte ich zu der Überzeugung: Könnten meine Patienten nur die Hälfte der Strategien ausprobieren, die unerwartet genesene Menschen nutzen, würde sich der allgemeine Gesundheitszustand deutlich verbessern – nicht nur bei den Erkrankten, sondern in der gesamten Bevölkerung. Aber der Druck war groß, die dogmatischen Grenzen meines Berufsstandes nicht zu überschreiten, und es fiel mir schwer, mich davon zu befreien.
Ich bin im ländlichen Indiana auf einer kleinen Familienfarm zwischen schier endlosen Mais- und Sojafeldern und unter der weiten Himmelskuppel des Mittelwestens aufgewachsen. Ich habe einen amischen Hintergrund. Meine Eltern verließen die amische Gemeinschaft, als ich zwei Jahre alt war, doch wir lebten weiter nach ihren Prinzipien. Wir züchteten Tiere und produzierten einen großen Teil unserer Nahrung selbst, einschließlich Fleisch und Weizenmehl. Meine Mutter nähte unsere Kleidung von Hand. Funk, Fernsehen und die meisten modernen Gerätschaften und Beschäftigungen galten als »böse«. Sie waren zu fürchten und zu meiden. Ich empfand diese Welt als isolierend und schwierig und brach so bald wie möglich aus, um zunächst das Wheaton College bei Chicago zu besuchen. Danach studierte ich Theologie an der Princeton University, Medizin an der Indiana University School of Medicine und absolvierte schließlich meine Facharztausbildung an der Harvard University. Ich weiß noch, wie die Welt weit zu werden schien – wie sich eine bislang verschlossene Tür öffnete und sich unzählige Möglichkeiten vor mir auftaten. Zu Beginn des Theologiestudiums war ich voller Fragen, befand mich auf der Suche nach Antworten und versuchte, die fundamentalistischen Überzeugungen meiner Kindheit mit neuem Wissen und neuen Erfahrungen in Einklang zu bringen. Statt Antworten fand ich in Princeton noch mehr Fragen. Von meinem Mentor lernte ich aber auch, dass Fragen genauso wichtig sind wie Antworten.
»Das Ziel«, so sagte er, »besteht nicht zwangsläufig darin, eine absolute Antwort zu finden. Es besteht darin, bessere Fragen zu stellen. Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deiner Antwort.«
Unsere Fragen sind die Kraft, die uns vorantreibt. Wenn wir gute Fragen stellen, ist es durchaus möglich, dass wir uns in eine gute Richtung bewegen.
Die Philosophie des Medizinstudiums unterschied sich so sehr davon, dass es sich wie ein Schleudertrauma anfühlte. Ich weiß noch genau, wann mir klar wurde, dass die in der Medizin herrschende Kultur so gar nicht meinen Hoffnungen oder Erwartungen entsprach. Ich stand ganz vorn in einem wie ein Amphitheater gestalteten Hörsaal und stellte dem Professor eine Frage zu seiner Vorlesung.
»Lernen Sie einfach den Stoff auswendig«, sagte er. »Und stellen Sie keine Fragen.«
Es war ein Satz, den ich im Laufe des Medizinstudiums immer wieder hören sollte: Stellen Sie keine Fragen. Stellen Sie keine Fragen. Stellen Sie keine Fragen … Natürlich muss man als Medizinstudent den Stoff lernen. Man muss sehr viel Zeit und Kraft aufwenden, um die für den Arztberuf nötige Wissensgrundlage zu schaffen. Doch in meinen Ohren klang dieser Satz wie ein unschönes Echo der Philosophie, mit der ich aufgewachsen war: dass man das Dogma nicht infrage stellen durfte.
Auswendig lernen zu müssen und keine Fragen stellen zu dürfen prägt Ärzte dahin gehend, dass sie den Kopf einziehen und keinen Staub aufwirbeln. Am Ende sind wir Teil eines Systems, das zwar unglaubliche wissenschaftliche und technische Fortschritte hervorbringt, aber tagtäglich Patientinnen und Patienten im Stich lässt und wichtige Möglichkeiten der Heilung übersieht. In meiner zwanzigjährigen medizinischen Tätigkeit gab es reichlich verpasste Gelegenheiten – Augenblicke, in denen wir die Möglichkeit hatten, den Lauf eines Lebens zu verändern, und sie nicht nutzten. Es wird Zeit, ein wenig Staub aufzuwirbeln. Ich bin nun endlich an dem Punkt, dass ich mutig die nötigen Fragen stelle und ihrer Spur folge, wohin sie führt: so weit, wie es die aktuelle Wissenschaft zulässt – und noch ein wenig weiter.
Es gibt keine klinischen Studien zur Erforschung von Spontanremissionen, keine Doppelblindstudien – Goldstandard der medizinischen Welt. Dies wäre unmöglich, da wir derzeit nicht kontrollieren können, unter welchen Bedingungen Spontanremissionen stattfinden. Außerdem wäre es moralisch verwerflich, unsere Theorien an todkranken Patientinnen und Patienten zu testen. Bei der Spontanremission müssen wir zu Anthropologen, Detektiven, medizinischen Forschern werden und persönliche Berichte, Krankenakten sowie die aktuelle Forschung durchkämmen, um die Puzzleteile zusammenzufügen. Das vorliegende Buch ist mein Versuch, dies zu tun.
Seit 2003 spreche ich mit Menschen, die unheilbare Krankheiten überlebt haben, und studiere ihre Krankenakten. Dabei ist mir ein Muster bestimmter Prinzipien und Verhaltensweisen aufgefallen. Das unerwartete Verschwinden von Krankheiten überrascht mich nicht mehr. Ich bin nach Brasilien gereist und habe die Heilzentren besucht, wohin die Menschen zu Tausenden strömen in dem Glauben, dort Heilung zu finden – was häufiger geschieht, als innerhalb unseres medizinischen Paradigmas einen Sinn ergibt. Ich begleitete einen sogenannten Gesundbeter im Herzen der Vereinigten Staaten und beobachtete das überraschende Verschwinden von Erkrankungen bei Patientinnen und Patienten, die bei mir in Behandlung sind. Ich rang mit meinen Zweifeln und tue es immer noch, obwohl ich weitermache.
Dieses Buch plädiert nicht dafür, dass Patienten ihre Medikamente absetzen oder medizinische Maßnahmen ablehnen sollen. Wir haben Arzneimittel und Medizintechnik entwickelt, die innovativ, notwendig und oft lebensrettend sind. Wie die Geschichten zeigen, treten viele Fälle von Spontanremission in Verbindung mit den außergewöhnlichen Bemühungen von engagierten Ärzten auf, die an der Spitze ihrer Fachgebiete stehen. Fälle von unerwarteter Heilung zeigen lediglich, dass diese Maßnahmen nicht immer ausreichen und die Heilung weitere Facetten hat.
Im Zuge meiner Nachforschungen lernte ich, dass wir tiefer gehen und über eine langfristige medikamentöse Behandlung der Symptome hinaus zu den Wurzeln der Krankheit vordringen müssen, wie ich es bei meinen eigenen Patientinnen und Patienten praktiziere. Es ist mitfühlend und wichtig, kurzfristig bei den Symptomen anzusetzen. Langfristig aber muss die Ursache einer Erkrankung angegangen werden, die oft im Verborgenen liegt. Spontanheilungen ermöglichen einen seltenen Einblick in die wahren Krankheitsursachen. Wir müssen diese Fälle untersuchen und so viel wie möglich daraus lernen. Das gewonnene Wissen können wir in die Behandlung chronischer und unheilbarer Krankheiten einfließen lassen, um sowohl die Mittel der modernen Medizin als auch die Weisheit dieser unerwarteten Genesungen zu nutzen.
Dieses Buch zeichnet meine Forschungen zum Phänomen der Spontanremission nach, mit denen ich mich seit siebzehn Jahren beschäftige. Der erste Teil setzt dort an, wo auch ich angefangen habe, und betrachtet die Bausteine der Gesundheit. Bei einer spontanen Remission verändert irgendetwas die voraussichtliche Krankheitsentwicklung – und zwar auf radikale Weise. Logischer Ausgangspunkt waren das Immunsystem, die erste und wichtigste Verteidigungslinie des Körpers gegen Infektionen und Krankheiten, sowie die Faktoren, die es beeinflussen: Ernährung, Lebensführung und Stress. Immer wieder konnte ich beobachten, wie Menschen, die unheilbare Krankheiten überstanden, umwälzende Veränderungen in diesen Bereichen vornahmen (die in der medizinischen Routineversorgung oft ausgeklammert werden). Ich musste gründlicher untersuchen, was genau geschehen war und warum. Dabei entdeckte ich nicht nur überrascht, was für eine heilende Wirkung derartige Veränderungen entfalten können. Es führte mich auch tiefer in die Feinheiten der Verbindung von Körper und Geist und die Mysterien des menschlichen Herzens hinein.
Es überraschte mich nicht, dass in der Verbindung von Körper und Geist ein großes Potenzial für radikale Heilung schlummert. Sogar die Schulmedizin akzeptiert, dass etwa das Stressniveau und die Denkmuster Einfluss auf die körperliche Gesundheit haben können. Mich überraschten vielmehr die Ausmaße dieses Potenzials, das größer ist als alles, worauf mich die medizinische Ausbildung vorbereitet hatte. Im zweiten Teil nehme ich Sie mit, wenn ich untersuche, wie stark die Verbindung zwischen radikaler Heilung und unseren Gedanken, Überzeugungen und sogar unserem tiefsten und meist ungeprüften Selbstbild ist. Ich ertappte mich dabei, dass ich mich fragte: »Kann meine Identität irgendwie über meine Genesungsfähigkeit entscheiden?« Die Antwort darauf ist sowohl komplex als auch aufschlussreich.
Ich werde hier immer wieder ausführlich von Menschen berichten, die unheilbare Krankheiten überlebten und mir auf meiner Suche nach Antworten Einblick in ihre Krankenakten und ihr Leben gewährten. Ich versuche, die Vielfalt und die Einzigartigkeit ihrer Geschichten einzufangen, denn ich glaube, dass nicht nur die Gemeinsamkeiten, sondern auch die Unterschiede Licht auf die Geheimnisse der Spontanheilung werfen. Oder wie der berühmte Psychologe Carl Rogers sagte: »Das Persönlichste ist das Allgemeinste.«3
Diese Fälle lehren uns, dass wir körperlich wie geistig eine heilungsfördernde biologische Umgebung schaffen müssen. Denn der Körper will gesund werden. Und es gehört viel mehr dazu, diese Voraussetzungen zu schaffen, als man uns lehrt. Ich möchte Sie an diesem Prozess teilhaben lassen und Sie auf eine Reise mitnehmen, auf der ich diese Fälle nacheinander untersuche, mich mit der bahnbrechenden neuen Wissenschaft von Körper und Geist auseinandersetze und dem von diesen Geschichten beleuchteten Weg zur Heilung folge. Diese Reise führte mich letztlich zu einem neuen Modell der Medizin, das auf den »vier Säulen der Gesundheit« ruht, wie ich sie inzwischen nenne: der Heilung des Immunsystems, der Heilung der Ernährung, der Heilung der Stressreaktion und der Heilung der Identität.
Die Entwicklung auf diesem Forschungsgebiet ist noch lange nicht abgeschlossen, und ich weiß längst nicht alles. Aber ich habe ein paar vorläufige Antworten und viele wichtige Fragen, und beides hat mich dem Verständnis für das, was hinter diesen medizinischen »Wundern« stecken könnte, ein großes Stück näher gebracht. Das Wörtchen »Wunder« dient sehr oft als Sammelbegriff für Dinge, die wir nicht erklären können. Aber sogar Wunder haben ihre Erklärung – wir kennen sie nur noch nicht. Bisweilen scheuen wir Erklärungsversuche, weil wir glauben, wenn wir den wahren Mechanismus aufdecken, würde dies das »Wunder« irgendwie kleiner machen, es irgendwie schmälern. Doch überraschende Entwicklungen dieser Art verlieren für mich nichts von ihrem Zauber, wenn ich weiß, wie sie funktionieren. Sie erscheinen mir sogar noch wunderbarer, wenn ich den Deckel öffnen, hineinsehen und den Mechanismus hinter einem bislang rätselhaften Phänomen betrachten kann, kunstvoll wie ein Uhrwerk.
Ich habe mir vor langer Zeit geschworen, nur zu schreiben, wenn ich etwas zu sagen hatte, das unbedingt gesagt werden musste. Der Philosoph Søren Kierkegaard beschrieb eindringlich, was der Lärm und das Getöse des modernen Lebens für den Einzelnen bedeuten. Anders als andere Autoren wollte er weder eine weitere noch die lauteste Stimme unter vielen in der Öffentlichkeit sein. Er wollte vielmehr etwas wegnehmen, damit die Leserinnen und Leser die Wahrheit, die sie benötigten, finden und wieder zu leben beginnen konnten.
Ich hoffe, dieses Buch wird das Gleiche tun. Ich melde mich nun ebenfalls zu Wort, weil ich glaube, dass wir dringend über diese Fälle sprechen müssen. Die Geschichten in diesem Buch lüften den Vorhang und zeigen, dass wir schon einiges über die Dinge wissen, die das Leben gesund, lebendig und sogar wunderbar machen. Sie zeigen aber auch, dass wir sie vergessen haben. Es gibt nur eine Möglichkeit, dieses Wissen wiederzufinden: Wir müssen sowohl den inneren als auch den äußeren Lärm und die Meinungen zum Verstummen bringen und zu einer unverfälschteren, wahreren Basis zurückkehren – der verschütteten, aber unauslöschlichen Flamme des Wissens, die in jedem Menschen brennt.
Es ist eine neue Wissenschaft, und wir werden in den kommenden Jahrzehnten noch viel mehr dazu in Erfahrung bringen. Doch die aktuellen Forschungen und das Potenzial, das sie für Millionen von Menschen bergen, sind zu wichtig, um sie einem breiteren Publikum vorzuenthalten.
Ich habe die große Hoffnung, dass das vorliegende Buch all jenen einen klaren Weg zur Heilung aufzeigen wird, die mit chronischen oder gar unheilbaren Krankheiten ringen, die einen Menschen lieben, der davon betroffen ist, oder einfach so gesund und vital wie möglich leben möchten.
Die moderne Medizin erklärt für gewöhnlich, wie die Situation ist und womit Sie künftig leben müssen, aber sie hilft Ihnen nicht zu verstehen, was möglich ist oder was sein könnte. Unabhängig davon, ob die Diagnose auf Diabetes, eine Herzerkrankung, Depressionen, Krebs, eine Autoimmunerkrankung oder etwas anderes lautet, gibt man Ihnen vielleicht weder die nötige Hoffnung noch das nötige Handwerkszeug, damit Sie wieder ganz gesund werden können. Wir müssen das Außergewöhnliche auf den Operationstisch legen, um es zu sezieren und daraus zu lernen und die außergewöhnlichen Möglichkeiten, die in jedem von uns stecken, für alle sichtbar zu machen.
Heute lebt Claire auf Hawaii – wie sie es geplant hatte, bevor sie krank geworden war.
»Nach der Diagnose dachte ich nicht, dass ich es schaffen würde«, sagt sie. »Aber wir liegen genau im Zeitplan.«
Sie lebt auf O’ahu mit ihrem Mann, ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn, die beide Musiker sind. Die Abende verbringt sie auf ihrem Lanai – einer Art offenen, überdachten Veranda, wie man sie auf Hawaii überall findet – und genießt die Aussicht. Sie kann die Lichter von Honolulu sehen und den Himmel, der sich mit dem Wetter verändert. Vor Kurzem zog ein Hurrikan durch, der großen Schaden anzurichten drohte. Doch es wurde lange nicht so schlimm wie befürchtet. Ich musste daran denken, dass auch der Krebs ihre Welt wie ein verheerender Wirbelsturm zu zerstören drohte.
»Wir wurden ein wenig durchgerüttelt, aber es geht uns gut«, erzählt sie über den jüngsten Sturm. »Wir hatten Glück. Er ist vorübergezogen.«
Was können wir tun, damit der Sturm an uns vorüberzieht? Die Antwort ist nicht einfach, und dies ist kein Buch für Menschen, die einfache Antworten suchen. Es erzählt von einer langen Reise zur Erkundung der Geheimnisse der Spontanremission – die vielleicht auch die Geheimnisse dauerhafter Gesundheit und Vitalität in sich bergen. Die Arbeit hielt keine einfachen Lösungen für mich bereit. Jedes Mal, wenn ich auf der Suche nach Antworten einen Stein umdrehte, schien eine weitere Frage darunter zum Vorschein zu kommen. Ich musste mir ins Gedächtnis rufen, dass das Ziel nicht darin bestand, sofort Schlussfolgerungen zu ziehen, wenn ich auf eine vermeintliche »Antwort« stieß. Sondern dass es darin bestand, bessere Fragen zu stellen. Und die erste Frage lautete: Was ging in Brasilien wirklich vor?
Teil 1 Unglaubliche Immunität
1 Sprung ins Unmögliche
Ich glaube, bei der Erforschung der Natur täuscht nichts mehr als die unverrückbare Überzeugung, dass gewisse Phänomene unmöglich sind.
William James
Meine allererste selbstständige Operation war eine Beinamputation. Es war 2 Uhr morgens, und ich war bereits seit Stunden auf Station. Ich wurde angepiept, dass ich in den Operationssaal (OP) kommen sollte, und über den Patienten informiert. Es war ein älterer Herr, der mit extrem starken Schmerzen im linken Bein ins Krankenhaus gekommen war. Als die Schwestern ihn untersuchten, entdeckten sie mehrere Gangränen am Unterschenkel und am Fuß. Ein fortgeschrittener, schlecht eingestellter Diabetes kann wie in diesem Fall zu schweren Durchblutungsstörungen führen, sodass die Gliedmaßen schlechter versorgt werden. Als der Mann mitten in der Nacht in die Notaufnahme kam, hatte er bereits umfangreiche Gewebeschäden und eine gefährliche Infektion. Das Bein war nicht zu retten.
Ich wusch mir die vorgeschriebenen fünf Minuten Hände und Arme, schrubbte zwischen den Fingern und bis zu den Ellenbogen hinauf. Ich hielt die Arme nach oben, damit sie an der Luft trocknen konnten, und schob mich mit dem Rücken voraus durch die Tür zum OP-Vorraum. Die chirurgisch-technische Assistentin streifte mir den Operationskittel über, legte mir den Mundschutz an und streckte ihre Arme, um mir die Haube aufzusetzen, aber sie waren nicht lang genug. Ich bin ziemlich groß. Sie stellte sich genau in dem Augenblick auf die Zehenspitzen, als ich versuchte, ein wenig in die Knie zu gehen. Wir mussten beide lachen, und ich merkte, wie nervös ich eigentlich war. Ich war Assistenzarzt, frisch von der Universität, und trug zum ersten Mal die Verantwortung im OP.
Meine nervöse Anspannung legte sich beim ersten Schnitt. Als ich mit dem Skalpell einmal sauber um das Bein fuhr und eine tiefe, dünne Linie hinterließ, überkam mich eine Art meditative Ruhe, ein Gefühl von höchster, vollkommener Konzentration. Ich weiß nicht genau, wie viele Minuten vergingen, während ich einen Schnitt nach dem anderen machte und die Wunde immer wieder kauterisierte, um die Blutung zu stoppen und dafür zu sorgen, dass die Operationsstelle sauber und übersichtlich blieb. Nie werde ich den Geruch von versengtem Fleisch oder das Geräusch der Knochensäge vergessen, als ich das Schienbein durchtrennte. Es erinnerte mich ein wenig an die Kettensägen, mit denen ich als junger Bursche auf der Farm gearbeitet hatte. Aber sie hatten rau und kratzig geklungen, und dieses Geräusch war zarter, feiner und auch schrecklicher. Irgendwie empfand ich den Augenblick als unwirklich: Ich konnte nicht glauben, dass wirklich ich im Operationskittel und hinter dem Mundschutz steckte. Es war so unwahrscheinlich, dass ich einmal hier landen würde.
Als Jugendlicher war ich furchtbar still. Vielleicht war ich auch deshalb so schüchtern, weil ich in einer fundamentalistischen Familie aufwuchs und nie das Gefühl hatte dazuzugehören. In der Highschool wurde ich zum »schüchternsten Jungen« gewählt. In meinen selbst genähten Kleidern fühlte ich mich immer fehl am Platz, wenn ich aus dem Schulbus stieg und nach Hause ging, was sich wie eine Reise in die Vergangenheit anfühlte. Radio und Fernsehen waren verboten, und damals empfand ich die Welt als sehr eng. Alle Erwachsenen, die ich kannte, arbeiteten auf einer Farm oder hatten gelegentlich eine andere körperliche Arbeit. Meine Mutter hatte eine Teilzeitstelle als Krankenschwester in einem lutherischen Krankenhaus in Fort Wayne, und als ich siebzehn wurde, empfahl sie mir, mich dort als Pflegehelfer zu bewerben. Ich war groß und stark – ich war es gewohnt, schwere Heuballen und Eimer mit Wasser oder Getreide zu schleppen – und konnte spielend einen erwachsenen Mann auf eine Transportliege heben oder eine Patientin in den Rollstuhl setzen.
In diesem Job lernte ich das gesamte Spektrum menschlicher Erfahrung kennen. Ich schob Mütter mit ihren Neugeborenen im Arm auf den Gehweg hinaus. Ich setzte Patienten auf Bettpfannen und trug den Abfall hinaus. Ich sammelte die Wäsche ein. Ich wischte nach einer schwierigen Operation das Blut vom Boden. Ich sah, wie einem krebskranken Jungen die Haare ausgingen und er ein paar Monate später das Krankenhaus verließ, mit neuem Flaum auf dem Kopf und einem Strauß Luftballons in der kleinen Hand. Ich half den Schwestern, Patienten auf die Seite zu rollen, und hielt sie in den Armen, während sie gewaschen und verbunden wurden. Ich schob Tote in die Leichenhalle, das Laken übers Gesicht gezogen.
Dabei lernte ich die Schwestern und Pfleger besser kennen als die Ärzte. Sie waren diejenigen, die immer da, immer am Bett der Patienten waren. Sie halfen mir und brachten mir bei, wie man Blut abnimmt, Patienten an die Geräte anschließt und ein EKG macht.
»Du kannst gut mit Patienten umgehen«, sagten sie. »Du solltest Arzt werden.«
Der Gedanke war überraschend und landete wie ein Same im fruchtbaren Boden meines Gehirns, wo er keimte und wuchs. Es war mir nie in den Sinn gekommen, dass eine solche Zukunft möglich war.
Und nun stand ich hier und operierte in einem OP, der genauso aussah wie damals, als ich die Patienten abgeholt hatte, wenn die Chirurgen fertig waren und Mundschutz und Hauben auf den Boden warfen.
Bei einer Amputation muss der Muskel den Knochenrand so weit überlappen, dass man einen Stummel formen kann, der später gut und im Idealfall schmerzfrei in eine Beinprothese passt. Als ich mit der langen gebogenen Nadel die Stiche setzte, bemühte ich mich, den Schenkel entsprechend zu formen, obwohl ich bezweifelte, dass dieser Mann je wieder aus dem Rollstuhl herauskommen und eine Prothese bekommen würde. Die Operation war gut verlaufen, aber ich machte mir Sorgen um ihn. Er war alt und krank. Das Insulin, das er beinah sein ganzes Leben lang genommen hatte, ließ ihn im Stich, und sein Körper schaltete allmählich ab – Glied für Glied. Ich fragte mich, ob wir schon vor langer Zeit mehr für ihn hätten tun können, um ihn auf einen anderen Weg zu bringen.
Ich war Arzt geworden, weil ich dachte, ich könnte Menschen helfen. Ich hatte mir ausgemalt, dass ich meinen Patientinnen und Patienten zu einem gesünderen – einem besseren – Leben verhelfen würde. Doch oft war das, was wir Ärzte taten, zu wenig und kam zu spät. Ich sah meine Kolleginnen und Kollegen rund um die Uhr arbeiten und von einem Patienten zum nächsten eilen. Es lag nicht an mangelndem Einsatz oder Engagement, dass es uns oft schwerfiel, Menschen bei ihrer Genesung zu helfen. Wir arbeiteten immer mit einem so kleinen Ausschnitt der Geschichte, dass uns der größere Zusammenhang entging und wir die Symptome, nicht die dahinterliegenden Krankheitsursachen behandelten. Tag für Tag sah ich Menschen, die an echten Erkrankungen litten und echte Lösungen brauchten.
Noch Jahre später dachte ich an meine erste Operation und an diesen Mann, der an Diabetes erkrankt war, lange bevor er in meinem Operationssaal aufgetaucht war. Die Krankheit hatte eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt, aus der er sich nicht hatte befreien können. Ich dachte auch daran, dass die unerforschten Fälle von Spontanremission vielleicht genau die Hinweise enthielten, die wir brauchten, um Menschen wie ihm zu helfen, bevor es zu spät war. Also buchte ich im Jahr 2003 einen Flug nach Brasilien.
Sektion eines »Wunders«
Als ich in der brasilianischen Hauptstadt Brasília aus dem Flugzeug stieg, war die Luft warm und weich wie Badewasser. Es war März und Spätsommer auf der Südhalbkugel. Ich hatte das Gefühl, dass die Sonne tief in meine Knochen drang, und allmählich schwand die Kälte des Winters in Boston, die ich zurückgelassen hatte. Vielleicht ist diese Reise doch keine so schlechte Idee, dachte ich. Aber ich hatte immer noch Zweifel.
Als ich die Entscheidung getroffen hatte, Berichten von »wundersamen« Heilungen in einigen brasilianischen Heilzentren nachzugehen, hatte ich keine Ahnung, worauf ich mich da einließ. Ich dachte, dass ich für eine Woche hinfliegen, Nachforschungen anstellen und die Fragen klären würde, die mich umtrieben, nämlich ob diese Behauptungen irgendwie berechtigt waren. Heute ist es mir peinlich, dies zuzugeben, aber im Grunde hatte ich bereits abschlägig entschieden. Ich war mir sicher, dass ich nur an der Oberfläche kratzen musste, und schon würde der glänzende Anstrich von »Wunderheilungen« abblättern und der Betrug dahinter zum Vorschein kommen. Eine kurze Reise, ein reines Gewissen, und anschließend würde ich mit meinem Leben und meiner Karriere weitermachen und mir nicht mehr den Kopf über Spontanheilungen zerbrechen und darüber, ob da irgendetwas dran war.
Im Jahr davor hatte ich immer wieder Berichte über die plötzliche Heilung unheilbarer Krankheiten aus Brasilien und anderswo gehört. Nikki hatte den Anfang gemacht, und dann wurden es schnell mehr. Aus allen Ecken der Vereinigten Staaten riefen Menschen an, die mir unbedingt ihre Genesungsgeschichten erzählen wollten. Nachdem ich weitere Nachforschungen abgelehnt hatte, bat Nikki ihre neuen Freundinnen und Freunde aus Brasilien, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Es hatte sich schnell herumgesprochen, dass ich das Phänomen der Spontanheilung erforschte. Einige der Fälle, die mir dabei zu Ohren kamen, schienen unglaublich. Aber die Menschen waren sehr offen. Sie tippten ihre Geschichten in den Computer und schickten sie per E-Mail. Sie hängten Röntgenaufnahmen, MRT-Bilder und Krankenakten mit den krakeligen Randnotizen ihrer Ärzte an.
In einigen Fällen reichten die Beweise einfach nicht aus, um die Behauptung einer Spontanheilung zu erhärten, oder die ursprüngliche Diagnose erschien mir wackelig. Andere wirkten vielversprechend, doch der Zeitraum war zu kurz – es konnte sich auch um Fälle von vorübergehender Remission handeln, um einen kurzen Aufschub während eines letztlich tödlichen Verlaufs. In wieder anderen sehnten sich die Menschen derart verzweifelt nach Heilung, dass sie trotz des Fortschreitens der Erkrankung glaubten, geheilt zu sein. Es tat mir unendlich leid für sie. Ich verstand ihren Wunsch nach Besserung; sie sehnten sich so sehr danach, dass sie sich einredeten, geheilt zu sein. Was nicht hieß, dass dies wirklich so war. Wenn Menschen anriefen oder E-Mails schickten, um ihre Geschichte zu erzählen, hörte ich zu. Mehr nicht. Die Last meiner Verantwortung in den Bereichen Verwaltung, Medizin und Lehre hatte sich wie ein Joch auf meine Schultern gelegt. Es war nicht der richtige Zeitpunkt, um Hirngespinsten nachzujagen und mich auf die Suche nach einem Phänomen zu machen, das sich nur schwer definieren ließ und sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wie eine Fata Morgana, wie ein moderner Jungbrunnen in Luft auflösen würde.
»Sie haben die richtige Ausbildung und die richtige Perspektive«, beharrte Nikki und bezog sich damit auf die Kombination aus meiner medizinischen Ausbildung und meinem theologischen Abschluss. Sie war der Ansicht, ich hätte die optimalen Voraussetzungen für eine unvoreingenommene Untersuchung des Phänomens spontaner Heilung. Und die Berichte waren fesselnd: Tumoren schmolzen wie Eiswürfel; Lahme erhoben sich zum Gehen; Sterbenskranke waren noch jahrelang gesund und munter, obwohl sie längst hätten tot sein müssen. Doch es waren nur Geschichten – es gab keine Beweise, zumindest noch nicht. Es beunruhigte mich, dass ich diesen Sprung wagen, dabei meine Karriere und meinen Ruf aufs Spiel setzen und keine stichhaltigen Beweise für irgendeine dieser Behauptungen finden würde.
Aber konnte ich einem Thema, bei dem es sich möglicherweise um ein noch gänzlich unerschlossenes Forschungs- und Studiengebiet handelte, weiterhin den Rücken zukehren? Von einigen der eingehenden Fälle konnte ich mich nur schwer abwenden. Diese Menschen hatten echte Beweise für Diagnose und Remission. Bei der Prüfung ihrer Krankenakten fand ich keine Erklärung. Was, wenn hier tatsächlich etwas vor sich ging – etwas, vor dem die moderne Medizin die Augen verschloss?
Nachdem ich erkannt hatte, wie fehlerhaft die Daten zur Häufigkeit von Spontanheilungen waren, weitete ich meine Recherchen aus. Abend für Abend ertappte ich mich dabei, wie ich mich nach der Visite an den Computer setzte, durch Zeitschriftenartikel klickte, den Begriff »Spontanremission« in medizinische Datenbanken eingab und der Spur der Brotkrumen folgte, wohin sie mich führte. Ich war erschüttert davon, wie viel ich darüber fand.
Beispiele für Spontanremissionen bei unheilbaren Krankheiten waren überall. Sie waren nur schwer zu erkennen. Da sie als »Ausreißer« galten, wurden sie in Diskussionen über Krankheitsverläufe und Behandlungsmöglichkeiten üblicherweise nicht erwähnt. Beim Sammeln und Zusammenfassen der Daten gingen Fälle von unerwarteter Heilung, die wie Glücksfälle oder Fehler in einem Diagramm aus Datenpunkten aussahen, in der Masse der Mittelwerte unter. Die Wissenschaft der Medizin basiert auf dem Durchschnitt – auf dem, was normalerweise geschieht und was die Durchschnittsperson tut. Wenn ich dagegen gezielt nach Fällen von Spontanremission suchte, hatte es den Anschein, als würde ich überall fündig. Sie waren die ganze Zeit vor meiner Nase gewesen, und ich hatte sie doch nicht gesehen.
Als ich vor langer Zeit beschlossen hatte, mein Leben in ländlicher Abgeschiedenheit aufzugeben und nach höherer Bildung zu streben, hatte ich mir geschworen, der Wahrheit zu folgen, wohin sie mich führte. In der Wissenschaft muss man dorthin gehen, wohin man manchmal nicht gehen will – selbst wenn es politisch unangenehm ist. Es wurde Zeit, die Fragen zu stellen, die in der Medizin sonst niemand stellte, nämlich wie diese Fälle von Spontanremission zustande kamen. Es war meine Verantwortung, diesen Fragen nachzugehen, auch wenn meine Nachforschungen die Behauptungen widerlegten. Immer wieder musste ich an meinen Mentor an der Princeton University und an sein Mantra denken: »Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deiner Antwort.« Wie konnten wir eine Antwort finden, wenn wir gar nicht erst fragten?
Die Taxifahrt vom Flughafen zum ersten von mehreren »spirituellen« Zentren sollte eineinhalb Stunden dauern. Als wir die Randbezirke von Brasília hinter uns ließen, wurde die Landschaft weit und verwandelte sich in sanfte grüne Hügel. Ich versuchte, mich abzulenken und die Aussicht zu genießen, aber Fragen und Zweifel schwirrten mir durch den Kopf. Würde sich die ganze Sache als Fehler entpuppen? Ich musste mich daran erinnern, aufgeschlossen zu bleiben. Ich war bereit, endlich Fragen zu stellen, aber diese Fragen mussten auch zu etwas führen.
Die brasilianischen Heilzentren waren in Kleinstädten auf dem Land versteckt. Sie zeigten mir die tiefe Spiritualität der Brasilianerinnen und Brasilianer. Ihre Kultur ist ganz anders als meine. Ihre Weltanschauung akzeptiert, dass ein Heiler mit Geistern oder der Energie einer anderen Ebene kommunizieren und sie übermitteln (channeln) kann – einer unsichtbaren Welt, die realer und wichtiger ist als die Welt, die wir sehen und anfassen können. Sie halten die materielle Welt für den schwachen Schatten dieser tieferen und wahrhaftigeren Welt. Ihrer Auffassung nach haben Qualitäten, die sich nicht beschreiben lassen, wie die Liebe und die menschliche Seele eine enorme Kraft, besonders im Hinblick auf Krankheit und Heilung: Krankheiten nehmen in der Seele ihren Anfang; wird die Seele geheilt, passt sich der physische Körper an diese neue Realität an.
Aus dem ganzen Land strömten die Menschen scharenweise in diese Zentren. Mitunter verkauften sie sogar einen Teil ihres Besitzes, um sich die Reise leisten zu können. Das Zentrum, das im Mittelpunkt meiner eigenen Reise stand, war die Casa de Dom Inácio Loyola in Abadiânia. Der Ort unterschied sich ein wenig von den anderen, da er Menschen aus aller Welt anzog. Aus diesem Personenkreis kamen besonders viele Berichte über Remissionen, und zumindest einige der Fälle, die ich vor meiner Abreise auf Herz und Nieren geprüft hatte, erschienen mir interessant genug, um ihnen nachzugehen. Außerdem war dies der Ort, den unter die Lupe zu nehmen mich Nikki gebeten hatte.
Bei meiner Ankunft ließ ich die Umgebung der Casa auf mich wirken – einer Villa mit vielen offenen Räumen, die von grünen Hügeln umgeben war. Es gab Orte zum Meditieren und Beten, Gärten, durch die sich viele kleine Wege schlängelten, Bänke im Schatten von Palisanderbäumen. Ein solcher Ort, der sich so ganz anders anfühlte als der Alltag mit seiner Last und seinen Sorgen, konnte durchaus einen gewissen körperlichen und geistigen Neustart begünstigen – und vielleicht auch dazu beitragen, Kraftreserven für den Kampf gegen bestimmte körperliche wie geistige Erkrankungen und Leiden zu entdecken. Selbst ich spürte, wie meine Sorgen schwanden, wie sich der Stress und die Angst, die ich aus Boston mitgebracht hatte, unter der warmen Sonne und in der sanften Brise Abadiânias verflüchtigten. Aber selbstverständlich heilt ein Urlaub keine unheilbaren Krankheiten. Wenn die Berichte, die mir zu Ohren gekommen waren, der Wahrheit entsprachen, musste mehr dahinterstecken.
Bei unserer ersten Begegnung saß der Heiler João Teixeira de Faria, auch bekannt als John of God, dem so viele Besucher ihre Genesung zuschrieben, in einem großen Sessel jenseits eines Meers von Meditierenden. Er hatte schütteres dunkles Haar, eine Brille und war ganz in Weiß gekleidet. Die Menschen warteten in einer langen Schlange darauf, von ihm empfangen zu werden, kurz vor ihn zu treten und in Sekundenschnelle Diagnose und Verordnung zu erhalten, um anschließend zur Meditation zurückzukehren. Ich schüttelte ihm die Hand in dem Bewusstsein, dass ihn die einen für einen Wundertäter, die anderen für einen Betrüger hielten (später sollten auch noch weitere Anschuldigungen laut werden).
Meine Skepsis gegenüber Faria war berechtigt. Ich wusste, dass er behauptete, »spirituelle Operationen« vorzunehmen, und obwohl die Behandlungen ebenso kostenlos waren wie das tägliche Mittagessen, verdiente sein Heilzentrum unter anderem an einer hauseigenen Kräutermischung. Und immer dann, wenn einem Menschen oder einem Ort »Wunderheilungen« zugeschrieben werden, schrillen bei mir die Alarmglocken. Vor vielen Hundert Jahren behaupteten Menschen, das heilige Wasser im französischen Lourdes habe sie geheilt. Doch ein zur Prüfung dieser Behauptungen einberufener Ausschuss konnte keine statistisch bedeutsamen Zusammenhänge zwischen Wasser und Genesungen feststellen. Wäre es mir damals möglich gewesen, die Heilungen in Lourdes zu untersuchen, hätte meine Aufmerksamkeit nicht dem Quellwasser gegolten, sondern den Menschen, denen Heilung widerfuhr. Auch in Abadiânia interessierte mich vor allem die Gemeinschaft der Menschen. Es handelte sich um eine einzigartige Population mit einer hohen Dichte an Remissionsberichten.
Insgeheim zog ich eine klare Grenze: Ich würde mich ausschließlich mit Fällen beschäftigen, bei denen unstrittig medizinische Beweise vorlagen, dass etwas Unerklärliches geschehen war.4
Einer der Ersten, mit denen ich sprach, war Juan. Er war ein lebhafter älterer Herr in den Achtzigern und kam jedes Jahr mit seiner Familie in die Casa. Er lebte als Sojabauer in einer anderen ländlichen Region Brasiliens, und seine sonnengebräunten Hände, wie abgegriffenes und glatt poliertes Holz, zeugten von der jahrelangen Arbeit auf den Feldern. Jahrzehnte zuvor hatte eine Biopsie ergeben, dass er an einem Glioblastom (Glioblastoma multiforme) litt, einem schnell wachsenden tödlichen Hirntumor. Das Glioblastom gehört nicht zu den Arten von Krebs, die man überlebt: Fünf Jahre nach der Diagnose leben nur noch 2 bis 5 Prozent der Patienten. Danach geht auch dieser geringe Prozentsatz schnell gegen null. Bei einem Glioblastom gibt es keine Heilung. Es erfolgt eine palliative Behandlung in der Absicht, den Patienten das Leben zu erleichtern und es – so weit wie möglich – ein wenig zu verlängern. Dennoch sitzt mir Juan Jahrzehnte nach seiner Diagnose gegenüber. Er ist ungewöhnlich gesund für sein Alter und strahlt eine stille, meditative Ruhe aus.
Ich fragte ihn, worauf er seine eigentlich unmögliche Genesung zurückführte. Er breitete die Arme aus und zuckte mit den Schultern. Wer konnte das schon wissen? Er sagte, nach der Diagnose habe er damit begonnen, in die Casa zu fahren. Seither komme er jedes Jahr, um im Energieraum zu sitzen und zu meditieren. Er betrachtete es als eine Art Jahresinspektion wie einen Ölwechsel für ein Auto.
»Haben Sie nach der Diagnose etwas in Ihrem Leben verändert?«, wollte ich von ihm wissen.





























