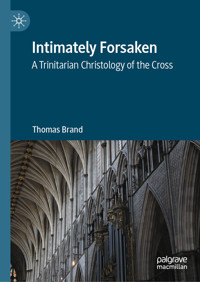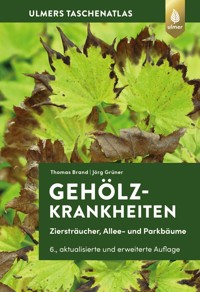
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Eugen Ulmer
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Der Taschenatlas „Gehölzkrankheiten“ stellt Ihnen die häufigsten und auffälligsten Schadbilder an insgesamt 61 Gehölzgattungen vor und beschreibt diese ausführlich in Wort und Bild. Durch ein breit angelegtes Merkmalsspektrum haben Sie die Möglichkeit Krankheiten, Schädlingsbefall sowie abiotische Schädigungen an Ihren Gehölzen sicher zu erkennen. Ergänzt wird der Text durch Hinweise zur Vorbeugung und Bekämpfung der jeweiligen Schadursache. Besonders aktuell ist dieses Buch auch durch die Aufnahme in der Praxis auftretender gebietsfremder Schadorganismen, von denen einige bereits die Existenz unserer heimischen Baumarten bedrohen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Thomas Brand | Jörg Grüner
GEHÖLZ-KRANKHEITEN
Ziersträucher, Allee- und Parkbäume
6., aktualisierte und erweiterte Auflage
644 Farbfotos 3 Sporentafeln 1 Zeichnung
Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) mit gleichzeitiger Infektion durch Cryptostroma corticale (Rußrindenkrankheit) mit dunklem Sporenrasen unter der Rinde (links) und Stegonsporium pyriforme mit dunklen Flecken auf und hellem Holz unter der Rinde (rechts)
Inhalt
Einleitung
Schadursachen und Pflanzenschutz
Erklärung von Fachbegriffen und Abkürzungen
Beschreibung und Abbildung von Schadsymptomen bei Gehölzen
Abies
Acer
Aesculus
Alnus
Amelanchier
Berberis
Betula
Buxus
Carpinus
Castanea
Catalpa
Cedrus
Cercis
Chamaecyparis
Cornus
Corylus
Cotoneaster
Crataegus
Euonymus
Fagus
Forsythia
Frangula
Fraxinus
Gleditsia
Hedera
Ilex
Juglans
Juniperus
Laburnum
Ligustrum
Lonicera
Magnolia
Mahonia
Malus
Photinia
Picea
Pieris
Pinus
Platanus
Populus
Prunus
Pyracantha
Pyrus
Quercus
Rhododendron
Ribes
Robinia
Rosa
Salix
Sambucus
Sequoiadendron
Sorbus
Symphoricarpos
Syringa
Taxus
Thuja
Tilia
Tsuga
Ulmus
Viburnum
Wisteria
Sporentafel I, II und III
Anschriften der Pflanzenschutzdienste
Bildquellen
Literatur
Einleitung
Die mittlerweile 6. Auflage dieses Werks, vormals „Farbatlas Gehölzkrankheiten“, folgt dem bewährten Grundgedanken, häufige und auffällige abiotische oder biotische Schadursachen an Gehölzen im öffentlichen Grün sowie in Gärten mit prägnanten Texten und charakteristischen Bildern vorzustellen.
Seit der 5. Auflage (2017) erlebten wir in großen Teilen Mitteleuropas Dürrejahre bislang nicht gekannten Ausmaßes. Weder die Häufung der Trockenphasen, deren Dauer noch die Extreme waren bisher typisch für unsere Weltregion. Die ungenügenden Niederschlagsmengen bei oft gleichzeitig hohen Temperaturen sowie lokal katastrophal auftretende Unwetter machten vielen die Abhängigkeit von Wetter und Klima begreiflicher. Auch die Gehölze in unserem Umfeld sind davon betroffen: Einerseits wirken Wassermangel, Hitze, Sturm und Überschwemmung als direkte Stressfaktoren auf sie ein, andererseits werden einige Schaderreger gefördert. Die Borkenkäfer sind hierbei nur das bekannteste Beispiel trockenstressgeförderter Krankheiten und Schädlinge. Dieser Entwicklung versuchen wir mit der Aufnahme solcher Beispiele in dieses Buch Rechnung zu tragen.
Selbstverständlich bleiben die bekannten Schadursachen und neu auftretende, invasive Arten relevant. Auf Basis der im Wesentlichen von den ehemaligen Autoren Prof. Dr. Franz Nienhaus, Prof. Dr. Bernd Böhmer sowie Prof. Dr. Heinz Butin erarbeiteten früheren Auflagen erfolgte die inhaltliche Überarbeitung mit dem Ziel, die aktuell bedeutendsten Gehölzkrankheiten und -schädlinge darzustellen. Für 61 in Gärten und im öffentlichen Grün verwendete Gehölzgattungen werden zunächst kurz die wichtigsten Schadursachen angesprochen, jeweils mit Verweis auf weitere Information, entweder im vorliegenden Buch (Abb.) oder in der Literatur (LIT). Darauf folgt für jede aufgenommene Gehölzgattung eine reich bebilderte Zusammenstellung ausgewählter Schadursachen, zu denen charakteristische Erkennungsmerkmale (EM), Verwechslungsmöglichkeiten (VM) und die je nach Notwendigkeit sinnvollen Gegenmaßnahmen (GM) angegeben werden. Zusätzlich wird bei einzelnen Schadursachen auf weiterführende Literatur verwiesen (LIT). Zwar geben die gewählten Bilder und prägnanten Texte meist ausreichend Hinweise, jedoch können sie grundsätzlich die fundierte Diagnose und Beratung versierter Fachleute, beispielsweise bei den amtlichen Pflanzenschutzdienststellen (PSD), nicht ersetzen. Denn nur wenn die Ursachen der Schädigung bekannt sind, lassen sich auch die geeigneten Maßnahmen treffen. Die in diesem Buch genannten Gegenmaßnahmen (GM) beziehen sich auf den Privatgarten und das öffentliche Grün. In Baumschulen, in denen die Gehölze herangezogen werden, sind oftmals weitergehende Gegenmaßnahmen notwendig und sinnvoll.
Ihnen, den Nutzern des Taschenatlas Gehölzkrankheiten, wünschen wir viel Erfolg!
Rastede, Freiburg
Herbst 2023
Die Verfasser
Schadursachen und Pflanzenschutz
Gehölze sind vielfachen Einflüssen ausgesetzt, die negativ auf die Lebensvorgänge einwirken und Schäden verursachen können.
Zum einen sind es ungünstige Umweltbedingungen, sogenannte abiotische Schadursachen, die Gehölze schädigen: Mangel oder Überschuss der lebensnotwendigen Wachstumsfaktoren Wasser, Licht, Wärme, Nährstoffe und Luft, aber auch mechanische Überlastung oder Einwirken von Schadstoffen. Zum anderen sind Pflanzen Nahrung und Lebensraum für verschiedene Organismen: Krankheitserreger wie Viren, Bakterien und Pilze parasitieren auf Gehölzen ebenso wie verschiedenste tierische Schädlinge. Nicht alle Schaderreger sind dabei so aggressiv, dass der Wirt gefährdet ist. Manche werden nur unter bestimmten Umweltbedingungen aktiv und der Schaden an der Pflanze relevant. Viele Krankheitserreger und Schädlinge sind Nutznießer von Vorschädigungen (Sekundär- oder Schwächeerreger). Sie vermögen nur über Wunden einzudringen oder geschwächte Pflanzen zu befallen. Um negative Einflüsse abiotischer Schadursachen, Krankheitserreger und Schädlinge möglichst gering zu halten, werden Pflanzenschutzmaßnahmen ergriffen. Nach der Definition im Pflanzenschutzgesetz (Gesetz zur Neuordnung des Pflanzenschutzrechts vom 6. Februar 2012) ist der Integrierte Pflanzenschutz „eine Kombination von Verfahren, bei denen unter vorrangiger Berücksichtigung biologischer, biotechnischer, pflanzenzüchterischer sowie anbau- und kulturtechnischer Maßnahmen die Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel auf das notwendige Maß beschränkt wird.“ Die indirekten Maßnahmen der Vorbeugung bilden die Basis. Durch die Auswahl für einen Standort geeigneter Gehölze sowie weniger anfälliger (widerstandsfähiger, toleranter, resistenter) Arten und Sorten werden etliche Probleme schon vor der Pflanzung verhindert. Die Standortvorbereitung ist ebenso wichtig wie die korrekte Pflanzung und artgerechte Pflege, um die gesunde Entwicklung von Bäumen und Sträuchern zu gewährleisten. Hygiene hilft weiter, die Wahrscheinlichkeit eines Befalls zu reduzieren: Nur gesundes Pflanzgut findet Verwendung, befallenes Pflanzenmaterial wird beseitigt, Werkzeug gereinigt und ggf. desinfiziert, Schaderreger werden durch Barrieren von der Pflanze ferngehalten.
Trotz aller vorbeugender Maßnahmen treten Krankheitserreger und Schädlinge auf, denn Pflanzen unterliegen den natürlichen Prozessen, werden von anderen Organismen besiedelt, genutzt und ausgebeutet. Um Gehölzen bei bestehendem Befall zu helfen, sind direkte Maßnahmen der Bekämpfung zu ergreifen.
Biotechnische Methoden nutzen chemische oder physikalische Reize, um tierische Schädlinge anzulocken (z. B. farbige Klebefallen, Pheromonfallen) oder zu vertreiben (Schall, Repellentien).
Der biologische Pflanzenschutz hat eine große Bedeutung erlangt. Förderung, Schonung und Einsatz natürlicher Gegenspieler (Insekten, Spinnentiere, Vögel, Amphibien, Reptilien und Säugetiere) erschweren die Etablierung größerer Schaderregeraufkommen. Eine hohe Biodiversität stabilisiert die Balance zwischen Wirtspflanze und Schaderreger. Durch naturnahe Gestaltung und rücksichtsvolle Pflege der Grünanlagen, lassen sich Rückzugsbereiche, Versteck- und Nistmöglichkeiten, Überwinterungsquartiere sowie Nektarquellen schaffen, die das natürliche Auftreten nützlicher Organismen fördern. Der Einsatz in Massen vermehrter Nützlinge im Freiland ist – mit Ausnahme des Nematodeneinsatzes gegen Dickmaulrüsslerlarven und Engerlinge des Gartenlaubkäfers – von geringer Bedeutung.
Physikalische Maßnahmen erfolgen meist durch mechanisches Entfernen des Befalls. Dadurch wird das Schaderregeraufkommen verringert und die wesentliche Infektionsquelle entfernt. Thermische Bekämpfung mittels Hitze ist an lebenden Pflanzen nur seltendurchführbar.
Wird trotz aller Alternativen die Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel notwendig, muss diese im Rahmen der gesetzlichen Regelungen sachgerecht und umweltschonend erfolgen. Die Anwendungsbestimmungen und Auflagen der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Neben dem Anwenderschutz sind insbesondere der Bienenschutz sowie der Schutz von Grund- und Oberflächenwasser zu betonen. Nur bei angemessenem Umgang mit den Substanzen können vermeidbare Risiken ausgeschlossen werden.
Auskünfte über die Zulassung und Eignung von Pflanzenschutzmitteln für bestimmte Anwendungsgebiete (Indikationen: Pflanze und Schadorganismus) sowie über sinnvolle Alternativen erteilen unter anderem die zuständigen Pflanzenschutzdienste der Bundesländer (S. 282).
Erklärung von Fachbegriffen und Abkürzungen
adult: erwachsen, geschlechtsreif
Aecidien (auch Aecien): meist lebhaft gefärbte, becherförmige oder blasenartige Sporenbehälter der Rostpilze mit Aecidiosporen
apikal: an der Spitze gelegen; scheitelständig
Apothecien (Einz.: Apothecium): schüsselförmige Fruchtkörper der Schlauchpilze (Ascomyceten)
Asci (Einz.: Ascus): schlauch- oder sackförmige Zellen, in denen Ascosporen gebildet werden
Ascomyceten: Pilze mit schlauch- oder sackförmigen Sporenbehältern (Asci), in denen geschlechtliche Sporen (Ascosporen) entstehen
Basidiomyceten: Pilze mit Ständerzellen (Basidien), an deren Oberfläche geschlechtliche Sporen (Basidiosporen) gebildet werden
Braunfäule: Holzzersetzung und -verfärbung durch Pilze, die aus verholzten Zellwänden die Cellulose und Hemicellulose abbauen; Lignin wird nicht abgebaut; brauner, spröder, querrissiger Rückstand (Würfelbruch)
Buchtenfraß: am Blattrand eingefressene Buchten; Fraßbild durch Rüsselkäfer
Chlorose: gelbliche bis grünlich weiße Verfärbung von Blättern oder Nadeln durch Chlorophyllabbau oder verminderte Chlorophyllbildung
Endophyten: Mikroorganismen (Bakterien und Pilze), die in gesundem Pflanzengewebe zunächst symptomlos leben, unter bestimmten Bedingungen jedoch als Schwächeparasiten zur Entstehung von Krankheitssymptomen beitragen
Epiphyten: auf höheren Pflanzen autotroph oder saprobisch lebende Pflanzen oder Mikroorganismen, nicht direkt schädigend
Exuvien: bei der Larvenhäutung abgestreifte Häute von Insekten und Milben
Fensterfraß: Fraß nur auf einer Blattseite, wobei die gegenüberliegende Epidermis als durchsichtige Zellschicht erhalten bleibt
Frosttrocknis: winterlicher Austrocknungsschaden, charakterisiert durch Verbräunen und Absterben besonders von jungen Nadeln oder Trieben bei anhaltend tiefen Temperaturen und gleichzeitig starker Wind- und/oder Sonnenexposition
Gallen: durch Pilze, Bakterien oder tierische Organismen verursachte und gesteuerte, spezifische Gewebewucherungen an Pflanzenorganen (Blätter, Spross, Wurzel)
Hauptfruchtform: Teleomorphe; Pilzfruchtkörper mit geschlechtlich entstandenen Sporen (Gegenteil: Nebenfruchtform)
Hexenbesen: Wuchsanomalien aus besenartigen, dicht stehenden, verkürzten Trieben mit kleineren Blättern oder Nadeln durch vielfachen Austrieb infizierter Seitenknospen
Honigtau: zuckerhaltige Ausscheidung von Pflanzensaugern, die Phloemsaft saugen (z. B. Blattläuse, Schildläuse, Zikaden)
Hyphen: fadenförmige, meist durch Querwände in Zellen geteilte Elemente des Vegetationskörpers von Pilzen (vgl. Mycel)
Imagines (Einz.: Imago): voll ausgebildete, geschlechtsreife Insekten imperfekte Pilze: Fungi imperfecti; Pilze, in deren Entwicklungsgang ein Sexualvorgang (mit Hauptfruchtform) fehlt oder nicht bekannt ist
Infektion: Ansteckung; Eindringen eines Pathogens oder Parasiten in einen Wirt und Etablierung eines dauerhaften oder zeitweisen parasitischen Verhältnisses
Interkostalfelder: Flächen der Blattspreite zwischen größeren Blattadern
invasive Arten: gebietsfremde, vom Menschen eingeschleppte, etablierte Arten (Pflanzen, Pilze, Tiere), die unerwünschte Auswirkungen verursachen
Kahlfraß: Fraßbild, bei dem die Blätter vollständig gefressen werden
Kambium: teilungsfähiges Gewebe bei Gehölzen zwischen Holzgewebe und Rindengewebe; bewirkt das sekundäre Dickungswachstum der Bäume
Kleistothecien (Einz.: Kleistothecium): allseitig geschlossene Fruchtkörper der Schlauchpilze; bei Echten Mehltaupilzen als Chasmothecien bezeichnet
Konidien: ein- oder mehrzellige, ungeschlechtlich entstandene Sporen (Verbreitungsorgane) der Pilze
Krebs/Krebswunde: mehrjährige, meist nicht ausheilende, durch Schaderreger verursachte Holz- und Rindenerkrankung mit periodischen Überwallungsreaktionen
Lochfraß: Fraßbild mit Löchern in der Blattspreite
Makro-/Mikrokonidien: größere bzw. kleinere Konidienform von Pilzen, die gleichzeitig unterschiedliche Konidientypen bilden
Minierfraß: Fraß im Gewebeinneren zwischen oberer und unterer Blattepidermis, wobei schmale Gangminen oder Platzminen entstehen
Moderfäule: Holzzersetzung durch Pilze ähnlich einer Braunfäule, bei der hauptsächlich Cellulose abgebaut, Lignin aber kaum modifiziert wird; das Erscheinungsbild ähnelt jedoch eher einer Weißfäule
Mycel: Pilzgeflecht; Gesamtheit der Hyphen
Nebenfruchtform: Anamorphe; Pilzform mit ungeschlechtlich gebildeten Sporen (Konidien) in Fruchtkörpern oder an freien Sporenträgern (Gegenteil: Hauptfruchtform)
Nekrose: meist lokal auftretender Zell- und Gewebetod, der in der Regel mit Braunfärbung einhergeht
Nymphen: Jugendstadien von Milben oder Insekten mit ähnlichem Aussehen wie das adulte Tier; bei Insekten mit unvollständiger Verwandlung, bereits mit Flügelansätzen
Parasit: Organismus, der sich fakultativ oder obligat von der Biomasse anderer Lebewesen ernährt
parthenogenetisch: Vermehrungsform ohne Befruchtung der Eizellen bei Insekten und Milben
Perithecien (Einz.: Perithecium): kugel- oder flaschenförmige, oft mit einer apikalen Öffnung versehene Fruchtkörper der Ascomyceten
Phloem: Teil des Leitgewebes, in dem Assimilate (Endprodukte der Photosynthese) transportiert werden
Phytoplasmen (früher Mykoplasmen, MLO): Bakterien ohne Zellwand, mit veränderlicher Zellform; Krankheitserreger im Phloem von Pflanzen
polyphag: Ernährung von mehreren, unterschiedlichen Wirten
Pyknidien (Einz.: Pyknidium): kugelige, ungeschlechtlich entstandene Fruchtkörper mit Konidien
Rhizomorphen: bündelartige, mehrere Millimeter dicke, braune Mycelstränge, z. B. der Hallimasche
Rindenbrand: scharfrandig begrenzte Rindennekrose
Rußtau: dunkel gefärbter Pilzrasen auf mit Honigtau oder Nektar beschmutzten Flächen
Saprobionten: Organismen, die sich von totem, organischem Material saprobisch ernähren
Schabefraß: flacher, oberflächlicher Blattfraß; Fraßbild z. B. von Schnecken, (jungen) Raupen und Afterraupen
Schlauchpilze: Ascomyceten
Schwächeparasit: Organismus, der nur an geschwächten, in ihrer Widerstandskraft beeinträchtigten Wirten Fuß fassen kann
Seneszenz: Alterung von Organismen oder einzelnen Organen; natürlicher, teils endogen gesteuerter Vorgang, der durch belastende Umwelteinflüsse ausgelöst oder beschleunigt werden kann
Siphonen: paarige, kurze oder längere Röhrchen mit Sekretfunktion; arttypisch für Röhrenblattläuse
Skelettierfraß: Fraßbild, bei dem nur die gröberen Blattadern stehen bleiben
Sklerotien (Einz.: Sklerotium): Überdauerungsorgane der Pilze, bestehend aus kompaktem, dauerhaftem Gewebe
Sporodochien (Einz.: Sporodochium): polsterförmige Mycelbildungen mit Konidienproduktion
Ständerpilze: Basidiomyceten
Stromata (Einz.: Stroma): kompakte, zelluläre Gewebe, auf oder in denen Fruktifikationsorgane sitzen bzw. eingesenkt sind
systemisch: Ausbreitung eines Erregers oder eines Stoffes innerhalb eines fremden Organismus
Teleutolager (Telien): meist bräunliche Sporenlager der Rostpilze mit dickwandigen Teleutosporen (Wintersporen)
Uredolager (Uredien): meist leuchtend gelbe Sporenlager von Rostpilzen mit Uredosporen (Sommersporen)
Viren (Einz.: Virus): ultramikroskopische, infektiöse Partikel ohne eigenen Stoffwechsel; obligate Parasiten
Weißfäule: Holzzersetzung und -verfärbung durch Pilze, die aus verholzten Zellwänden vorwiegend Lignin, teilweise auch Cellulose und Hemicellulose abbauen
Wirtswechsel: obligater Übergang von Rostpilzen oder Blattläusen von einer Wirtspflanze auf eine nicht verwandte Wirtspflanzenart, verbunden mit der Ausbildung verschiedener Sporenformen bzw. Stadien
Wundleiste: durch wiederholtes Aufreißen und Überwallen von Rindenrissen („Frostrissen“) entstandenes Überwallungsgewebe
Xylem: Teil des Leitgewebes, in dem Wasser und Nährsalze transportiert werden
Abkürzungen
EM – Erkennungsmerkmal
VM – Verwechslungsmöglichkeit
GM – Gegenmaßnahmen (Vorbeugung und Bekämpfung)
LIT – Literatur
PSD – Pflanzenschutzdienst
Abies (Tanne)
•an Knospen, Nadeln
– Nadelverfärbung durch Frost: Abb. 1 oder chloridhaltiges Auftaumittel: vgl. Abb. 179
– Kümmerwuchs mit Nadelvergilbung durch andere abiotische Faktoren: Abb. 4
– Nadelverdrehung durch Einbrütige Tannentrieblaus (Adelges [Dreyfusia] nordmannianae): Abb. 2
– Nadelverdrehung durch Weißtannentrieblaus (Mindarus abietinus): Läuse grün, mit Wachsflaum
•an Trieben
– Welke und Nadelverfärbung durch Spätfrost: vgl. Abb. 177
– Triebsterben durch Grauschimmel (Botrytis cinerea): LIT 11, 18
– Triebanschwellung, Triebsterbendurch Einbrütige Tannentrieblaus (Adelges [Dreyfusia] nordmannianae): Abb. 2
•an Ästen, am Stamm
– Saugschäden durch Tannenrindenlaus (Cinara curvipes): Abb. 3
Abb. 1: Nadelverfärbung durch Frosttrocknis, „Winterdürre“
EM: ab Frühjahr jüngste Nadeln ganz oder teilweise braunrot verfärbt, meist auf Süd-/Südwestseite; übrige Nadeln grün; Knospen können absterben
VM: Winterfrostschäden: nur Nadelspitzen braun; Schäden durch Tannentrieblaus (Abb. 2); Pilzinfektionen (LIT 18)
GM: gute Wasser- und Nährstoffversorgung
Abb. 2: Deformation, Triebsterben durch Einbrütige Tannentrieblaus (Adelges [Dreyfusia] nordmannianae)
EM: überwiegend abwärts gekrümmte Nadeln durch Saugen dunkler, kurzrüsseliger Sommerjungläuse an Maitriebnadeln (a, b); Häutungsreste nadelunterseits; Nadeln werden missfarben; Triebsterben durch rindensaugende, langrüsselige Winterläuse (c)
VM: Weißtannentrieblaus: Läuse graugrün, Nadeln aufwärtsgekrümmt; Frosttrocknis (Abb. 1); Botrytis-Infektion (LIT 18)
GM: bei Einzelbäumen befallene Triebe ausschneiden; frühzeitige Behandlung mit einem gegen saugende Insekten zugelassenen Insektizid
Abb. 3: Saugschäden durch Tannenrindenlaus (Cinara curvipes)
EM: auf der Rinde Kolonien 4 bis 5 mm großer Läuse; Hinterleib mattschwarz, Brust glänzend schwarz (a); Honigtaubildung (b); nur Lästling
VM: Braunschwarze Tannenrindenlaus (Cinara confinis): Läuse bräunlich
GM: Abspritzen mit starkem Wasserstrahl; keine Insektizidanwendung
Abb. 4: Degeneration durch nichtparasitäre Faktoren
EM: auf jüngere Bäume beschränkte, allgemeine Verfallserscheinungen, charakterisiert durch Kümmerwuchs, verkürzte Triebe, verkleinerte Nadeln, anfangs auch Nadelvergilbung, schließlich Verbräunung und Abfallen von Nadeln; unspezifisches Krankheitsbild, mögliche Ursachen: Staunässe, Bodenverdichtung, mangelnde Nährstoff- oder Spurenelementversorgung, Wurzelschädigung
GM: Bodenverbesserung (Bodenlockerung, evtl. Dränage, ausgewogene Düngung)
Acer (Ahorn)
•an Blättern, Knospen
– Blattrandnekrosen durch chloridhaltiges Auftaumittel: Abb. 5 oder Trockenheit: Abb. 19
– Blattfleckung durch Sonnenbrand (Hitzeschaden): Abb. 6
– Blattverfärbung durch Nährstoffmangel: vgl. Abb. 239
– chlorotische Fleckung durch Virusinfektion: LIT 16
– große, braune Flecke durch Petrakia echinata: Abb. 7 bzw. Pleuro- ceras pseudoplatani: Abb. 8
– 1 bis 3 cm große, bräunliche Flecke durch Phyllosticta minima: Konidien ähnlich Tafel I/11
– schwarze Blattflecke durch Ahornrunzelschorf (Rhytisma acerinum): Abb. 9
– weiße Überzüge durch Echte Mehltaupilze (Sawadaea-Arten): Abb. 10
– „Weißfleckigkeit“ durch Pilzinfektion (Cristulariella depraedans): Abb. 11
– hellbraune, rundliche Blattflecke durch Fenstergallmücke (Dasineura vitrina): Abb. 12
– löcherige Saugschäden durch Ahornborstenlaus (Periphyllus testudinaceus): Abb. 14
– starke Honigtauausscheidung durch Ahornzierlaus
– silbrig weiße Sprenkelung durch Zwergzikaden (Edwardsiana sp.): Abb. 15
– Gallmilben-Befall: Abb. 13
– Fraßschäden durch Schmetterlingsraupen: Abb. 16
– Blattschäden durch Ahornminiermotten: Phyllonorycter geniculella an Berg-Ahorn, P. platanoidella an Spitz-Ahorn: Minen ähnlich Abb. 198
•an Ästen, am Stamm
– streifenartige Rindennekrosen durch Sonnenbrand: Abb. 18
– Absterben von Rinde durch Pilzinfektion mit Stegonsporium pyriforme („Stegonsporium-Ahorntriebsterben“): Abb. 20
– Kronenwelke, Rindennekrosen mit dunkler Sporenmasse „Rußrindenkrankheit“ (Cryptostroma corticale): Abb. 21
– Kronenwelke und Baumsterben durch Welkepilz (Verticillium dahliae): Abb. 22
– Aststerben, Rindennekrosen durch Rotpustelpilz (Nectria cinnabarina): Abb. 17
– Stammfäule durch holzzersetzende Pilze: Behangener Seitling (Pleurotus dryinus): LIT 14 oder Schuppiger Porling (Cerioporus [Polyporus] squamosus): vgl. Abb. 134
– Baumsterben durch Asiatischen Laubholzbockkäfer (Anoplophora glabripennis): Abb. 23 oder Citrusbockkäfer (Anoplophora chinensis): Abb. 302
•am Stammfuß
– braune Konsolen von Lackporlingen (Ganoderma-Arten): vgl. Abb. 111 oder büschelig wachsende Hutpilze von Sparrigem Schüppling (Pholiota squarrosa): LIT 14
– Wurzelhalsfäule durch Phytophthora-Arten
Abb. 5: Blattrandnekrosen durch Auftaumittel
EM: Blattränder bräunlich oder rotbraun; vertrocknet, oft eingerollt (b); Schäden an straßenzugewandter Seite (a); sicherer Nachweis durch chem. Blattanalyse
VM: Anfangsstadium von Dürreschaden: Differenzialdiagnose durch Chloridnachweis (LIT 18)
GM: Verwendung chloridarmer Auftaumittel
Abb. 6: Fleckenartige Blattverbräunung durch starke Sonneneinstrahlung (Hitzeschaden)
EM: interkostal liegende, unregelmäßig geformte, bräunliche Flecke mit diffusem Rand; bei größeren Nekrosen Blattdeformation und vorzeitiger Blattfall; Fehlen pilzlicher Strukturen; besonders nach heißen, strahlungsreichen Tagen
VM: Verfärbung durch Nährstoffmangel; Saugschäden durch Blattläuse; Pilzinfektionen (Abb. 8)
GM: nicht möglich
Abb. 7: Blattfleckung durch „Petrakia-Blattbräune“ (Petrakia echinata)
EM: auf Blättern von Berg-Ahorn bis 5 cm große, gezonte, graubraune Flecke (a); oberseits weiße, später schwarze Sporodochien mit mehrzelligen, braunen Konidien (b); vorzeitiger Blattfall; Neuinfektion durch Ascosporen der Hauptfruchtform im Frühjahr
VM: Pleuroceras-Blattbräune (Abb. 8)
GM: Beseitigung des Falllaubes
Abb. 8: Blattfleckung durch „Pleuroceras-Blattbräune“ (Pleuroceras pseudoplatani) an Berg-Ahorn
EM: blattoberseits braune, 2 bis 5 cm große Flecke, anfangs mit fransenförmigem Rand, später einheitlich blassbraun mit dunklem, glattem Rand; blattunterseits schwarzbraune Adernverfärbung mit winzigen Fruchtkörpern der Asteroma-Spermatienform; bei ausgedehnten Nekrosen Blattverkrümmung und Vergilbung
VM: Petrakia-Blattbräune (Abb. 7): unterseits keine Adernschwärzung! Strahlungsschäden (Abb. 6)
GM: Beseitigung des Falllaubes
Abb. 9: Blattfleckung durch Pilzinfektion (Rhytisma acerinum), „Ahornrunzelschorf“, „Teerfleckenkrankheit“
EM: ab Sommer blattoberseits meist mehrere schwarze Flecke (a, rechts auf Berg-Ahorn, links auf Spitz-Ahorn), oft mit gelblichem Rand; im Stroma flache Fruchtkörper der Melasmia-Konidienform; (b: ein breiter, brauner Rand zeigt den Befall durch den Hyperparasiten Ascochyta velata an); im folgenden Frühjahr auf abgefallenen Blättern Hauptfruchtform mit spaltenförmig sich öffnenden Apothecien (c); mehrere, wirtsabhängige Rassen; keine wesentliche Beeinträchtigung des Baumes; leichter Befall eher ästhetische Bereicherung
VM: Frühstadien von R. acerinum mit den getrennt bleibenden, punktförmigen Stromata von Rhytisma punctatum (d, links)
GM: Beseitigung des Falllaubes
Abb. 10: Weiße Blattfleckung oder Überzüge durch Echte Mehltaupilze (Sawadaea-Arten), „Ahornmehltau“
EM: a, b) Sawadaea (Uncinula) tulasnei, hier an Spitz-Ahorn: blattoberseits rundliche, scharf begrenzte Flecke (a); ab Spätsommer gelbliche, dann braunschwarze, kugelige Fruchtkörper (b); c) Sawadaea (Uncinula) bicornis, hier an Feld-Ahorn: auf beiden Blattflächen diffuse, meist zusammenhängende Überzüge; junge Blätter oft verformt
VM:Cristulariella depraedans (Abb. 11); Zikaden-Befall (Abb. 15)
GM: nicht erforderlich
Abb. 11: Blattfleckung durch Pilzinfektion (Cristulariella depraedans) auf Berg-Ahorn, „Weißfleckigkeit“
EM: kleine, rundliche, grauweiße Flecke (a); blattunterseits kleine, gestielte, weiße Sporenköpfchen (b, Pfeil); Blatt später löcherig; auch auf Eiche und Hainbuche
VM: Befallsbild der Ahornfenstergallmücke an Berg-Ahorn (Abb. 12)
GM: nicht erforderlich
Abb. 12: Blattfleckung durch Ahornfenstergallmücke (Dasineura vitrina)
EM: anfangs grünlich gelbe, linsenförmige, kreisrunde Gallen, unterseits mit „Sichtfenster“; innen weißliche Larve; im Spätstadium oft Entwicklung halbparasitischer Pilze (z. B. Diplodina acerina); im Endstadium löcherige, hellbraune Flecke
VM:Cristulariella depraedans (Abb. 11a); Drisina glutinosa: sehr flache, kreisrunde, hellgrüne bis gelbliche Galle, oft bräunlich durch Endophyten-Befall; Filzgalle blattunterseits (Abb. 13d)
GM: nicht erforderlich
Abb. 13: Gallenbildung durch Gallmilben (Aceria- und Vasates-Arten)
EM: a) Körnchengalle (Aceria cephalonea) an Feld-Ahorn: Blattgalle grün, später rötlich; b) Hörnchengalle (Aceria macrorhyncha) an Berg-Ahorn: bis 3 mm hohe, hörnchenartige Ausstülpungen, innen Milben; c) Köpfchengalle (Vasates quadripedes) an Silber-Ahorn: Gallen unregelmäßig kugelig, erst grün, dann leuchtend rot, schließlich schwarz; d) Filzgalle (Aceria pseudoplatani) an Berg-Ahorn: auf Blattoberseite erhabene, hellgrüne, später dunkelbraune Flecke, unterseits weiße bis rötliche Filzrasen, meist in Nervenwinkeln; im Filz zahlreiche, 0,16 mm lange Milben (LIT 4)
GM: nicht erforderlich
Abb. 14: Saugschäden durch Ahornborstenlaus (Periphyllus testudinaceus, Syn. P. villosus)
EM: vor Blattentfaltung entstehende, grünweiße, in Reihe angeordnete Blattwölbungen, die lochartig aufreißen (a); unterseits 3 bis 4 mm große, grünlich schwarze, borstentragende Läuse (b), später auch an Trieben; ab Juni grüne, sesshafte, unscheinbare „sommerliche Ruhelarven“
VM: andere Läusearten
GM: nicht erforderlich
Abb. 15: Weißliche Sprenkelung durch Zwergzikaden-Befall (z. B. Edwardsiana nigriloba)
EM: blattoberseits winzige, weißliche, teilweise zusammenfließende Punkte oder Flecke; unterseits im Frühjahr hellgelbe, bei Störung wegspringende Larven; ab Juli 3 bis 4 mm lange, adulte Zikaden mit schwarzer Flügelmusterung; daneben weißliche Larvenhüllen (vgl. Abb. 37)
VM: andere Zikadenarten
GM: nicht erforderlich
Abb. 16: Fraßschäden durch Schmetterlingsraupen
EM: a, b) Kleiner Frostspanner (Operophtera brumata): Schäden durch Loch- oder Sklelettierfraß (a, hier an Spitz-Ahorn); Raupe grün, mit hellen Längsstreifen, bis 20 mm lang (b), Massenauftreten möglich; auf zahlreichen Laubbäumen; meist Wiederbegrünung auch nach starkem Befall c) Ahorneule (Acronicta aceris): Skelettierfraß durch 4 bis 5 cm lange Raupe mit rotbraunen Haarbüscheln und weißen Rückenflecken; polyphag
VM: andere Schmetterlingsraupen
GM: Raupen absammeln; Vogelnistkästen aufhängen; gegen Frostspanner im Herbst Leimringe an den Stamm anbringen
Abb. 17: Rindennekrosen und Aststerben durch Pilzinfektion (Nectria cinnabarina), „Rotpustelkrankheit“
EM: an größeren Ästungswunden elliptische Nekrosen (a) mit Fruchtkörpern der Nebenfruchtform (Tubercularia vulgaris, b); Konidien zylindrisch-ellipsoid, einzellig; ab Herbst rote, in Gruppen zusammenstehende Perithecien der Hauptfruchtform (c); Wunden können überwallt werden; dünnere Äste sterben ab (z. B. beim hochanfälligen Acer palmatum)
VM: andere Nectria- bzw. Neonectria-Arten (LIT 11)
GM: vorbeugend frühzeitige, fachgerechte Ästung; ausreichende Wasserversorgung, vor allem bei frisch gepflanzten Bäumen
Abb. 18: Rindenschädigung durch Überhitzung, Sonnenbrand
EM: an jüngeren Bäumen auf der Süd-/Südwestseite bis 1,50 m lange, verschieden breite, abgestorbene Rindenstreifen oder Rindenrisse (a), vor allem bei Neuanpflanzungen und nach heißen und trockenen Sommermonaten; bei geringer Schädigung Ausbildung einer subletalen Rindennekrose mit Absterben nur des Außenbastes (b), Kambium bleibt hier funktionsfähig; bei Kambiumtod Freilegung des Splintholzes mit beginnender Überwallung; Bruchgefahr durch Besiedlung holzzersetzender Pilze (LIT 14)
VM: mechanische Verletzungen (vgl. Abb. 363); „Verticillium-Welke“ (Abb. 22)
GM: vorbeugend durch Anbringen von Schutzmaterial, z. B. Schilfrohrmatten (c) oder weißem Stammanstrich
Abb. 19: Blattrandnekrosen (a) und Blattfall (b) durch Trockenheit
EM: vom Blattrand her Vertrocknung, Braunfärbung und Einrollen insbesondere exponierter Blätter
VM: Salzstress (Abb. 5)
GM: auf ausreichende Wasserversorgung achten, versiegelten Wurzelraum öffnen, konkurrierende Gehölze beseitigen
Abb. 20: Ahorntriebsterben an Berg-Ahorn durch Pilzinfektion (Stegonsporium pyriforme)
EM: schwarze Flecke auf der Rinde an geschwächten Ahornen, vor allem nach Trockenstress (LIT 39)
VM: „Rußrindenkrankheit“ (Cryptostroma corticale), hier aber großflächige dunkle Sporenlager unter der Rinde (Abb. 21)
GM: auf optimale Standortbedingungen (Wasserversorgung!) achten
Abb. 21: „Rußrindenkrankheit“ an Berg-Ahorn durch Pilzinfektion (Cryptostroma corticale)
EM: anfangs Ausbildung von Rindennekrosen sowie Schleimfluss am Stamm; in der Folge Welkesymptome in der Krone, schließlich Absterben des ganzen Baumes mit grobscholligem Abplatzen der Rinde (a); unter der Rinde dunkle Sporenmasse (b); Konidien (c) einzellig, elliptisch (Tafel III/14); (Konidien können beim Einatmen zu Gesundheitsschäden führen! LIT 24); grünlich braune Verfärbung des Splintholzes; verstärktes Auftreten nach trocken-heißen Sommern; Pilz kann als Endophyt latent vorhanden sein
VM:Stegonsporium-Ahorntriebsterben, oberflächliche punktuelle Sporenlager (Abb. 20); Hypoxylon-Arten; Sonnenbrand
GM: Bevorzugung weniger anfälliger Arten (Berg-Ahorn besonders betroffen), adäquate Wasserversorgung sicherstellen; Entnahme erkrankter Bäume
Abb. 22: Blattwelke und Stammriss durch Welkepilz (Verticillium dahliae), „VerticilliumWelke“
EM: schüttere Krone, welkende Blätter, absterbende Triebe zunächst oft einseitig in der Krone; im Splintholz ringförmig angeordnete Farbflecke (a) mit Verstopfung der Gefäße (Tracheomykose); später Aufreißen des Stammes bis zur Rinde durch endogene Rissbildung (b); bei vitalen Bäumen Überwallung der Stammrisse (c); Risse an allen Stammseiten, häufig versetzt vorkommend
VM: Echter Frostriss (vgl. Abb. 362b)
GM: vor Pflanzung Bodenuntersuchung auf Verticillium, Bevorzugung widerstandsfähiger Gehölze; hygienische Vorkehrungen bei Schnittmaßnahmen; Entnahme erkrankter Bäume
Abb. 23: Baumsterben durch Asiatischen Laubholzbockkäfer, „ALB“ (Anoplophora glabripennis)
EM: im Frühsommer an Zweigen Reifungsfraß durch schwarzglänzenden Käfer mit unterschiedlich großen, weißen Flecken (a); Larven minieren erst im Kambialbereich, dann im Holzkörper, dort ca. 3 cm breite, ovale Bohrgänge (b); Larven bis 5 cm lang (c); Entwicklungsdauer ein bis zwei Jahre; Ausflugsloch bis 1 cm weit, kreisrund (d); Befall gesunder Bäume; bevorzugte Wirte: Ahorn, Rosskastanie, Weide und Pappel; zunächst Zurücksterben einzelner Kronenteile, später Absterben des Baumes; in Deutschland erstmals 2004 festgestellt (LIT 5)
VM: Citrusbockkäfer (Abb. 302): befällt vitale Bäume am Stammfuß und am Wurzelanlauf (daher schwerer nachweisbar); weites Wirtsspektrum; seit 2000 in
GM: Europa meldepflichtiger Quarantäneschädling. Bei Befallsverdacht PSD benachrichtigen!