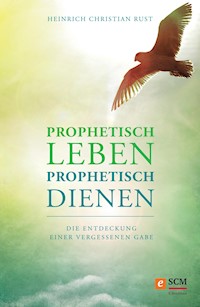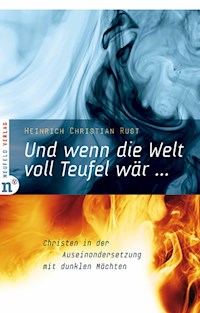Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neufeld Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Edition IGW
- Sprache: Deutsch
Warum ist trotz der charismatischen Bewegungen und Aufbrüche der letzten Jahrzehnte nicht mehr geistliche Frucht sichtbar? Liegt es vielleicht daran, dass charismatische Erfahrungen und charismatisch geprägte Theologie nicht ausreichend in einer fundierten Lehre vom Heiligen Geist verankert sind? Heinrich Christian Rust, bekannt für biblisch begründete Positionen und eine lebendige Mischung aus Nüchternheit und Offenheit für das Wirken des Heiligen Geistes, greift dieses zentrale Thema neu auf. "Ein faszinierendes, sehr persönlich geschriebenes und gut lesbares Buch. Man liest immer weiter, denn man spürt das Fließen des Geistes in Gefühlen und Gedanken. Es handelt sich um die beste deutsche Einführung in die Mitte pfingstlicher und charismatischer Bewegungen, die dem Christentum neue Zukunft erschließen. Eine missionale Pneumatologie, die sich keine Gemeinde und kein Theologe entgehen lassen sollten." Professor Dr. Jürgen Moltmann
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 599
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heinrich Christian Rust
Geist Gottes –Quelle des Lebens
Grundlagen einer missionalen Pneumatologie
Zu diesem Buch
Warum ist trotz der charismatischen Bewegungen und Aufbrüche der letzten Jahrzehnte nicht mehr geistliche Frucht sichtbar? Liegt es vielleicht daran, dass charismatische Erfahrungen und charismatisch geprägte Theologie nicht ausreichend in einer fundierten Lehre vom Heiligen Geist verankert sind?
Heinrich Christian Rust, bekannt für biblisch begründete Positionen und eine lebendige Mischung aus Nüchternheit und Offenheit für das Wirken des Heiligen Geistes, greift dieses zentrale Thema neu auf. Er bietet eine gut verständliche Orientierung und fordert heraus, das umfassende Wirken des Heiligen Geistes in dieser Welt, in der Gemeinde Jesu Christi und in jedem einzelnen Menschen neu wahrzunehmen.
„Ein faszinierendes, sehr persönlich geschriebenes und gut lesbares Buch. Lebensberichte und theologisches Denken des Heiligen Geistes wechseln ab. Man liest immer weiter, denn man spürt das Fließen des Geistes in Gefühlen und Gedanken. Es handelt sich um die beste deutsche Einführung in die Mitte pfingstlicher und charismatischer Bewegungen, die dem Christentum neue Zukunft erschließen. Der Verfasser bewegt sich auf der Höhe der internationalen theologischen Entdeckung und Diskussionen über Person und Wirken des Geistes Gottes. Eine missionale Pneumatologie, die sich keine Gemeinde und kein Theologe entgehen lassen sollten.“
Professor Dr. Jürgen Moltmann
„Dieses Buch gehört in die Hand und ins Herz eines jeden Menschen, der den Weg der christlichen Gemeinde im 21. Jahrhundert mitgestalten möchte.“
Dr. Christoph Schrodt in AUFATMEN
Das „Gemisch von Bibelnähe, trinitarischem Denken und breitem Erfahrungsschatz führt Rust konsequent zu seiner missionalen Pneumatologie, die eine gute Schneise zwischen dem pfingstlich-charismatischen Lager und der missionalen Bewegung schlägt. … Das eigentlich Neue bzw. die konsequente Missionalität in Rusts Entwurf zeichnet sich … dadurch aus, dass Rust sämtliches Wirken des Geistes immer in den Dienst der Missio Dei, der Sendung Gottes, stellt.“
Philip Mertens auf seinem Blog
Zur Edition IGW
Die Edition IGW wird herausgegeben vom Institut für Gemeindebau und Weltmission (IGW), das angehende Pastoren und Gemeindeleiter sowie kirchliche und diakonische Mitarbeitende in regionalen Schulungszentren in der Schweiz, Deutschland und in Österreich theologisch ausbildet.
Die Edition IGW macht Forschungsergebnisse von Studierenden und Dozierenden bei IGW einer breiten Leserschaft zugänglich und will damit einen Beitrag leisten, der aktuellen gemeindebaulich-missionarischen Herausforderung in Europa zu begegnen.
IGW
Josefstraße 206
CH-8005 Zürich
www.igw.edu
Über den Autor
Dr. Heinrich Christian Rust, geboren 1953, ist Pastor einer Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in Braunschweig. Er ist verheiratet mit Christiane und Vater von drei erwachsenen Kindern.
Nach dem Studium in Hamburg und Leuven/Belgien war er Landesjugendpastor in Niedersachsen, Gemeindepastor in Hannover und Referent für missionarische Gemeindedienste im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland (EFG). Seit 2003 ist er Pastor einer Baptistengemeinde in Braunschweig.
Heiner Rust ist auch als Autor und Referent bekannt und war Sprecher des Kreises Charismatischer Leiter sowie Delegierter im Theologischen Ausschuss der Lausanner Bewegung. Er engagiert sich in zahlreichen Initiativen, darunter auch im Vorstand des Christlichen Gesundheitskongresses sowie im Institut für Gemeindebau und Weltmission Deutschland.
Weitere Veröffentlichungen von Dr. Heinrich Christian Rust (Auswahl):
Beten – 7 Gründe, warum ich es tue. Neufeld, Schwarzenfeld 2006
Charismatisch dienen – gabenorientiert leben. Oncken, Kassel 2006
Geist Gottes – Quelle des Lebens. Grundlagen einer missionalen Pneumatologie. Neufeld, Schwarzenfeld 2013
Gemeinde der Zukunft. Aufbrechen aus der Stagnation. Oncken, Kassel 2006
Gemeinde lieben – Gemeinde leiten. Oncken, Kassel 1999
Prophetisch leben – prophetisch dienen. Die Entdeckung einer vergessenen Gabe. SCM R. Brockhaus, Witten 2014
Relevante Gemeinde. Die Gemeinde von morgen beginnt heute. Oncken, Kassel 2009
Über allem die Liebe. Zehn Predigten. Oncken, Kassel 2011
Wie unser Christsein neu werden kann. Der 5x5-Kurs. Oncken, Kassel 2004
Impressum
Dieses Buch als E-Book: ISBN 978-3-86256-760-7
Dieses Buch in gedruckter Form:ISBN 978-3-86256-032-5, Bestell-Nummer 590 032
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet über www.d-nb.de abrufbar
Bibelzitate, soweit nicht anders angegeben, wurden folgender Übersetzungentnommen: Hoffnung für alle © 1983, 1996, 2002 by International BibleSociety. Übersetzt und herausgegeben durch: Brunnen Verlag Basel
Weiter wurden verwendet:LU: Lutherbibel, revidierter Text 1984, durchgesehene Ausgabe in neuerRechtschreibung © 1999 Deutsche Bibelgesellschaft, StuttgartEB: Revidierte Elberfelder Bibel ©1985/1991/2006 SCM R. BrockhausVerlag, Witten
Lektorat: Roland Nickel, Altdorf/BöblingenUmschlaggestaltung: spoon design, Olaf JohannsonUmschlagbilder: Mikhail hoboton Popov/Shutterstock.comSatz: Neufeld Media, Weißenburg in Bayern
© 2013 Neufeld Verlag Schwarzenfeld
Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise,nur mit Genehmigung des Verlages
www.neufeld-verlag.de / www.neufeld-verlag.ch
Bleiben Sie auf dem Laufenden:www.newsletter.neufeld-verlag.dewww.facebook.com/NeufeldVerlagwww.neufeld-verlag.de/blog
Mehr E-Books aus dem Neufeld Verlag finden Sie bei den gängigen Anbietern oder direkt unter https://neufeld-verlag.e-bookshelf.de/
Inhalt
Zu diesem Buch
Zur Edition IGW
Über den Autor
Impressum
Vorwort von Peter Zimmerling
Einführung: Bewegungen des Geistes und Erstarrungen des Lebens
1. Der trinitarische Geist Gottes – sein Wesen und seine Personalität
1.1Das Wirken des Geistes in der Geschichte
a.Der Schöpfergeist
b.Der Geist Gottes in alttestamentlicher Zeit
c.Der Messias als Träger des Geistes
d.Die Ausgießung des Geistes zu Pfingsten
e.Der Geist in der Mission und in der Gemeinde
f.Der Geist der Vollendung
1.2 Die trinitarische Einheit
a.Der Geist des Sohnes
b.Der Geist des Vaters
c.Die trinitarische Gemeinschaft
1.3 Das Wesen des Geistes
a.Beweger und Bewahrer
b.Person und Kraft
c.Herr und Tröster
2. Der Geist der Offenbarung – Zugänge zum Geist Gottes
2.1Erfahrung und Offenbarung
2.2Wort und Geist
2.3Vernunft und Mystik
2.4Offenheit und Verschlossenheit
3. Der Geist des Lebens – Schöpfung und Neuschöpfung
3.1Staunen und Seufzen
3.2Blühen und Welken
3.3Überführung und Überwindung
4. Der Geist der Freiheit – Neugeburt und Geisterfüllung
4.1Das evangelistische Wirken des Heiligen Geistes
4.2Die Erfahrung der Rechtfertigung aus Glauben
4.3Der Empfang der Gabe des Heiligen Geistes
4.4Das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist
5. Der Geist der Liebe – Gotteskindschaft und Heiligung
5.1Geisterfahrung als Anfangs- und Wachstumserfahrung
5.2Geisterfahrung als ganzheitliche Transformation
5.3Geisterfahrung als Gemeinschaftserfahrung
5.4Abhängigkeit und Autorität
6. Der Geist der Versöhnung – Gemeinschaft und Kirche
6.1Die Berufung zur Gemeinschaft der Glaubenden
6.2Die Einheit in der Vielfalt
a.Die Einverleibung durch den Geist Gottes
b.Die Soziologie des Geistes Gottes
c.Der konfessionelle Sündenfall und die Ökumene der Herzen
6.3Die verheißene Gegenwart des Geistes Gottes
a.Das Wort Gottes und die Verkündigung
b.Die Taufe
c.Das Abendmahl
d.Charisma und Amt
6.4Der bleibende Auftrag der Gemeinde Jesu Christi
a.Leiturgia – Die Anbetung und der Gottesdienst
b.Koinonia – Die Gemeinschaft
c.Martyria – Das evangelistische Zeugnis
d.Diakonia – Der Dienst am Nächsten
e.Didaskalia – Die Lehre und die Jüngerschaft
7. Der Geist der Gnade – Charisma und Dienst
7.1Begriff und Wesen der Charismen
7.2Vielfalt der Charismen
Die Gabe der Prophetie – Röm 12,6; 1Kor 12,10.28.39
Die Gabe der Diakonie und Hilfeleistung – Röm 12,7; 1Kor 12,28
Die Gabe der Lehre – Röm 12,7; 1Kor 12,28f
Die Gabe der Leitung – Röm 12,8; 1Kor 12,28
Die Gabe der Seelsorge – Röm 12,8
Die Gabe des Teilens – Röm 12,8
Die Gabe der Barmherzigkeit – Röm 12,8
Die Gabe des Wortes der Weisheit – 1Kor 12,8
Die Gabe des Wortes der Erkenntnis – 1Kor 12,8
Die Gabe des Glaubens – 1Kor 12,9
Die Gaben der Heilungen – 1Kor 12,9.28.30
Die Gaben der Kraftwirkungen – 1Kor 12,10.28.29
Die Gabe der Geisterunterscheidung – 1Kor 12,10
Die Gabe der Glossolalie – 1Kor 12,10.28.30
Die Gabe der Auslegung von Glossolalie – 1Kor 12,10
7.3Empfang und Entwicklung der Charismen
a.Empfangen
b.Entwickeln
c.Einsetzen
7.4Ausprägung und Intensität der Charismen
7.5Wirkung und Funktion der Charismen
a.Die Bedeutung für die Verherrlichung Gottes
b.Die Bedeutung für die Auferbauung der Gemeinde
c.Die Bedeutung für die Mission
d.Die Bedeutung für das persönliche Leben
7.6Praxisfelder der Charismen
a.Die Charismen in der persönlichen Gottesbeziehung
b.Die Charismen in der Gemeinde
I. Die gottesdienstliche Versammlung
II. Die Gebets- und Hauskreise
III. Die Dienstgruppen
IV. Die Seelsorge
c.Die Charismen im Alltag
8. Der Geist der Hoffnung – Erwartung und Vollendung
8.1Das Angeld des Heiligen Geistes
8.2Das Seufzen des Heiligen Geistes
8.3Widerstand und Ergebung im Heiligen Geist
8.4Die Vollendung und Gottes neue Welt
Ausblick: Ein neues Pfingsten – Aufbruch zur Quelle des Lebens
Literatur
Band 1 der Edition IGW
Band 2 der Edition IGW
Band 3 der Edition IGW
Band 4 der Edition IGW
Band 6 der Edition IGW
Band 7 der Edition IGW
Band 8 der Edition IGW
Mehr von Heinrich Christian Rust
Noch mehr von Heinrich Christian Rust
Über den Verlag
Für Christiane
Vorwort von Peter Zimmerling
Das neue Buch von Heinrich Christian Rust informiert in umfassender Weise über Wesen und Wirken des Geistes Gottes. Man merkt ihm an, dass der Autor von Anfang an, mittlerweile seit mehreren Jahrzehnten, in den charismatischen Bewegungen sowohl in Deutschland als auch weltweit engagiert ist.
Mit einer von dem farbigen Prediger W. J. Seymour (1870–1922) in der Azusa-Street-Mission von Los Angeles ausgelösten Erweckung begann 1906 die klassische Pfingstbewegung, die zum Impulsgeber für eine Fülle von charismatischen Gruppen wurde, die sich seit den 1960er-Jahren in den traditionellen Konfessionen bildeten. Der Autor ist mit den charismatischen Bewegungen in der Betonung der bewussten Erfahrung des Geistes einschließlich der spektakulären Charismen einig. Theorie und Praxis haben sich bei ihm gegenseitig befruchtet: Er setzt sich nicht nur mit den wichtigsten wissenschaftlichen Untersuchungen zum Heiligen Geist aus der jüngsten Vergangenheit auseinander, sondern reflektiert im Gespräch mit ihnen – durchaus selbstkritisch – auch seine eigenen Erfahrungen. Das macht die Veröffentlichung von Rust zu einem Leseabenteuer.
In acht Kapiteln schreitet der Autor das ganze Spektrum der Pneumatologie ab. Ich beschränke mich auf eine Auswahl daraus: Rust beginnt mit einer trinitätstheologischen Grundlegung des Geistes. Dieser handelt immer nur in Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Danach werden verschiedene Zugangsweisen zum Geist Gottes beschrieben. In einem weiteren Kapitel entfaltet der Verfasser die Bedeutung des Heiligen Geistes für Kirche und Gemeinde. Ein besonders wichtiges Kapitel befasst sich mit dem Wirken des Geistes durch die Charismen.
Bis vor etwa vierzig Jahren mahnte man in Arbeiten über den Heiligen Geist die„Geistvergessenheit“ der abendländischen Theologie an (Otto A. Dilschneider). Seitdem erfolgte sukzessive eine Wiederentdeckung des Geistes. Im Ökumenischen Rat der Kirchen wurde seit dem Beitritt der orthodoxen Kirchen und verschiedener Pfingstkirchen 1961 verstärkt nach der Bedeutung des Geistes gefragt. Mit der Einberufung des Zweiten Vatikanischen Konzils durch Papst Johannes XXIII. vor 50 Jahren war die Erwartung eines „neuen Pfingsten“ und die Betonung der Charismen des Geistes verbunden. Kurze Zeit später bildeten sich innerhalb fast aller Konfessionen charismatische Bewegungen, die sich zwar lehrmäßig von der Anfang des 20. Jh. entstandenen traditionellen Pfingstbewegung abgrenzten, für die aber eine am Geist orientierte Spiritualität und Theologie typisch war. Diese Impulse wurden sowohl von der wissenschaftlichen Theologie als auch von der kirchlichen Praxis aufgegriffen und führten zu einem Paradigmenwechsel.
In der Folgezeit erschien eine Reihe wissenschaftlicher Pneumatologien. Hierbei ragen Entwürfe wie die von Hendrikus Berkhof, Jürgen Moltmann und Michael Welker hervor. Rust entwickelt seine eigenen Überlegungen vor allem im Gespräch mit Moltmann und bringt dabei immer wieder die Perspektive der charismatischen Bewegungen zur Geltung. Als am schnellsten wachsende Frömmigkeitsbewegung der Gegenwart war es nicht zuletzt ihr Verdienst, dass die Pneumatologie im Mainstream-Protestantismus wieder auf die theologische Agenda kam.
Die Wiederentdeckung der neutestamentlichen Charismen stellt einen wesentlichen Beitrag der charismatischen Bewegungen für Theologie und Kirche insgesamt dar. Der Geist steht nach der paulinischen Charismenlehre nicht im Gegensatz zu menschlichen Fähigkeiten, sondern nimmt sie im Charisma in Dienst. Er weckt aber auch ganz neue Begabungen in einem Menschen. Ein den neutestamentlichen Vorstellungen angemessenes Charismenverständnis muss Raum lassen für die Verleihung unspektakulärer und spektakulärer Geistesgaben an begabte und unbegabte Menschen durch den gleichen Geist. Die Gemeinde Jesu Christi stellt eine Gemeinschaft unterschiedlich begabter Menschen dar. Wie der von Gott geschaffene menschliche Leib durch seine unterschiedlichen Glieder konstituiert wird, gehören auch zur Gemeinde, zum Leib Christi, Menschen mit den unterschiedlichsten Charismen.
Rust hebt zu Recht hervor: Indem ein bleibend in sich unterschiedener, dreieiniger Gott Ursprung der Charismen ist, wird die notwendige Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Charismen von der Gotteslehre her begründbar. Die Verschiedenartigkeit der Gnadengaben ist nicht zugunsten von Uniformität zu überwinden, etwa dadurch, dass alle die gleichen spektakulären Gaben besitzen, sondern spiegelt die Unterschiedenheit des göttlichen Gebers der Charismen wider. Zur Begeisterung für die Charismen gehört die Pflege ihrer Verschiedenheit. Das Bild von der Gemeinde als dem Leib Jesu Christi weist darauf hin, dass sämtliche Glieder des Leibes der Pflege bedürfen. Würde man sich auf wenige Glieder oder gar nur auf ein Glied konzentrieren, hätte das über kurz oder lang nicht nur den Tod der anderen Glieder, sondern des ganzen Leibes zur Folge.
Positiv hervorheben möchte ich schließlich, dass die Untersuchung von Rust auch für gebildete theologische Laien verständlich ist. Ich wünsche dem Buch viele neugierige Leserinnen und Leser!
Peter Zimmerling
Leipzig
Einführung: Bewegungen des Geistes und Erstarrungen des Lebens
Eigentlich fing der Tag ganz normal an. Im Sommer wache ich immer sehr zeitig auf. Heute verdecken allerdings dicke Wolken die morgendliche Sonne. So sitze ich in meinem schönen Schreibtischsessel und schaue aus dem Fenster meines Arbeitszimmers auf das Wolkenspiel am Himmel. „Herr, wie viele Wolken verdecken deine Herrlichkeit, dein wunderbares Licht!“ Es sind keine klagenden und schon gar nicht anklagende Worte, die da spontan über meine Lippen kommen. Nein, es ist eher eine nüchterne Feststellung, die ich meinem Gott mitteilen will; so, als sei es das Normalste von der Welt.
Dabei denke ich zunächst an mich selbst. Wie oft will ich selbst in einem guten Licht dastehen. Die eigenen Scheinwerfer jedoch verdunkeln wie dicke Wolken das wahre Licht Gottes. Da sind meine eitlen Versuche, es möglichst vielen Menschen recht zu machen; da sind meine Gedanken und Ideen, die allzu oft aus mir herauspurzeln und zu unsortierter Sehnsucht werden. Damit setze ich mich und andere unter Druck und verliere dabei die Freude und die Kraft des Heiligen Geistes. Diese Gedanken des Mangels und der Ohnmacht lassen es an diesem wolkenverhangenen Morgen immer dunkler werden in mir. Vor meinen Augen verschließen die Wolken das Sonnenlicht, die Herrlichkeit. Es ist, als ob sich vor mir ein schwerer, grauer Vorhang schließt.
Wie große, dunkle, dreckige Steine legen sich die Gedanken schwer auf mein Gemüt und meine Seele. Und sie werden noch lästiger, als ich anfange, mir die Situation der Gemeinden in unserem Land vor Augen zu führen – so oft sind sie so ohnmächtig. Da sind die erdrückenden Statistiken über die Mitgliederbewegungen in so vielen Kirchen und Gemeinden unseres Landes. Gleichzeitig sind da die blassen Erfolge einer christlichen Minderheit, die geradezu pausbäckig behauptet, sie sei doch das „Licht der Welt“ und das „Salz der Erde“. Nun, wie könnte man hier widersprechen, zumal bei diesen Aussagen ja der Herr selbst zitiert wird. Aber wo ist diese Leuchtkraft, diese Salzkraft nur geblieben? Warum diese vielen düsteren Fakten am Gemeindehimmel? Darf ich überhaupt so fragen?
Ich versinke in den Erinnerungen an anscheinend bessere Tage. Diese Erinnerungen machen es in mir nicht heller, sondern sie verstärken die Last und den Schmerz über die gegenwärtige Dunkelheit. Und dennoch gebe ich meinen Gedanken freien Lauf.
Als Jugendlicher stand ich noch mit meiner Gitarre auf der Straße und sang die neuen Jesus-Lieder. Es herrschte Aufbruchsstimmung im Land. So habe ich es jedenfalls damals empfunden. Die Jesus-People-Bewegung1 hatte damals auch einige Jugendgruppen in Deutschland erfasst. Schon als Teenager war ich in der kleinen baptistischen Gemeinde im niedersächsischen Bückeburg mit der charismatischen Bewegung in Verbindung gekommen. In Gebetskreisen lobten wir den Herrn in Sprachen, die der Geist uns eingab. Wir sangen neue, geistgewirkte Melodien und Lieder. Wir empfingen prophetische Eindrücke. Die ganze Palette der Geistesgaben brach unter uns auf. Zudem war da dieser brennende Hunger und Durst nach Leben, nach einem Leben aus Gott. Schon bald suchten wir den Kontakt zu anderen Jugendlichen, die ähnliche Erfahrungen machten. Ich lernte junge Christen aus anderen Konfessionsfamilien kennen: Lutheraner, Reformierte, Katholiken, Methodisten, Pfingstler und orthodoxe Christen. Sie waren ebenfalls vom Geist Gottes neu ergriffen. Wir verabredeten uns zu missionarisch-evangelistischen Aktionen im In-und Ausland. Damals nannten wir es „Preach-in“ oder „Sing & Pray“ oder „Outreach“. Das klang irgendwie origineller als die Begriffe „Zeugnisversammlung“, „Lob-Gottesdienst“ oder „Evangelisation“. Viele junge Menschen fanden damals Anfang der 70er-Jahre zu einem lebendigen Glauben an Jesus Christus. Ach, diese Tage waren so stark von einem Geist der Kraft und der Vision für eine neue, von Gott geprägte Welt beseelt! Da waren keine dunklen Wolken, die uns bedrückten! Ich erinnere mich, dass ich manchmal vor lauter Freude nicht einschlafen konnte.
Schon bald formierten sich die charismatischen Aufbrüche im Land immer mehr. Seit 1972 war ich regelmäßiger Teilnehmer der Tagungen auf Schloss Craheim,2 einem ökumenischen Lebenszentrum in Unterfranken. Dort empfingen wir gute Impulse von internationalen charismatischen Leitern wie Rodman Williams, David du Plessis, Graham Pulkingham, Michael Harper oder Peter Hocken. Wir wurden vom „Fisherfolk“ aus England in die neue Art der Anbetungsgesänge eingeführt, die sich dann in Deutschland als Chorusse durchsetzten. In meiner Konfessionsfamilie, im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland, wurde bereits 1975 der Arbeitskreis „Charisma & Gemeinde“ gegründet. Von Anfang an war ich im Mitarbeiterkreis dabei und auch später viele Jahre in der Leitung. Wir erlebten wunderbare Tagungen und Konferenzen, zum Teil auch gemeinsam mit den charismatischen Bewegungen aus den anderen Konfessionen3. Würde es zu einer wirklichen Erneuerung der Kirchen, Freikirchen und Gemeinschaften im Land kommen?
Die Pfingstbewegung hatte sich in Deutschland nur sehr zögerlich entwickelt, nicht zu vergleichen mit dem rasanten Wachstum in anderen Ländern. Die Hoffnung der charismatischen Bewegungen konzentrierte sich zunächst auf die Erneuerung der einzelnen Person. Wir veranstalteten Tagungen zum Thema „Wie empfange ich den Heiligen Geist?“ oder zu Fragen der christlichen Nachfolge und besonders auch zu den verschiedenen Charismen. Die Rede von der bevorstehenden Erweckung und einer neuen Ausgießung des Heiligen Geistes beflügelte uns immer wieder neu. Bei ungezählten kleinen Tagungen und größeren Konferenzen erlebten wir das Wirken des Geistes in einem außergewöhnlichen Maß4. Menschen wurden spontan von körperlichen und seelischen Nöten geheilt. Wir erfuhren Befreiung und innere Heilung. Das ermutigte uns, Großes von Gott zu erwarten. Es sollte doch wieder so zugehen wie in den Tagen des NT! Jesus Christus hat doch auch heute noch die gleiche Autorität, oder?
Schon sehr bald kam es zu Spannungen in den bestehenden Kirchen und Gemeinden, denn nicht alle Mitchristen konnten sich über diese „Charismatiker“ freuen. Sie fragten, ob deren Lehre und Leben denn überhaupt biblisch sei und ob die Gaben des Heiligen Geistes denn heute noch so wirksam sein könnten, da wir im Kanon der von Gottes Geist gegebenen biblischen Schriften ja das Maß aller Dinge hätten. Böse Worte und verhärtete, unbelehrbare Herzen prallten da aufeinander – von beiden Seiten. Hunderte, ja Tausende verließen ihr altes Gemeindeschiff und gründeten neue Christliche Zentren oder unabhängige charismatische Gemeinden, die wie ein schnelles Motorboot auch schon bald viel Fahrt aufnahmen. In den letzten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts haben sich in Deutschland nach meiner Einschätzung etwa 850 dieser neuen charismatischen Gruppen und Gemeinden gebildet. Heute sind viele von ihnen im D-Netz zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen. Die meisten dieser neuen charismatisch geprägten Gemeinden haben allerdings die Grundformen der traditionellen Kirchen und Gemeinden übernommen: Auch sie treffen sich in großen Räumlichkeiten und pflegen eine starke Veranstaltungsorientierung. Sie haben Leitungsstrukturen, die mit ihrer Straffheit teilweise noch das Papsttum in den Schatten stellen. Sie geben dem Lobpreis, dem Singen von Anbetungsliedern, in den Veranstaltungen einen großen Raum. Der Musikstil ist vielfach einseitig auf neues Liedgut ausgerichtet. Die Charismen, besonders die Gaben der Offenbarung, werden gefördert; andere Geistesgaben sind zwar erwünscht, prägen aber das Gemeindeleben in der Regel nur geringfügig5.
Schon bald kam es auch hier zu Erstarrungen und zu notvollen Erfahrungen. Es zogen dunkle Wolken auf. Mitglieder aus den charismatisch geprägten Gemeindegruppen klagten zunehmend über geistlichen Missbrauch. Nicht wenige trennten sich wieder von ihrer neuen geistlichen Heimat. Einige fanden zurück in die „alten“ Kirchen und entschieden sich für eine softe Version des Geisteswirkens. Die Offenheit für die Charismen und das Wirken des Heiligen Geistes wurde zwar noch postuliert, aber in kleine Zirkel, Gebetsgruppen oder Sonderveranstaltungen verbannt. Einige nahmen die Sicht des amerikanischen Theologen C. Peter Wagner auf, der von einer „Dritten Welle“ der charismatischen Bewegung sprach6. In dieser dritten Welle spielt die Redeweise von der „Taufe im Heiligen Geist“ oder auch die Bedeutung der Gabe der Glossolalie (Sprachenrede) keine herausragende Rolle mehr, ja, sie wird zum Teil sogar aus Rücksichtnahme bewusst gemieden. Ob daraus aber nun wirklich eine „Welle“ geworden ist, kann ich nicht beurteilen. Zudem finde ich den „Wellen-Gedanken“ auch etwas befremdlich. Muss ich denn davon ausgehen, dass der Geist Gottes immer versucht, in neuen Wellen, mit neuen Akzenten Bewegung in eine erstarrte Christenheit zu bringen?
Die Fragen nach dem, was der Geist Gottes gegenwärtig tut oder bewegen will, trieb mich und andere charismatisch geprägte Leiter in ungezählten Zusammenkünften um. Angeregt durch die Berichte aus der argentinischen Erweckung, nahmen wir die Impulse zu einer „geistlichen Kampfführung“7 auf. Carlos Annacondia oder Ed Miller waren gern gesehene Gäste bei deutschen charismatisch geprägten Zusammenkünften. Dennoch war das Urteil über diese Art des Betens und inneren Kämpfens nicht ungeteilt. Wolfram Kopfermann, der langjährige Leiter der Geistlichen Gemeinde-Erneuerung in der Evangelischen Kirche, distanzierte sich von einer derartigen Machtanmaßung „ohne Auftrag“8. Ich selbst habe mich wenige Jahre später dazu ebenfalls differenziert in meinem Buch „Und wenn die Welt voll Teufel wär …“9 geäußert. Anfang der 90er-Jahre schien der Heilige Geist einen neuen Segen für die kämpfende charismatische Bewegung bereit zu halten. Die Toronto Airport Christian Fellowship, eine pfingstlich geprägte Freikirche in der Nähe des Flughafens der kanadischen Stadt Toronto, erlebte seit 1994 eine besondere Ausgießung des Heiligen Geistes, die von starken Manifestationen begleitet war. Die ekstatischen Erfahrungen wie etwa das nach einer Segnung erfolgte Umfallen, auch als „Ruhen im Geist“ bezeichnet, euphorisches Lachen, Weinen oder Schreien, Zittern und Schütteln oder außergewöhnliche Laute unterschiedlichster Art wurden als eine besondere Salbung des Geistes gedeutet und als „Toronto-Segen“10 bekannt. Menschen hatten sich offenbar nicht mehr unter Kontrolle. Es machte mich neugierig, was der Geist Gottes wohl hier für einen neuen Akzent setzen wollte. Im Herbst 1994 flog ich nach Toronto, um mir dieses Wirken anzuschauen. Ich war ja vieles schon gewohnt, doch was ich dann dort erlebte, faszinierte mich zum einen und es stieß mich zum anderen auch irgendwie ab. Ich hatte den Eindruck, dass sich hier zum Teil auch ganz bewusst angeleitete Prozesse der gemeinsam gewollten Ekstase vollzogen, die jedoch nicht alle eindeutig vom Geist Gottes initiiert waren. Dennoch spürte ich in den Versammlungen eine heilige Gegenwart Gottes. Ich hatte schon häufig prophetische Impulse empfangen und konnte vielen Menschen und Gemeinden damit dienen. In den Toronto-Versammlungen waren die Offenbarungen bei mir nun verstärkt und außergewöhnlich klar. Ich erfuhr, wie Gott mir zum Teil sehr konkrete Einzelheiten über Menschen offenbarte, die ich niemals in meinem Leben zuvor gesehen hatte. Ich empfing klare Zusprüche und prophetische Worte, die ich weitergab und die in ihrer Wirkung und Treffsicherheit nicht nur die Empfänger verblüfften, sondern auch mich selbst. Schließlich erfuhr ich bei einem Segnungsgebet am eigenen Leib, wie der Geist Gottes mich in einer starken Kraft berührte und ich die körperliche Beherrschung verlor und zu Boden sank. In diesen Momenten erlebte ich einen ganz tiefen inneren Frieden und es umgab mich so etwas wie ein helles, wohltuendes, fließendes Licht. Es waren kurze, aber sehr schöne Augenblicke, an die ich mich heute noch gern erinnere. Wieder in Deutschland angekommen, berichtete ich von meinen Erfahrungen. Aber ich teilte auch die Auffassung, dass es sich bei den Toronto-Phänomenen nicht immer um vom Geist Gottes gewirkte Manifestationen handeln müsse. Bei all den ekstatischen Äußerungen war wohl auch viel Manipulatives und Menschliches im Spiel. Ich versuchte einerseits, die Kritiker der Toronto-Bewegung zu gewinnen, indem ich ihnen darlegte, wie auch die ekstatischen Erfahrungen hier und da vom Geist Gottes genutzt oder auch initiiert werden können. Es gab hierfür genügend Beispiele im AT oder ich erinnerte an Petrus, der betete und dabei in Ekstase war (Apg 10,10). Andererseits versuchte ich meine charismatischen Freunde zu besänftigen, die meinten, dass dieser „Toronto-Segen“ der Start für eine weltweite geistliche Erweckung sei. Nein, diese Auffassung konnte ich nicht teilen, zumal es doch sehr „menschelte“ in dieser Bewegung. Nach zum Teil heftigen Debatten und Urteilen ebbte diese Toronto-Welle wieder ab.
Ich selber erfahre heute immer wieder einmal ähnliche ekstatische Augenblicke, wenn ich im Geist bete. Aber es sind nicht diese Phänomene, die ich suche, sondern ich suche meinen Herrn und Gott. Ich würde diese Erfahrungen auch niemals als den entscheidenden Schlüssel für einen geistlichen Aufbruch sehen.
Der Toronto-Welle folgten noch andere Bewegungen des Heiligen Geistes. Da pilgerte schon bald die charismatische Jüngerschaft zur Brownsville Assembly of God in Pensacola im US-Staat Florida. Der Geist Gottes wirkte hier seit dem 18. Juni 1995 in einem kontinuierlichen starken missionarischen Aufbruch11. Tausende Menschen wurden vom Geist Gottes ergriffen und von Sünde überführt. Der Akzent in dieser Geistesbewegung lag auf der Buße. Zwar gab es auch hier und da ekstatische Erfahrungen, sie standen aber keineswegs im Mittelpunkt. Vielmehr war das Wirken des Geistes in der Pensacola-Bewegung an einzelne Verkündiger (Steve Hill, John A. Kilpatrick u. a.) geknüpft. Als ich wenige Jahre später Pensacola besuchte, war es um diese starke Bußbewegung sehr ruhig geworden. Ich fragte den Taxifahrer, der mich zur Erweckungsveranstaltung fuhr, wie sich denn dieser starke geistliche Aufbruch in der Stadt niedergeschlagen habe. Er schaute mich verdutzt an und fragte mich zurück, von welchem Aufbruch ich denn sprechen würde, er hätte davon noch nichts gehört. Nach wenigen Jahren des Aufbruchs in dieser Gemeinde erlebte ich nun Gottesdienste, die von einer eher klassischen pfingstlich-spirituellen Kultur geprägt waren. Im Anschluss an die Veranstaltungen sprach ich mit geistlichen Vätern und Müttern der Brownsville-Assembly-of-God-Gemeinde, die mir unter Tränen mitteilten, wie viele Fragen sie umtrieben. War es wirklich alles so vom Geist Gottes gewollt und initiiert? Niemals werde ich diese fragenden und enttäuschten Gesichter der Frauen und Männer vergessen, die über viele Jahre diese Gemeinde begleitet und geleitet haben. Hatte diese Erweckungswelle auch Schaden angerichtet?
Immer, wenn in der Folgezeit von einer neuen „Welle des Geistes“ die Rede war, hörte ich deshalb nicht nur mit Freude und einer inneren Hoffnung zu, sondern auch mit Skepsis. Da wurden wir von unseren Mitchristen in Uganda aufgefordert, eine starke Freisetzung des Geistes durch das Gebet zu bewirken. Da riefen uns geistliche Leiter aus Kanada auf, die Generationen in einer neuen Väterbewegung zusammenzubringen. Da legten wir immer wieder die „Kronen des konfessionellen Stolzes“ vor dem Thron des Lammes Gottes nieder und erhofften so einen neuen Durchbruch zu einer geistlichen Einheit. Wir bekannten ungezählte Male unsere nationale Schuld, die wir gegenüber dem Volk der Juden auf uns geladen haben, gingen Wege der Versöhnung und suchten die Gemeinschaft mit der immer stärker werdenden Gruppe der messianischen Juden. Wir reichten uns im ökumenischen Chor neu die Hände und sind nun „Miteinander für Europa“ unterwegs. Doch die Kraft der geistlichen Erneuerung, der Geist des Aufbruchs, wich immer mehr einem Lazarettdenken. Das Lamento über den beklagenswerten Zustand von Kirchen und Freikirchen, immer noch steigenden Austrittszahlen und zahme neue charismatische Gemeinden und Gemeinschaften konnten die vielen dunklen Wolken am Himmel Gottes nicht vertreiben.
Hier und da entdecken wir ein blaues Loch und ein Sonnenstrahl der Herrlichkeit Gottes erwärmt uns – und schon pilgern alle wieder hin zu diesem Sonneneinfall, um zu partizipieren, um zu lernen, um ihn „mitzunehmen“. Doch was tut sich wirklich in der geistlichen Welt? Ich kann inzwischen jene Mitchristen gut verstehen, die es leid sind, auf immer neue Wellen des Geistes zu achten; die kein Interesse mehr daran haben, immer neu auf die schon lang verheißene geistliche Erweckung im Land zu hoffen. Da helfen dann auch keine noch so profilierten prophetischen Worte. Ist die charismatische Bewegung am Ende? Die Zahl derer, die sich mehr oder weniger frustriert von ihren Gemeinden verabschieden, nimmt zu.12 Der Weg zurück in die verfassten Kirchen und Freikirchen wird jedoch nur selten gefunden. Unzählige bleiben auf der Strecke, formieren sich in kleinen Gemeinschaften oder auch in Hauskirchen. Andere zählen sich zu den „entkirchlichten Christen“ und erklären das bestehende Gemeinde- und Kirchensystem für ein gescheitertes Modell.13 Haben die charismatischen Erneuerungsbewegungen in den verfassten Kirchen und Freikirchen, die starken geistlichen Aufbrüche der vergangenen 50 Jahre ihre Blütezeit schon hinter sich? Müssen wir von einer „postcharismatischen Depression“14 reden? Wo ist die Kraft, die Dynamik, die einst diese Bewegungen geprägt hat? Ich frage mich: Warum haben diese Wellen des Geistes nicht zu einer umfassenden Neubelebung unserer Kirchen beigetragen? Oder war das womöglich gar nicht das Hauptziel, das der Geist Gottes mit dem neuen Pfingsten hatte? Es ist unbestritten, dass die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen starken Niederschlag in der weltweiten Pfingstbewegung und in ihren kirchlichen Gruppierungen gefunden hat. Ebenso haben auch die charismatischen Erneuerungsbewegungen ihren positiven Beitrag zur Belebung der bestehenden Kirchen geleistet. Die pfingstlich-charismatische Bewegung zählt zu den stärksten christlichen Reformbewegungen, die wir in der Welt wahrnehmen können. Etwa 730 Millionen Christen sind davon in den Pfingstkirchen, in den Erneuerungsbewegungen innerhalb der bestehenden traditionellen Kirchen und Freikirchen sowie in den neuen charismatischen Gemeinden und Gemeinschaften erfasst.15 Und so beschäftigt mich die Frage: Ist damit das Ziel dieser neuen Ausgießung des Geistes Gottes erreicht? Haben wir die Impulse, die der Geist Gottes setzen wollte, wirklich verstanden und erfasst? War es nicht derselbe Geist Gottes, der parallel auch andere Reformbewegungen auslöste? War es nicht derselbe Geist Gottes, der die Sicht für die Weltmission am Ende des 18. Jahrhunderts neu bewirkte? Man denke nur an Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf und die Herrnhuter Bewegung16; man denke an die großen Weltmissionskonferenzen17, die zeitgleich mit dem Aufbruch der Pfingstbewegungen ihren Lauf nahmen. Sind nicht die Reformbewegungen des Pietismus des 18. und 19. Jahrhunderts, die Erweckungs- und Gemeinschaftsbewegungen des 19. und 20. Jahrhunderts ebenso Wirkungen des Heiligen Geistes?18 Wie verhalten sich diese Bewegungen zum pfingstlich-charismatischen Aufbruch der letzten 100 Jahre? Ist der Geist Gottes ein Geist der Mission, der uns hier neu ergreifen will? Ist es der Geist Gottes, der zeitgleich ein neues Bewusstsein für die Einheit der Kinder Gottes schafft und die Einheitsbewegungen der Ökumene19 und der Evangelischen Allianz20 auslöste? Wie steht es um die Einheit der Christen heute? Ist es der Geist Gottes, der das auserwählte Volk der Juden zurückführt in das Land Israel und somit sammelt und eint? Wie steht es um die Einheit des Gottesvolkes der Juden und des dazugenommenen Gottesvolkes aus den Nationen? Ist es der Geist Gottes, der als Geist der Erbarmung, als Geist der Gerechtigkeit und Freiheit hinter den Befreiungsbewegungen steht, die sich zum Teil in der Befreiungstheologie21 oder auch der feministischen Theologie22 äußern? Warum geschieht es, dass sich die Vertreter dieser unterschiedlichen Bewegungen zum Teil bitterlich bekämpfen und behindern, wenn der Geist Gottes hier initiativ ist? Warum isolieren sich die einzelnen Bewegungen und erstarren in ihren dogmatischen Wahrheiten und Überzeugungen? Warum wird diese gebeutelte und von Krisen geschüttelte Welt nicht stärker von diesem Licht Gottes erfasst, das in den Farben der Gnade, der Einheit, der Versöhnung, der Freiheit und der Gerechtigkeit leuchtet? Warum sind da so viele Wolken?
Alle diese Gedanken gehen mir an diesem sommerlichen Morgen in meinem Arbeitszimmer durch den Kopf und durch das Herz. Von glorreichen Erinnerungen an Momente, in denen ich die Herrlichkeit Gottes erfahren habe, falle ich in die dunklen Löcher der Ohnmacht, der Streitigkeiten. Ich sehe die Enttäuschten, die nicht mehr hoffen wollen und sich in eine Innerlichkeit und Individualisierung ihres Glaubens zurückziehen. Mal gluckse ich vor Freude an dem frischen Sprudeln der Gnadenbewegungen Gottes und dann wieder verdurste ich innerlich bei dem Anblick der offensichtlichen geistlichen Dürre in unserem Land und in dem alten Europa. Brauchen wir ein neues Pfingsten, eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes? „Ja! Komm, Heiliger Geist! Belebe uns neu! Öffne die Quellen des Lebens für dieses dürre Land!“ Ich weine, ich bete, ich schweige.
„Kannst du schwimmen?“ Immer wieder kommt mir diese Frage in den Sinn, so als würde sie der Geist Gottes selbst in mein Herz geben. „Natürlich kann ich schwimmen, das kann doch jedes kleine Kind! Aber zurzeit sitze ich hier in meinem Schreibtischsessel, schaue aus dem Fenster und schwelge in alten Zeiten und gräme mich angesichts der vielen ungelösten Fragen, lieber Herr!“
„Kannst du schwimmen, so wie der Prophet Hesekiel?“ Ich werde hellhörig. Was ist das? Eine Frage von Gott? Musste dieser alttestamentliche Prophet denn irgendwann einmal schwimmen? Was hat das mit meinen so großen und schwerwiegenden Fragen zu tun? Ich schlage in der Bibel nach und stoße auf einen Text, der mich bis heute nicht mehr loslässt. Ein Text, der mich letztlich auch entscheidend motiviert hat, dieses Buch zu schreiben. Ich lese Hesekiel 47,1–12:
Dann führte mich der Mann noch einmal zum Eingang des Tempelgebäudes, der nach Osten lag. Dort sah ich Wasser unter der Schwelle hervorquellen. Erst floss es an der Vorderseite des Tempels entlang in südlicher Richtung, dann am Altar vorbei nach Osten. Der Mann verließ mit mir den Tempelbezirk durch das Nordtor des äußeren Vorhofs, und wir gingen an der Außenmauer entlang bis zum Osttor. Ich sah, wie das Wasser an der Südseite des Torgebäudes hervorkam. Wir folgten dem Wasserlauf in östlicher Richtung; nachdem der Mann mit seiner Messlatte 500 Meter ausgemessen hatte, ließ er mich an dieser Stelle durch das Wasser gehen. Es war nur knöcheltief. Wieder maß er 500 Meter aus, und jetzt reichte es mir schon bis an die Knie. Nach weiteren 500 Metern stand ich bis zur Hüfte im Wasser. Ein letztes Mal folgte ich dem Mann 500 Meter, und nun war das Wasser zu einem tiefen Fluss geworden, durch den ich nicht mehr gehen konnte. Man konnte nur noch hindurchschwimmen. Der Mann fragte mich: „Hast du das gesehen, sterblicher Mensch?“
Dann brachte er mich wieder ans Ufer zurück. Ich sah, dass auf beiden Seiten des Flusses sehr viele Bäume standen. Der Mann sagte zu mir: „Dieser Fluss fließt weiter nach Osten in das Gebiet oberhalb der Jordanebene, dann durchquert er die Ebene und mündet schließlich ins Tote Meer. Dort verwandelt er das Salzwasser in gesundes Süßwasser. Wohin der Fluss kommt, da wird es bald wieder Tiere in großer Zahl und viele Fische geben. Ja, durch ihn wird das Wasser des Toten Meeres gesund, so dass es darin von Tieren wimmelt. Am Ufer des Meeres leben dann Fischer, von En-Gedi bis En-Eglajim breiten sie ihre Netze zum Trocknen aus. Fische aller Art wird es wieder dort geben, so zahlreich wie im Mittelmeer. Nur in den Sümpfen und Teichen rund um das Tote Meer wird kein Süßwasser sein. Aus ihnen soll auch in Zukunft Salz gewonnen werden. An beiden Ufern des Flusses wachsen alle Arten von Obstbäumen. Ihre Blätter verwelken nie, und sie tragen für immer reiche Frucht. Denn der Fluss, der ihren Wurzeln Wasser gibt, kommt aus dem Heiligtum. Monat für Monat bringen sie neue, wohlschmeckende Früchte hervor, und ihre Blätter heilen die Menschen von ihren Krankheiten.
Dieser Fluss steht für das Leben, für die heilbringende Gegenwart Gottes. Er entspringt in der Herrlichkeit Gottes – im Tempel, wo nach alttestamentlichen Vorstellungen Gottes Schechina (dt. Ruhe, Wohnung, Geist, Herrlichkeit) wohnt. Die Schechina ist keine Eigenschaft Gottes, sondern seine strahlende und heilende Gegenwart (2Mo 40,35). Sie lässt sich nicht einsperren, auch nicht in einen neuen Tempel23. Doch dieses Leben, dieser Fluss der Heiligkeit, der Fruchtbarkeit, der Liebe und Gnade Gottes kann nicht in den starren Formen des Lebens, in Tempeln und Wohnungen festgehalten werden. Die heilende Gegenwart Gottes lässt diese Schechina unter der Tür hervorquellen. Sie fließt an einen Ort, wo man es nicht für möglich hält: dieser Lebensfluss fließt zu den dürren und versalzenen Orten, um sie fruchtbar zu machen. Der Prophet geht erstaunt diesem Fluss nach. Behutsam wird er geleitet durch einen Boten Gottes. Zunächst hat er noch Boden unter den Füßen; er hat die Kontrolle, kann messen und ermessen. Dann aber wird es patschig und das Lebenswasser steigt bis zu den Knöcheln, bis zur Hüfte und schließlich verliert er den Boden unter den Füßen. In diesem heilenden Fluss des Lebens kann man nur noch schwimmen (V. 9). Der Prophet wird mitgetragen, geradezu mitgerissen von dieser Bewegung. Heilung geschieht und ständig neue Frucht entsteht am Ufer dieses Flusses. Selbst die alten Salzpfützen der Vergangenheit werden noch dem Leben dienen.
Es ist nahe liegend, diesen Fluss, diese Quelle des Lebens mit dem Geist Gottes in Verbindung zu bringen. Gott selbst wird im AT als die Quelle des Lebens (Ps 36,10) oder als lebendige Quelle (Jer 2,13; 17,13) bezeichnet. Aus Jahwe selbst fließen Lebenskräfte zum Segen der ganzen Schöpfung (Ps 65,10). Nach dem Zeugnis des NT empfangen Menschen aus dieser Quelle „Gnade um Gnade“ (Joh 1,16; LU). Jesus spricht von der neuen Geburt durch „Wasser und Geist“ (Joh 3,5; LU). Er ist es, der mit dem Heiligen Geist „tauft“ (Joh 1,33). Der Geist wird „ausgegossen“ (Joel 3,1; Apg 2,17; LU). Der Strom des Lebens begegnet uns auch in der Sicht der Vollendung. Johannes sieht ihn als Fluss, der hervorquillt aus dem Thron Gottes und des Lammes, glänzend wie ein Kristall (Offb 22,1). Wo der Geist Gottes wirkt, entsteht Frucht (Joh 15,5; Gal 5,22f). Der „Baum des Lebens“ (1Mo 2,9; LU) taucht am Ende der Geschichte wieder als „Holz des Lebens“ auf, das in der vom Himmel herabkommenden Stadt Jerusalem stehen soll und viele Früchte zur Heilung der Nationen trägt (Offb 22,2–3). Der Geist lädt gemeinsam mit der Gemeinde in die heilende Gottesgemeinschaft ein. „Der Geist und die Braut sagen: ‚Komm!‘ Und wer das hört, soll auch rufen: ‚Komm!‘. Wer durstig ist, der soll kommen. Jedem, der es haben möchte, wird Gott das Wasser des Lebens schenken“ (Offb 22,17).
Der Geist Gottes tritt auf den Plan, der durch alle Zeiten hindurch fließt wie ein Strom des Lebens, der seine Schöpfung in die große Mission Gottes ruft. Seit Pfingsten ist er ausgegossen in die Herzen der Menschen (Röm 5,5). Er will weiterfließen zur Transformation, zur Veränderung und Heilung der vertrockneten Landschaften und der Nationen. Dieser Strom ist nicht aufzuhalten, auch nicht durch die neuen Tempelmauern der menschlichen Vernunft, der kirchlichen Erstarrung oder des Hochmutes der Menschen. Wer sich in diesen Strom hineinbegibt, der verliert schnell den Boden unter den Füßen, er muss schwimmen.
Meine Fragen, die mich an diesem sommerlichen Morgen in dem Wolkenmeer der Ohnmacht und Hoffnungsarmut versenken wollten, haben durch die Frage Gottes an mich nun eine andere Richtung bekommen. „Kannst du schwimmen?“ – „Ich weiß es nicht, mein Herr, aber ich will mich gern von diesem Strom des Lebens, diesem Geist des Lebens neu erfassen lassen!“ Die Wolken sind noch da, aber ich weiß um den Glanz und um die Schönheit des ewigen, fließenden Lichtes Gottes. Mein Tag wird hell.
Diese bewusst erfahrene Einladung des Geistes Gottes, mich ganz neu auf den tragenden und fließenden Lebensstrom einzulassen, hat nicht nur meine Gedanken erhellt, sondern sie hat mich auch ermutigt, mich mit der Quelle und den Strömungen neu zu befassen und den Erstarrungen des Lebens nicht zu viel Aufmerksamkeit zu geben. Dieses Buch soll nicht einen klagenden und lamentierenden Unterton haben, sondern ich hoffe, dass es mir gelingt, die strahlenden Kristallfarben dieser Quelle des Lebens zu beschreiben. Das wird im Rahmen eines Sachbuches nur sehr schwer möglich sein, und so mute ich meiner Leserschaft immer wieder Geschichten des Lebens zu, die komplizierte theologische Zusammenhänge häufig klarer entfalten können als viele theologische Spitzfindigkeiten. Die Vorstellung vom kristallenen Lebensstrom wird uns dabei immer wieder begleiten, gleichsam wie ein Hintergrund für die theologischen Skizzen, die zu einer missionalen Pneumatologie beitragen sollen. Es ist nicht nur eine Vorstellung, sondern eine realistische Erfahrung, dass dieser Geist in mein Herz ausgegossen ist und mich immer neu ergreifen will. Hier und da komme ich in meinen Gedanken, meinen Argumentationslinien ins Schwimmen; manchmal fehlen mir die Worte und die Metaphern und Bilder überlagern sich. Das liegt wohl in der Natur der Sache bzw. des Geistes. Der Geist Gottes ist Bewegung und nicht Erstarrung. Allerdings gebe ich zu, dass auch die Erstarrungen des Lebens zum Nachdenken reizen.
Ich will der Frage nachgehen, warum die charismatischen Bewegungen oder auch andere Erneuerungsbewegungen so schnell an Schwung verlieren können. Es könnte an einer Einseitigkeit der Wahrnehmung liegen. Der Gedanke der „Wellen des Geistes“ symbolisiert zwar Dynamik, hat aber de facto dazu geführt, dass sich die verschiedenen Bewegungen voneinander abgrenzten und lediglich noch in einer Richtung unterwegs waren. Manche richteten ihre neuen „Tempel“ wohnlich ein und besangen die Gegenwart Gottes – ohne zu bemerken, dass diese gerade unterwegs war. Es blieben Formen, Rituale, Gewissheiten. Je mehr man es sich allerdings in den neuen Bewegungen gemütlich machte, desto mehr verloren sie an Schwung, der Strom wurde immer enger. Es ist bereits angeklungen, dass in den vielfältigen pfingstlich-charismatischen Bewegungen auch eine gewisse Engführung und Starre auszumachen ist. Ein Grund dafür mag darin liegen, dass neue Bewegungen sich nicht selten aufgrund einer Unzufriedenheit mit dem Status quo entwickeln, aber seltener, weil der Geist Gottes uns „mitfließen“ lässt und in seiner Liebeskraft zum Standortwechsel auffordert. Die Konzentration der charismatischen Erneuerungsbewegungen auf die Erneuerung des einzelnen Menschen hat nach meiner Einschätzung zu einer verhängnisvollen Verengung der Bewegung geführt. Da geht es um die Ersterfahrung des Empfangs der Gabe des Geistes, um ein vom Geist Gottes erfülltes Leben in der Heiligung und um die vielbesagten Charismen. Zuweilen stehen einzelne Geistesgaben unverhältnismäßig stark im Mittelpunkt (Sprachenrede, Heilungen, Prophetie, Leitung). Die gemeinschaftsfördernde Dimension, die ekklesiologischen und sozialpolitischen Akzente einer ganzheitlichen Lehre vom Heiligen Geist bis hin zur kosmischen und eschatologischen Pneumatologie werden nur wenig bedacht. Peter Zimmerling reflektiert diese Tatsache angesichts einer Zuordnung zu den drei Artikeln des apostolischen Glaubensbekenntnisses und resümiert: „Die Konsequenzen aus der nur mangelhaften trinitarischen Rückbindung des Geisteswirkens in charismatischer Theologie und Frömmigkeit besteht in einer häufig zu beobachtenden Vernachlässigung des ersten und zweiten Artikels. Der fehlende Bezug zum ersten Artikel lässt leicht übersehen, dass jede Geisterfahrung von soziologischen und charakterlichen Gegebenheiten des jeweiligen Menschen geprägt ist; der vernachlässigte christologische Rückbezug führt zur Gefahr des Triumphalismus. Beides lässt sich am Charismen-, Gemeinschafts-, Gottesdienst-, Seelsorge- und Gemeindeaufbauverständnis charismatischer Bewegungen verifizieren.“24 Zimmerling könnte hier auch zusätzlich eine verkürzte Wahrnehmung des dritten Artikels ausmachen, denn auch die eschatologisch-pneumatologische Dimension wird zu wenig bedacht. Die pneumatologische Gemeindelehre hat sich vielfach zu einem Reizthema auch unter den Charismatikern entwickelt. Es gibt unterschiedliche Gemeindeaufbaukonzepte. Während die innerkirchlichen Bewegungen auf die charismatische Erneuerung der bestehenden Ortsgemeinden zielen, wählen andere den Weg der Gemeindeneugründung. Hier entfaltete sich eine Vielzahl von verschiedenen ekklesiologischen Entwürfen (Hauskirchen, ökumenische Gemeinschaften, Kommunitäten, freie unabhängige Ortsgemeinden). Die Neugründungen sind oft begründet in der Ablehnung der bestehenden Kirchen und Freikirchen. Die Pfingstkirchen haben sich zur eigenen Kirchenbildung entschieden und bieten ekklesiologisch vielen charismatischen Gruppen und Gemeinschaften ein konfessionelles Zuhause. Die charismatischen Erneuerungsbewegungen in den traditionellen Kirchen und Freikirchen meiden zum Teil die Frage nach einer vom Geist Gottes geprägten Gemeindelehre. In diesem Sinne setzt die Charismatische Erneuerung in der katholischen Kirche in Deutschland den Akzent sehr eindeutig und zum Teil auch einseitig auf die geistliche Erneuerung des Einzelnen. Die Reduzierung des Geisteswirkens auf Themen wie Geistestaufe, Geisterfüllung oder auch auf die Freisetzung einzelner Charismen hat den missionarischen Schwung der charismatischen Bewegungen enorm ausgebremst.
Der Geist Gottes ist ein Geist der Mission in dieser Welt, nicht nur ein charismatischer Geist. Er ist der Geist des Lebens, der auch an all die vertrockneten Orte dieser Welt gelangen will. Ein neues Nachdenken über diesen Geist der Mission finden wir bereits bei dem jungen Karl Barth.25 In Anlehnung an Barths Redeweise von der „Actio Dei“ prägte der Missiologe Karl Hartenstein26 den Begriff der „Missio Dei“ (Sendung Gottes), um deutlich zu machen, dass Mission eine Aktion des dreieinen Gottes selbst ist und nicht nur eine menschliche Reaktion auf den Missionsauftrag Jesu. In jüngerer Zeit nahmen die Missiologen Lesslie Newbigin27, David J. Bosch28 oder auch Paul Hiebert29 die Fragestellungen auf, wie diese Mission Gottes sich in der jeweiligen Kultur ereignen kann. Die Veränderung der Gesellschaft wurde in der Perspektive des angebrochenen Gottesreiches als Ziel dieser Mission gesehen, und nicht allein die Erfahrung der versöhnenden Erlösung des einzelnen Menschen. Alan Hirsch und Michael Frost30, Alan J. Roxburgh31, Ed Stetzer32 oder auch die deutschen Theologen Johannes Reimer33, Roland Hardmeier34 und Tobias Faix35 nahmen diesen ganzheitlichen inkarnatorischen Ansatz36 der Mission auf und verwendeten hierfür den Begriff „missional“. Im Unterschied zum langläufig verwandten Terminus „missionarisch“ bezeichnet „missional“ ein ganzheitliches Verständnis von der Sendung Gottes in alle Bereiche des Lebens.
„Eine missionale Kirche definiert sich vor allem aus ihrer Berufung zur Mission und entwickelt ihr Wesen und alles Handeln aus dieser Sendung als Trägerin von Gottes Mission in dieser Welt. Das Ordnungsprinzip von Kirche ist Mission. Wenn Kirche ihre Mission lebt, ist sie wirklich Kirche. Kirche selbst ist nicht nur das Produkt von Mission, sondern sie muss diese Mission mit allen Mitteln weiter führen – darin liegt ihre Bestimmung. Die Mission Gottes drückt sich in jedem Glaubenden aus und in jeder Gemeinschaft, die sich auf Jesus beruft. Diese Mission zu behindern, heißt Gottes Absicht mit und durch sein Volk zu behindern.“37
Ich habe mit großem Interesse und Gewinn die Literatur zu einer neuen missionalen Theologie gelesen. Bei aller Wertschätzung ist mir jedoch aufgefallen, dass die Pneumatologie auch darin leider nur eine sehr untergeordnete Darstellung findet. Ähnlich ist es in der Literatur zur Emerging Church38. Die Emerging Church ist eine dezentrale, stark heterogene Reformbewegung von verschiedenen Christen, die in ihrem Umfeld und ihrer Tradition auf die Fragestellungen der angebrochenen Postmoderne reagieren wollen. Theologisch gibt es nur eine konturenhafte Homogenität in dieser Reformbewegung. Viele Vertreter versuchen im Prinzip ihrer kirchlichen Tradition theologisch treu zu bleiben, aber sie setzen neue Akzente in der Spiritualität und in der gemeindlichen Kultur. Gemeinde Jesu wird als ein Netzwerk verstanden. Der Dialog mit der jeweiligen Kultur wird gesucht. Zur Orthodoxie (Rechtgläubigkeit) kommt die Orthopraxie (das rechte Handeln).39 Doch welche Bedeutung kommt dem Heiligen Geist zu, wenn es um eine Weiterentwicklung der Gemeinde in der Postmoderne geht? Wie korrespondiert das neue Nachdenken über die sich weiterentwickelnde Gemeinde Jesu (Emerging Church) oder über die neue missionale Ekklesiologie mit dem Wirken des Geistes Gottes?
Ich will versuchen, in diesem Buch einige Grundlagen für eine missionale Pneumatologie zu beschreiben. Ich tue es in der Hoffnung, dass wir den „Weitwinkel“ für das umfassende Wirken des Heiligen Geistes in dieser Welt, in der Gemeinde Jesu Christi und in jedem einzelnen Menschen neu in den Blick bekommen. Jedes Nachdenken über die Gemeinde Jesu Christi hängt theologisch untrennbar mit dem Nachdenken über das Wesen und Wirken des Heiligen Geistes zusammen. Ekklesiologie und Pneumatologie sind deshalb nicht getrennt voneinander zu betrachten. Es sind nicht die emergenten, missionalen neuen Gemeindeformen, die eine neue Belebung oder eine Reanimation der vom Todeskeim geprägten Kirchen und Gemeinschaften hervorbringen, sondern es ist der Geist des Lebens, es ist dieses Wasser der Lebendigkeit, der Schönheit, der Weisheit und der Wahrheit, das auch heute schon unter den Türschwellen der Kirchen hervorquillt.
1.Der trinitarische Geist Gottes – sein Wesen und seine Personalität
Heute denke ich daran mit einem gewissen Schmunzeln. „Und nun singen wir das schöne Lied ‚O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein!‘“ Freudestrahlend lädt der Pastor die Gemeinde dazu ein, dieses bekannte Pfingstlied anzustimmen. In der anschließenden Predigt nimmt er Bezug auf die Ausgießung des Heiligen Geistes und betont, dass wir als Gläubige diesen Geist empfangen haben. Die ungläubige Welt jedoch verstehe nichts von alledem, betont der engagierte Prediger. Er fährt fort: „Der Geist Gottes ist den Nichtchristen ja noch nicht geschenkt. Sie leben in Verblendung der Sünde. Wohl gibt es auch unter Christen Verwirrung, wenn sie sich zu sehr auf den Geist konzentrieren und dabei Jesus aus dem Blick verlieren.“ Auch die Anbetung des Geistes Gottes ist nach Ansicht des Predigers unangemessen. „Wir beten Gott den Vater an durch unseren Herrn Jesus Christus. Das tun wir zwar in der Kraft des Heiligen Geistes, aber wir beten nicht zum Geist Gottes!“ Der Pastor war sehr überzeugt von dem, was er da sprach. Hier und da sehe ich ein betont zustimmendes Nicken in dieser evangelikal-pietistisch geprägten Versammlung. Doch dann kommt die eigentliche intellektuelle Aufgabe für die Zuhörerschaft – so empfinde ich es jedenfalls nachträglich. Die Gemeinde wird nämlich nun aufgefordert als „Antwort auf die Verkündigung“ den Pfingstchoral „Nun bitten wir den Heiligen Geist um den rechten Glauben allermeist“ anzustimmen. „Irgendetwas passt hier nicht zusammen“, denke ich! Darf man nun zum Heiligen Geist beten oder nicht?
Die Lehre über den Heiligen Geist hat gerade in evangelikalen Kreisen allzu häufig eine theologische Schlagseite, die verheerende Auswirkungen haben kann. Die vielfach vertretene Auffassung, dass der Geist Gottes ja nur in der Kirche und im Herzen eines durch den Heiligen Geist neu geborenen Gotteskindes wirken würde, macht nach wie vor die Runde. Die Devise lautet: „Diese Welt ist versumpft in ihrer Sünde und der Verstand des unerlösten Menschen ist verfinstert. Da kann mir dann nichts Gutes begegnen.“ Mit einer solchen Einstellung ging ich ins Studium und merkte, wie groß deshalb anfänglich die inneren Barrieren waren, mich den Aussagen der Humanwissenschaften (Psychologie, Pädagogik) zu stellen. Wie sollte jemand, der den Geist Gottes nicht empfangen hatte, überhaupt zu tragfähigen Aussagen über Gottes Schöpfung, über den Menschen kommen? Es mag anmaßend klingen und es war und ist sicher auch vermessen, so zu denken und zu argumentieren. Aber so war meine Prägung, die ich jahrelang in mich aufgenommen hatte: Die Welt ist böse, die Kirche ist gut. Wir sind als Botschafter in diese Welt gesandt. Wenn hier jemand umdenken musste, dann waren es immer die anderen. Das ist natürlich keine gute Grundlage zu Beginn eines Studiums! Es ist auch keine gute Grundlage für einen missionalen Lebensstil.
Heute hat sich – Gott sei es gedankt – meine Wahrnehmung verändert. Und das hängt sehr stark mit meiner Sicht zusammen, die ich vom Wesen und von der Personalität des Heiligen Geist gewonnen habe.
1.1Das Wirken des Geistes in der Geschichte
Der Geist Gottes tritt nicht erst mit dem Pfingstereignis auf den Plan. Die Bibel bezeugt uns sein Wirken durch die gesamte Geschichte hindurch.
a.Der Schöpfergeist
Der Geist Gottes ist der Geist des Lebens. Dies ist der Geist, der bei der Schöpfung dieser Welt gestaltend war und bleibt. Als Gott Himmel und Erde schuf, schwebte der Geist Gottes (hebr. ruach elohim) über dem Wasser (1Mo 1,2).40 Die Weisheitsliteratur des AT bezeugt, dass jeder Mensch sein Leben durch den Geist Gottes eingehaucht bekommen hat (Hiob 33,4; Ps 104,30; Weish 1,7). Nicht nur das menschliche Leben ist von Gottes Ruach durchhaucht, sondern die ganze Schöpfung, der gesamte Kosmos trägt in sich den Atem Gottes.41 Keine Pflanze, kein Tier, kein Stein und kein Sandkorn ist ohne den Geist Gottes denkbar. Die Schöpfung ist ein trinitarischer Akt und sie ist nicht nur Gott dem Vater zuzuordnen oder bestenfalls noch auf Christus hin zu deuten (vgl. Kol 1,15f). Der Geist Gottes ist ebenso der Schöpfer.42
Diese Erkenntnis führt allerdings zu einer der zentralen Fragen der Pneumatologie: In welchem Verhältnis stehen Schöpfung und Erlösung? Ohne Zweifel ist auch heute noch die Tendenz erkennbar, die viele Jahrhunderte die Theologie und Frömmigkeit geprägt hat: Der Heilige Geist wird allein als ein Geist der Erlösung verstanden, der dann folgerichtig seinen Ort auch lediglich unter den Erlösten, sprich in der Kirche, haben kann. Ein solches Verständnis vom Geist entfremdet die Christen von einer Welt, die scheinbar ohne Gott ist. Es isoliert die „Heiligen“ von den „Unerlösten“, es trennt Kirche und Welt und führt zu einer „Kommunikationsunfähigkeit der Kirche in ihrer Erfahrung des Geistes gegenüber der Welt“.43 Wird hingegen der Schöpfergeist und der Erlösergeist in einer Einheit gesehen, so bietet sich eine neue Kommunikationsebene und eine Grundlage für ein missionales Verständnis. Die hartnäckige Tendenz der Trennung von Schöpfergeist und Erlösergeist ist vor allem in der anhaltenden Platonisierung des Christentums begründet, die eine leib- und naturfeindliche Weltabgeschiedenheit propagiert. Auch die begrenzte Wahrnehmung, den Geist Gottes nur noch als Geist Christi und nicht auch als Geist des Vaters wahrzunehmen, hat hier ihre Folgen gehabt.44
Heute steht nicht allein der Mensch im Mittelpunkt der Fragestellung. Vielmehr wird nach der „immanenten Transzendenz“ (J. Moltmann)45 in der gesamten Schöpfung gefragt. Die Kontinuitätsfrage beschränkt sich nicht auf die Anthropologie, sondern betrifft den gesamten Kosmos. Geisterfahrung ist nicht nur Selbsterfahrung, sondern ein konstitutives Element in der Gemeinschafts- und Naturerfahrung. Je mehr ein Mensch vom Geist Gottes ergriffen und geprägt ist, umso mehr wird er das Wirken des Geistes in der Schöpfung und in allem Leben wahrnehmen und auch ehren. Albert Schweitzer hat daraus seine Ethik des Lebens entwickelt, die er treffend „Ehrfurcht vor dem Leben“ nannte.46
Dennoch bleibt die Frage, wie sich die Sünde auf die Wahrnehmung und auf die Wirksamkeit des Geistes im Leben eines Menschen und in diesem gesamten Kosmos auswirkt. Die Sündenrealität verdunkelt, sie vernebelt und sie hemmt das freie Heilswirken des Geistes Gottes. Die Wahrnehmung in einer von Sünde geprägten Welt ist zu vergleichen mit einem Glas trüben Wassers. Hier sehen wir nicht nur die Elemente, die das Wasser trübe machen, sondern wir sollten auch erkennen, dass da nach wie vor Wasser ist. Sünde, Tod und Niedrigkeit führen allerdings nicht dazu, dass der Geist Gottes seine klare Kreativität und Wahrheit nicht weiter entwickeln kann. Aber die Bibel bezeugt, dass der Geist Gottes auch da erfahrbar ist, wo die Folgen der Sünde das Leben prägen, wo Schwachheit, Krankheit und Tod Einzug halten. Er wirkt auch in all den Tiefen und Finsternissen des Lebens. L. Dabney zeigt auf, dass die Kenosis des Geistes (= die sich selbst entäußernde Kraft) durchgängig im Leben Jesu wirksam war, auch in dem Moment, als er ausrief: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen!“47 In den Zerbrochenheiten und Rissen des Lebens ist der Geist Gottes ebenso wirksam und wahrnehmbar wie in den Heilungen und in der Überwindung aller Todesrealität.
Die Erkenntnis, dass der Erlösergeist, der Geist von Pfingsten, kein anderer Geist ist als der Schöpfergeist, dass der Erlösergott kein anderer Gott ist als der Schöpfergott, führt zu einer neuen Sicht und Spiritualität im Leben eines vom Geist Gottes erfüllten Menschen. Er kann tiefgehende Geisterfahrungen nicht nur machen, indem er sich spirituellen Übungen und kontemplativen Erfahrungen hingibt, sondern mitten im Alltag des natürlichen Lebens. Alles Natürliche wird für den vom Geist Gottes erfüllten Menschen heilig, sprich: gott-zugehörig. Er bringt es in Verbindung mit Gott. Alles Heilige trägt auch den befreienden Charakter des Natürlichen. Die neueren Ansätze zu einer ökologischen Theologie, zu einer kosmischen Christologie oder einer ökumenischen Ekklesiologie setzen die Identität des erlösenden und schöpferischen Geistes voraus. Zusammenfassend betont Jürgen Moltmann die Notwendigkeit einer solchen ganzheitlichen Sicht der Pneumatologie:
„Die Gemeinschaft des Geistes führt die Christenheit notwendig über sich selbst hinaus in die größere Gemeinschaft aller Geschöpfe Gottes. Auch die Schöpfungsgemeinschaft, in der alle Geschöpfe miteinander, füreinander und ineinander existieren, ist Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Beide Erfahrungen des Geistes stellen die Kirche Christi heute in Solidarität mit dem tödlich bedrohten Kosmos. Angesichts des Endes der Natur werden die Kirchen die kosmische Bedeutung Christi und des Geistes entdecken oder sie werden an der Vernichtung der irdischen Schöpfung Gottes mitschuldig. Was in früheren Zeiten als Lebensverachtung, Leibfeindlichkeit und Weltabgeschiedenheit nur eine innere Einstellung war, ist heute alltägliche Wirklichkeit im Zynismus der fortschreitenden Naturzerstörung. Die Entdeckung der kosmischen Weite des Geistes führt dagegen zum Respekt der Würde aller Geschöpfe, in denen Gott durch seinen Geist anwesend ist. In der gegenwärtigen Situation ist diese Entdeckung nicht romantische Poesie oder spekulative Vision, sondern die notwendige Voraussetzung für das Überleben der Menschheit auf Gottes einmaliger Erde.“48
Nicht nur der Respekt und die Ehrfurcht vor dem Leben sind die Folge einer solchen ganzheitlichen pneumatologischen Sicht, sondern auch ein umsichtiges Wahrnehmen des Geisteswirkens bei Menschen in anderen Kulturen und Religionen. Bereits im AT finden wir Ansätze für ein Verständnis, welches das Geisteswirken auch bei nichtjüdischen Menschen oder Völkern erkennt und erwartet. Der Perserkönig Kyros, der die Exilierten aus Babel wieder heimziehen lässt, wird als Werkzeug Jahwes gesehen, als ein vom Geist Gottes Gesalbter (Jer 27,4–11; Jes 4,5). Herausragend ist ebenso die Aussage im Prophetenbuch Maleachi. Dort wird nicht nur gesagt, dass die Völker eschatologisch zu Jahwe umkehren werden, sondern dass jetzt schon in allen Völkern, in anderen Religionen und Kulturen Jahwe unbewusst verehrt wird. „Auf der ganzen Welt werde ich verehrt, an allen Orten bringen mir die Menschen Opfergaben dar, die mir gefallen, und lassen den Rauch zu mir aufsteigen. Ja, alle Völker ehren mich, den allmächtigen Gott“ (Mal 1,11).49 Vielleicht hatte Paulus diese Aussagen vor Augen, als er vor den Athenern von dem allumfassenden Urgrund sprach und den „unbekannten Gott“ verkündete, durch den allein wir leben und handeln (Apg 17,28). Die Schlussfolgerungen im 1. Johannesbrief können in ähnlicher Weise verstanden werden: Gott ist die Agape-Liebe (1Joh 4,8.16) und alle menschliche Agape-Liebe stammt aus Gott (1Joh 4,7). Folglich ist jeder, der liebt und Gerechtigkeit tut, aus Gott gezeugt (1Joh 2,29). Missionale Pneumatologie spürt das Wirken des Geistes Gottes auch in anderen Kulturen und Religionen auf, um Menschen auf die Quelle dieser Liebe in Jesus Christus hinzuweisen. Zudem ist bei allem Bemühen um eine komparative und dialogische Religionswissenschaft daran festzuhalten, dass in Jesus Christus die Liebe Gottes erschienen ist und er der Weg zum Vater ist.
Das Zweite Vatikanische Konzil (1962–1965) formulierte hierzu Folgendes: Alles, „was sich an Gutem und Wahrem bei ihnen (den anderen Religionen und Kulturen) findet“, ist „Gabe dessen, der jeden Menschen erleuchtet“ (LG 16). Damit vertritt Vatikanum II religionstheologisch einen Inklusivismus, der davon ausgeht, dass die volle und endgültige Offenbarung in Christus erfolgt ist, aber andere Religionen und Kulturen auch Wahres und Heiliges enthalten können.50 Missionale Pneumatologie spürt diese Werte des Wahren und Heiligen in anderen Religionen und Kulturen auf und weist zugleich auf den Ursprung und die Quelle des Heils in Christus hin.51 Christen sind überzeugt, dass das Wort Gottes in Jesus Christus die tiefste und vollkommene Offenbarung ist. Ohne Orientierung an Jesus, der von dem Geist der Liebe, der Güte und Gerechtigkeit geprägt ist, können wir nicht erkennen, ob irgendwo der Geist Gottes sich manifestiert. Wenn etwas der Botschaft von Jesus widerspricht, dann kann es nicht vom Geist Gottes stammen. Der notwendige interreligiöse Dialog und der Dialog der Weltanschauungen wird bereichert durch eine komparative Theologie, die auch spirituelle Erfahrungen mit einbezieht und sich nicht nur auf doktrinärer bzw. wissenschaftlicher Ebene bewegt.52 Die Pneumatologie eröffnet somit neue Zugänge zum notwendigen interreligiösen Dialog.
b.Der Geist Gottes in alttestamentlicher Zeit
Gottes Geist wirkt nicht nur in der Schöpfung, sondern sein Wirken wird auch im Leben des alten Bundesvolkes bezeugt. Der Geist Gottes wirkte in der Väterzeit. Von Joseph wird berichtet, dass er durch den Geist Gottes Träume und die Fähigkeit der Traumdeutung bekam (1Mo 41,38). Erst in der Richterzeit begegnet jedoch ein gezielter Gebrauch des Begriffs der Ruach Gottes.53 Hier werden Menschen durch den Geist Gottes mit Kraft zugerüstet, die ihnen geradezu Unmögliches ermöglicht (Ri 3,10; 6,34; 11,29; 14,6; 16,10; 1Sam 11,6). Der Geist Gottes kommt über die erwählten Personen und erfüllt sie mit großer Energie und Weisheit. Dabei verschweigt das biblische Zeugnis nicht, dass es sich hierbei um fehlerhafte Menschen handelt. M. Welker konstatiert über diese charismatischen Führungspersonen der frühen Zeit: „Nicht nur unvollkommene, endliche, sterbliche Menschen, sondern auch Außenseiter, Zweifler, Misstrauische, Machtbewusste, die auch vor Bedrohung und Erpressung ihrer Mitmenschen nicht zurückschrecken – so werden die „frühen Charismatiker“ von den biblischen Texten gekennzeichnet.“54
Diese ersten Zeugnisse vom Wirken des Geistes Gottes berichten von einem unerwarteten Eingreifen Jahwes und von der Erneuerung der Einmütigkeit des Volkes. In all diesen frühen Bezeugungen der Erfahrung des Geistes Gottes geht es primär um die Wiederherstellung von Ordnung, Einheit und Solidarität. Er befähigt einzelne Frauen und Männer im Volk Israel, Leitung zu übernehmen. Als Mose 70 Männer ausgewählt hatte, die ihn in der Leitung unterstützen sollten, wurde ihnen der Geist Gottes verheißen (4Mo 2,16f). Josua, der Nachfolger von Mose, wurde ebenfalls mit Gottes Ruach erfüllt (1Mo 27,18–23; 5Mo 34,9). In der folgenden Königszeit wird von David berichtet, dass der Geist Gottes auf ihn kam, als Samuel ihn salbte (1Sam 16,13). Die Psalmgebete bezeugen das Bewusstsein der Wirkung des Geistes Gottes in der individuellen Spiritualität (Ps 51,13; 143,10).