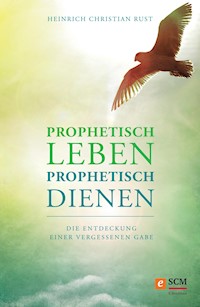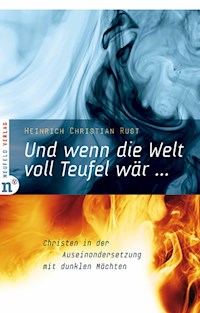
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neufeld Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
In den letzten Jahren erwachte ein neues Bewusstsein für die Existenz des Bösen. In diesem Buch zeichnet Heinrich Christian Rust ein Bild dieses realen Kampfes zwischen Gut und Böse. Indem er die Aussagen der Bibel zur unsichtbaren Wirklichkeit wahr- und ernst nimmt, gelingt ihm eine nüchterne Bestandsaufnahme. Zwischen fundamentalistischer Schwarz-Weiß-Malerei, rationalistischer Leugnung und charismatischer Erfahrungs-Theologie findet Rust zu einer biblisch begründeten Position. Dabei bleibt das Buch nicht theoretisch: Am Ende gibt der Autor auch handfeste Ratschläge für den Umgang mit dämonischen Belastungen in der Praxis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heinrich Christian Rust
Und wenn die Weltvoll Teufel wär …
Christen in der Auseinandersetzung mit dunklen Mächten
Zu diesem Buch
In den letzten Jahren erwachte ein neues Bewusstsein für die Existenz des Bösen. In diesem Buch zeichnet Heinrich Christian Rust ein Bild dieses realen Kampfes zwischen Gut und Böse.
Indem er die Aussagen der Bibel zur unsichtbaren Wirklichkeit wahr- und ernst nimmt, gelingt ihm eine nüchterne Bestandsaufnahme. Zwischen fundamentalistischer Schwarz-Weiß-Malerei, rationalistischer Leugnung und charismatischer Erfahrungs-Theologie findet Rust zu einer biblisch begründeten Position.
Dabei bleibt das Buch nicht theoretisch: Am Ende gibt der Autor auch handfeste Ratschläge für den Umgang mit dämonischen Belastungen in der Praxis.
„Ein wesentlicher und unentbehrlicher Beitrag zu einer Diskussion, der wir nicht länger ausweichen sollten.“
Dr. Roland Werner im Vorwort
Über den Autor
Dr. Heinrich Christian Rust, geboren 1953, ist Pastor einer Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in Braunschweig. Er ist verheiratet mit Christiane und Vater von drei erwachsenen Kindern.
Nach dem Studium in Hamburg und Leuven/Belgien war er Landesjugendpastor in Niedersachsen, Gemeindepastor in Hannover und Referent für missionarische Gemeindedienste im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland (EFG). Seit 2003 ist er Pastor einer Baptistengemeinde in Braunschweig.
Heiner Rust ist auch als Autor und Referent bekannt und war Sprecher des Kreises Charismatischer Leiter sowie Delegierter im Theologischen Ausschuss der Lausanner Bewegung. Er engagiert sich in zahlreichen Initiativen, darunter auch im Vorstand des Christlichen Gesundheitskongresses sowie im Institut für Gemeindebau und Weltmission Deutschland.
Weitere Veröffentlichungen von Dr. Heinrich Christian Rust (Auswahl):
Beten – 7 Gründe, warum ich es tue. Neufeld, Schwarzenfeld 2006
Charismatisch dienen – gabenorientiert leben. Oncken, Kassel 2006
Geist Gottes – Quelle des Lebens. Grundlagen einer missionalen Pneumatologie. Neufeld, Schwarzenfeld 22015
Gemeinde der Zukunft. Aufbrechen aus der Stagnation. Oncken, Kassel 2006
Gemeinde lieben – Gemeinde leiten. Oncken, Kassel 1999
Prophetisch leben – prophetisch dienen. Die Entdeckung einer vergessenen Gabe. SCM R. Brockhaus, Witten 2014
Relevante Gemeinde. Die Gemeinde von morgen beginnt heute. Oncken, Kassel 2009
Über allem die Liebe. Zehn Predigten. Oncken, Kassel 2011
Wie unser Christsein neu werden kann. Der 5x5-Kurs. Oncken, Kassel 2004
Impressum
Dieses Buch als E-Book:ISBN 978-3-86256-763-8
Dieses Buch in gedruckter Form:ISBN 978-3-937896-55-7, Bestell-Nummer 588 655
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet über www.d-nb.de abrufbar
Bibelzitate, soweit nicht anders angegeben, sind der Bibel, Revidierte Elberfelder Übersetzung, entnommen. © 1985/1991/2006 R. Brockhaus Verlag, Wuppertal. Verwendet mit freundlicher Genehmigung des Verlages
Umschlaggestaltung: spoon design, Olaf JohannsonUmschlagbild:Shutterstock.comSatz: Neufeld Verlag
© 2007 Neufeld Verlag Schwarzenfeld
(Überarbeitete Neuauflage: Eine frühere Ausgabe dieses Buches erschien 2002 im Verlag Projektion J, Asslar)
Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages
www.neufeld-verlag.de / www.neufeld-verlag.ch
Bleiben Sie auf dem Laufenden:www.newsletter.neufeld-verlag.dewww.facebook.com/NeufeldVerlagwww.neufeld-verlag.de/blog
Mehr E-Books aus dem Neufeld Verlag finden Sie bei den gängigen Anbietern oder direkt unter https://neufeld-verlag.e-bookshelf.de/
Inhaltsverzeichnis
Zu diesem Buch
Über den Autor
Impressum
Vorwort
Einleitung: Unerwartete Begegnungen
1 Eine Welt – oder viele Welten?
1. Von antiken Weltanschauungen zum rationalistisch-materialistischen Weltbild
2. Konfrontation mit der unsichtbaren Wirklichkeit
3. Biblische Grundaussagen zu einer ganzheitlichen Weltsicht
a) Es gibt (nur) einen Gott
b) Gott ist der Schöpfer der sichtbaren und unsichtbaren Welt
c) Die Realität des Bösen wird als antigöttliche Macht bezeugt
d) Der Mensch ist für die Gemeinschaft mit Gott und Menschen geschaffen
e) Die Sünde des Menschen und ihre Auswirkungen
f) Die Erlösung durch Jesus Christus
g) Das Reich Gottes und das Volk Gottes
h) Der neue Himmel und die neue Erde
i) Die Erkenntnis der biblischen Wirklichkeit
4. Plädoyer für ein zukunftsfähiges Weltbild
a) Die Notwendigkeit der Neu-Deutung biblischer Sprache
b) Die Notwendigkeit der Denkmöglichkeit biblischer Weltsicht
c) Die Notwendigkeit der theologischen Zuordnung satanischen Machtanspruchs
d) Die Notwendigkeit der Zuordnung von Kultur und Weltbild
2 Erfahrene Wirklichkeit und biblische Wahrheit
1. Das biblische Wort als Deuterahmen erfahrener Wirklichkeit
2. Erfahrungen und Erkenntnisse, die in der Bibel nicht bezeugt werden
a) Die Christus-Zentriertheit
b) Die Übereinstimmung mit dem biblischen Zeugnis
c) Die Beurteilung durch die Gemeinde
3. Sprache als Denkmuster
a) Die personhafte Sprache
b) Ontologische Sprache
c) Definitionen
4. Was bedeutet bibeltreu? Sieben Thesen
a) Die biblischen Texte haben sowohl historische Faktizität als auch metaphysischen Charakter.
b) Die Bibel beschreibt die eine Wirklichkeit, die nicht allein durch den Verstand wahrgenommen werden kann.
c) Im Zentrum der biblischen Wirklichkeit steht die Christusoffenbarung.
d) Die Autorität der biblischen Schriften ist begründet in ihrer Inspiriertheit durch den Heiligen Geist und der von der Kirche autorisierten Kanonbildung.
e) Es gibt eine ganze Reihe von metaphysischen Erfahrungen und Erkenntnissen, die in den Schriften der Bibel nicht bezeugt werden, die dennoch als real anerkannt werden müssen.
f) Der metaphysische Charakter biblischer Offenbarung zeigt auch Grenzen der Sprache auf.
g) Die unterschiedliche Begrifflichkeit der biblischen Texte macht eine sorgfältige Definition notwendig, um lehrmäßige Klarheit zu erzielen.
3 Der Einfluss des Bösen
1. Die Gestalt des Bösen
2. Die Erfahrungsebenen des Bösen
a) Die individuelle Ebene
b) Die gemeindliche Ebene
c) Die gesellschaftliche Ebene
d) Die kosmische Ebene
3. Das Wesen und die Taktik des Bösen
a) Der Versucher
b) Der Lügner
c) Der Mörder
d) Der »Engel des Lichtes«
e) Der Besiegte
4. Vom Ursprung des Bösen
a) Metaphysischer Dualismus
b) Monismus
c) Unerklärbarkeit
d) Das »Nichtige«
e) Resultat des Missbrauchs menschlicher Freiheit
f) Gefallener Engel
Fazit
5. Vom Ende des Bösen
a) Die große Drangsal (Offb. 7, 1–17)
b) Der Antichrist
c) Die Wiederkunft Jesu Christi und das Gericht über den Antichristen
d) Die Bindung Satans und das Tausendjährige Reich
e) Das endgültige Gericht über Satan
6. Die Hölle
a) Die Hölle ist nicht dasselbe wie das Totenreich
b) Der Feuerpfuhl
c) Die Ewigkeit der Verdammnis
4 Die Macht Gottes
1. Gott als alleiniger Schöpfer
2. Die Sendung Jesu Christi in die Welt
3. Der Sieg Jesu Christi durch Kreuz und Auferstehung
4. Die Macht des Heiligen Geistes
a) Der evangelistische Dienst des Heiligen Geistes
I. Der Nicht-Glaube an Jesus ist Sünde
II. Die Gerechtigkeit
III. Das Gericht
b) Der organisch-umgestaltende Dienst des Heiligen Geistes
c) Der charismatische Dienst des Heiligen Geistes
d) Der pädagogische Dienst des Heiligen Geistes
5. Der Dienst der Engel
a) Der Ursprung der Engel
b) Die Funktionen und das Wesen der Engel
5 Die Verantwortung des Menschen
1. Personsein und Freiheit – der Mensch als Gottes Ebenbild
2. Verlorene Freiheit – die Macht der Sünde
a) Die Sündenerkenntnis
b) Die Versuchung zur Sünde
c) Der gefallene Mensch – Die Lehre von der Erbsünde
I. Die Sünde ist unausweichlich
II. Die Sünde ist Schuld
III. Die Sünde verwirklicht sich in den Sünden
IV. Das Ausmaß der Sünde
3. Erlösung und Befreiung – die Neuschöpfung des Menschen
4. Leben mit Anfechtungen – Christen als Überwinder
a) Kenne den Feind!
b) Bleibe in der Liebe Gottes!
c) Sei stark in Christus!
d) Sei vom Geist erfüllt!
e) Sei aktiv im christlichen Zeugnis und Dienst!
f) Beeile dich, deine gestörten Beziehungen in Ordnung zu bringen!
g) Ziehe die Waffenrüstung Gottes an!
h) Sei beständig im Gebet!
i) Lobe Gott!
5. Macht- und Ohnmachtserfahrungen – die Frage nach einer möglichen Dämonisierung von Christen
a) Das Zeugnis der Bibel in dieser Frage ist nicht eindeutig zu beantworten.
b) Die Erfahrungen unzähliger Christen und Seelsorger bezeugen die Wirksamkeit dämonischer Kräfte im Leben von wiedergeborenen Christen.
c) Die Wirkungsweise der Dämonen ist zu berücksichtigen.
I. Satan wirkt in einer vielfachen Gestalt.
II. Auch Christen werden massiv vom Satan angegriffen.
III. Die Einflussnahme des Satans und seiner Dämonen kann unterschiedliche Auswirkungen haben.
6 Die Autorität der Gemeinde
1. Zwischen Angst und Oberflächlichkeit
2. Beauftragung und Bevollmächtigung
a) Vollmacht ist Teilhabe an Gottes Macht
b) Die Vollmacht Jesu Christi
c) Die Vollmacht der Gemeinde Jesu
d) Die gefährdete Vollmacht
e) Vollmacht und Liebe
f) Vollmacht und Souveränität
7 Die Befreiungsdienste der Gemeinde
1. Die Abwehr dämonischer Angriffe im Leben eines Christen
a) Bewusste neue Hingabe des Lebens an Jesus Christus
b) Vergebung
c) Dämonen gebieten
d) Bitte um Heilung, Stärkung und Erfüllung mit dem Heiligen Geist
2. Der Dienst an dämonisierten Menschen
3. Hilfen zur Diagnose bei Dämonisierungen
a) Sünde im Leben eines Menschen
b) Körperliche und seelische Symptome
c) Okkulte Praktiken
d) Belastung durch die Familiengeschichte oder durch Flüche
e) Identifizierung der Dämonen
f) Geisterunterscheidung
g) Der Rat von Humanwissenschaftlern
4. Der konkrete Vollzug der Befreiung
a) Vorbereitung
b) Bekennen und Lossagen
c) Vollmächtiges Gebieten
d) Dank und Annahme der Befreiung
e) Erfüllung mit dem Heiligen Geist
5. Wenn die Befreiung ausbleibt
8 Die Konfrontation mit überpersönlichen finsteren Mächten
1. Gibt es überpersönliche finstere Mächte?
2. Grundlagen und Strategien der so genannten geistlichen Kampfführung
a) Buße über den Sünden der Städte und Nationen
b) Versöhnungswege
c) Gebetsmärsche und nationale Gebetstage
d) Spiritual Mapping
e) Königin des Himmels
3. Würdigung und Kritik
a) Die Betonung der Evangelisation
b) Die Stärkung des Gebetes
c) Die Bedeutung der Einheit
d) Die Sensibilisierung für die geistliche Dimension der Kultur
e) Der Akzent der Buße
a) Mangelnde biblische Grundlage
b) Die Betonung der Identifizierung von Dämonen und Mächten
c) Sünden einer Nation können nicht vergeben werden
d) Gibt es eine Optimierung satanischer Präsenz in dieser Welt?
e) Es gibt keine Aufforderung zur offensiven Konfrontation
I. Die »Confronters« greifen die dämonischen Mächte direkt an und fordern sie heraus.
II. Die »Moderates« betonen zwar einige Aspekte der geistlichen Kampfführung, wie z. B. das Gebet oder auch die Einheit der Christen, sie bejahen auch die Existenz von überpersönlichen finsteren Mächten, sie reagieren jedoch nur, wenn sie dazu aufgefordert werden.
III. Als dritte Gruppe nennt Thomas White die Konservativen (Conservatives).
4. Ansätze zum weiteren Gespräch
Nachwort
Literaturverzeichnis
Stellungnahme der Consultation »Deliver Us From Evil« der Internationalen Lausanner Bewegung (Nairobi 2000)
Introduction
Origins
Common Ground
Theological Affirmations
Spiritual Conflict in Practice
Warnings
Areas of Tension
Frontiers That Need Ongoing Exploration
Über den Verlag
Meinem Vater Heinrich Rust in Dankbarkeit gewidmet
Ein feste Burg ist unser Gott,
ein gute Wehr und Waffen.
Er hilft uns frei aus aller Not,
die uns jetzt hat betroffen.
Der alt böse Feind
mit Ernst er’s jetzt meint;
groß Macht und viel List
sein grausam Rüstung ist,
auf Erd ist nicht seinsgleichen.
Mit unsrer Macht ist nichts getan,
wir sind gar bald verloren;
es streit’ für uns der rechte Mann,
den Gott hat selbst erkoren.
Fragst du, wer der ist?
Er heißt Jesus Christ,
der Herr Zebaoth,
und ist kein andrer Gott,
das Feld muss er behalten.
Und wenn die Welt voll Teufel wär
und wollt uns gar verschlingen,
so fürchten wir uns nicht so sehr,
es soll uns doch gelingen.
Der Fürst dieser Welt,
wie saur er sich stellt,
tut er uns doch nicht,
das macht, er ist gericht’.
Ein Wörtlein kann ihn fällen.
Aus: Ein feste Burg ist unser Gott
Martin Luther 1529
Vorwort
Zuerst einmal: Dies ist ein wichtiges Buch zur richtigen Zeit. Heinrich Christian Rust versucht, dem Phänomen des Bösen auf die Spur zu kommen. Und zwar nicht sensationsheischend oder spekulativ, sondern aus einer geistlich-theologischen Verantwortung heraus.
Dabei spannt er den Bogen weit: Ausgehend von einem geistesgeschichtlichen und theologiegeschichtlichen Abriss der verschiedenen Versuche, das Böse zu verstehen und zu deuten, über die gegenwärtige innerevangelikale Diskussion um die Fragen der so genannten »geistlichen Kampfführung« bis hin zu praktischen Ratschlägen für das Befreiungsgebet für Menschen, die unter den zerstörerischen Einfluss dämonischer Mächte geraten sind.
Deutlich wird dabei das ehrliche Bemühen, den verschiedenen Meinungen und Ansätzen gerecht zu werden, ohne die eigene Position zu verleugnen. Das ist wohltuend.
Wohltuend ist auch, dass im Hintergrund der ganzen Darstellung die Überzeugung zu spüren ist, dass Gott in Jesus den Sieg über das Böse und den Bösen schon längst errungen hat. Diese Gewissheit nimmt alle Überlegungen aus der halb-düsteren Atmosphäre von Neugier und ängstlichem Schauer heraus. Aus allen Ecken und Enden strahlt das helle Licht der Auferstehung von Jesus, die die Grundlage des Sieges über alle Gewalt des Teufels in seinen verschiedenen Formen und Fratzen ist. Diese Siegesgewissheit garantiert, dass wir es hier mit einer wahrhaft evangelischen, also dem Evangelium entsprechenden Darstellung zu tun haben.
Ein weiterer hilfreicher Aspekt bei diesem Buch ist, dass Heiner Rust in sich beides vereint: Die persönliche Erfahrung bei der Befreiung von dämonisch belasteten Menschen und die geisteswissenschaftlich-theoretische Reflexion. Das macht dieses Buch lesenswert sowohl für den Theologen, der um ein Weltbild ringt, das den Realitäten des multi-religiösen 21. Jahrhunderts angemessen ist, als auch für den Pastoren und Seelsorger, der mit den Nöten, Ängsten und Bedrängnissen der Menschen direkt konfrontiert wird.
»Und wenn die Welt voll Teufel wär …« – dieses Zitat aus dem bekannten Reformationslied fasst die glaubensvolle Weite und die seelsorgerische Konkretheit dieser Darstellung von Heiner Rust zusammen.
Ich wünsche diesem Buch eine weite Verbreitung. Es ist sicher nicht das letzte Wort, aber doch ein wesentlicher und unentbehrlicher Beitrag zu einer Diskussion, der wir in der Christenheit nicht länger ausweichen sollten.
Roland Werner, Marburg
Einleitung
Unerwartete Begegnungen
Wenn nun der Sohn euch freimachen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Johannes 8,36
Eigentlich habe ich mich nie sonderlich für den Teufel und seine Machenschaften interessiert. Irgendwie hatte ich auch den Eindruck, dass es für mich gefährlich werden könnte, obwohl ich in einem christlichen Elternhaus groß geworden bin. Aber komisch war es doch: Da bekam ich als kleiner Junge ein wunderschönes Kasperle-Theater geschenkt. Natürlich waren auch die putzigen Handpuppen dabei: Allen vorweg Kasperl, und dann der Polizist, die Gretel, ein Krokodil und schließlich ein grimmig dreinschauendes Teufelchen. Man schlüpfte einfach in die Puppen hinein und spielte mit ihnen. Kann und darf man eigentlich mit dem Teufel spielen? Klar, es war ja nur eine Plastikfigur meines Kasperletheaters – und dennoch, gerne habe ich mit dem Teufel nicht gespielt. Meist blieb er in der Ecke liegen.
Denke ich an die Predigten, die meine Kinder- und Jugendzeit geprägt haben, so war auch hier der Teufel »kein Thema«. In unserer kleinen Baptistengemeinde ging ich gerne zum Gottesdienst, und schon früh hörte ich aufmerksam zu, wenn die Pastoren das Wort Gottes verkündigten. Und dann gab es ja auch noch die speziellen Kindergottesdienste und Jungschargruppen. Schon bald hatte ich den Eindruck, dass ich die biblischen Geschichten von Jesus alle gut kannte. Vom Teufel und den Dämonen wurde – so weit ich mich erinnern kann – so gut wie gar nicht gesprochen. Alles lief nach dem Motto: »Wir halten uns an Jesus Christus! Mit diesen anderen Dingen wollen wir nichts zu tun haben!« – Man wusste wohl vom Widersacher Gottes, aber man sprach nicht darüber.
Typisch für diese Grundeinstellung war auch die kleine Geschichte, die man bis heute immer noch auf frommen Kalenderblättchen finden kann: Ein Schüler wird aufgefordert, einen Aufsatz über Gott und den Teufel zu schreiben. Da er aus dem Kindergottesdienst so viele Geschichten von Jesus kennt, schreibt er eifrig die Seiten voll. Schließlich ist die Zeit abgelaufen. Die Lehrerin fordert die Kinder auf, ihre Aufsätze abzugeben. Erschrocken darüber, dass die Zeit schon um ist, schreibt unser fromme Schuljunge folgenden Satz unter seinen Aufsatz: »Entschuldigung, ich bin nicht fertig geworden. Als ich anfing, über Jesus nachzudenken, hatte ich für den Teufel keine Zeit mehr!« So richtig diese Parole klingen mag, so scheint sie mir jedoch ebenfalls gefährlich zu sein.
Auch während meines Theologiestudiums erfuhr ich bei den Vorlesungen nicht viel anderes. Die These Karl Barths (1886–1968) von dem Bösen als dem eigentlich Nichtigen prägte auch in den meisten evangelikalen Seminaren die Diskussion. Doch dann wurde diese Harmlosigkeit erschüttert.
Ich hörte von den bewegenden Berichten einiger Missionare aus Indonesien oder auch aus Südafrika, von den Befreiungen dämonisch belasteter Menschen und dem Siegeszug Jesu in ganzen Landstrichen dieser Welt. Wie gerne wollte ich auch in der Mission meinen Dienst aufnehmen! Noch während meines Theologiestudiums bekam ich die Möglichkeit eines dreimonatigen Missionspraktikums in Sierra Leone, Afrika. Mit zwei weiteren Studenten machte ich mich auf die Reise. Wir kamen in ein Gebiet, wo es gerade einen geistlichen Aufbruch gegeben hatte. Eines Tages durften wir in ein weit entferntes Dorf gehen, um dort zu predigen und die gute Nachricht von Jesus zu verkündigen. Silvanus Valcacel, unser Begleiter, deutete auf einen Mann, der bislang zu den gefürchtetsten Männer der Gegend gehört habe. Er verstünde sich auf die Ferntötung von Menschen. Viele Frauen und Männer seien durch seine okkulte Machtausübung schon zu Tode gekommen. Mit großer Überzeugung fügte Silvanus dann aber hinzu: »Aber unser Herr Jesus Christus hat die Macht über alle finsteren Mächte! Halleluja!« – Mein »Halleluja« war etwas leiser als das meines afrikanischen Freundes. Irgendwie fand ich das schon sehr unheimlich!
Zurückgekehrt aus Afrika wurde ich ernstlich krank, so dass ich mehrfach ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Ärzte konnten meine Krankheit jedoch nicht diagnostizieren. Aus einer Darmverstimmung wurde eine Leberentzündung, aus einer Bauchentzündung wurde eine Tropenkrankheit, aus einer Immunsschwäche wurde schließlich sogar der Verdacht auf Leukämie. Nachdem die Blutwerte einigermaßen stabilisiert waren, entließ man mich aus dem Hospital. Ich war jedoch immer noch sehr schwach, so dass ich kaum laufen konnte.
In einem Gebetskreis berichtete ich von meiner Krankheit. Sicher, viele Menschen hatten in diesen schweren Monaten intensiv für mich gebetet, doch dieses Mal schien es anders zu sein. Die Leiterin des Gebetskreises meinte, es könne sich hierbei um einen dämonischen Angriff handeln, der mit meinem Afrikaaufenthalt zu tun habe. Wir sollten dämonischen Angriffen im Gebet und in der Macht Jesu Christi widerstehen. So schlossen wir uns im Gebet mutig zusammen, verkündeten Jesu Herrschaft in meinem Leben und wiesen die dämonischen Mächte zurück. Sofort spürte ich so etwas wie einen warmen, heilenden Strom, der meinen ganzen Körper durchdrang. Ich stand auf, war gestärkt und fühlte mich vollkommen geheilt! Sofort berichtete ich meinen Angehörigen und Freunden von diesem Wunder. Auch meine Mitstudenten und meine Lehrer im theologischen Seminar freuten sich mit mir. Unser sonst sehr zurückhaltender und wenig enthusiastischer Seminardirektor stieß sogar ein lautes: »Preist den Herrn!« aus, als er erfuhr, dass die Universitätsklinik in Göttingen meine vollkommene Heilung diagnostiziert hatte. Die Freude und Dankbarkeit war groß und ist immer noch groß, wenn ich an dieses Wunder denke, das ich am eigenen Körper erfahren habe.
Dennoch blieben Fragen: Warum hatten dämonische Mächte mich dermaßen attackieren können? Hatte ich die Macht des Bösen nicht richtig eingeschätzt? War ich zu blauäugig in den »geistlichen Kampf« gezogen? Immer wieder höre ich bis heute von den massiven Attacken Satans auf Missionare. Mancher kommt dabei zu Tode. Wieviel Macht hat der Böse?
Diese Erfahrungen haben mich in meinem Dienst als Pastor sensibel werden lassen für die Dimension der unsichtbaren Welt. In den ersten Jahren meines Dienstes hatte ich das große Vorrecht, desöfteren mit dem holländischen reformierten Theologen und Seelsorger Dr. Willem C. van Dam Zusammenarbeiten zu können. In vielen Seminaren und Tagungen habe ich seine nüchterne, biblisch gegründete Einschätzung der Fragen um den Einfluss Satans und die Macht Jesu kennen und schätzen gelernt. Ich habe meine ersten Erfahrungen im Befreiungsdienst in der Seelsorge gemacht; viele Menschen wurden von den Ketten der Finsternis befreit und erlebten innere und äußere Heilungen. In meinem 13-jährigen Gemeindedienst in der Baptistengemeinde in Hannover arbeitete ich mit Pastoren zusammen, die diese Sicht mit mir teilten. Sicher haben wir auch immer wieder Fehler gemacht; unter dem Strich jedoch glaube ich, dass auch in dieser Zeit unzähligen Menschen die Freiheit in Christus geschenkt wurde.
In der Gemeindepraxis wurde ich allerdings damit konfrontiert, dass Menschen nicht allein dämonisiert waren, sondern auch seelisch krank und zerbrochen, traurig und in Sünde lebten. Wo muss man da ansetzen? Muss ein Mensch erst befreit werden, bevor die Heilung geschehen kann? Muss erst Vergebung sein, bevor Heilung geschieht? Müssen im Befreiungsdienst bestimmte Gebete gesprochen werden? Können auch Christen unter dämonischem Einfluss stehen?
Offensichtlich waren wir mit unseren Fragen nicht allein. In den Jahren zwischen 1980 und 1990 erschienen viele hilfreiche Bücher auf dem christlichen Markt, die sich mit diesen komplexen seelsorgerlichen Fragen befassten. Die meisten stammten von amerikanischen Autoren. Einige Seelsorger berichteten von enorm beeindruckenden Erfahrungen und schlossen daraus, dass ihre Sicht der Dinge und auch ihre Form der Seelsorge »funktioniere« und womöglich die einzige oder zumindest die beste sei. Dieser Boom von seelsorgerlich geprägten »Rezeptbüchern«, die alle mehr oder weniger auf Erfahrung basierten, hatte aber auch negative Auswirkungen. So mancher Christ versuchte denn auch, Dämonen auszutreiben, wo es schlicht und einfach nur darum ging, im Gehorsam Jesus Christus nachzufolgen und der Sünde abzusagen. Auch die Zahl derer, die sich durch eine Überbetonung der unsichtbaren Welt schließlich nicht mehr in der sichtbaren Welt zurechtfanden und sogar krank wurden, nahm meines Erachtens zu.
Eine gute, solide theologische Basis und Gemeindelehre über diese Fragen ist auch heute noch der beste Weg, um den Gefahren und Missständen zu wehren. Suchte ich Hilfe und Orientierung bei meinen evangelikal-theologischen Freunden, so stieß ich allerdings häufig auf völliges Unverständnis, wenn es darum ging, dem Unsichtbaren mit einer klaren biblischen Grundhaltung zu begegnen. Alles, was irgendwie nicht »verwort-bar« war – alles, was nicht in die herkömmlichen Sprach- und Denkraster evangelikaler Theologie passte –, wurde mit großer Skepsis gesehen. Eine Erfahrung, die nicht auch an irgendeiner Stelle in der Bibel aufzufinden sei, konnte angeblich auch keinen besonderen Wert haben – oder sie wurde schlichtweg als »unbiblisch« degradiert und damit geradezu als ketzerisch entlarvt.
Besonders eisiger evangelikaler Gegenwind kam mir entgegen, als ich versuchte, die ekstatischen Erfahrungen im geistlichen Leben für zulässig zu erklären, die in den 1990er Jahren auch als »Toronto-Segen« bekannt geworden waren – so genannt nach der Toronto Airport Church, in der diese Erlebnisse erstmals verstärkt auftraten. Obwohl das biblische Zeugnis über Ekstase schmal ist, so konnte es meines Erachtens jedoch nicht völlig aus der Bibel gestrichen werden. Wie biblisch sind wir sogenannten bibeltreuen Theologen wirklich? Sind wir womöglich in einer rational geprägten Wahrnehmung und Deutung des Wortes Gottes so gefangen, dass wir große Teile der biblischen Offenbarung kaum wahrnehmen oder ausblenden?
Immer wieder, wenn es um den ganzen Bereich der unsichtbaren Welt geht, hört man bis heute meist nur Warnungen und Abgrenzungen. Neben dem bekannten englischen Altvater evangelikaler Theologie John Stott waren es in den vergangenen Jahren vor allem die Missiologen des amerikanischen evangelikalen Fuller-Seminars wie C. Peter Wagner, John Wimber oder auch Charles H. Kraft, die sich in die Diskussion einbrachten. Aber auch im deutschsprachigen Kulturraum ist man zurückhaltend. So weist z. B. der Gründer der evangelikalen und charismatischen Anskar-Kirche, Wolfram Kopfermann, in seinem 1995 erschienenen Buch »Macht ohne Auftrag« die Praxis der »geistlichen Kampfführung« deutlich in ihre Schranken. Die unsichtbare Wirklichkeit – auch in ihrer dämonischen Realität – wird hier zwar als gegeben vorausgesetzt, die sich ausbreitende Praxis des aktiven Widerstandes gegen »Territorialmächte« (dämonische Mächte, die ganze Landstriche prägen) aber energisch abgelehnt. Wiederum machte sich Hilflosigkeit in weiten Kreisen der charismatisch geprägten Christenheit breit. Auch hier – wie bereits auf der seelsorgerlichen Ebene der Auseinandersetzungen – stehen die faszinierenden Erfahrungsberichte anscheinend gegen das, was man in der Heiligen Schrift wiederfindet. Besonders herausfordernd waren die Berichte von James und Kim Stanton (Remnat Warrior Christian Ministries) oder auch dem Seelsorgeehepaar Ken und Sylvia Thornberg, die durch ihre Seminare zum Thema Befreiungsdienst in vielen charismatischen Kreisen und Werken in Deutschland eine Praxis an den Tag legten, die zwar in biblischer Hinsicht nur sehr schwach begründet war, jedoch offensichtlich häufig »zum Erfolg« führte. Aber kann das eine biblische Grundlage für einen so sensiblen Bereich der Seelsorge ersetzen?
Ich selber nahm mich in diesen Jahren zurück. Natürlich mochte ich nicht etwas praktizieren und vorantreiben, was womöglich gegen das Zeugnis der Heiligen Schrift ist. Mir fiel auf, dass nicht nur ich Zurückhaltung übte. Auch manche Fürbitter, die in den 1980er Jahren noch überzeugt »im geistlichen Kampf« standen und die freudig bei den aufkommenden Jesus-Märschen mitzogen, schwiegen nun lieber. Aber war das die Lösung? Während das Böse in immer neueren Fratzen auf der Bildfläche des gesellschaftlichen Lebens erscheint, haben wir keinen aktiven Widerstand zu leisten? Am 11. September 2001 wurde die Welt durch den terroristischen Anschlag auf das World Trade Center in New York geschockt. Die Zeitungsüberschriften der folgenden Tage machten deutlich, dass selbst säkularisierte Zeitgenossen von der Macht des Bösen und von satanischen Dimensionen sprechen. Sollen wir kämpfen gegen die Mächte der Finsternis, die sich in unseren Ländern ausbreiten, oder lieber nicht? Bei meinen Gesprächen mit vielen geistlichen Leitern im Land verstärkte sich mein Eindruck, dass dringend Orientierung nötig ist.
In anderen Ländern der Erde gibt es ähnliche Fragestellungen. Mit großem Gewinn nahm ich vom 16. bis 22. August 2000 an einer theologischen Studientagung der weltweiten Lausanner Bewegung in Nairobi/Kenia zum Thema: »Erlöse uns vom Bösen – Geistliche Kampfführung« teil. Die Begegnung mit den erfahrenen Schwestern und Brüdern aus anderen Ländern half mir, die eigene Glaubenspraxis besser zu reflektieren und die theologische Reflexion zum Thema zu vertiefen. Zudem wurde mir deutlich, dass wir in Deutschland auf eine Kirchengeschichte zurückblicken, die uns viele gute Impulse gibt – man denke nur an Martin Luther, an Johann Christoph Blumhardt oder auch an den geistlichen Kampf der Bekennenden Kirche zur Zeit des Dritten Reiches.
Die ganze Thematik der »geistlichen Kampfführung« muss auf einer breiten Basis angegangen werden. Deshalb habe ich mich entschlossen, das vorliegende Buch zu schreiben und die Diskussion auch in unserem Land wieder aufzunehmen. Dabei werde ich zunächst etwas über unser Weltbild nachdenken. Gleich am Anfang soll die Frage nach der Bedeutung der biblischen Aussagen behandelt werden. In den folgenden Kapiteln denke ich über Grundzüge einer biblischen Lehre vom Bösen nach, über die Macht Gottes und schließlich auch über die Verantwortung des Menschen in diesem Zusammenhang. Im letzten Teil des Buches befasse ich mich mit einigen Grundfragen der Gemeinde- und Seelsorgepraxis.
1
Eine Welt – oder viele Welten?
In der Welt habt ihr Bedrängnis; aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden.Johannes 16,33
»Wo soll das bloß noch alles enden?« Seufzend legte mein Großvater die Tageszeitung aus der Hand. Die Meldung von der Landung auf dem Mond hatte ihn erschüttert. In seiner Weltanschauung waren Mondlandungen nicht vorgesehen. Diese neuen technischen Errungenschaften machten ihm zudem Angst.
Heute sind es andere Meldungen, die uns die Wahrheit der jesuanischen Aussage von der »Bedrängnis in der Welt« vor Augen führen: Das explosionsartige Wachstum der Weltbevölkerung und die damit verbundenen Herausforderungen; die drastische Zunahme an Gewaltkonflikten im In- und Ausland; die unkalkulierbare Entwicklung der Informationstechnik und nicht zuletzt die stark umstrittenen Fortschritte in der Genforschung. Wo soll das bloß enden? Gibt es überhaupt ein Ende? Verbergen sich hinter den Meldungen aus dieser Welt noch andere Welten?
Spätestens dann, wenn wir die erschütternden Auswirkungen der beiden Weltkriege sehen, wenn wir im menschlichen Leben die Bosheit einer Bestie zu erkennen glauben, stellt sich die Frage nach dem Weltverständnis. Dazu kommen die unzähligen Entdeckungen und Offenbarungen, die wir mit einer von der Aufklärung geprägten Weltsicht nicht deuten können. Hilflosigkeit macht sich breit und endet häufig in einer Sprachlosigkeit oder auch in einer vom Intellekt abgehobenen Religiosität. Da, wo die unsichtbare Welt nicht zur realen Welt zählt, lauert die Gefahr des modernen Aberglaubens. Zudem bekommt sie etwas Exotisches; das Fremde interessiert und lockt die suchenden Geister an. Fallen wir nun zurück in ein Weltverständnis des Mittelalters? Welche Weltsicht vermittelt uns die Bibel?
1. Von antiken Weltanschauungen zum rationalistischmaterialistischen Weltbild
Wer heute noch von Himmel und Hölle, von Engeln und Dämonen und von der unsichtbaren Welt spricht, als sei sie selbstverständlich und begreifbar, der handelt sich schnell den Vorwurf ein, man wolle zurückfallen in den Aberglauben des Mittelalters. Wir wissen von den schrecklichen Folgen einer geradezu naiven Vorstellung von der unsichtbaren Welt. Zwischen 1450 und 1700 wurden allein über 100 000 Menschen als angebliche Hexen und Hexer auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Das so genannte »finstere Mittelalter« wurde deshalb so dunkel, weil immer mehr Menschen die Macht des Bösen überbetonten und schließlich hinter jedem Kritiker und hinter jeder übersinnlichen Macht den Bösen vermuteten.1 Die kirchliche Inquisition sah hinter all dem das kosmische Komplott Satans gegen die christliche Kirche und damit gegen die christliche Gesellschaft.
Grundlegend für diese Ansicht war das sogenannte »biblische Weltbild« (Empyreum) der frühen und mittelalterlichen Christenheit, das sich die Wirklichkeit mit Himmel, Erde und Hölle wie in drei Stockwerken gegliedert dachte. Da gibt es ein »oben« und ein »unten«; da bekommt das Unsichtbare Namen und Gestalt. Mittelalterliche Darstellungen vom Teufel und von Dämonen müssen geradezu als naiv betrachtet werden. Attribute wie Hörner, Pferdefuß und Schwanz sind Produkte menschlicher Phantasien, die mit der Wirklichkeit satanischer Existenz nichts zu tun haben. Diese Vorstellungen von einer jenseitigen räumlichen Welt des Bösen hielten sich bis in die Tage der Aufklärung erstaunlich hartnäckig. Man stellte sich vor, dass über bzw. unter unserer Welt das Jenseits lag, ein Raum, der naiv räumlich gedacht wurde und an dem sich Gottes Engelheere bzw. die dämonischen Heere des Teufels aufhielten.
Obwohl Nikolaus Kopernikus (1473–1543) durch seine Entdeckung, dass die Sonne und nicht die Erde den Mittelpunkt unseres Planetensystems darstellt, bereits eine grundlegende Änderung in der Weltsicht einläutete, stellte erst der italienische Philosoph Giordano Bruno (1548–1600) die Existenz eines Jenseits als Ort der unsichtbaren Welt völlig infrage. Die Vorstellung einer jenseitigen Welt mit Engeln, Dämonen und unsichtbaren Mächten wich einer Sicht, in der alles innerweltlich verstanden werden musste. Obwohl man Giordano Bruno nach siebenjähriger, schmählicher Haft schließlich als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannte, konnte die Kirche nicht mehr einfach in den traditionellen Denkschemata bleiben.2 Dennoch hielt sie an der Grundüberzeugung fest, dass es eine unsichtbare Welt gebe, wenngleich ihr Ort nicht mehr eindeutig auszumachen sei.
Die Reformatoren sprechen mit einer großen Selbstverständlichkeit von Engeln und Dämonen. Besonders Martin Luther ging in seiner Frömmigkeit und Theologie von der Existenz Satans aus. »Nullus diabolus, nullus redemptor« (Wo kein Teufel ist, braucht es auch keinen Erlöser!) – diese Einsicht prägte auch die Theologie der Reformatoren. Luther lehnte die »neuen Astrologen« ab, sah jedoch auch die Auffassung vom Empyreum kritisch, in der Christus als im Himmel thronend gedacht wurde. Von besonderer Aktualität dürfte ein Predigtausspruch von 1520 sein: »Wenn sie mit dem Kopf durch den Himmel bohren und sehen sich in dem Himmel um, da finden sie niemand; denn Christus liegt in der Krippe und in des Weibes Schoß.«3 So konnte sich die klassische Auffassung von einem dreistufigen Weltbild zwar nicht mehr richtig halten, doch auch das neu entstehende Weltverständnis der aufkeimenden Aufklärung hieß die Kirche zunächst nicht willkommen.
Dieses aufklärerische Weltbild wurde entscheidend von den Philosophen René Descartes (1596–1650) und Baruch Spinoza (1632–1677) definiert. Auch die Naturwissenschaftler Galileo Galilei (1564–1642), Robert Boyle (1626–1691) und Isaac Newton (1643–1727) trugen dazu bei, dass ein neues Weltverständnis Ausbreitung fand. Dieses neue Weltbild ließ die verschiedenartigsten weltanschaulichen bzw. religiösen Deutungen zu. Der Geltungs- und Wahrheitsprimat der biblischen Offenbarung wurde jedoch mehr und mehr eingeschränkt. So rückte, allgemein gesprochen, auf vielen Forschungsgebieten die Offenbarung immer mehr an die zweite Stelle hinter die Vernunft.
Ausgenommen von dieser Tendenz war die Theologie, besonders in Deutschland. Aber schon bald erschütterte der aufkeimende Deismus auch die Theologie. Der Deismus geht davon aus, dass der Mensch alles, was er zur rechten Erkenntnis Gottes und seines Willens benötigt, in seiner eigenen vernünftigen Natur finden könne; die biblische Offenbarung kann deshalb nichts anderes aussagen als das, was man ohnehin mit der Vernunft erkennen könne. Die deistische Denkweise wurde angeführt von Herbert von Cherbury (1583–1648), John Toland (1671–1722), Thomas Morgan (1680–1743) oder auch Matthew Tindal (1656–1733). Erst durch Gottfried W. Baron von Leibnitz (1646–1716) findet das »neue Denken« stärkeren Einfluss in der Theologie. Leibnitz verstand sich nicht ausschließlich als Theologe; er gab den theologischen Aussagen in seinen Werken jedoch ihre klare Platzanweisung. Auch Gott ist in seinen Offenbarungen in gewissen Grenzen zu sehen. Diese Grenzen werden von der Natur gesetzt. Alle Offenbarung ist demnach der Vernunft des Menschen zuzuordnen. Mit diesem Ansatz versucht Leibnitz letztlich, die biblische Offenbarung »verständlich« zu machen. In seiner Schule steht Christian Wolff (1679–1754), der, bahnbrechend für die rationalistische Wissenschaft, Methoden der Erkenntnis festschreibt. Immer noch ging es darum, nachzuweisen, dass die biblische Offenbarung letztlich mit der rationalen Erkenntnis der Wissenschaft in Übereinstimmung stehe.
Viel kirchenfeindlicher und radikaler waren die Ansätze der französischen Aufklärer Voltaire (1694–1778) oder auch Julien Offray de Lamettrie (1709–1751). In Deutschland setzte sich zunächst eine gemäßigte theologische Position durch, die versuchte, das Gegeneinander von Vernunft und Offenbarung durch eine wie auch immer geartete Zuordnung zu lösen. Die älteren Vertreter dieser als Neologie verstandenen theologischen Schule waren die Berliner Theologen Johannes Joachim Spalding (1714–1804) und August F. W. Sack (1703–1786). Es ließ sich jedoch nicht vermeiden: Christliche Theologie verstand sich immer mehr im Sinne des Rationalismus; das Christentum wurde zunehmend als eine Vernunftreligion definiert, in der das Übersinnliche, das nicht durch die Vernunft Erfassbare, verschwand. Diese Vernunftreligion war jedoch nicht ohne Werte. Der Schriftsteller und Philosoph und als »Liebhaber der Theologie« bekannte Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781) und schließlich auch Immanuel Kant (1724–1804) ordneten der christlichen Vernunftreligion die »christliche« Moral zu. Im Mittelpunkt des Interesses stand der Mensch in seiner Entscheidung für gutes oder schlechtes Handeln, nicht aber die Auseinandersetzung mit einem biblischen Weltverständnis.4
Der im 18. und 19. Jahrhundert aufkeimende Liberalismus und Rationalismus führte schließlich zur Verbannung alles Überirdischen aus dem Weltverständnis unzähliger Denker, Philosophen und auch Theologen. Wenn man sich tatsächlich auf eine Welt festlegt, die durch Raum, Zeit und Bewusstsein begrenzt ist, dann ist es völlig unsinnig, über geistige Einwirkungen von jenseits dieser Grenzen zu sprechen. Die Aufklärung räumte denn auch kräftig auf und verwies alle neutestamentlichen Berichte über die Wirksamkeit geistiger Wesen, Engel oder Dämonen in den Bereich des Unbedeutenden. Genauso wird der Glaube an Träume, Visionen, Geistheilungen und ähnliche Erfahrungen wie die Existenz handelnder und wirksamer Wesensmächte als absurd betrachtet. Da, wo man die moralstiftende Religion als außermenschliche Macht erlebte und deutete, gab es zaghafte Ansätze zu einer neuen Weltbilddebatte (Johann Gottfried Herder, Johann Georg Hamann). Gegen die so genannte liberale Theologie setzten sich jedoch weder diese Ansätze noch der aufkeimende Pietismus oder die Erweckungsbewegungen des 18. und 19. Jahrhunderts durch. Die bekannten Erweckungsprediger (z. B. Charles Finney) sprachen zwar offen von Teufel und Hölle, hatten aber auf Kirche und besonders Theologie nur geringen Einfluss. Die liberale Theologie des 19. Jahrhunderts betrachtete alle biblischen Berichte über diese Dinge als nicht akzeptabel. Rudolf Bultmann (1884–1976) und seine Schüler nahmen eine systematische »Entmythologisierung« der Bibel vor. Das wurde zum Brennpunkt einer teilweise hoch erregten Diskussion, in welcher die zentralen Themen des christlichen Glaubens zur Verhandlung kamen. Die Bibel wurde immer dünner, je radikaler man sich einem rationalistischem Weltverständnis verpflichtet sah. Karl Barth setzte mit seiner dialektischen Theologie einen Kontrapunkt gegenüber den zunehmend liberalen Theologien. Seine Engellehre meidet jedoch jede metaphysische Sprache; die Welt der Dämonen scheint ihm völlig verschlossen zu sein. Er will auf diese Welt nur »einen kurzen, scharfen Blick« werfen, denn – so der berühmte Theologe: »Ich liebe die Engel, ich mag aber die Dämonen und die Dämonologie nicht!«5 Auch der reformierte Theologe Emil Brunner (1889–1966) ist in seiner Dogmatik zurückhaltend, wenngleich er einräumt, dass die rationalistische Weltsicht dem Zeugnis des Neuen Testamentes nicht gerecht wird:
»Der Rationalismus ist zu allen Zeiten mit dem Teufel rasch fertig geworden – in der Theorie wenigstens! … Die Aufklärung hat den Teufel ganz einfach als nichtexistent erklärt und den Teufelsglauben als eine Ausgeburt mythenbildender Phantasie gedeutet. In das optimistische Weltbild der Aufklärung passt natürlich die Macht der Finsternis nicht hinein. Der Hinweis auf den Teufelsspuk und Hexenwahn früherer Zeiten und der nicht ganz unberechtigte Stolz darüber, dass diese betrüblichen Erscheinungen durch den Geist der Aufklärung überwunden seien, mochten dieser rein negativen Beurteilung zu einem gewissen Ansehen verhelfen. Aber diese rationalistische Einstellung wird weder dem biblischen Zeugnis, in dem die Macht der Finsternis den notwendigen dunklen Hintergrund der Erlösungsbotschaft bildet, noch der reiferen christlichen Erfahrung gerecht. Wir können dabei jedenfalls nicht stehen bleiben.«6
Trotz dieses Appells bleibt die Beschäftigung mit dem Unsichtbaren suspekt. Es fehlen Sprache und Denkkategorien, um dem wissenschaftlichen Anspruch des Theologietreibens gerecht zu werden. Die Ablösung von einem antiken Weltverständnis war gründlich; die Auseinandersetzung mit der erfahrenen Wirklichkeit des Unsichtbaren blieb jedoch weitestgehend unbefriedigend.
Als der Soziologe Peter L. Berger 1969 sein Buch: »Auf den Spuren der Engel« veröffentlichte, da schüttelte die theologische Welt nur den Kopf. Theologen waren vielmehr damit beschäftigt, den »Tod Gottes« zu proklamieren und zum aktiven politischen Handeln aufzurufen. Die Zeit für eine neue Weltsicht war scheinbar nicht reif. Da unternahm jemand den Versuch, auf eine Wirklichkeit hinzuweisen, die unsere Alltagswelt transzendiert, d. h. überschreitet und von enormer Bedeutung für die Menschen ist. Berger forderte eine Wiederentdeckung der Transzendenz und eine »Offenheit der Wahrnehmung« gegenüber der Wirklichkeit.7 Die Herausforderung Bergers findet jedoch kaum Gehör. Der Theologe Ernst Benz beschreibt in seinem Standardwerk »Die Vision« die Situation treffend. Erfahrungen mit der Welt des Unsichtbaren, so Benz,
»verführen den wissenschaftlichen Betrachter von heute meist zu einer rein psychopathologischen Deutung und – wenn möglich – Behandlung. Unsere heutige Zeit schützt sich so ängstlich gegen alle Erschütterungen vom Transzendenten her, dass sie die zeitgenössischen Träger einer visionären Begabung zunächst einmal in die Nervenklinik einliefert, mit dem redlichen Ziel, sie dort von ihren visionären Störungen zu befreien, und auch die früheren Träger derartig ›anormaler‹ seelischer Fähigkeiten zu Psychopathen erklärt.«8
Unbeachtet der philosophischen und theologischen Deutung blieb das Böse in der Welt, und es mehrte sich. Um es zu begreifen, braucht man neue Kategorien. Schließlich versteht man Teufel und Dämonen vielfach nur als Begriffe, als Personifikationen des Bösen im Menschen oder auch in der Welt. Damit ordnet man die Auseinandersetzung dem Bereich der Ethik und Moral zu. Das Böse hatte nun keine offizielle Definition mehr, »es ist im Prozess der Neuzeit ins Unbewusste, Subjektive und Private abgesunken. Der einzelne ist mit seinem Bösen allein.«9
2. Konfrontation mit der unsichtbaren Wirklichkeit
Man sollte meinen, das »Böse« habe nun mithilfe der Aufklärung seine klare Platzanweisung erhalten, und nicht nur das »Böse«. Die Verneinung der Welt des Unsichtbaren führte ja unmittelbar zur Einsamkeit des Menschen mit seiner Diesseitigkeit. Alles musste nun irgendwie erklärbar werden.
Es waren nicht erst die beiden großen Weltkriege mit ihren entsetzlichen Auswüchsen des Bösen, die massiv an diesem scheinbar intakten aufklärerischen Weltbild rüttelten. Die Konfrontation mit der unsichtbaren Wirklichkeit war durch alle Zeiten gegeben. 200 Jahre nach der Französischen Revolution, einem Höhepunkt der Aufklärung, haben heute Okkultismus und Religionen aller Art wieder Hochkonjunktur. Unsere Zeit ist nicht nur geprägt von einer nicht enden wollenden Technisierung und radikalen Gottlosigkeit, sondern auch von einer intensiven Suche nach dem verlorengegangenen Jenseits. Mit jedem Triumph der Vernunft ist zugleich auch eine Gegenbewegung geboren. Die Ahnung, dass es da noch mehr »zwischen Himmel und Erde« gebe, ist auch den Menschen unserer Zeit nicht abhanden gekommen. Die kirchliche Theologie schaut dieser neuen Religiosität etwas hilflos zu. Einerseits muss sie sich eingestehen, dass mit der Verbannung der Unsichtbarkeit aus der Theologie die Kirche ungeheuer arm geworden ist. Wenn nicht die christliche Kirche etwas sagen kann zu Engeln, zu Geistwesen; zu Dämonen und Teufel – wer denn sonst? Zum anderen scheuen sich die christlichen Theologen, in eine »unvernünftige« Theologie zurückzufallen; nach wie vor lässt man nur rational Einsichtiges und »Beweisbares« als Lehre gelten. Theologie soll eben auch Wissenschaft sein, und zwar eine Wissenschaft für einen aufgeklärten Denker unserer Zeit.
Wo aber sollen dann die Menschen mit ihrer Suche nach dem Jenseits hin, wenn die christliche Kirche sich geradezu verweigert? Es ist schon auffallend, wie selbst in evangelikalen und pietistischen Kreisen die ganze Welt des Unsichtbaren mehr oder weniger als unwichtig angesehen wird. Man glaubt sich mit dem Wort: Visionen, Engel, Dämonen oder selbst der Heilige Geist sind Dinge, die nicht so gut in dieses von der Aufklärung geprägte Denken passen, in der Hand auf sicherem Terrain! Aber immer wieder hat es auch Denker und Philosophen gegeben, die aus diesem angeblich modernen Denkraster ausscherten.
Einer der ersten, der bei Anbruch der aufklärerischen Zeit von sich reden machte, war der schwedische Naturwissenschaftler Emanuel Swedenborg (1688–1772). Er wurde als Bischofssohn in Stockholm geboren. Als Naturwissenschaftler und Erfinder sowie als Politiker genoss er bereits in jungen Jahren hohes Ansehen. Mit 37 Jahren jedoch beendete er seine Tätigkeit als Wissenschaftler. Er begründete diesen sensationellen Schritt mit einer Christus-Vision, die ihm zuteil geworden sei. Durch weitere Offenbarungen erhielt er Einblick in die »Welt der Geister«. Damit machte er die Redeweise von der jenseitigen Geisterwelt auch in Wissenschaft, Philosophie und Theologie wieder zum Thema.10 Das Denken Swedenborgs übte in der Folgezeit enormen Einfluss aus. So sieht Immanuel Kant den Menschen als »Bürger zweier Welten«, wobei für ihn die wahre Welt die Geisterwelt ist. Zahlreiche Kant-Forscher haben darauf hingewiesen, dass die grundlegenden Themen des Philosophen sich an Swedenborgs Thesen entzündeten.11 Auch Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) ließ sich durch Swedenborg inspirieren. Die Magie, der sich seine Figur Faust ergibt, ist eben der Verkehr mit der Geisterwelt, wie auch Swedenborg ihn pflegte. Für Goethe ist der schwedische Forscher zugleich ein »gewürdigter Seher unserer Zeiten«.12 Ansätze für eine neue Orientierung gab es auch bei pietistischen Lehrern wie z. B. dem schwäbischen Prälaten Friedrich Christoph Oetinger (1702–1782) u. a. Auf die Götterdämmerung zur Zeit der Aufklärung folgte zunehmend eine Dämmerung der Vernunft. Die Religion und damit auch die Hoffnung und Orientierung an einem unsichtbaren Jenseits wurde eben nicht durch eine von Vernunft geprägte Wissenschaft abgelöst; die Kirche erwies sich aufgrund ihrer wissenschaftlichen Verhaftung in der Theologie allerdings auch nicht als der geeignete Gesprächspartner für die neue Religiosität. So blieb der Mensch weitestgehend mit seinen religiösen Erfahrungen allein.
Die hohe Zeit der Psychologie nahm ihren Lauf. Zugleich entwickelte sich eine Art Kult der Humanität, der die Verehrung des Menschen als dem höchsten Wesen verpflichtet war. Selbst das Denken des einstigen sowjetischen Staatschefs Michail Gorbatschow steht noch ganz in dieser Tradition. »Wir sehen den Sozialismus als die Gesellschaftsordnung eines echten realen Humanismus an, in welchem der Mensch tatsächlich als das ›Maß aller Dinge‹ auftritt« – so definierte er auf dem Parteitag der KPdSU laut »Prawda« vom 29. Juni 1988 das Ziel der »Perestroika«. Im selben Jahr erklärte seine Partei, dass der Mensch die Religion durch Erziehung überwinden könne und damit die »Hinwendung zum Übernatürlichen nicht vonnöten« sei.13
Gerade der durch die Perestroika ausgelöste Zerfall der sowjetischen Ideologie führte neben der Götterdämmerung auch zu einer Dämmerung der Ideologien. Meiner Meinung nach führte dieser Zusammenbruch ideologischer Systeme zu einem Boom okkulter Religionen.
Die Kleinanzeigen der Tageszeitungen bringen es an den Tag: Esoterik, Wahrsagerei und jegliche Formen okkulter Praktiken sowie die offenkundige Einladung zu Zauberveranstaltungen, Hexenzusammenkünften oder Einführungskurse in meditative Praktiken sind an der Tagesordnung. Im Jahr 2000 bedienten allein 37 deutsche Zeitschriften mit Auflagenhöhen zwischen 10 000 und 60 000 Exemplaren diesen Markt. Laut einer Befragung des Dortmunder Forsa-Instituts glauben 63 Prozent der Männer und 55 Prozent der Frauen in Deutschland an übersinnliche Kräfte und Erscheinungen, das sind 59 Prozent der Gesamtbevölkerung. Einem Bericht der Zeitung »Die Woche« zufolge gab es 2000 in Deutschland rund 6 000 Astrologen, 10 000 Geistheiler und 90 000 Wahrsager, wohingegen die Kirchen insgesamt nur rund 40 000 hauptamtliche Geistliche und Seelsorger beschäftigten.14
Auf Esoterik-Messen suchen unzählige Menschen unserer Zeit den Rückzug in die Innerlichkeit, die mal mehr und mal weniger auch einen Ausflug ins Jenseits ansteuern. Dabei kommt es gar nicht so sehr darauf an, was sich dort in der Innerlichkeit auftut oder welche Art von Kraft mir im Jenseits begegnet. Allein die Tatsache, dass sich durch derartige Begegnungen irgendein Einfluss oder auch eine Verwandlung im Leben zeigt (Transformationen), allein dieses Faktum zählt. Es gehört zur neuen Religiosität, dass sie vagabundiert und sich auf dem Markt der Möglichkeiten umschaut. Die Wahrheitsfrage ist dabei nicht ausschlaggebend, allein das Erleben zählt. Mal ist die übersinnliche Kraft mehr in der Natur oder im Diesseits aufzuspüren, ein anderes Mal sind weite Wege des Zugangs zu gehen. Auch das Bewusstsein für eine differenzierte Wahrnehmung des Jenseits ist nicht sehr ausgeprägt. Das Böse als aktive Kraft wird in esoterischen Zirkeln eher skeptisch gesehen. Erleuchtung oder auch ein »höheres Bewusstsein« erlangt der Esoteriker durch Rituale und Techniken, die von »Meistern« vermittelt werden – denjenigen, die eine geistige Transformation vollzogen haben und ihr Leben im Einklang mit den kosmischen Kräften und Gesetzen meistern. Immer wieder geht es in der Esoterik um diese »göttliche Energie«, die geweckt werden soll.
Grundlegend für diese Praktiken ist die Auffassung, dass es zwischen »Geist« und »Stoff« keine grundsätzliche Differenzierung gibt, sondern lediglich Abstufungen. Geist und Materie sind verschiedene Erscheinungsformen; die Wirklichkeit wird als einziges geistig-energetisches Kraftfeld verstanden, in dem »Entwicklung« möglich ist. Vor allem das Zauberwort »Energie«, die Vorstellung von einer den ganzen Kosmos durchdringenden »Lebensenergie« fasziniert viele Menschen.
Eine derartige Vorstellung liegt auch dem Yoga zugrunde. Durch bestimmte unsichtbare »Energie-Zentren« (Chakren) kann der Mensch Lebenskraft aus dem Kosmos aufnehmen und auch einsetzen. Der Einfluss des Yoga auf nahezu alle esoterischen Zirkel der Gegenwart sowie auf die Mitte der 1960er Jahre entstandenen New-Age-Bewegung ist unübersehbar.
Während in vielen esoterischen Kreisen das Interesse näher am Zugang zu dieser Energie und an ihren Auswirkungen liegt, ist im Okkultismus ein größeres Interesse an der Quelle der Energie zu entdecken. Dennoch sind die Grenzen zwischen Esoterik und Okkultismus nur schwer zu ziehen. Hans-Jürgen Ruppert spricht von einem »esoterischen Okkultismus«:
»Schon von der Wortbedeutung her ist ›Okkultismus‹ eng mit dem Begriff ›Esoterik‹ verwandt. Das griechische Wort esoteros (= ›innerlich‹, ›verborgen‹) entspricht dem lateinischen occultus. Dieser Begriff bezieht sich vor allem auf die Geheimhaltung des okkulten Wissens und auf dementsprechende Praktiken und Rituale, wie sie seit jeher in Geheimbünden gepflegt werden. In der Antike bezeichnete man als occulta die Geheimnisse, die in den Mysterien überliefert wurden.«15
Die weltanschauliche Grundauffassung ist in der Esoterik und im Okkultismus gleich: Es geht um eine monistische Auffassung der Wirklichkeit; sichtbare und unsichtbare Welt korrespondieren miteinander. Die transzendente Wirklichkeit wird entweder als eine Art »kosmische Energie« verstanden oder sie wird wiederum unterteilt in anrufbare Mächte, die auch personhaft sein können. Das gesamte Spektrum ist geradezu unübersichtbar. Kurt Hutten, der frühere Leiter der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, unterschied vier Kategorien von Okkultismus, die er als »Okkultkonfessionen« bezeichnete:16 den Spiritismus, die Astrologie, die esoterisch-gnostischen Weltdeutungen (Theosophie, Anthroposophie, moderne Rosenkreuzer) und die Ufologie. Als fünfte Okkultbewegung sieht Hans-Jürgen Ruppert die seit den 1960er Jahren in den USA entstandenen New-Age-Bewegungen an. In all diesen Bewegungen geht es immer mehr oder weniger um die Frage, wie man an Wissen und Informationen oder auch Kraft, Energie und Macht aus der unsichtbaren Welt gelangt. Diese Wissens- und Kraftenergien können dann in unterschiedlicher Weise gesteuert oder auch eingesetzt werden.
Der gegenwärtige Boom des Übersinnlichen ist schwer zu erfassen, da es so gut wie keine klaren Definitionen und Zuordnungen gibt. Geister, Mächte und Energien stehen nebeneinander; religiöse Sprache macht sich breit; Religionsstifter und »große Geister« stehen nebeneinander. Die spezifischen okkulten Praktiken, mit denen der Zugang zum Übersinnlichen geschafft werden soll, können vielfach noch klar definiert werden. Geradezu verbreitet sind die populären Formen wie Handlesen, Tisch- und Gläserrücken oder auch das Auspendeln von Botschaften. Immer beliebter werden auch die unterschiedlichen Formen des Spiritismus. Der Versuch, mit verstorbenen Menschen Kontakt aufzunehmen, um so »Botschaften« aus dem Jenseits zu erhalten, hat sich bis in hohe Bildungsschichten und Regierungskreise einiger westlicher Nationen verbreitet. Für einige ist der Einfluss gewisser Popgruppen, die mit ihrer Musik bewusst Satan verherrlichen wollen (z. B. Black Sabbath, Black Widow, Tyrannosaurus Rex oder andere Gruppen des Black Metal) nicht zu unterschätzen. Für immer mehr Menschen werden diese Praktiken zu einem Einstieg in das ganze Feld des Satanismus. Die Anhänger des Satanskultes heutiger Prägung mischen in ihren Riten religiöse Satanszeremonien mit sexuellen und okkulten Praktiken, die ausdrücklich im Namen Satans ausgeübt werden. Wieviele solcher organisierter Satanskulte es im deutschsprachigen Raum inzwischen gibt, ist nicht erfasst; die Zahl und Aktivität scheint jedoch zu steigen.
Wenn schon die Beschreibung der ganzen Szene des Okkulten schwierig ist, so ist die Deutung der unterschiedlichsten Praktiken und Aktivitäten um so schwieriger.