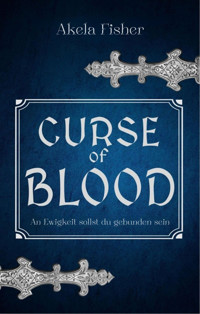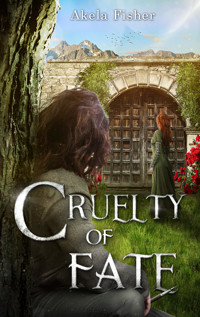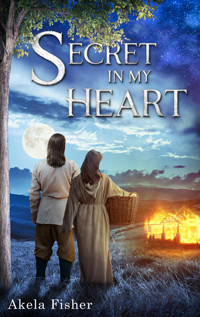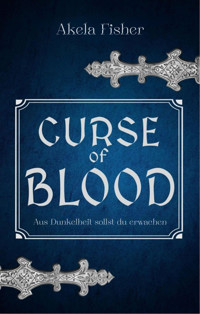4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Was verbirgt sich in der Dunkelheit der Nacht? In einer Welt, in der der Tod nie weit entfernt ist, lauern Schrecken hinter jeder Ecke. Ein unheimliches Geisterschiff bringt Angst und Verderben in ein kleines Fischerdorf, während ein ruheloser Geist in einem alten Schloss die Lebenden heimsucht. Eine Bauchrednerin sieht sich mit der dunklen Macht ihrer Puppe konfrontiert, und Albträume werden lebendig, wenn der Nachtalb sein wehrloses Opfer quält. Acht Gruselgeschichten verweben mittelalterliche Atmosphäre mit düsterem Grauen und unerwarteten Wendungen – ein Leseerlebnis, das dich nicht mehr loslassen wird. Klappentext: Willkommen in einer Welt jenseits der Vorstellungskraft, in der Geister durch die Dunkelheit wandeln, Nachtalben ihre unheimlichen Mächte entfesseln und mysteriöse Erscheinungen das Unfassbare offenbaren. Diese Sammlung von Kurzgeschichten erkundet die Grenzen des Übernatürlichen und nimmt den Leser auf eine Reise durch das Unbekannte mit. Erlebe die Spannung, die Furcht und die Magie, die in den Schatten lauern, und lass dich von den geheimnisvollen Phänomenen verzaubern, die in diesen Geschichten zum Leben erweckt werden. Bereite dich darauf vor, deine Vorstellungskraft zu erweitern und deine Sinne zu schärfen, denn nichts ist, wie es scheint in dieser Welt der Geister, Nachtalben und übernatürlichen Phänomene.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Akela Fisher
Geister der
Vergangenheit
Band 2
© 2024 Akela Fisher
Alle Rechte vorbehalten.
Website: https://akelasbooks.de
Lektorat von: "Die Flinke Feder", https://www.die-flinke-feder.de/
Coverdesign von: "Dream Design - Cover and Art", https://coverandart.jimdofree.com/
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter:
Akela Fisher
c/o WirFinden.Es
Naß und Hellie GbR
Kirchgasse 19
Inhalt
Todesschatten
Geheimnis der Tiefe
Unheimliche Präsenz
Die Brücke zwischen den Welten
Der Fluch des Nachtalbs
Das Geisterschiff
Ventriloquist
Schatten der Vergangenheit
Über Akela
Akelas Gruselgeschichten
Akelas Romane
Todesschatten
»Es ranken sich unheimliche Mythen und Legenden um diesen Wald«, sagte Luciel zu seinem Freund, als die beiden jungen Männer an einem sonnigen Morgen auf einer saftig grünen Wiese in unmittelbarer Nähe eines dichten Waldes picknickten. »Tief im Dunkeln des Waldes soll es einen alten Friedhof geben, der schon vor Jahrhunderten in Vergessenheit geriet und die Geister derer, die dort begraben sind, sollen an diesem Ort ihr Unwesen treiben.«
»Das ist doch Unsinn. Ich war schon oft in diesem Wald, aber einen Friedhof habe ich nie gesehen«, entgegnete Mariano.
»Vielleicht wird er nur zur Geisterstunde sichtbar«, mutmaßte Luciel schulterzuckend.
»Wollen wir heute Nacht nachsehen?«, fragte Mariano. Er glaubte keineswegs daran, dass die Geister der Verstorbenen noch unter ihnen weilten. Daher hatte er auch keinerlei Bedenken des nachts in einem einsamen Wald nach einem gespenstischen Friedhof zu suchen. Doch Luciel sah das ganz anders. Als Sohn eines berühmten oder wohl eher berüchtigten Mediums, hatte er von klein auf manch seltsames Ereignis erlebt. Obwohl jeder in dem kleinen Dorf, in dem sie lebten, seine Mutter für eine Hexe hielt, stand er zu ihr, glaubte ihr, obwohl er sich wünschte, dass es nicht wahr wäre. All ihre Geschichten über das Jenseits, ruhelose Seelen und die Gefahr, die von ihnen ausging, jagten ihm Angst ein. Der bloße Gedanke an umherspukende Geister bescherte dem sensiblen jungen Mann eine Gänsehaut.
»Ich denke, das sollten wir lieber nicht tun«, äußerte Luciel besorgt. Er malte sich bereits aus, wie es sein würde, wenn sie den Friedhof wirklich fänden, die Geister sie heimsuchen und in den Wahnsinn treiben würden. Vermutlich kämen sie nie wieder nach Hause.
»Ich werde dich vor allem, was uns übel mitspielen will, beschützen«, sagte Mariano und lächelte seinen Freund aufmunternd an.
»Wie willst du mich denn vor einem Geist beschützen?«, fragte Luciel zweifelnd.
»Vertraust du mir?« Mariano lächelte noch immer.
»Nein«, sagte Luciel knapp. Das Lächeln aus Marianos Gesicht verschwand.
»In jeder anderen Situation würde ich dir mein Leben anvertrauen, aber Mariano, du glaubst nicht an Geister. Du machst dich immer darüber lustig. Wenn mich plötzlich ein Geist verfolgen würde, dann würdest du mich nur auslachen«, erklärte Luciel.
»Du hast Recht. Dann lass uns erst recht in den Wald gehen. Du beweist mir die Existenz von Geistern und ich beweise dir, dass ich dich vor ihnen beschützen kann«, schlug Mariano vor. Doch Luciel fühlte sich nicht wohl bei dem Gedanken. Lediglich der entschlossene Blick seines Freundes führte dazu, dass er sich schließlich erweichen ließ.
Die Nacht brach herein. Luciel und Mariano trafen, ausgestattet mit zwei Öllampen, vor dem Dorf wieder aufeinander und liefen gemeinsam Richtung Wald. Es war ein angenehm lauer Sommerabend, doch schmälerte das Luciels Bedenken keineswegs. Kurz bevor sie den Wald erreichten, blieb er stehen.
»Ich kann das nicht«, flüsterte er ängstlich.
»Ich werde nicht von deiner Seite weichen«, entgegnete Mariano und reichte seinem Freund die Hand. Zögerlich ergriff er diese und so setzten sie ihren Weg langsam fort.
Die Stille, die in diesem Wald herrschte, war beängstigend. Kein Rauschen des Windes, kein Flüstern der Blätter, nicht einmal das Huschen kleiner Mäuse im Dickicht war zu hören.
»Hier herrscht wahrhaftig Grabesstille«, flüsterte Luciel mit zittriger Stimme.
»Noch haben wir kein einziges Grab gefunden«, entgegnete Mariano. Er zog Luciel dichter an sich heran und hoffte, dass sich dieser dadurch sicherer fühlte. Er spürte, wie Luciel sich an seinem Arm festkrallte.
»Ist dir kalt?«, fragte Mariano, nachdem sie schon eine ganze Weile durch den Wald gelaufen waren.
»Nein, ich zittere vor Angst«, gab Luciel ehrlich zu.
»Du brauchst wirklich keine Angst zu haben. Wir laufen nun schon so lange zwischen den Bäumen umher und noch immer haben wir keinen einzigen …« Mariano stolperte und fiel.
»Hast du dich verletzt?«, fragte Luciel hektisch und kniete sich neben seinen Freund.
»Nein, es ist alles in Ordnung.« Mariano hob die Öllampe, die ihm runtergefallen war, wieder auf und suchte nach dem Grund für seinen Sturz. Luciel hielt den Atem an, als das schummrige Licht auf eine riesige Steinplatte fiel.
»Jetzt haben wir den Friedhof wohl doch gefunden.« Beinah panisch sah Luciel sich nach weiteren Gräbern oder gar nach ihren Bewohnern um, während Mariano wieder aufstand und seine verschmutzte Kleidung abklopfte. Neugierig trat er näher an die Grabplatte heran. Er hoffte entziffern zu können, wer dort ruhte, doch diese Hoffnung war vergebens. Der Stein war stark verwittert und mit Moos bewachsen. Der Name des Verstorbenen somit unlesbar.
»Siehst du irgendwelche Geister?«, fragte Mariano.
»Nein, aber es ist auch noch nicht Mitternacht«, antwortete Luciel und klammerte sich wieder am Arm seines Freundes fest.
»Aus welcher Richtung sind wir gekommen?«, fragte er beunruhigt. Scheinbar hatte er in der Dunkelheit die Orientierung verloren und hoffte inständig, dass Mariano den Weg nach Hause noch kannte. Sein Freund sah sich suchend um.
»Von dort«, sagte er schließlich und zeigte in irgendeine Richtung, um Luciel zu beruhigen. Doch in Wahrheit hatte er keine Antwort auf dessen Frage.
Neugierig suchte Mariano nach weiteren Gräbern und wurde auch bald fündig. Jedoch waren sie alle unleserlich. Lediglich eine Jahreszahl, die er entziffern konnte, verriet ihnen, dass dieser Friedhof weit über 500 Jahre alt war.
»Wir sollten wiederkommen, wenn es hell ist. Bestimmt finden wir dann mehr heraus«, schlug Mariano vor.
»Im Tageslicht wäre ich auch viel lieber hier, als mitten in der Nacht«, entgegnete Luciel und versuchte seinen Freund in die Richtung zu ziehen, in die er vorhin gezeigt hatte.
»Na gut, gehen wir.« Mariano gab nach und hoffte, dass der eingeschlagene Weg sie tatsächlich heimführen würde. Doch dem war nicht so. Ziellos irrten sie umher und je länger ihre Suche nach dem richtigen Weg dauerte, desto ängstlicher wurde Luciel. Auch Mariano begann sich unwohl zu fühlen.
»Es tut mir leid. Ich fürchte, wir haben uns verlaufen«, gab er mit schlechtem Gewissen zu.
»Den Eindruck habe ich auch«, entgegnete Luciel. Er ließ seinen Blick durch die Dunkelheit schweifen, doch konnte er rein gar nichts erkennen. Das schummrige Licht der Öllampe reichte bei Weitem nicht aus.
»Autsch«, zischte Mariano vor Schmerz, als er sich den Fuß an einem Stein stieß. Ein genauerer Blick verriet ihm, dass es sich um dieselbe Grabplatte handelte, über die er bereits früher gestolpert war.
»Wir sind im Kreis gelaufen«, murmelte er ungläubig.
»Wir hätten gar nicht herkommen dürfen«, sagte Luciel nörgelnd und seufzte laut.
»Hab keine Angst. Ich habe dir versprochen dich zu beschützen und das werde ich auch tun«, versicherte Mariano ihm. »Selbst wenn wir erst bei Sonnenaufgang den richtigen Weg finden, wird dir nichts passieren.«
»Ich will aber nicht hier sein, wenn die Uhr Mitternacht schlägt«, lamentierte Luciel.
»Wir werden den richtigen Weg schon finden.« Mariano griff nach Luciels Hand und ließ seinen Blick nachdenklich durch die Dunkelheit schweifen. »Lass uns diesen Weg einschlagen«, schlug er vor und schritt voran. Doch wieder endete ihr Weg, nach scheinbar ewigem Umherirren, an derselben Grabplatte.
»Ich verstehe das nicht. Ich bin mir sicher, dass wir immer geradeaus gegangen sind«, murmelte Mariano.
»Ich sagte dir doch, hier spukt es.« Luciel war starr vor Angst. Er war sich sicher, dass irgendein übersinnliches Wesen sie an diesem Ort festhielt und dafür sorgte, dass ihr Weg sie unbewusst immer wieder an dieselbe Stelle zurückführte.
»Ich wüsste gerne, wie spät es gerade ist«, sagte Luciel, die Stirn in Falten gezogen. Mariano lag eine Bemerkung über Geister auf der Zunge, die er sich jedoch aus Rücksicht auf seinen Freund verkniff. Er sah keinen Sinn darin noch weiter umherzuirren und so setzte er sich zum Nachdenken auf die alte verwitterte Grabplatte. Luciel stockte der Atem. In dem Moment, in dem Mariano sich auf dem Stein niederließ, bildete sich um ihn herum eine bläulich schimmernde Aura.
»Bitte, steh sofort wieder auf«, bat Luciel ihn kurzatmig.
»Was hast du?«, fragte er irritiert.
»Bitte, steh auf«, wiederholte Luciel flehend und Mariano erhob sich. Die gespenstische Aura blieb an der Grabplatte haften und nahm langsam die Gestalt eines sehr alten Mannes an. Der Anblick, der sich Luciel bot, ließ ihm das Blut in den Adern gefrieren. Die ausgemergelte aschfahle Gestalt eines Mannes, gehüllt in zerschlissene Leinentücher, die ihn aus dunklen Augenhöhlen anstarrte, löste in ihm den Wunsch aus, schreiend davon zu laufen, doch seine Beine waren schwer wie Blei.
»Was ist denn los?«, fragte Mariano, ging auf seinen Freund zu und griff fürsorglich nach dessen Händen.
»Der … der Geist«, stammelte Luciel leise.
»Geist? Welcher Geist?« Mariano sah sich um, konnte jedoch nichts Ungewöhnliches erblicken.
»Auf der Grabplatte«, ergänzte Luciel, ohne seinen Blick von der unheimlichen Erscheinung abzuwenden.
»Auf der Grabplatte ist nichts«, sagte Mariano skeptisch. Er fragte sich, ob Luciel ihm einen Streich spielen wollte, sagte jedoch nichts.
»Soll das heißen, du siehst ihn nicht?« Mit ängstlicher Miene wandte Luciel sich nun Mariano zu.
»Nein, ich sehe …« Er hielt inne. Plötzlich spürte er wie ihn eine eisige Kälte umgab, Gänsehaut bildete sich auf seinen Armen. Als er ausatmete erschien eine nebelartige Wolke vor seinen Lippen.
»Was geschieht hier? Wieso ist es auf einmal so kalt?«, fragte Mariano und sah sich um.
»Es ist der Geist«, flüsterte Luciel. »Wir müssen hier weg.«
»In Ordnung«, sagte Mariano, griff abermals nach der Hand seines Freundes und gemeinsam liefen sie so schnell ihre Füße sie trugen. Sie machten erst Halt, als sie sich sicher waren, genug Abstand zu dem alten Friedhof gewonnen zu haben.
»Über dem Grab schwebte wirklich ein Geist. Du musst mir glauben«, sagte Luciel vollkommen außer Atem.
»Beruhige dich. Du weißt, ich glaube eigentlich nicht an Übersinnliches, aber irgendetwas Seltsames geht hier vor sich und wenn du sagst, da war ein Geist, will ich versuchen dir zu glauben«, entgegnete Mariano ehrlich und sah seinem Freund tief in die leuchtend blauen Augen. Der jedoch sah über dessen Schulter an ihm vorbei.
»Er ist uns gefolgt«, flüsterte er, den Blick starr auf den Geist gerichtet, der hinter Mariano schwebte. Dieser drehte sich um, doch er konnte den Geist nach wie vor nicht sehen. Stattdessen fiel sein Blick auf die Grabplatte.
»Er ist uns nicht gefolgt. Wir sind schon wieder im Kreis gelaufen.« Missmutig ließ Mariano die Schultern hängen. Fliehen schien tatsächlich unmöglich zu sein.
»Dieser Geist, den du siehst, will er uns etwas antun?«, fragte Mariano. Er hoffte inständig, dass sie trotz der unheimlichen Atmosphäre nicht in Gefahr waren.
»Ich weiß es nicht. Aber er sieht beängstigend aus«, antwortete Luciel.
»Was geschieht hier?« fragte Mariano erschrocken, als er bemerkte, wie sich Nebelschwaden über den Boden auf sie zu bewegten. Bevor Luciel antworten konnte, sank er mit schmerzverzerrtem Gesicht auf die Knie.
»Ich höre seine Stimme in meinem Kopf«, sagte er mit zusammengebissenen Zähnen und legte die Hände an seine Schläfen. Sein Kopf fühlte sich an, als würde er zerspringen. Besorgt trat Mariano näher an ihn heran und legte fürsorglich eine Hand auf den Rücken seines Freundes. Doch wusste er nicht, was er tun sollte. Er fühlte sich so hilflos. Mariano ergriff Luciel unter den Schultern und zog ihn wieder auf die Beine. Seinen besten Freund stützend versuchte er noch einmal einen Weg aus dem Wald zu finden. Ohne sich umzudrehen, liefen die beiden von den verwitterten Grabsteinen weg. Sie folgten dem Waldweg immer geradeaus, ohne auch nur ein einziges Mal abzubiegen.
Erschöpft und resignierend blieben sie stehen, als sie direkt vor sich wieder dieselbe Grabplatte erblickten.
»Er lässt uns nicht gehen«, murmelte Luciel, den Blick direkt in die leeren Augenhöhlen des unheimlichen Geistes gerichtet.
»Hat er das zu dir gesagt?«, fragte Mariano ängstlich.
Luciel nickte. »Er hat gesagt, wir werden hier sterben«, antwortete er.
»Nein, das werde ich nicht zulassen«, sagte Mariano entschlossen und stellte sich zwischen Luciel und die Grabplatte, in der Hoffnung ihn so vor dem Geist beschützen zu können. Der Nebel kroch um ihre Waden. Es bildeten sich schemenhafte Hände, die versuchten nach den beiden jungen Männern zu greifen. Mit gequältem Gesichtsausdruck ließ Luciel seinen Blick über die anderen Gräber schweifen.
»Was hast du? Was siehst du?«, fragte Mariano, als er das bemerkte.
»Es werden immer mehr«, flüsterte Luciel vollkommen verängstigt.
»Immer mehr Geister?«, hakte Mariano nach. Sein Begleiter nickte erneut.
Über jedem der unzähligen Grabsteine schwebte mittlerweile ein Geist, gehüllt in blauen Nebel, und beobachtete sie.
»Ich sehe keinen einzigen.« Mariano sah seinen Freund ungläubig an. »Du hast die Gabe deiner Mutter«, stellte er fassungslos fest und bereute augenblicklich Luciel nie geglaubt zu haben.
»Ich wünschte, ich hätte sie nicht«, entgegnete dieser den Tränen nahe.
Von vielen schauderhaften Fratzen angestarrt war er starr vor Angst und zitterte am ganzen Körper. All ihre mordlüsternen Drohungen hallten wie ein Echo durch seinen Kopf und bescherten ihm unsägliche Schmerzen.
»Ihr werdet diesen Ort niemals wieder verlassen.«
»Ihr habt euer Schicksal besiegelt.«
»Törichte Sterbliche. Dies wird euer Ende sein.«
»Ich halte das nicht aus. Ich muss hier weg«, schrie Luciel und rannte los.
»Warte«, rief Mariano und eilte ihm besorgt hinterher, verlor ihn aber schnell aus den Augen. »Luciel? Wo bist du?« Langsam und mit suchendem Blick schritt Mariano voran. »Luciel? Kannst du mich hören?« Er hatte Angst um seinen Freund und verfluchte sich zeitgleich selbst dafür mit ihm in den Wald gegangen zu sein. Es war seine Schuld, dass sie nun in Gefahr waren. »Luciel?« Den Blick nach vorne gerichtet bemerkte Mariano zu spät, dass er direkt auf ein großes Loch im Boden zulief. Erschrocken schrie er auf als er fiel, doch statt auf feuchter kalter Erde landete er direkt auf dem warmen Körper seines Freundes.
»Luciel«, sagte er besorgt und zog den bewusstlosen jungen Mann in seine Arme. »Luciel, wach auf.« Er rüttelte ein wenig an ihm und schlug ihm vorsichtig auf die Wange, bis Luciel müde blinzelnd seine Augen wieder öffnete.
»Was ist denn los?«, fragte dieser ein wenig verwirrt.
»Zum Glück habe ich dich gefunden. Wie es scheint, sind wir beide zufällig in das gleiche Erdloch hineingefallen«, antwortete Mariano erleichtert. Doch Luciel erschien das merkwürdig. Misstrauisch sah er sich in dem Loch um. In diesem perfekten rechteckigen Loch, das aussah, als wäre es von Menschenhand zu einem bestimmten Zweck ausgehoben worden.
»Das ist kein einfaches Erdloch. Es ist ein Grab«, flüsterte er unheilahnend und stand auf. Auch Mariano sah sich das Loch, in dem sie festsaßen, nun genauer an. Beide richteten ihren Blick nach oben und sahen auf den Grabstein, der an der Stirnseite des Grabes stand.
»Hier ruhen in ewiger Qual …«, las Luciel die verschnörkelte Inschrift, »Mariano und Luciel.« Er schluckte schwer. »Wir müssen irgendwie hier raus.«
»Klettere auf meinen Rücken, dann kannst du dich hochziehen«, schlug Mariano vor und wollte gerade in die Hocke gehen, als sich plötzlich die Wände des Grabes auf sie zu bewegten.
»Wir müssen uns beeilen«, rief Mariano voller Panik.
»Es geht nicht«, entgegnete Luciel und sah an sich herunter. Bis zu den Knien steckte er in der Erde fest und es schien als würde diese ihn immer weiter unter sich begraben wollen. Als Mariano das bemerkte, versuchte er Luciel aus der Erde herauszuziehen, doch es war vergebens. Sie kamen nicht gegen die Erdmassen an, die sie immer weiter einhüllten.
»Wir sind hier unten gefangen«, schluchzte Luciel.
»Es tut mir leid. Ich hätte auf dich hören sollen«, lamentierte Mariano, während sie die kalte feuchte Erde schon bis zu den Schultern fest umklammerte. Er streckte eine Hand nach Luciel aus und strich ihm ein allerletztes Mal sanft über die Wange.
»Ich will nicht sterben«, schluchzte Luciel, dem unaufhaltsam Tränen an seinen Wangen hinabrannen.
»Luciel? Hörst du mir überhaupt zu?« Marianos Stimme holte Luciel aus seinem Tagtraum. Ungläubig blinzelnd wandte er sich ihm zu.
»Entschuldige bitte. Was hast du gerade gesagt?«
»Ich sagte, lass uns heute Nacht in den Wald gehen. Du beweist mir die Existenz von Geistern und ich dir, dass ich dich vor ihnen beschützen kann«, wiederholte Mariano.
»Nein. Auf gar keinen Fall«, protestierte Luciel.
»Hast du etwa Angst?«, hakte Mariano amüsiert nach.
»Ja, habe ich und dazu stehe ich auch«, antwortete er mit entschlossener Stimme.
»Nun komm schon. Gib dir einen Ruck«, versuchte sein Freund ihn doch noch zu diesem Abenteuer zu überreden.
»Nein! Und das ist mein letztes Wort.«
Geheimnis der Tiefe
Im strahlenden Sonnenschein stand Morten an einem idyllischen See, der umgeben von bewaldeten Bergen und grünen Wiesen inmitten eines friedlichen Tals lag. Erst vor Kurzem war der junge Mann hier in ein kleines Dorf auf einem Hügel gezogen und kannte sich deshalb in der Gegend noch kaum aus. Jedoch liebte er es Neues zu entdecken und an diesem wunderschönen Frühlingsmorgen diesen ruhigen See gefunden zu haben, freute ihn sehr. Er trat an das Ufer heran, zog einen Schuh aus und hielt seine Zehen in das kühle Wasser. Erschrocken wich er zurück, als er meinte das bleiche Gesicht eines Mannes unter der Wasseroberfläche gesehen zu haben. Er stolperte und fiel. Hektisch sah er sich um, doch außer ihm war niemand hier. Vorsichtig tastete er sich wieder an das Ufer heran, der Mann im Wasser aber war verschwunden. Morten zog seinen Schuh wieder an und setzte seinen Spaziergang fort. Eine Weile dachte er noch über das seltsame Ereignis nach. Hatte er es sich vielleicht nur eingebildet? Doch schon bald lenkte ihn die Schönheit der Natur von seinen Gedanken ab.
Mitten in der Nacht jedoch wurde Morten durch das Knarzen der Dielen geweckt. Vorsichtig öffnete er seine Augen. Er spürte seinen Puls ansteigen und überlegte, ob er es wagen sollte, aufzustehen, um nach dem Rechten zu sehen. Langsam setzte er sich auf und zündete eine Kerze an. Mit angehaltenem Atem drehte er seinen Kopf, doch nichts war zu sehen. Ein wenig mutiger erhob er sich und schritt auf die Tür seiner Schlafkammer zu. Kurz bevor er diese erreichte, rutschte er in einer Pfütze aus. Irritiert saß er auf dem Boden. Er starrte auf seine nasse Hand und fragte sich, woher das viele Wasser kam. Hatte er vielleicht seine Waschschüssel ausgekippt, ohne es zu merken? Keine Erklärung findend stand er wieder auf und warf einen Blick durch die Tür. Auch auf dem Flur befand sich niemand. Morten schüttelte ungläubig den Kopf und begab sich wieder zu Bett, nachdem er den Boden notdürftig trockengewischt hatte.
»Guten Morgen, Morten«, vernahm er die Stimme von Elenor, seiner Nachbarin, als er am nächsten Morgen verschlafen in seinen kleinen Vorgarten trat. Mit einem freundlichen Nicken erwiderte er ihren Gruß.
»Hast du dich schon ein wenig eingelebt?«, fragte sie neugierig.
»Dazu war noch nicht genügend Zeit, ich finde es aber wirklich schön hier. Es ist so friedlich«, antwortete er höflich, fragte sich aber insgeheim, wie man sich in so wenigen Tagen bereits eingelebt haben sollte.
»Ja, nicht wahr? Ich lebe schon ewig hier. Meine Eltern und Großeltern lebten ebenfalls in dieser Gegend. Ich könnte mir keinen schöneren Ort vorstellen.« Die geschwätzige Nachbarin setzte lächelnd ihre Gartenarbeit fort.
Morten hingegen schlug noch einmal den Weg zum See ein. Obwohl er sich ein wenig fürchtete, siegte doch seine Neugier und er wollte wissen, ob er sich die Erscheinung im Wasser nur eingebildet hatte, oder ob sie sich ihm wieder zeigen würde.
Als Morten den See erreichte, war er doch etwas verunsichert und hielt ein wenig Abstand zum Ufer. Nachdenklich saß er im grünen Gras und starrte abwesend auf das Wasser. Er war so sehr in seine Gedanken versunken, dass er nicht mitbekam, wie der See langsam begann sich zu regen. Anfangs kaum merklich bildeten sich kleine Wellen auf der Oberfläche, obwohl nicht einmal der leiseste Wind wehte. Die Wellen wurden größer und erzeugten ein Rauschen, das Morten aus seinen Gedanken riss. Irritiert fiel sein Blick auf das Wasser, das sich immer mehr in Bewegung setzte. Dann sah er sich um. Noch immer war kein Wind zu spüren, kein Zweig bewegte sich, nicht einmal ein Grashalm. Beunruhigt wich Morten ein Stück zurück und versuchte hastig aufzustehen, als sich plötzlich eine riesige Welle vor ihm aufbäumte und ihn unter sich begrub.