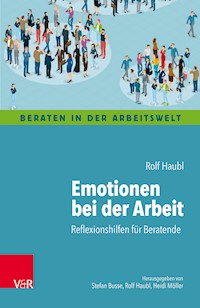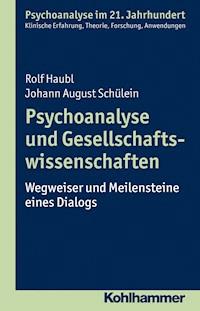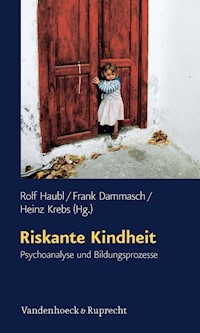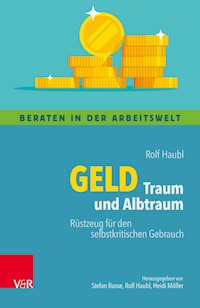
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Beraten in der Arbeitswelt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Geld regiert die Welt? Auf jeden Fall ist Geld ein soziales Medium, das das Wirtschaftssystem einer Gesellschaft mit dem psychischen System ihrer Mitglieder verbindet. Auf diese Weise entstehen Sozialcharaktere, die eine Gesellschaft und ihre verschiedenen Organisationen reproduzieren. Diese Sozialcharaktere begegnen einem auch in Therapie und Beratung. Rolf Haubl bettet seine langjährigen Erfahrungen als Analytiker, Supervisor und Berater in unterschiedliche Diskurse zu monetärer Kompetenz ein und reichert sie mit eigenen Daten aus qualitativen und quantitativen empirischen Untersuchungen an sowie mit Erlebnissen mit geldzentrierten Selbsterfahrungsgruppen (»Mein persönlicher Umgang mit Geld«) und Einzelcoachings. Beratende erhalten so Anregungen, wie sie das Thema Geld in ihrer praktischen Arbeit fallspezifisch reflektieren und welche Konzepte sie dafür nutzen können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 111
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BERATEN IN DER ARBEITSWELT
Herausgegeben von
Stefan Busse, Rolf Haubl und Heidi Möller
Rolf Haubl
Geld –Traum und Albtraum
Rüstzeug für den selbstkritischen Gebrauch
Mit einer Tabelle
Vandenhoeck & Ruprecht
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2019, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG,Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: vladwel/shutterstock.com
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Produktion: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISSN 2625-6061
ISBN 978-3-647-99929-6
Inhalt
Zu dieser Buchreihe
Einleitung und Vorbemerkung
Gesellschaftliche Funktionen des Geldverkehrs
Gefühle des Homo oeconomicus
Geld und das gute Leben
Ambivalenz des Geldgebrauchs
▸ Fallanalyse: Sehnsucht nach geldfreien Beziehungen
Geld schafft Wahlfreiheit
Kommerzialisierung: Alles hat seinen Preis
Reichtum: Mehr ist oft zu viel
Monetäre Sozialcharaktere
Tugenden und Untugenden
Sparsamkeit: Veredelung des Verzichts
Verschwendung: Ohne Maß und Ziel
Geiz: Angst, Geld auszugeben
Gier: Angst, nicht satt zu werden
Kleinlichkeit: Zwanghafte Korrektheit
Großzügigkeit: In Hülle und Fülle
Akteure im Geldgeschäft
Kredite: Verzichte nie!
Aktien: Den großen Coup landen!
▸ Fallanalyse: Geld arbeiten lassen
Kundenberater und -beraterinnen als professionelle Verführende
▸ Fallanalyse: Daytrading als magische Praxis
Wissenschaftlich optimierter Optimismus
Private Finanzkrisen: Überschuldung als kritisches Lebensereignis
Exemplarische Schuldnerkarriere
Schuldnerberatung
Die heilige Familie und das liebe Geld: Geld und Besitz in Familienunternehmen
Nachfolgeprozesse
▸ Fallanalyse: Destruktive Kränkungen
Typische Konflikte
Beratungsresistenz
(Unbewusste) subjektive Bedeutungen des Geldes
Typologie der Geldstile
Geldstile und Geschlecht
Finanztherapeutische Interventionen: Geldzentrierte Selbsterfahrungsgruppen
Modul »Wünsche«
Modul »Statements«
▸ Fallvignette »Harmoney«
Modul »Herkunft«
▸ Fallvignette »Geld vernünftig gebrauchen«
Modul »Konfliktsituationen«
▸ Fallvignette »Kollegialität«
Modul »Gehaltsforderung«
Geld im Beratungsprozess
▸ Fallvignette »Im Dienst des Klienten«
▸ Fallvignette »Insidergeschäft«
▸ Fallvignette »Auftrag zum Coaching«
Literatur
Zu dieser Buchreihe
Die Reihe wendet sich an erfahrene Beratende und Personalverantwortliche, die Beratung beauftragen, die Lust haben, scheinbar vertraute Positionen neu zu entdecken, neue Positionen kennenzulernen, und die auch angeregt werden wollen, eigene zu beziehen. Wir denken aber auch an Kolleginnen und Kollegen in der Aus- und Weiterbildung, die neben dem Bedürfnis, sich Beratungsexpertise anzueignen, verfolgen wollen, was in der Community praktisch, theoretisch und diskursiv en vogue ist. Als weitere Zielgruppe haben wir mit dieser Reihe Beratungsforschende, die den Dialog mit einer theoretisch aufgeklärten Praxis und einer praxisaffinen Theorie verfolgen und mitgestalten wollen, im Blick.
Theoretische wie konzeptuelle Basics als auch aktuelle Trends werden pointiert, kompakt, aber auch kritisch und kontrovers dargestellt und besprochen. Komprimierende Darstellungen »verstreuten« Wissens als auch theoretische wie konzeptuelle Weiterentwicklungen von Beratungsansätzen sollen hier Platz haben. Die Bände wollen auf je rund 90 Seiten den Leserinnen und Lesern die Option eröffnen, sich mit den Themen intensiver vertraut zu machen, als dies bei der Lektüre kleinerer Formate wie Zeitschriftenaufsätzen oder Hand- oder Lehrbuchartikeln möglich ist.
Die Autorinnen und Autoren der Reihe bearbeiten Themen, die sie aktuell selbst beschäftigen und umtreiben, die aber auch in der Beratungscommunity Virulenz haben und Aufmerksamkeit finden. So offerieren die Texte nicht einfach abgehangenes Beratungswissen, sondern bewegen sich an den vordersten Linien aktueller und brisanter Themen und Fragestellungen von Beratung in der Arbeitswelt. Der gemeinsame Fokus liegt dabei auf einer handwerklich fundierten, theoretisch verankerten und gesellschaftlich verantwortlichen Beratung. Die Reihe versteht sich dabei als methoden- und schulenübergreifend, in der zu einem transdisziplinären und interprofessionellen Dialog in der Beratungsszene angeregt wird.
Wir laden Sie als Leserinnen und Leser dazu ein, sich von der Themenauswahl und der kompakten Qualität der Texte für Ihren Arbeitsalltag in den Feldern Supervision, Coaching und Organisationsberatung inspirieren zu lassen.
Stefan Busse, Rolf Haubl und Heidi Möller
Einleitung und Vorbemerkung
Vor einiger Zeit suchte mich eine junge Frau auf, um Coaching nachzufragen. Sie hatte sich auf die Stelle einer Assistentin der Geschäftsleitung eines Unternehmens beworben und wollte sich nun mit meiner Hilfe auf das anstehende Bewerbungsgespräch vorbereiten. Die Stelle erschien ihr von den Aufgaben her attraktiv und auch gut bezahlt. Allerdings würde sie weniger verdienen als ein Mann in einer vergleichbaren Position. Sie wisse, wie verbreitet diese soziale Ungleichheit sei. Der Maxime »Gleicher Lohn für gleiche Arbeit« stimme sie nicht nur zu, sondern trete auch politisch für deren Realisierung ein. Im Bewerbungsgespräch wolle sie diese Ungerechtigkeit gegebenenfalls zum Thema machen, zu bedenken geben, wie kränkend es sei, nicht gleich behandelt zu werden. Meine Frage, ob ein Bewerbungsgespräch denn der passende Ort sei, um eine solche Diskussion zu provozieren, verneinte sie zwar, es blieb aber spürbar, dass die Angelegenheit für sie noch nicht erledigt war. Wenn es dazu komme, ihre Gehaltsvorstellungen zu erläutern, werde sie mit einer langen Liste von Qualifikationen aufwarten und letztlich eine Summe nennen, die nahe an den Vergleichsgrößen der Männer liege. Gesagt, getan. Nach dem Bewerbungsgespräch kam die junge Frau erneut zu mir und erzählte, wie es gelaufen war. In der Tat habe sie ihre Gehaltsvorstellungen offensiv vorgetragen und es sich nicht verkneifen können, mit der Bemerkung zu enden, das Geld »sei sie auch wert«. Ihr potenzieller Chef habe daraufhin gekontert: Sie wisse aber schon, dass sich »Wert und Preis unterscheiden«. An diesem Punkt im Gespräch sei ihr mulmig geworden. Sie habe mit einer scharfen Reaktion gerechnet, die aber ausgeblieben sei. Sie beide hätten wortlos so getan, als sei ihre Konfrontation gar nicht ernst gemeint. Auf diese Weise entschärft, hätten sie sich wieder den Arbeitsinhalten zugewandt. Die junge Frau habe sich als kompetent präsentiert und sei offenbar auch so wahrgenommen worden. Am Ende des Gesprächs habe sie ein Angebot erhalten, das zwar unter ihren Vorstellungen liege, aber lukrativ genug sei, um es anzunehmen. Welchen tatsächlichen Wert ihre Arbeit für das Unternehmen haben werde, müsse sich nun zeigen.
Dieser Ausschnitt aus einer Fallerzählung gibt das Leitmotiv des Buches vor: Geld ist ein soziales Medium, das das Wirtschaftssystem einer Gesellschaft mit dem psychischen System seiner Mitglieder verbindet. Auf diese Weise entstehen Sozialcharaktere, die eine Gesellschaft und ihre verschiedenen Organisationen reproduzieren.
Geld macht mobil. Bewusst, vorbewusst und unbewusst. Was das im Guten wie im Schlechten heißt, soll in den folgenden Kapiteln exploriert werden.
Der Inhalt des Buches besteht zum Teil aus bereits vorhandenen Textbausteinen, manche überarbeitet, inhaltlich und/oder stilistisch; andere sind neu. Eingebettet werden diese Bausteine in verschiedene Diskurse, die es zum Thema monetärer Kompetenz gibt, angereichert durch eigene Daten aus qualitativen und quantitativen empirischen Untersuchungen, plus Erfahrungen mit geldzentrierten Selbsterfahrungsgruppen (»Mein persönlicher Umgang mit Geld«) sowie Einzelcoachings, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe.
Ziel ist es zum einen, Beratern einige Anregungen zu geben, wie sie das Thema Geld in ihrer praktischen Arbeit fallspezifisch reflektieren können, zum anderen, welche gehaltvollen explikativen Konzepte sie dafür nutzen können.
Bevor es losgeht, noch eine Anmerkung: Bei der gendergerechten Schreibweise habe ich mich um einen lockeren Wechsel zwischen männlichen und weiblichen Bezeichnungen bemüht, es mögen sich bitte alle Geschlechtsidentitäten angesprochen und mitgemeint fühlen. Sofern Personen eines bestimmten Geschlechts gemeint sind, werde ich das explizit zum Ausdruck bringen.
Gesellschaftliche Funktionen des Geldverkehrs
Gefühle des Homo oeconomicus
In modernen Gesellschaften werden die Lebenschancen der Gesellschaftsmitglieder weitgehend durch die Geldmenge bestimmt, über die sie verfügen. Da Geld keinen Eigenwert hat, sondern seinen Wert aus seinen Einsatzmöglichkeiten auf Märkten bezieht, manifestiert es Tauschbeziehungen, die prinzipiell ohne Ansehen der Person bestehen. Um kompetent mit ihm umzugehen, müssen die Gesellschaftsmitglieder deshalb fähig sein, von allem abzusehen, was persönliche Beziehungen ausmacht. Denn nur dann können sie nüchtern monetär kalkulieren.
Diese Abstraktion erfolgt nicht naturwüchsig. Vielmehr ist sie das historische Ergebnis langwieriger Vergesellschaftungs- und Sozialisationsprozesse, in deren Verlauf die »Triebstruktur des Geldes« zunehmend rationalisiert wird. Dabei führt der Weg der Entsinnlichung von den frühen Naturalgeldkonventionen über die stoffliche Wertdeckung (Gold- und Silbermünzen) und die Erfindung von Scheidemünzen und Banknoten, Kredit- und Giralgeld (Schecks, Wechsel, Überweisungen) hin zur Plastiklegitimation der Scheckkarte.
Obwohl sich die Geldwirtschaft seit Jahrhunderten durchgesetzt hat, ist ein zweckrationales Verhältnis zu Geld bis heute nicht selbstverständlich. Die Gesellschaftsmitglieder erleben und gebrauchen es nicht nur gemäß seiner ökonomischen Bestimmung. Geld ist nicht einfach bloßes Tausch- und Zahlungsmittel sowie Mittel der Wertbemessung, Wertaufbewahrung und Wertübertragung und hat sonst keine Bedeutung. Die Mitglieder moderner Gesellschaften erleben und gebrauchen es immer auch als ein Symbol, in dem die ökonomische Bedeutung mit einer emotionalen Bedeutung konfundiert ist.
In der Art und Weise, wie wir mit Geld umgehen, kommt unsere Persönlichkeit mit allen unbewältigten lebensgeschichtlichen Traumata und Konflikten zum Ausdruck. Und deshalb lässt Geld uns nicht kalt, ganz gleich, wie viel wir davon zur Verfügung haben.
Die emotionale Bedeutung kann derart im Vordergrund stehen, dass sie – und zwar unabhängig von der Geldmenge – einen kompetenten Geldgebrauch erschwert oder gar verhindert.
Um das alltagsökonomische Handeln moderner Menschen angemessen zu verstehen, sind Vorstellungen, wie sie von Wirtschaftswissenschaftlern entwickelt werden, keine große Hilfe, da es den von ihnen unterstellten Homo oeconomicus lebensweltlich nicht gibt. Dessen Rationalität ist nur allzu oft die Rationalisierung eines irrationalen Begehrens, dessen Konzeptualisierung einer sozio- und psychodynamischen Perspektive bedarf.
In einer modernen Gesellschaft kann sich kein Mitglied leisten, von Geld nichts zu verstehen. Die Beherrschung dieses Mediums sozioökonomischer Integration ist eine elementare Kulturtechnik, mindestens ebenso relevant wie Lesen, Schreiben, Rechnen und die Handhabung des Computers. Und dennoch enthält ein Großteil der Bevölkerung in der Regel keine systematische Unterrichtung, wie Geld erworben, verwaltet und vermehrt wird. Ihre monetäre Kompetenz erlangen die Gesellschaftsmitglieder hauptsächlich durch die praktische Teilhabe am alltäglichen Geldgebrauch.
Es fehlen soziale Räume, in denen wir handlungsentlastet darüber reflektieren, was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht. Für manche von uns muss es erst zu einer krisenhaften Entwicklung unserer finanziellen Verhältnisse kommen, um uns die monetären Randbedingungen unseres persönlichen Lebensentwurfes bewusst zu machen und unsere monetäre Kompetenz selbstkritisch auf den Prüfstand zu stellen.
Geld und das gute Leben
Zu allen modernen Vorstellungen von einem guten Leben gehört, dass man das nötige Geld besitzt und es für befriedigende Güter ausgibt. Geld soll Mittel bleiben und nicht zu einem Selbstzweck werden. Aber wer hat wann genug Geld? In einer kapitalistischen Gesellschaft, in der die Tendenz besteht, den Wert von Personen nach dem Geld zu bemessen, über das sie verfügen, ist die Frage schwer zu beantworten. Im sozialen Vergleich wird es immer andere geben, die weniger Geld haben, aber immer auch andere, die mehr haben.
Da Geldbesitz auf einer Skala abgetragen wird, die nach oben offen ist, gibt es für ihn keine natürliche Grenze, so wie auch niemand zu Ende zählen kann, weil die Zahlenreihe kein Ende hat. Im Unterschied zu Geld sind Bedürfnisse ihrer Natur nach nicht linear, sondern zyklisch. Einer kapitalistischen Gesellschaft muss dies ein Ärgernis sein, weil ihre Warenproduktion einen Konsumenten verlangt, der keine Sättigung kennt. Folglich zielt sie darauf ab, nicht nur Waren, sondern auch Bedürfnisse zu produzieren.
Durch die Synchronisierung von Warenproduktion und Bedürfnisproduktion werden die Bedürfnisse nach der Logik des Geldes strukturiert und damit unendlich. Als Gut, in dem alle käuflichen Güter aufgehoben sind, verweist Geld zudem immer über die Gegenwart hinaus: Es hält Möglichkeiten für Befriedigungen vorrätig, für die es in der Gegenwart noch gar keine Bedürfnisse gibt. Die Ultima Ratio dieser Orientierung ist es, alle Güter zu Waren zu machen und die Vorstellung von einem guten Leben an deren Besitz zu binden. In einem finalen Schritt sind es dann die Waren selbst, die diese Entwicklung stören. Denn alle gekauften Güter sind enttäuschungsanfällig, weil sich jederzeit herausstellen kann, dass sie nicht – vielleicht auch nie – so gut sind wie versprochen und gewünscht.
Das einzige Gut, für das dies nicht in gleicher Weise gilt, ist das Geld, weshalb es der Logik des Systems entspricht, es selbst zu einer endlos nachgefragten Ware zu machen.
Ambivalenz des Geldgebrauchs
Monetarisierung ist allerdings psychisch riskant. So habe ich vor einigen Jahren mit einem Kollegen eine explorative Befragung zu Geldstereotypen durchgeführt. Wir befragten eine repräsentative Stichprobe von Augsburger Erstsemestern der Wirtschaftswissenschaften.
In dieser Stichprobe stimmte eine Mehrheit dem Statement »Geld verdirbt den Charakter« zu. Desgleichen war die Mehrheit der Befragten der Meinung: »Freundlichkeit, Großzügigkeit und Liebe sind eher unter den Armen als unter den Reichen zu finden.«
Die in diesen Stereotypen zum Ausdruck kommende Sehnsucht nach unmittelbaren, nicht geldvermittelten zwischenmenschlichen Beziehungen stand im Gegensatz zu dem Stereotyp »Geld regiert die Welt«. Und auch diesem Statement stimmte eine Mehrheit der Befragten zu.
Damit wird ein Dilemma deutlich: Auf der einen Seite büßt man in einer monetarisierten Gesellschaft, ohne über ausreichend Geld zu verfügen, an Kontrolle über seine Lebensbedingungen ein. Folglich gilt es, nach Geld zu streben, um sich möglichst viele Befriedigungschancen zu eröffnen. Dieses Streben bringt aber auf der anderen Seite psychische Kosten mit sich, die – allgemein formuliert – in der Gefahr bestehen, sich an die Welt des Geldes zu verlieren.
Fallanalyse: Sehnsucht nach geldfreien Beziehungen
An einer meiner geldzentrierten Selbsterfahrungsgruppen nahm ein ökonomisch höchst erfolgreicher jüngerer Mann teil, der in den letzten paar Jahren bereits drei Geschäfte eröffnet hatte und jetzt vor der Eröffnung eines vierten stand. Seine Teilnahme begründete er mit der rätselhaften Frage, herausfinden zu wollen, warum seine Frau so gut wie kein Geld ausgebe, es sei denn für die Kinder, obwohl er doch mehr als genug Geld zur Verfügung hätte.
Im Laufe des Gruppenprozesses, in dem er immer wieder andere Gruppenmitglieder durch sein großspuriges Auftreten provozierte,