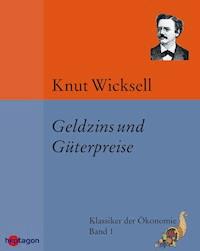
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: heptagon
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Klassiker der Ökonomie
- Sprache: Deutsch
Das wirkungsmächtigste Buch Knut Wicksells ist das 1898 erschienene 'Geldzins und Güterpreise. Eine Studie über die den Tauschwert des Geldes bestimmenden Ursachen'. Bemerkenswert ist, dass es die Keynesianer ebenso angeregt hat wie die Monetaristen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Knut Wicksell: Geldzins und Güterpreise Neu herausgegeben von Thomas Müller Klassiker der Ökonomie. Band 1 Veröffentlicht im heptagon Verlag © Berlin 2014 www.heptagon.de ISBN: 978-3-934616-84-4
Knut Wicksell – Sozialreformer und Neoklassiker
Paul Samuelson urteilt über Knut Wicksell: »If economists ran a popularity contest among themselves, the chances are Knut Wicksell would be the easy winner«1. Wicksell ist nicht der Erste, den man als »Ökonom der Ökonomen« bezeichnet, vor ihm erfuhr beispielsweise auch David Ricardo diese Ehrung. Die größere Aktualität des Ersteren hat uns aber dazu inspiriert, unserer Reihe »Klassiker der Ökonomie« mit Wicksells wichtigstem Buch »Geldzins und Güterpreise« zu eröffnen. Bemerkenswert ist, dass es die Keynesianer ebenso angeregt hat wie die Monetaristen.
Johan Gustav Knut Wicksell wird am 20. Dezember 1851 als jüngstes von 5 Kindern in Stockholm geboren. Seine Eltern sterben beide früh, sodass er bereits mit 15 Jahren Vollwaise ist. Sein Vater war ein erfolgreicher Lebensmittelhändler, der genug Vermögen hinterließ, um Knut Wicksell ab 1869 ein Studium mit Hauptfach Mathematik in Uppsala zu ermöglichen, das er 1875 mit dem Diplom abschließt. Als vielseitig interessierter Mensch belegt er in seiner Studienzeit auch Kurse in Astronomie, Physik, Latein, skandinavischen Sprachen, Philosophie und Geschichte.
Im Anschluss bleibt er als Postgraduierter an der Universität, sein Interesse gilt aber seit seiner Abkehr vom christlichen Glauben überwiegend sozialwissenschaftlichen Themen. Die soziale Situation in Schweden – besonders eine hohe Kinderzahl und auffälliger Alkoholismus bei den Ärmeren – veranlasst ihn, als Journalist und Redner über Bevölkerungsentwicklung aufzutreten. Seit einer Rede von 1880 ist er eine »öffentliche Figur in Schweden«.2 Wegen seiner vielseitigen Interessen legt er erst 10 Jahre nach Ende seines Studiums – im Mai 1885 – seine Dissertation für den Grad des Licensiaten in Mathematik vor, mit dem Titel »On Proving the Existence of a Root in an Algebraic Equation«.3 In der Folgezeit beschäftigt er sich intensiver mit Ökonomie, um seine Theorien zu untermauern. Während eines längeren London-Aufenthalts studiert er die klassischen britischen Ökonomen, u.a. Smith, Ricardo, Mill und Bentham. Ein Stipendium der Lorén-Stiftung ermöglicht ihm, weitere ökonomische Studien zu betreiben. Er besucht Universitäten in ganz Europa, u.a. Berlin und Paris. Besonders beeindruckt ist er von der »Österreichischen Schule« in Wien, wo er sich ausführlich mit dem Werk Eugen von Böhm-Bawerks beschäftigt und Vorlesungen von Carl Menger besucht. In Kopenhagen 1888 lernt er seine spätere Frau Anna Bugge kennen, eine norwegische Pädagogin, mit der er zwei Söhne hat.
Sein erstes theoretisches ökonomisches Buch erscheint 1892 unter dem Titel »Kapitalzins und Arbeitslohn«. Er wendet darin die Grenzproduktivitätslehre auf die Einkommensverteilung an. Im Folgejahr erscheint »Über Wert, Kapital und Rente«. Im Mai 1895 verteidigt er erfolgreich seine Dissertation mit dem Titel »Zur Lehre von der Steuerinzidenz«, die ein Jahr später den ersten Teil des Werkes »Finanztheoretische Untersuchungen nebst Darstellung und Kritik des Steuerwesens Schwedens« bildet. Im Jahr 1900 wird er schließlich zum Universitätsprofessor für Ökonomie in Lund berufen, veröffentlicht später ein zweibändiges Vorlesungswerk über Nationalökonomie (1913/22). Nach seiner Emeritierung 1916 ist er als Berater der Bank von Schweden in Stockholm tätig. Er stirbt am 3. Mai 1926 an einer Lungenentzündung.
Wicksell hat über 800 Schriften publiziert, auch heute noch stellen sie eine Fundgrube für Ökonomen dar.4 Seine Werke zur Wert-, Preis und Verteilungstheorie, sowie zur Kapital- und Zinstheorie werden breit rezipiert; »Wicksells unzeitgemäße finanzwissenschaftliche Überlegungen haben bekanntlich in starkem Maße das Denken des Nobelpreisträgers James M. Buchanan und damit auch die Entwicklung der Public Choice Theorie geprägt«.5 Wegen seiner sozialen Untersuchungen – insbesondere der Frage nach der optimalen Bevölkerungsanzahl – bezeichnet ihn Mats Lundahl als den größten schwedischen Sozialwissenschaftler aller Zeiten, im Urteil Johan Åkermans ist er Malthus' wichtigster Nachfolger. Wicksell ist Verfechter einer Erziehungsreform, um die Klassenunterschiede zu beseitigen.
Das wirkungsmächtigste Buch Knut Wicksells ist das 1898 erschienene »Geldzins und Güterpreise. Eine Studie über die den Tauschwert des Geldes bestimmenden Ursachen«. Da es in deutscher Sprache erschienen ist, hat es die englischsprachige Welt erst sehr viel später erreicht. Auch unter deutschsprachigen Ökonomen wird es wenig beachtet, da hier die historische Schule vorherrscht; eine löbliche Ausnahme ist Ludwig von Mises mit seinem 1912 publizierten Werk »Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel«. Als John Maynard Keynes entdeckt, dass Wicksell viele seiner Gedanken vorher zu Papier gebracht hat, beauftragt er 1936 seinen Schüler Richard Kahn mit der Übersetzung von »Geldzins und Güterpreise« ins Englische.
Die herausragende Leistung des Buches liegt in der Entdeckung des Zinses als Regulator der wirtschaftlichen Entwicklung. Wicksell ist ein Anhänger stabiler Preise und er plädiert für eine internationale Zusammenarbeit: »In jedem neuen Schritt zur Zusammenschließung der Völker für wirtschaftliche oder wissenschaftliche Zwecke begrüße ich meinerseits mit Freude eine neue Garantie für die Wahrung und Stärkung desjenigen Gutes, von dem das glückliche Erreichen aller anderen materiellen und immateriellen Güter schließlich abhängt – des internationalen Friedens.«6
Viele der Gedanken Wicksells haben Einzug in die ökonomische Theorie gehalten; seine Herangehensweise an ökonomische Theorien, insbesondere das Hinterfragen mathematischer Modelle, machen sein Werk auch heute noch lesenswert. Auch wegen des philosophischen Hinterfragens des Sinns ökonomischer Institutionen lohnt die Lektüre. So urteilt er über Banken: »Dann aber möchte ich in aller Bescheidenheit daran erinnern, dass die Banken doch nicht in erster Linie dazu da sind, um recht viel Geld zu verdienen, sondern die Aufgabe haben, dem Publikum mit Umsatzmitteln zu dienen und zwar in genügender Menge, d.h. zu möglichster Erhaltung der Güterpreise.«7
1
Erich W. Streissler: »Vorwort«, in: »Studien zur Entwicklung der ökonomischen Theorie XVIII«. Herausgegeben von Erich W. Streissler et al., Duncker & Humblot, Berlin 1998, S. 5.
2
Siehe: Mats Lundahl: Knut Wicksell on poverty. London 2005, S. 1.
3
Johan Åkerman: Knut Wicksell. A Pioneer of Econometrics, in: Econometrica, Vol. I (1993), S. 114.
4
Siehe bspw. die Veröffentlichung seines Manuskripts »Eine neue Krisentheorie« durch Harald Hagemann, in Erich W. Streissler et al., a.a.O., S. 253 ff.
5
Hans.-E. Loef und Hans G. Monissen: »Knut Wicksell und die moderne Makroökonomik«, in: Streissler et al., a.a.O., S. 66.
6
Siehe das vorliegende Werk, S. 179.
7
Ibid., S. 173 f.
Vorwort
Als ich die vorliegende Arbeit begann, welche trotz ihres geringen Umfanges mich über zwei Jahre fast ununterbrochen beschäftigt hat, war es lediglich reine Absicht, die Gründe für und gegen die Quantitätstheorie und insbesondere für und gegen den Bimetallismus (dem ich damals noch am ehesten zuneigte) in übersichtlicher Weise zusammenzustellen und zu prüfen. Von diesem einfachen Plan bin ich jedoch bald abgekommen und zwar aufgrund folgender Überlegung. Ich hegte schon den Verdacht und wurde durch ein eingehenderes Studium besonders von Tookes und seiner Anhänger Schriften mehr und mehr in demselben bestärkt, dass es neben der Quantitätstheorie in Wirklichkeit keine zweite gibt, welcher der Name einer durchgeführten, in sich zusammenhängenden Theorie des Geldes beigelegt werden könnte. Ist somit jene Theorie falsch – oder insoweit sie falsch ist –, so gibt es bis heutigen Tages eben nur eine falsche Theorie des Geldes und keine wahre. Die Kritik der Tookeschen Schule enthält nach der negativen Seite hin allerdings sehr viel richtiges und belehrendes, positiv jedoch kommt sie nicht über einige mehr oder weniger geistreiche Aphorismen hinaus, die zu einem in sich geschlossenen Ganzen zu verbinden jedenfalls dieser Schule selbst niemals gelungen, ja nicht einmal von ihr versucht worden ist. Man kann ohne Übertreibung behaupten, dass noch in der Gegenwart viele selbst der hervorragendsten Nationalökonomen ohne eine wirkliche, logisch durchdachte Theorie des Geldes dastehen, ein Umstand, welcher der modernen Diskussion auf diesem Gebiet selbstverständlich nicht besonders förderlich gewesen ist.
Auf der anderen Hand weist die Quantitätstheorie, auch wie sie in Ricardos wahrhaft klassischen Schriften über das Geld uns begegnet, noch zu erhebliche, von der späteren Kritik dargelegte Mängel auf, um ohne weiteres aufrecht erhalten werden zu können. Es blieb deshalb m.E. nichts anderes übrig, als zu versuchen, in den Fußstapfen dieses großen Meisters weiter vorzudringen, m.a.W.: der Grundauffassung, welche einstens zur Aufstellung der Quantitätstheorie geführt hat, eine konsequente Weiterentwicklung zu geben, um dadurch womöglich zu einer Theorie zu gelangen, welche sowohl in sich selbst widerspruchsfrei wäre, wie mit den Tatsachen in vollem Einklang stände.
Ein brauchbares Ergebnis schien nun in folgender Art gewonnen werden zu können. Nach Ricardos Ansicht wird ein Überfluss an Geld sich in zweierlei Weise kundgeben, teils in einer Erhöhung aller Preise, teils in einer Erniedrigung des Darlehenszinses. Letztere Wirkung wird jedoch, wie er hervorhebt, nur eine vorübergehende sein können, denn sobald die Preise sich der vergrößerten Geldmenge angepasst haben, ist auch der Geldüberfluss eo ipso verschwunden, und der Geldzins muss, unter sonst gleichen Umständen, auf seine frühere Höhe zurückgehen. Um eine mehr oder weniger andauernde Erniedrigung des Darlehenszinses zu bewirken, würde deshalb ein sich immer erneuernder Überfluss an Geld, eine stetige Zunahme der (relativen) Geldmenge erforderlich sein, sodass jene Erscheinung nur unter stetig fortschreitender Erhöhung der Güterpreise denkbar wäre. Letzterer Satz dürfte nun in der Tat ein allgemeingültiger sein, und bei der entwickelten Kreditwirtschaft der Gegenwart sogar eine erhöhte Bedeutung beanspruchen können, indem neben einer Vermehrung des materiellen Geldes als Ursache der Krediterleichterung eine vergrößerte (tatsächliche oder virtuelle) Umlaufgeschwindigkeit des Geldes als Wirkung derselben auftritt, wie unten gezeigt werden soll.1
Wenn die Geldanstalten ihr Geld oder ihren Kredit zu billigeren Bedingungen als gewöhnlich darbieten, kann dies logischerweise nur eine stärkere Inanspruchnahme von Geld oder Kredit seitens des Publikums, also eine Erhöhung der Preise zur Folge haben, und zwar so, dass die Preiserhöhung dem obigen gemäß eine fortschreitende wird, so lange die Krediterleichterung besteht – und umgekehrt natürlich bei erschwerten Kreditbedingungen.
Jedoch mit einer sehr wichtigen Modifikation, welche ganz in der Natur der Sache liegt, deren Nichtbeachtung aber vielfach zu voreiligen, mit den Tatsachen schlecht übereinstimmenden Schlussfolgerungen geführt hat. Ein Darlehenszins ist natürlich niemals an sich weder hoch noch niedrig, sondern lediglich im Verhältnis zu dem, was man mit Geld in der Hand verdienen kann, oder verdienen zu können hofft. Also nicht der niedrige oder hohe Stand des Darlehenszinses im absoluten Sinne, sondern sein jeweiliges Verhältnis zu dem, was ich unten den natürlichen Kapitalzins nenne, und was angenähert dem realen Zins der Unternehmungen selbst gleichkommt, genauer aber, wiewohl ziemlich abstrakt als diejenige Zinsrate gekennzeichnet wird, welche durch Angebot und Nachfrage festgestellt werden würde, falls die Realkapitalien ohne Vermittlung des Geldes in natura dargeliehen würden – ist als die Ursache aufzufassen, welche die Nachfrage nach Rohstoffen, Arbeit, Bodenleistungen oder sonstigen Produktivmitteln beeinflusst und dadurch mittelbar die Bewegung der Güterpreise nach oben oder nach unten bestimmt. –
Es muss wundernehmen, dass dieser, im Grunde genommen sehr einfache, fast selbstverständliche Satz zwar gelegentlich in der Literatur angedeutet wird, aber m.W. niemals einer durchgeführten Theorie des Geldes und der Geldpreise zu Grunde gelegt worden ist. Die Erklärung hierfür kann ich nur in der bisher leider sehr mangelhaften Entwicklung der Theorie des Kapitalzinses selbst erblicken. Die Nationalökonomen werden nicht müde, ihren Schülern einzuschärfen, dass Geld und (Real-)Kapital nicht dieselbe Sache seien, Kapitalzins und Geldzins somit zwei verschiedene Dinge; sobald es aber zu den Anwendungen kommt, lassen sie fast ausnahmslos jene beiden Begriffe in eine »unentwirrbare Konfusion zusammenschmelzen«, wie Mill sich ausdrückt – nebenbei bemerkt, am Anfang einer Auseinandersetzung2, in der er selbst, trotz allem Bemühen, nur dazu gelangt ist jene Konfusion zu verstärken.
Erst der geniale Entwurf einer wirklich realen Theorie des Kapitals, der in Jevons’ »Theory of political economy« enthalten ist3 und in Böhm-Bawerks berühmter Arbeit: »Positive Theorie des Kapitales« zu voller Entfaltung gebracht wurde, hat uns in die Lage versetzt, die Phänomene des Kapitals und des Kapitalzinses, wie sie sich gestalten würden unter der, allerdings rein gedachten, Voraussetzung, dass sie ohne Vermittlung von Geld oder Geldkredit vor sich gehen könnten, zu überblicken und dabei zugleich die Modifikationen zu beurteilen, welche durch das Auftreten des Geldverkehrs verursacht werden. Diese Modifikationen sind in der Tat von ganz wesentlicher Art. Es ist nicht wahr, dass »das Geld nur eine Form des Kapitals« ist, dass im Gelddarlehen »die Realkapitalien in Geldform verliehen werden« usw.: Das flüssige Realkapital (d.h. die Waren) wird ja überhaupt nicht verliehen, (auch beim einfachen Warenkredit nicht) sondern das Geld wird verliehen, und dann das betreffende Warenkapital gegen dieses Geld verkauft.
Der Geldzins wird demnach gar nicht ohne weiteres mit derjenigen Zinsrate übereinstimmen, welche durch Nachfrage und Angebot reguliert würde, falls die Realkapitalien in natura ausgeliehen würden. Das Angebot an Realkapital ist nämlich durch rein physische Verhältnisse begrenzt, das Angebot an Geld aber ist theoretisch durchaus unbegrenzt und auch praktisch nur in mehr oder weniger elastische Grenzen gebannt: können ja dieselben Geldstücke in gegebener Zeit fast beliebig oft an verschiedene Personen, oder an eine und dieselbe Person, verliehen werden.4
Dennoch ist es sicher genug, dass der Geldzins sich über kurz oder lang dem Stand des natürlichen Kapitalzinses anschließen, m.a.W.: dass seine Höhe in letzter Instanz nur von dem relativen Überfluss oder Mangel an Realkapitalien bestimmt werden wird. Aber gerade diese Erscheinung wäre m.E. durchaus unerklärlich, wenn man nicht voraussetzen dürfte, dass jeder andauernde Unterschied zwischen den beiden Raten zu einer Veränderung der Güterpreise Anlass gibt, und zwar zu einer sich stetig wiederholenden, progressiven, welche bei der tatsächlichen Gestaltung des Geldwesens früher oder später den Darlehenszins dazu zwingt, sich der jeweiligen Höhe des natürlichen Kapitalzinses anzuschließen.
Ich glaube keine bessere Illustration dieses Satzes geben zu können, als wenn ich an den berühmten, neuerdings von Mühlberger5 deutsch herausgegebenen Briefwechsel zwischen Bastiat und Proudhon über die »Unentgeltlichkeit des Kredits« erinnere.
Nicht nur Proudhon, sondern (wie aus dem 6. Brief Bastiats6 zur vollen Evidenz erhellt) auch sein Gegner Bastiat war der Meinung, dass die Banken, wenn sie Zettel ohne volle metallische Deckung ausgeben dürfen, ihre Diskontosätze in entsprechendem Maß herabsetzen können und bei freier Konkurrenz auch werden. Ist diese Auffassung richtig, so sind wir offenbar nur um ein Haar von der Unentgeltlichkeit des Kredits entfernt. Jedenfalls lässt sich recht wohl ein Zustand denken, wo durch die Entwicklung des Kreditwesens sowohl der nötige Barfond wie die sonstigen Selbstkosten der Banken auf ein Minimum gebracht wären. Es könnte also nach jener Ansicht der Geldzins ohne irgendeine Vermehrung des Realkapitals beinahe auf Null sinken! Wo blieben dann alle die von den Nationalökonomen und nicht am wenigsten von Bastiat selbst angeführten Gründe für die ökonomische Berechtigung und Notwendigkeit des Darlehenszinses, für seine Bestimmung durch Angebot und Nachfrage nach Kapital?!
Der Widerspruch löst sich aber in sehr einfacher Weise, sobald man annehmen darf, eine konstante Abweichung des Darlehenszinses vom natürlichen Kapitalzinse nach unten würde nicht nur, wie Bastiat selbst hervorhebt, eine Erhöhung, sondern eine progressive, somit schließlich jedes Maß übersteigende Erhöhung der Preise bewirken, was natürlich die Banken früher oder später veranlassen würde, mit ihren Zinssätzen heraufzugehen; und mutatis mutandis, würde das Umgekehrte der Fall sein, wenn der Geldzins höher als der natürliche Zins zu stehen käme. Zugleich aber ist klar, dass, insofern man sich auf den Standpunkt der Weltwirtschaft stellt und ein ähnliches Vorgehen sämtlicher Banken voraussetzt, jene Eventualität nicht bald eintreten muss, ein Unterschied der beiden Raten mit den oben geschilderten Einwirkungen auf die Preise vielmehr längere Zeit hindurch bestehen kann; und es fragt sich dann, ob wir nicht eben in diesem Umstand eine hinreichende Erklärung aller tatsächlich nachgewiesenen Veränderungen der Preise gefunden haben, zumal alle anderen Erklärungsweisen, wie ich unten zu zeigen versuche, sich als logisch unhaltbar erweisen.
Die Quantitätstheorie behält hierbei insofern recht, als einer Vermehrung bzw. einer relativen Verminderung des Geldvorrats immer die Tendenz zugeschrieben werden muss, auf die Preise erhöhend bzw. erniedrigend einzuwirken – und zwar zunächst durch ihre Einwirkung in entgegengesetzter Richtung auf die Zinsrate. Aber die monetären Veränderungen bleiben hier – jedenfalls wenn es sich nicht um allzulange Zeiträume handelt – nur der eine Faktor. Der andere, welcher die Einwirkung des Ersteren oft mehr als aufwiegt, besteht in den unabhängigen Bewegungen des natürlichen Kapitalzinses selbst, welche notwendig, in der Regel aber erst nach und nach, von entsprechenden Veränderungen des Geldzinses begleitet werden.
Dadurch erledigt sich zugleich in schlagender Weise der wichtigste Einwand, welcher gegen jene Theorie angeführt zu werden pflegt, nämlich der Hinweis darauf, dass eine aufsteigende Preisbewegung tatsächlich nur selten mit niedrigen oder fallenden, weit öfter vielmehr mit hohen oder ansteigenden Zinssätzen, fallende Preise umgekehrt mit fallenden Zinssätzen verbunden waren; denn mit der obigen Auffassung steht dies offenbar in vollem Einklang. –
Wie einfach und klar somit diese Anschauungsweise erscheint, ihre Durchführung ins Detail begegnet nichtsdestoweniger großen Schwierigkeiten. Fast bei jedem Schritt stößt man auf gegnerische Meinungen, von denen einige in dem allgemeinen Bewusstsein nicht nur der Laien, sondern auch der Männer vom Fach tief eingewurzelt sind, oder kommt man zu Ergebnissen, die beim ersten Anblick geradezu als Paradoxon erscheinen. Ich habe mich ehrlich bemüht, jene Schwierigkeiten realiter zu beseitigen, statt etwa mit Phrasen über sie hinwegzutäuschen, habe aber das Gefühl, dass bei mehr Darstellungstalent oder verfügbarer Zeit sich alles in viel einfacherer, schlichterer, überzeugender Weise hätte darstellen lassen müssen.
Das schlimmste jedoch ist, dass die genauere Prüfung der Theorie an der Hand der Erfahrung leider noch ausstehend bleibt. Ich bin weit davon entfernt, das wenige, was ich in dieser Hinsicht im XI. Abschnitte angeführt habe, als ausreichend zu betrachten, habe aber dort die Gründe angegeben, weshalb eine detaillierte Untersuchung auf diesem Gebiet mir als eine überaus schwierige, ja zur Zeit fast unüberwindbare Aufgabe vorkommt. Ohne die volle Sanktion seitens der Erfahrung bleibt aber jede Theorie, mag sie an sich noch so plausibel erscheinen, nur eine Hypothese, und für mehr als eine solche möchte ich die meinige nicht ausgeben. Ihre Bedeutung nicht nur für die Theorie, sondern auch für die Praxis des Geldwesens, falls sie sich schließlich als richtig erweisen sollte, glaube ich jedoch nicht überschätzt zu haben. –
Einleitungsweise sind einige Bemerkungen über den Begriff des durchschnittlichen Niveaus der Geldpreise und die Möglichkeit einer Messung desselben vorausgeschickt worden. Sie beanspruchen keineswegs eine erschöpfende Behandlung dieses viel debattierten Gegenstandes zu geben,7 hoffentlich werden sie aber zur Aufklärung über die Frage einigermaßen beitragen können. –
Um die Benutzung des Buches zu erleichtern, sind einige Partien desselben mit kleineren Lettern gedruckt. Sie können ohne Störung des Zusammenhanges – zumal bei einer ersten Lektüre – überschlagen werden, und dies gilt auch von dem ganzen IX. Abschnitt, wo ich eine mehr systematische Darstellung der Theorie unter gewissen hypothetischen Voraussetzungen versucht habe. Die dort am Anfang mitgeteilte Darstellung des Böhm-Bawerkschen Produktions-(Lohnfonds-)Theorie könnte sogar als überflüssig erscheinen, da später keine direkte Anwendung davon gemacht wird. Dies ist aber nur der Fall, weil ich im Folgenden der Einfachheit wegen eine unveränderliche (einjährige) Länge des Produktionsprozesses fingiert habe. Zugleich wollte ich wenigstens den Weg andeuten, wie man über diese Einschränkung hinweg kommen kann. Diesen bietet nun eben die Böhmsche Lehre – ist sie doch die einzige nationalökonomische Theorie, welche die Höhe des Kapitalzinses, des Arbeitslohns und der Grundrente, die Verteilung der Produktionsergebnisse zwischen Kapitalisten, Arbeitern, Grundeignern usf. in wahrhaft rationeller Weise erklärt.
Von der mathematischen Methode habe ich diesmal sonst so gut wie keinen Gebrauch gemacht. Nicht als ob ich über ihre Berechtigung und Anwendbarkeit anders dächte als früher, sondern einfach, weil mir der Gegenstand für eine Behandlung in exakter Form noch gar nicht reif erschien. Auf den meisten übrigen Gebieten der Nationalökonomie ist man wenigstens über die Richtung einig, in welcher diese oder jene Ursache auf die volkswirtschaftlichen Erscheinungen einwirkt, und der nächste Schritt muss dann ein Versuch auf Einführung genauerer quantitativer Beziehungen sein. Hier aber streitet man sich noch immer über Plus oder Minus. Tatsächlich findet man ja in Betreff des Einflusses einer Krediterleichterung auf die Preise unter den angesehensten Schriftstellern alle drei Meinungen vertreten: dass sie eine erhöhende, dass sie gar keine, und endlich (Tooke), dass sie eine erniedrigende Wirkung ausübe. Ich glaube für diesmal genug getan zu haben, wenn ich den Leser für eine dieser Meinungen gewonnen habe.
Dagegen habe ich mir erlaubt, in einem Anhang am Ende des Buches den Bernoullischen Satz: das sog. Gesetz der großen Zahlen, von dem ich in Bezug auf die Höhe der Kassenreserven und somit die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes einige Anwendungen mache, mathematisch zu beweisen. Ich kenne nämlich keine Arbeit über die Wahrscheinlichkeitsrechnung, wo dieser schöne und wichtige Satz in einer auch für Nicht-Mathematiker zugänglichen Form hergeleitet wäre, und so habe ich selbst eine solche Herleitung zu geben versucht, allerdings nur für den einfachsten Fall, welcher jedoch für die meisten Anwendungen ausreicht. –
Wegen eines Missverständnisses sind einige schon vor der Drucklegung von mir bemerkte Fehler nicht rechtzeitig berichtigt worden. Dieselben sowie einige später entdeckte finden sich in dem Druckfehlerverzeichnis vermerkt, welches ich den Leser vor Benutzung des Buches zu berücksichtigen ersuche.8
Eine wissenschaftliche Tätigkeit wurde mir, da ich kein Lehramt besitze, nur durch besondere Unterstützungen ermöglicht. In erster Reihe habe ich diesbezüglich der Direktion der Lorénsehen Stiftung, welche mir jetzt zum dritten Mal eine freigebige Spende vergönnt hat, meinen tiefempfundenen Dank abzustatten.
Ferner ist mir von Seite der schwedischen Regierung für diese Arbeit eine Unterstützung zu Teil geworden, was ehrerbietig anzuerkennen mir zur besonderen Genugtuung gereicht.
Herr Otto Gutsche in Breslau hat auch diesmal das Manuskript mit gewohnter Sorgfalt auf Sprachrichtigkeit durchgesehen, und hat dabei die Güte gehabt auch inhaltlich mich zu Verbesserung dunkler oder vernachlässigter Stellen anzuregen, wofür ich ihm meinen aufrichtigen Dank ausspreche.
Upsala, Januar 1898.
Knut Wicksell.
1
Der scheinbare Widerspruch dieses Satzes mit der Tatsache, dass umgekehrt ein
hoher
Zinsfuß eine gewisse Tendenz besitzt den Geldumlauf zu beschleunigen, erledigt sich sehr einfach in der auf S. 110 dargestellten Art. Siehe auch das Folgende im Texte.
2
On the rate of interest. Principles Bk III. Ch. XXIII.
3
In seinen früheren Schriften steht
Jevons
, wie wir unten sehen werden, noch ganz auf dem Standpunkt der älteren Auffassung.
4
Auch vom Warenkredit gilt das oben gesagte, und zwar im höchsten Grade. Mehr
Waren
, als er besitzt, kann der Kreditgeber allerdings nicht herausgeben, aber er kann beliebig viel
Geld
verleihen, nämlich gerade so viel, als der Kreditnehmer sich für die Waren zu zahlen verpflichtet.
5
Kapital und Zins, die Polemik zwischen
Bastiat
und
Proudhon
. (Jena. Gustav Fischer. 1896).
6
A.a.O. S. 209–211 ff.
7
Da es nicht im Buch selbst geschehen ist, mag in dieser Hinsicht hier noch auf die treffliche Abhandlung
Edgeworths
: Some new methods of measuring variations in general prices (Journal of Statistical Society 1888) verwiesen werden. Die in der Anmerkung S. 14 (in der E-Book-Ausgabe zweite Fußnote im II. Kapitel) erwähnte Idee einer rationellen Definition der Kaufkraft des Geldes, welche ich
Pareto
zuschreibe, rührt eigentlich, wie es scheint, von
Edgeworth
her.
8
Anmerkung der E-Book-Ausgabe: Dieses Verzeichnis fehlt, weil wir die Fehler gleich in den Text eingearbeitet haben.
I. Einleitung
Die Veränderungen, aufwärts oder abwärts, des allgemeinen Niveaus der Warenpreise waren zu jeder Zeit ein Gegenstand des größten allgemeinen Interesses, umso mehr, da ihre Ursachen meist ebenso dunkel und rätselhaft waren, wie ihre Einwirkung auf die sämtlichen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse eines Landes tiefgreifend und weittragend.
Die relative Änderung der Tauschwerte einzelner Warengruppen ist eine notwendige und leicht begreifliche Folge der veränderten Produktionsbedingungen und der technischen Fortschritte, die von Zeit zu Zeit eintreten; die dadurch bedingten Nachteile für einzelne Klassen von Produzenten und Konsumenten werden mehr oder weniger ausgeglichen durch Veränderung der Nachfrage oder Übergang des Kapitals, der Arbeit und auch der Bodenbenutzung aus den nunmehr weniger lohnenden Gebieten der Produktion in die übrigen, besser lohnenden.
Anders aber, wenn eine Erhöhung oder Erniedrigung der Geldpreise sämtlicher oder doch der meisten Waren stattfindet. Die Ausgleichung kann dann nicht mehr durch veränderte Nachfrage oder Übertragung produktiver Kräfte aus dem einen Produktionszweig in den anderen vor sich gehen, ihr Verlauf ist weit langsamer, sie vollzieht sich immer unter Schwierigkeiten und niemals vollständig, sodass stets, sei es in der Übergangszeit, sei es endgültig, ein Residuum sozialer Missverhältnisse zurückbleibt.
Eine allgemeine Erhöhung der Preise gereicht selbstverständlich allen jenen zum Nachteil, welche festes Geldeinkommen beziehen, was in unseren Tagen von immer zahlreicheren Gesellschaftsgruppen gilt; ebenso allen denjenigen, welche ihr Einkommen ganz oder größtenteils aus ausgeliehenen Geldkapitalien der einen oder anderen Art gewinnen – einer Klasse, welche bekanntlich keineswegs auf die eigentliche Kapitalistenklasse beschränkt ist –, wenigstens insofern nicht zufällig eine entsprechende Zinserhöhung den Ausfall in der Kaufkraft des Geldes wettmacht; schließlich den Arbeitern, sobald sie nicht eine entsprechende Lohnerhöhung zu erzwingen vermögen. Man darf allerdings in diesem Zusammenhang nicht vergessen, dass eine Lohnerhöhung auch der Preissteigerung vorangehen und deren unmittelbare Ursache sein kann; es wird sich sogar in der Folge zeigen, dass dies in Betreff allmählicher, bleibender Preissteigerungen, im Gegensatz zu den mehr zufälligen, durch spekulative Käufe u. dgl. hervorgebrachten, als der wahrscheinlichste Vorgang zu betrachten ist. Wenn dies der Fall ist, so kann von einer allgemeinen Benachteiligung der Arbeiter durch die gesteigerten Preise nicht ohne weiteres gesprochen werden. Andererseits liegt in der aufsteigenden Preisbewegung zweifellos ein Sporn für den Unternehmungsgeist; dieser Vorteil ist jedoch vielleicht mehr scheinbar als wirklich, jedenfalls ist derselbe nur zu oft mit einer Anregung zu ungesunden, weil auf einen sozusagen rein formellen, nicht tatsächlichen wirtschaftlichen Aufschwung begründeten Spekulationen mit dadurch veranlassten Kreditüberspannungen, Kreditstörungen und Krisen verbunden.
Ein nachhaltiges Sinken aller Warenpreise ist anerkanntermaßen ein nicht geringeres Übel. Der Vorteil, welcher für die Arbeiter daraus entspringen würde, dass sie sich mit demselben Lohnbetrag eine größere Menge ihrer Lebensbedürfnisse verschaffen könnten, wird Dicht selten von den sonstigen Folgen des Preisdruckes: der lähmenden Einwirkung auf das Geschäftsleben mit der daraus erwachsenden Arbeitslosigkeit und den sinkenden Löhnen mehr als aufgewogen. Überdies ist der niedrige Stand der Preise oftmals die Folge einer vorhergehenden Lohnerniedrigung; alsdann bildet er selbstverständlich höchstens ein Äquivalent für Letztere. Schließlich – und dieser Umstand ist hier vielleicht der wichtigste – wird bei niedrigen Warenpreisen sowohl für die Arbeiter wie überhaupt für den kleinen Mann der Druck der direkten oder indirekten Steuern viel empfindlicher. Die Gehälter der Staats- oder Gemeindebeamten vermindern sich fast niemals entsprechend den verminderten Lebenskosten, die Staatsgläubiger, wie überhaupt alle Gläubiger, beanspruchen, von der etwaigen Möglichkeit einer Schuldenkonvertierung abgesehen, denselben Geldzins wie früher, was für das Volk im Ganzen natürlich eine umso schwerere Bürde bedeutet, wenn die Mehrzahl seiner Gläubiger sich im Ausland befindet. Überhaupt, wenn die altherkömmlichen Steuern oder sonstigen Einnahmen des Staates (oder der Gemeinden) bei niedrigeren Güterpreisen bestehen bleiben, so liegt darin eine Verlockung zu einem mehr oder weniger verschwenderischen öffentlichen Haushalten, welchem selten mit genügender Kraft entgegengetreten werden kann.
Selbstverständlich führt sowohl eine Erhöhung wie eine Erniedrigung des Preisniveaus für gewisse Interessentenklassen bisweilen sehr beträchtliche Vorteile mit sich. Wenn aber Vorteile und Nachteile gegeneinander gehalten werden, wird sich zweifellos zeigen, dass die letzteren in beiden Fällen überwiegen, da ja überhaupt jede Störung des Gleichgewichtes des sozialen Mechanismus an sich ein Übel ist, und der Nutzen, welchen eine zufällige, unberechnete Vergrößerung unseres Einkommens mit sich bringt, fast niemals dem Schaden an Bedeutung gleichkommt, welcher durch eine ebenso große unerwartete Verminderung desselben hervorgerufen wird.
Es ist allerdings eine vielverbreitete Meinung, dass der allerglücklichste Zustand derjenige langsam und stetig sich erhöhender Güterpreise sei. Manche erblicken sogar in der Wertverringerung des Geldes, welche im Laufe der Jahrhunderte eingetreten ist, eine Art providentieller Einrichtung, durch welche besonders die verhängnisvollen Folgen des leichtsinnigen Schuldenmachens, des unbesonnenen Abwälzens von Lasten auf die Zukunft zu Gunsten der Gegenwart, tatsächlich gemildert worden seien. Dass die Regierungen früherer Zeiten vielfach im Wege der Münzverschlechterung jene angeblichen Pläne der Vorsehung kräftig gefördert haben, wird dabei allerdings verschieden beurteilt. Dem sei aber wie ihm wolle: In dem Maß wie die Menschen sich daran gewöhnen, mehr ihrer eigenen Kraft und Vorsorge zu vertrauen als den wohltätigen Einflüssen der Natur, wird selbstverständlich auf solche Heilmittel für begangene Fehlgriffe weniger Gewicht zu legen sein; auch würde, wenn man auf eine allmähliche Preissteigerung in annähernd bekannter Skala mit Sicherheit rechnen könnte, diese bei allen Geschäftsabschlüssen der Gegenwart schon in Rechnung gezogen werden, sodass ihre vermeintlich heilende Wirkung notwendig auf ein Minimum zurückgeführt werden würde. Die Leute, welche ein sich stetig aufwärts bewegendes Preisniveau dem festbleibenden vorziehen, erinnern deshalb stark an solche, die ihre Uhren absichtlich etwas vorgehen lassen, um desto sicherer rechtzeitig die Eisenbahnzüge etc. zu erreichen. Dazu dürfen diese aber des Vorgehens ihrer Uhren sich nicht bewusst sein oder bleiben, sonst gewöhnen sie sich daran, die paar Minuten Zeitvorsprung in Rechnung zu ziehen, und dann kommen sie trotz ihrer Pfiffigkeit schließlich doch zu spät ...
Wenn es somit in unserer Hand läge, die Preisverhältnisse der Zukunft vollständig zu regulieren, so lässt sich kaum bezweifeln, dass der Idealzustand, über den sich die überwiegende Mehrheit der verschiedenen Interessentengruppen einigen würde, eben ein solcher wäre, wo unbeschadet der unvermeidlichen Variationen der relativen Tauschwerte der Güter, das allgemeine durchschnittliche Niveau der Geldpreise – insofern dieser Begriff sich genau feststellen lässt, worauf wir gleich zurückkommen – ein durchaus unveränderliches und stabiles sein würde.
Und warum sollte eine solche Regulierung nicht im Bereich des praktisch Erreichbaren liegen? Was die relativen Tauschwerte betrifft, so sind ihre Veränderungen, wie schon erwähnt, von natürlichen Verhältnissen abhängig, die sich teilweise jeder menschlischen Kontrolle entziehen. Wenn durch Zölle, Staatsunterstützung, Ausfuhrprämien u. dgl. eine partielle Abänderung der natürlichen Reihenfolge jener Werte versucht wird, geschieht dies fast notwendigerweise auf Kosten der sonst für die Gesellschaft erreichbaren Summe von Gebrauchsnutzen und muss insofern als vernunftwidrig bezeichnet werden. Die konkreten Preise, die Geldpreise hingegen beruhen in letzter Instanz ganz und gar auf rein konventionellen Verhältnissen, nämlich auf der in unserer eigenen Hand liegenden Wahl des Preismessers. Allerdings ist auch diese Wahl durch gewisse natürliche Verhältnisse einigermaßen mitbedingt – man denke an die äußeren Umstände, welche uns gerade die Edelmetalle und unter ihnen in der neueren Zeit vorzugsweise das Gold als Münzmaterial gleichsam aufgezwungen haben –, allein diese Verhältnisse sind hier im Grunde genommen von nur sekundärer Bedeutung, oder, vielleicht richtiger gesprochen, es sollte ihnen niemals mehr als eine solche eingeräumt werden. Kommt es doch dem Menschen zu, und nicht zum wenigsten auf einem Gebiet von der außerordentlichen Wichtigkeit des Geldwesens, Herr, nicht Sklave der Natur zu sein. –
Wie wenig es jedoch bis jetzt gelungen ist, jenen ideellen Anforderungen zu genügen, wie wenig die theoretischen und praktischen Fortschritte auf dem Gebiet des Geldwesens die erwünschte Stabilität des Preismaßstabs und der Preise gesichert haben, davon zeugt im Übermaß die Preisgeschichte unseres Jahrhunderts und vor allem dessen letzterer Hälfte. Wie groß die seit Mitte des Jahrhunderts bis etwa zum Jahr 1873 eingetretene Steigerung, wie groß die nachher erfolgte und bis heutigentags anhaltende Erniedrigung des allgemeinen Preisniveaus (in Gold ausgedrückt), wie groß also umgekehrt die entsprechenden Veränderungen des Tauschwerts oder der Kaufkraft des Goldes während des betreffenden Zeitraumes gewesen sind, darüber herrschen allerdings verschiedene Meinungen. Das ist auch leicht erklärlich, denn einmal brauchen jene Veränderungen in den verschiedenen Ländern gar nicht gleichmäßig vor sich gegangen zu sein: Es ist vielmehr sicher, dass dies aus mehrfachen Ursachen, auf welche wir später zurückkommen werden, nicht der Fall gewesen ist. (Aus diesem Umstand erklären sich wahrscheinlich u.a. die kleinen Abweichungen der Sauerbeckschen von den Soetbeerschen Preistabellen, wie dies vom Ersteren selbst hervorgehoben worden ist.1 Dazu kommt die nicht unbedeutende Schwierigkeit, den Begriff des durchschnittlichen Niveaus der Preise in unzweideutiger Weise festzulegen, sowie die Unsicherheit darüber, welche Preise hierbei zu berücksichtigen sind: ob nur – wie bisher meistens geschehen – diejenigen des Großhandels oder auch die Kleinhandelspreise, ob nur Warenpreise oder auch solche von Leistungen und speziell die Höhe des Arbeitslohns usw. Wir werden im nächsten Abschnitt diese Fragen kurz zu beantworten suchen.
Trotz dieser abweichenden Meinungen, und trotzdem dass die bisherige Methode der Preiserhebungen durchaus nicht als einwandfrei gelten kann, dürfte über die substantielle Richtigkeit ihrer Hauptergebnisse kaum noch ein berechtigter Zweifel obwalten. Nun bieten zwar ältere Geschichtsepochen Beispiele von ähnlichen und noch viel stärkeren Preisschwankungen, besonders in einzelnen Ländern, in Hülle und Fülle dar. Allein man muss bedenken, dass in jenen Zeiten, wo die Naturalwirtschaft in ungleich höherem Maße als heute vorherrschte, ja auf großen Gebieten sowohl in der privaten wie der öffentlichen Wirtschaft die Regel war, Veränderungen in den Wertverhältnissen der Edelmetalle oder des Geldes, wenn noch so erheblich, notwendig einen viel geringeren Einfluss übten, als auch die kleinste Preisverschiebung heutzutage, wo die Geldwirtschaft (im weitesten Sinne dieses Wortes, also einschließlich der Kreditwirtschaft) fast universell geworden ist. – Dass die Beseitigung des Übels, die Schaffung eines konstanten Wertmessers, die Ressourcen der gegenwärtigen wirtschaftlichen Entwicklung übersteigen würde, muss, wie schon hervorgehoben, a priori als undenkbar erachtet werden. Die Schwierigkeiten des Problems liegen weit mehr auf dem Feld der Theorie als der Praxis. Steht einmal fest, was man sich unter Kaufkraft des Geldes zu denken hat, und wie dieselbe gemessen werden soll, und ist man ferner dazu gelangt, über die Ursachen der Veränderungen dieser Größe eine klare Vorstellung zu besitzen, so werden die praktischen Mittel nicht fehlen, die so gewonnene Einsicht gebührender Maßen zu verwerten. Von den erwähnten beiden theoretischen Fragen wird uns im Folgenden die letztere, ungleich schwierigere, vorzugsweise beschäftigen. Versuchen wir aber zunächst auf die Erstere eine möglichst klare Antwort zu geben.
1
S. die betr. Diskussion in Economic Journal, 1895 und 96.
II. Kaufkraft des Geldes und Durchschnittspreise
Wenn zwischen zwei verschiedenen Zeitpunkten sämtliche Warenpreise um genau denselben Prozentsatz zu- oder abgenommen hätten, so wäre man zweifelsohne zu der Aussage berechtigt, dass die Kaufkraft des Geldes gegenüber den Waren im entsprechenden Maße gesunken bzw. gestiegen sei. Ein solcher Fall wird jedoch fast niemals eintreten, denn wenn auch irgendeine allgemeine Ursache auf die sämtlichen Preise in derselben Richtung einwirkt und insofern eine durchaus gleichförmige Veränderung derselben hervorrufen sollte, so treten unterdessen in den meisten Fällen anderweitige, mit den stets vor sich gehenden Veränderungen der Güterproduktion und -konsumtion zusammenhängende Ursachen ins Spiel, die ihrerseits eine verschiedene Stellung der relativen Preise zur Folge haben müssen, sodass das Endergebnis sich in einer etwas stärkeren Zunahme des Preises dieser als jener Ware kundgibt, manchmal sogar in einem Preisrückgang einer oder mehrerer Warengruppen bei einer sonst allgemeinen Zunahme der Warenpreise – oder umgekehrt.
Alsdann wird man sich allerdings sagen können, dass die wirkliche Veränderung der Kaufkraft des Geldes gegenüber den Waren irgendwo zwischen den von den verschiedenen Preisveränderungen angezeigten Extremen liegen muss, ein genaueres Maß dafür aber in ganz einwandfreier Weise zu gewinnen, ist eine ziemlich schwierige Aufgabe.
Von vornherein ist klar und wird auch nunmehr allenthalben zugegeben, dass eine befriedigende Lösung derselben nur möglich ist, wenn man auf die Größe der wirklich umgesetzten Warenquanta, m.a.W.: auf die ungleiche Bedeutung der verschiedenen Warengruppen für die Volkswirtschaft Rücksicht nimmt. Geschieht dies nicht, so schwebt eigentlich die ganze Frage nach den Durchschnittspreisen in der Luft, und die gewöhnlich angewendete Methode zu deren Ermittlung könnte unter Umständen zu Resultaten führen, die sich selbst widersprechen. Das ist leicht zu zeigen:
Die von Jevons befürwortete Methode des geometrischen Mittels der Preisverhältnisse hat allerdings den formellen Vorzug, dasselbe Resultat zu liefern, ob man vorwärts oder rückwärts rechnet. Sonst aber ist dieselbe vollkommen willkürlich, sie lässt überhaupt keinerlei Berücksichtigung der Warenmengen zu, und würde deshalb unter Umständen zu ganz unannehmbaren Schlüssen führen. Auch die zuweilen empfohlene Anwendung des sog. harmonischen Mittels (welche bekanntlich darin besteht, dass man von den reziproken Werten der Preise das arithmetische Mittel und davon wiederum den reziproken Wert nimmt, m.a.W.: statt den Geldwert der Wareneinheit, sozusagen den Warenwert der Geldeinheit in Betracht zieht) hat vor der gewöhnlichen Methode keinen wesentlichen Vorzug und würde, wenn man die wirklich konsumierten Warenmengen nicht berücksichtigt, ebenso wie diese unhaltbare oder gar sich selbst widersprechende Resultate ergeben können.
Ist man aber in der Lage, die in einer Volkswirtschaft wirklich konsumierten Warenmengen annäherungsweise zu ermitteln, so lässt sich unschwer ein Maßstab für die Verteuerung oder Verbilligung des Durchschnittspreises der Waren, also für die Erniedrigung oder Erhöhung der Kaufkraft des Geldes gewinnen – jedoch zunächst nur unter der Voraussetzung, dass diese Warenmengen in den beiden zu vergleichenden Zeitpunkten dieselben geblieben, bzw. nur einer proportionalen Veränderung unterworfen gewesen sind. Bezeichnet man nämlich im ersteren Fall (auf welchen sich der Letztere leicht zurückführen lässt) die Warenmengen, je nach einer konventionellen Einheit berechnet, mit m1, m2 usw., sowie die Einheitspreise an dem früheren Zeitpunkt mit p1, p2, ... und an dem späteren Zeitpunkt mit p11, p22, ... so gibt zweifellos die Gleichung
bei Auflösung nach x die prozentuale Erhöhung bzw. Erniedrigung des Durchschnittspreises.
Im Allgemeinen aber wird, besonders wenn die beiden zu vergleichenden Epochen voneinander sehr entfernt liegen, die Zusammensetzung des tatsächlich konsumierten Warenkomplexes oft eine ganz verschiedene sein.
Wenn dies der Fall, so ist unser Problem in Wirklichkeit unlösbar, oder, richtiger gesagt, es kann nicht lediglich auf Grundlage der gegebenen Tatsachen gelöst werden. Es zeigt sich dies unmittelbar, wenn man annimmt, dass die Konsumtion an den beiden betrachteten Zeitpunkten ganz verschiedene Waren umfasst, z.B. überwiegend Fleisch statt vegetabilischer Nahrung, Weizen statt Roggen, Tee und Kaffee statt spirituöser Getränke, Steinkohlen und Petroleum statt Brennholz und Öl usw. Um hier entscheiden zu können, ob denn die Nahrung, Erfrischung, Heizung, Beleuchtung usf. mit den Jahren teurer oder billiger geworden sind, ist es offenbar nicht genug, die verschiedenen Preise zu kennen, man müsste darüber hinaus mindestens noch in der Lage sein, die verschiedenen Stoffe nach Nährwert, Geschmack, Brennwert usf. miteinander zu vergleichen.
Dieser Umstand, dass zwei verschiedene Warenmischungen eigentlich Quantitäten darstellen, die miteinander gar nicht ohne weiteres vergleichbar sind, wird von Lehr (gegen Drobisch) mit Recht hervorgehoben.1 Trotzdem aber versucht nun Lehr selbst, dieses schon als unlösbar erkannte Problem zu lösen, was selbstverständlich nur durch Einführung neuer willkürlicher Annahmen möglich wird, die bald mit den Tatsachen leidlich übereinstimmen, bald aber ihnen erheblich widersprechen können.
Lehr





























