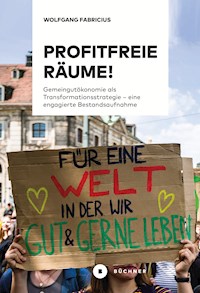Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Erde war ursprünglich Gemeingut der Menschen, Tiere und Pflanzen. Der Kapitalismus hat sie zum Spekulationsobjekt gewissenloser Investoren degradiert. Klimawandel, Artensterben und zig Millionen Klima-, Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlinge sind das Ergebnis. Diese Investoren müssen verdrängt werden und die Menschen insgesamt bestimmen, wie die Erde wieder als Gemeingut genutzt und gepflegt wird. John Bellers hat bereits vor der Industrialisierung 1696 erkannt, dass die Arbeitskraft der Armen die Goldgrube für die Reichen darstellt und dass die Armen durch Kooperation diesen Reichtum zur Selbstversorgung nutzten könnten. Mit anderen Worten: Arbeitsertrag darf als Kapitalertrag nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Trennung von Konsument und Produzent muss aufgehoben werden, indem die Konsumenten kollektive Eigentümer der Produktionsmittel werden. Durch Gemeingutökonomie soll über bereits existierende und neu zu gründende profitfreie Räume, die im Sinne von Robert Kurz als von der Dienstleistungsseite her schrittweise expandierende Keimzellen fungieren, das Finanzkapital durch Solidarkapital abgelöst und wieder in Gemeingut überführt werden. Das Internet mit den neuen Medien, Freier Software und Freiem Wissen erlaubt, mit den profitfreien Plattform-Coops von Trebor Scholz virtuelle Gemeinschaften zu bilden, in denen die von Lex Janssen geforderte und beispielsweise in der englischen Stadt Preston beginnende Selbstversorgung in allen Bereichen der Daseinsvorsorge auf- und ausgebaut werden kann. Die zu errichtenden Entscheidungsstrukturen sollten Commons-Charakter im Sinne von Elinor Ostrom haben. Für die höheren Ebenen können Erfahrungen einbezogen werden, wie sie beispielsweise die Zapatistas in Chiapas machen und wie sie mit den Ideen Murray Bookchins in Rojava und mit den Kommunalen Räten in Venezuela gewonnen werden. Entscheidend ist eine sachbezogene direkte Vertretung der Interessen der Menschen, die frei ist von parteilichen, religiösen und nationalen Einflüssen. Konkret könnten sich beispielsweise im Ernährungsbereich die NutzerInnen und Mitglieder des Dorfladen-Netzwerks, der Food Assembly/Marktschwärmer, der Solidarischen Landwirtschaft mit dem Urgenci-Netzwerk sowie der existierenden (z. B. VG Dresden, Migros und Coop Schweiz sowie Coop Italia) und auch neu zu gründenden Konsumgenossenschaften zusammenschließen und z. B. über Fairmondo oder OpenOlitor einen gemeinsamen Einkauf bei nach ökosozialen Richtlinien produzierenden Unternehmen aufbauen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meinem Großvater, der auch nie Soldat war und meinen beiden Söhnen, die es hoffentlich nie sein müssen
Inhalt
Vorbemerkung
1.
Profitmaximierung
1.1. Der Boden – vom Gemeingut zum Spekulationsobjekt
1.2. Liberalismus, Kapitalismus und Marktwirtschaft
1.2.1. Klassischer Liberalismus
1.2.2. Neoliberalismus
1.3. Trennung der Produktion von der Reproduktion
1.4. Geld und Eigentum
1.5. Ausbeutung von Produzent und Konsument
1.6. Kapitalgedeckte Alterssicherung
1.7. Bank- und Finanzmarkt-»reformen«
1.8. Nettokapitalrendite
1.9. Bedarfsweckung statt Bedarfsdeckung
1.10. Der Wohlstand steigt, die Armut auch
1.11. Armuts- und Reichtumsberichte
1.12. Verschärfung der Profitmaximierung
1.13. Investitions-/Freihandels-/Deregulierungsabkommen
1.14. Rhythmus von Konjunkturzyklus, Leitzins und Finanzzyklus
1.15. Der Anfang vom Ende des Neoliberalismus
1.16. Krieg als Lösung des Renditeproblems?
1.17. Und nach dem Krieg?
1.18. Das konventionelle multidimensionale Entscheidungsgestrüpp
1.18.1. Zum Staat
1.18.2. Zum »Tiefen Staat«
1.18.3. Akteure des »Tiefen Staates«
1.18.3.1. Council on Foreign Relations
1.18.3.2. Mont-Pèlerin-Society
1.18.3.3. Aspen-Institute
1.18.3.4. Atlantik-Brücke
1.18.3.5. Bilderberg-Gruppe
1.18.3.6. Atlantic Council
1.18.3.7. Trilaterale Kommission
1.19. Finanzakteure
1.20. Big Data
1.20.1. Künstliche Intelligenz
1.20.2. Sharing/Gig Economy - Plattformkapitalismus
1.20.3. Digitale Kooperation
1.20.4. Neue Finanzierungs- und Arbeitstechniken
2.
Profitminimierung
2.1. Probleme und Chancen
2.1.1. Bevölkerungsentwicklung
2.1.2. Informationstechnik
2.1.3. Open-Source-Software
2.1.4. Open-Source-Projekte
2.1.5. Energie
2.1.6. Finanzierung
2.2. Gegenstrategien
2.3. Neuere Gegenökonomien
2.3.1. Bedingungsloses Grundeinkommen
2.3.2. Peer-to-Peer-Ökonomie
2.3.3. Transition Town Initiative (TTI)
2.3.4. Gemeinwohlökonomie
2.3.5. Postwachstumsökonomie
2.3.6. Solidarische Ökonomie
2.4. Gemeingutökonomie als Teil der Solidarischen Ökonomie
2.4.1. Grundkonzept
2.4.2. Die reichsten Personen bzw. Institutionen sind Händler
f2.4.3. Gemeingut DDR?
2.5. Alternative Entscheidungsstrukturen
2.5.1. Proteste, Betriebsbesetzungen und Selbstverwaltung
2.5.2. Libertärer Kommunalismus
2.5.3. Kommunale Räte
2.5.4. Governing the Commons
2.6. Gesetzlich geregelte Entscheidungsstrukturen
2.6.1. Volksgesetzgebung in Deutschland
2.6.1.1. Volksentscheid »Nichtraucherschutz« in Bayern
2.6.1.2. Volksentscheid zu den Berliner Wasserbetrieben (BWB)
2.6.1.3. Volksentscheid zum Tempelhofer Feld in Berlin
2.6.2. Gesellschaft bürgerlichen Rechts
2.6.3. Der eingetragene (ideelle) Verein
2.6.4. Die Genossenschaft
2.6.4.1. Genossenschaftstypen
2.6.4.2. Struktur einer Genossenschaft
2.6.4.3. Genossenschaftsprinzipien
2.6.4.3.1. Das Identitätsprinzip
2.6.4.3.2. Demokratieprinzip
2.6.4.3.3. Rückvergütung
2.6.4.4. Doppelfunktion des Begriffs Genossenschaft
2.6.4.5. Genossenschaftsgesetz
2.6.4.6. Vertreterversammlung
2.7. Entfaltung der Genossenschaften
2.7.1. Wohnungsgenossenschaften
2.7.1.1. Entwicklung der Wohnungsgenossenschaften
2.7.1.2. Verkrustung alter Wohnungsgenossenschaften
2.7.1.3. Neue Genossenschaften
2.7.1.3.1. Bremer Höhe eG
2.7.1.3.2. Möckernkiez eG
2.7.1.4. GSW als Genossenschaft?
2.7.2. Konsumgenossenschaften
2.7.2.1. Rochdaler Pioniere
2.7.2.2. Die »dritte Säule der Arbeiterbewegung«
2.7.2.3. Weimarer Republik
2.7.2.4. Drittes Reich
2.7.2.5. Konsumgenossenschaften nach 1945
2.7.2.5.1. Konsumgenossenschaften im Westen
2.7.2.5.2. Konsumgenossenschaften im Osten
2.7.2.6. Konsumgenossenschaften nach 1989
2.7.2.6.1. Konsumgenossenschaft Berlin und Umgebung
2.7.2.6.2. Konsum Dresden
2.7.2.6.3. Konsum Leipzig
2.7.2.6.4. coop eG Kiel wird REWE-Markt!
2.7.2.6.5. Verbrauchergemeinschaft für umweltgerecht erzeugte Produkte
2.7.2.6.6. Kulturlandgenossenschaft
2.7.3. Genossenschaftsbanken
2.7.3.1. Volks- und Raiffeisenbanken
2.7.3.2. Sparda-Bank eG
2.7.3.3. GLS-Gemeinschaftsbank
2.7.3.4. Ökobank/Ökogenobank
2.7.3.5. Bank of the Commons
2.7.4. Wassergenossenschaften
2.7.4.1. Emschergenossenschaft eG
2.7.4.2. Wassergenossenschaft Hartau eG
2.7.4.3. Wassergenossenschaft Ellerhoop eG
2.7.4.4. Berliner Wasserbetriebe als Genossenschaft?
2.7.5. Energiegenossenschaften
2.7.5.1. Greenpeace Energy
2.7.5.2. Elektrizitätswerke Schönau
2.7.5.3. Bürgerenergie Berlin
2.7.6. Einkaufs-, Handwerks- und Händlergenossenschaften
2.7.7. Plattform-Kooperativismus
2.7.7.1. Fairmondo (ursprünglich Fairnopoly)
2.7.7.2. OpenOlitor
2.7.7.3. Hostsharing
2.7.7.4. Sozioökologischer Verbrauchsindex
3.
Nichtgenossenschaftliche Projekte
3.1. Ernährung, Landwirtschaft, Gemeinschaftsgärten
3.1.1. Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaften
3.1.1.1. Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaft Berlin e.V. (EVG)
3.1.1.2. Kaufhaus der europäischen Genossenschaften (KaDeGe)
3.1.2. Nichtkommerzielle Landwirtschaft (NKL)
3.1.3. Solidarische Landwirtschaft/Vertragslandwirtschaft
3.1.4. Selbsthilfeverein der Geringverdienenden und Erwerbslosen in Pankow e.V
3.1.5. Allmende-Kontor
3.1.6. Food-Assembly/Marktschwärmer
3.1.7. Dorfläden und Dorfladennetzwerk in Deutschland
3.2. Wohnen
3.2.1. Miethäuser
3.2.2. Initiative Genossenschaft von unten
3.3. Transformation des Bewusstseins
3.3.1. Kritische Universität
3.3.2. agit 883
3.3.3. Blaukreuz und die »Schlacht am Tegeler Weg«
3.3.4. Gesundheitsladen Berlin e.V
3.3.5. Mehringhof
3.3.6. Aktion Gesundheit
3.3.7. ATTAC
3.3.7.1. ATTAC Deutschland
3.3.7.2. ATTAC Berlin
3.3.8. Sozialforen
3.3.9. Offene Universität
4.
Ausland
4.1. Schweiz
4.1.1. COOP Schweiz
4.1.2. Gottlieb Duttweiler und die Schweizer Migros eG
4.1.3. Neustart Schweiz
4.1.4. Vertragslandwirtschaft
4.2. Italien
4.2.1. Coop Italia
4.2.2. Marcora-Gesetz
4.2.3. Gruppi di Acquisto Solidali (G.A.S.)
4.3. Spanien
4.3.1. Mondragón
4.3.2. Barcelona
4.4. Griechenland
4.4.1. Solarstrom in Bürgerhand auf Sifnos
4.4.2. Solioli
4.5. England
4.5.1. Das
»Preston-Modell«
4.6. USA
4.7. Japan
4.8. Venezuela
4.8.1. Cecosesola
Schlussbemerkung / Synoptisches Fazit
»There’s class warfare, all right, but it’s my class, the rich class, that’s making war, and
we’re winning.«
»Es herrscht Klassenkrieg, richtig, aber es ist meine Klasse, die Klasse der
Reichen, die Krieg führt, und wir gewinnen.«
Warren E. Buffett, 20061
»Die sicherste Art, den Krieg der Armen gegen die Reichen zu verhindern
wäre, sie an der Gesetzgebung teilnehmen zu lassen.«
Ludwig Börne, 18202
Vorbemerkung
Das exponentielle Wachstum der Menschheit, die endlose Entfaltung der globalisierten Industrie, die Digitalisierung, das nationale und weltweite Auseinanderdriften von Arm und Reich, der hemmungslose Missbrauch der Natur als Vorratskammer und Abfallgrube, der Klimawandel, das Artensterben, die bestehenden und drohenden Kriege und die zig Millionen Kriegs-, Umwelt- und Wirtschaftsflüchtlinge erschüttern zunehmend das Vertrauen der Menschen in die neoliberale Ökonomie und Politik.
Über wachsende Kritik hinaus werden Vorschläge zur Veränderung der Politik und Wirtschaft erarbeitet und propagiert. Doch es wird in der Regel übersehen, dass die offizielle Politik vom Kapital und seinen Lobbyisten dominiert wird. Dem entsprechendes entgegenzusetzen wird trotz der Möglichkeiten der sozialen Netze ehrenamtlich allein nicht gelingen. Es bedarf vielmehr finanziell ausreichend ausgestatteter Initiativen.
Karl Marx stellte fest: »Das Bewußtsein kann nie etwas Andres sein als das bewußte Sein, und das Sein der Menschen ist ihr wirklicher Lebensprozeß.«3 und »Es ist nicht das Bewußtsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt.«4 sowie »Der Geist der großen Mehrzahl der Menschen, sagt Adam Smith, entwickelt sich notwendig aus und an ihren Alltagsverrichtungen […].«5
Wir haben zwei unterschiedliche Einkommensformen, den Arbeits- und den Kapitalertrag. Sie bestimmen die Lebensprozesse oder Alltagsverrichtungen der Menschen unserer Gesellschaft. Dementsprechend finden wir in unserer Gesellschaft zwei ökonomische Gegenpositionen: externe Investoren, die eine Profitmaximierung und eine unendliche Vermehrung des Finanzkapitals anstreben und interne Investoren, die sich eine Profitminimierung und den Aufbau eines Solidarkapitals vorgenommen haben.
Rainer Mausfeld vergleicht repräsentative Demokratien mit Schafherden, deren Schäfer weniger die Interessen der Schafe, als vielmehr die der Eigentümer, der Investoren, vertreten. Der mittels der »Schäfer« errichtete Repressionsapparat hat physische und psychische Dimensionen und wird mit hohen Investitionen aufrechterhalten. Der Zugang zum Wissen über die Hintergründe der herrschenden strukturellen Gewalt soll dabei möglichst unklar bleiben. Damit die »Schafe« die errichtete Verschleierung nicht wahrnehmen, werden sie durch Techniken des Meinungs- und Empörungsmanagements abgelenkt. Durch die Entfaltung der sozialen Medien und des Whistleblowings reißt aber der installierte Vorhang an wesentlichen Stellen auf. Dies scheint den Machteliten Angst vor dem Volk zu bereiten. Die Repression wird verschärft.
Regelmäßig übersehen wird in diesem Zusammenhang aber die Notwendigkeit des Entfaltens einer leistungsfähigen Gegenökonomie, die den privaten, externen Investoren ihr Eigentum entzieht und ihre Aktionsräume zurückdrängt.
Die Profitmaximierung, die zu extremer Ausbeutung von Mensch und Natur geführt hat, macht die Kehrtwende um 180 Grad, die Profitminimierung, die mit dem Aufbau profitfreier Räume beginnt, unabdingbar. Über profitfreie Räume können Infrastruktur und Ressourcen zumindest der Daseinsvorsorge Gemeingut werden, das von der Gesellschaft solidarisch genutzt und gepflegt wird.
In der ersten Hälfte dieses Buches, der Beschreibung der Profitmaximierung, soll gezeigt werden, wie mit der hinter dem oben erwähnten Vorhang praktizierten Ökonomie die »Schafe« gemolken und die Investoren gemästet werden. Diese Ausbeutung der Verdammten durch die Auserwählten hat der Neoliberalismus perfektioniert.
Der Neoliberalismus hat sich mit intensiver Unterstützung des Kapitals in schleichender Form weltweit und auf allen, selbst den privatesten Ebenen eingenistet. Uralte Ideologien unserer Kultur waren dabei sehr hilfreich.
Der zweite Teil des Buches befasst sich mit dem Gegenstück zur Profitmaximierung, der Profitminimierung, wie es also gelingen kann, den Neoliberalismus aus unser aller Lebensräume und auch Gehirne wieder zu eliminieren und die Erde wieder als Gemeingut zu begreifen und zu pflegen. Es bedarf hierzu möglicherweise eines ähnlich hohen finanziellen Aufwandes wie für die Entfaltung des Neoliberalismus erforderlich war.
Von unseren Gegnern, den neoliberalen Kapitaleignern, können wir natürlich nicht erwarten, dass sie die gegen sie gerichteten Aktivitäten finanzieren. Auch die Medien, die sich in ihren Händen befinden, werden diesen Prozess behindern. Ohne eine ausgefeilte Gegenökonomie wird es deshalb nicht gelingen, diese Aktivitäten zu finanzieren.
Obwohl bereits in der Vergangenheit den politischen Akteuren zu den herrschenden Verhältnissen kaum Alternativen möglich erschienen, wurden in den letzten 250 Jahren über Kritik hinaus Gegenökonomien ersonnen und erprobt. Am erfolgreichsten war eine Ökonomie, die die »Schafe« selbst zu Investoren machte, indem sie Schritt für Schritt von den Dienstleistungen her Ressourcen und Infrastruktur in Gemeingut überführten. So entstanden weltweit Kooperativen bzw. Genossenschaften mit inzwischen einer Milliarde Mitgliedern. Direkte Demokratie, das Commoning, für diese tendenziell profitfreien Räume wurde – zumindest lokal – soweit möglich entwickelt und erprobt. Mit Internet und Smartphone stehen uns neue mächtige Instrumente zur Verfügung, die erforderliche Kommunikation und Kooperation auch weltweit auszubauen.
Die Solidarische Ökonomie umfasst Projekte sowohl auf der Anbieter- als auch der Abnehmerseite des kapitalistischen Marktes. Die hier propagierte Gemeingutökonomie konzentriert sich auf Projekte, die ihren Schwerpunkt auf der Abnehmer- bzw. der Verbraucherseite des kapitalistischen Marktes haben. Mit diesen Projekten werden die externen durch interne Investoren ersetzt und somit Ressourcen und Infrastruktur zunächst zumindest der Daseinsvorsorge profitfrei gestaltet und in Gemeingut überführt.
Mit dem zweifellos utopisch erscheinenden Projekt der Gemeingutökonomie sollen nicht nur profitfreie Räume mit lokalem Commoning errichtet, sondern auch übergeordnete Entscheidungsstrukturen für diese Räume gefunden werden. Es ist dies keine gewalttätige Revolution, sondern »nur« zielgerichtete harte Arbeit. Aber so wie die Menschen den Faustkeil – zwar erst nach etwa einer Million Jahren – hinter sich gelassen haben, werden sie den menschen- und umweltvernichtenden Mehrwert vielleicht schon nach jetzt guten 3000 Jahren überwinden.
Als Tutorium wird dieser Text bezeichnet, weil, obwohl die meisten dargestellten Details im Einzelnen bekannt sein dürften. versucht wird, sie – auch zur eigenen Orientierung – zu einem allgemein verständlichen Mosaik zusammenzufügen.
1Buffett 2006 Warren E. Buffett ist mit etwa 62 Mrd. $ der reichste Mann der Welt.
2 Zit nach Dahn 2013, S. 10
3Marx 1845, S. 26
4Marx 1858, S. 9
5Marx 1872, S. 109
1. Profitmaximierung
»Wenn eine Wissenschaft des Haushaltens auf den sparsamen, vernünftigen, effizienten
Umgang mit Ressourcen – vor allem mit Arbeit und Natur – abzielt, dann existiert bislang
gar keine Ökonomie«
Raul Zelik, 20096
1.1. Der Boden – vom Gemeingut zum Spekulationsobjekt
Als die Menschen noch Jäger und Sammler waren, gehörte ihnen, den Tieren und den Pflanzen der gesamte Erdball als Gemeingut noch gemeinsam. Mit der Erfindung des Säens und Erntens und der daraus folgenden Sesshaftigkeit fing aber der Mensch an, erste Teile des Gemeingutes Erde der freien Verfügbarkeit aller zu entziehen, zu rauben, zu »privatisieren«. Er zäunte, um »wilde« Tiere und nicht zum Klan gehörende Mitmenschen fernzuhalten, sein Grundstück ein und entfernte unliebsame Pflanzen. Durch das Bevölkerungswachstum wird die für jeden zur Verfügung stehende Fläche immer kleiner und wertvoller, und damit zum immer idealeren Spekulationsobjekt.
Mit der Zeit landeten immer größere Teile der Ressourcen und der sich entfaltenden Infrastruktur in die Hände einer immer kleineren aber umso mächtiger werdenden »Elite«. Es ist der Kapitalertrag, die Basis des Kapitalismus, der zusätzlich zum Arbeitsertrag hinzukam und bei einem Teil der Menschen auch ausschließliche Einkommensquelle wurde. Er führte zu einer Umverteilung des Reichtums von unten nach oben, von Süd nach Nord, von öffentlicher in private Hand.
Um den Kapitalismus abzuschaffen, wird es erforderlich sein, diesen Kapitalertrag aus der Welt zu verdrängen und den Globus wieder zum Gemeingut zu machen. Dass dies möglich ist, hat Peter Drucker7 für die USA aufgezeigt, indem Fonds der kapitalgedeckten Alterssicherung in der Lage wären, durch Investition in die Industrie innerhalb von 50 Jahren zwei Drittel der Infrastruktur und der Ressourcen der USA zu erwerben. Allerdings werden solche Fonds von kapitalistischen Managern bestimmt und der Rentensparer kann keinen Einfluss auf Investition und Kapitalertrag nehmen. Dies könnte aber beispielsweise über Genossenschaften realisiert werden.
1.2. Liberalismus, Kapitalismus und Marktwirtschaft
Dass sich Geld aus sich selbst heraus (selbstreferentiell) vermehren kann, bezeichnete schon Aristoteles als das Widernatürlichste, das er sich vorstellen konnte. Durch den Kapitalismus wurden die Märkte der Hanse von der Marktwirtschaft abgelöst und der Markt bzw. die Vermehrung des Geldes, der Mehrwert, ins Zentrum der Gesellschaft gerückt. Gestützt wurde diese Entwicklung von der Entfaltung liberaler und neoliberaler Ideologie, die tief im abendländischen Denken verwurzelt ist und die Entwicklung unserer Gesellschaft und unserer Ökonomie maßgeblich geprägt hat und prägt. Ein vom Kapital massiv unterstütztes weltweites Netz von Think Tanks wurde errichtet. Es stellt quasi einen »Deep State«, einen Staat im Inneren der Staaten, und in der Summe ein »globales Schattenreich« dar.8
Geolitiko meint: »Vorgedacht wird in Teilen des »Deep State« – vor allem in den unkontrollierten Thinktanks amerikanischen oder europäischen Ursprungs. Dort wird entschieden von Menschen, die nicht gewählt wurden. Dort werden die Institutionen erdacht, welche die Freiheit zukünftiger Entwicklung beschneiden sollen, um größenwahnsinnige, konstruktivistisch zusammengebastelte Strukturen zu ermöglichen.«9
Wie bei Platon der Staat aus drei Ständen besteht, hat nach seiner Ansicht auch die Seele jedes einzelnen Menschen drei Bestandteile10: »[…] Aus diesen Gründen dürfen wir offenbar nun behaupten, daß es vornehmlich drei Arten von Menschen gebe: eine wissbegierige, eine siegbegierige, eine gewinnbegierige.«11
Nach Kant will der Mensch, getrieben durch Ehrsucht, Herrschsucht oder Habsucht, sich einen Rang unter seinen Mitgenossen verschaffen, die er nicht wohl leiden, von denen er aber auch nicht lassen kann.«12
Scheidler spricht in diesem Sinne von den drei Tyranneien, der physischen Macht, der strukturellen Gewalt und der ideologischen Macht.
Die physische Macht erscheint in Form der Waffengewalt und konsolidiert sich unter anderem im militarisierten Staat.
Die strukturelle Gewalt beruht auf einer systematisch ungleichen Verteilung von Rechten, Besitz, Einkommen und Prestige. Zu ihrer Aufrechterhaltung bedarf sie der ideologischen und physischen Macht.
Die ideologische Macht reicht von der Beherrschung der Schrift über religiöse, moralische oder wissenschaftliche Ideologien bis zur modernen Expertokratie und der Beherrschung der Massenmedien. Sie dient zur Legitimierung der beiden anderen Mächte.
13
In der physischen Macht ist wohl der Siegbegierige Platons und die Herrschsucht bei Kant, in der strukturellen Gewalt der Gewinnbegierige Platons und die Habsucht bei Kant sowie in der ideologischen Macht der Wissbegierige Platons und die Ehrsucht bei Kant wiederzufinden.
Aristoteles mahnt: »Man muß dafür sorgen, daß der Gegensatz der Reichen und Armen sich möglichst ausgleicht oder daß der Mittelstand wächst. […] Namentlich muß man bedacht sein, durch Gesetze die Verhältnisse so zu regeln, daß niemand aufkommen kann, der allzu übermächtig ist durch Anhang oder Reichtum; und gelingt dies nicht, so muß man solche Leute ins Ausland verbannen.«14 Da es in einer globalisierten Welt kein Ausland mehr gibt, müssen für solche Maßnahmen wohl die Gefängnisse herhalten.
Aber die ideologische Macht des Liberalismus und Neoliberalismus war, gestützt auf die physische und die strukturelle Macht, in der Lage, unsere Realität zu erobern und unseren Alltag bis ins Detail hinein zu gestalten.
Nach Kaufmann hat die Globalisierung die Welt zu einem einzigen Betrieb gemacht: »Senkt ein Land die Unternehmenssteuer, müssen andere mitziehen. Senkt ein Land die Lohnstückkosten, werden dadurch andere zu teuer. Will ein Land eine Vermögenssteuer erheben, kann es dies nicht tun, weil sonst das Kapital dorthin flieht, wo es steuerfrei bleibt.«15
1.2.1. Klassischer Liberalismus
»Man muß, wenn von Freiheit gesprochen wird, immer wohl achtgeben, ob es nicht
eigentlich Privatinteressen sind, von denen gesprochen wird.«
Georg Wilhelm Friedrich Hegel16
Das liberale Gedankengut hat viele historische Wurzeln. Einen ersten ideologischen Grundstein legte Johannes Calvin (1509-1564). Nach ihm waren die Menschen von Gott schon vor der Erschaffung der Welt in Auserwählte und ewig Verdammte unterteilt. Das deutlichste Zeichen, zu den Auserwählten zu gehören, war nach Calvin wirtschaftlicher Erfolg. Die Armen sind die von Gott Verworfenen, die Reichen die Auserwählten. »In Calvins Lehre verbindet sich die apokalyptische Tradition mit dem kapitalistischen Projekt. Die Spaltung der Menschheit in Auserwählte und Verdammte, wie sie die Johannes-Offenbarung verkündet, wird auf das Wirtschaftsgeschehen projiziert, göttliche Ordnung und Marktlogik werden eins.«17 Diese Lehre legitimierte die soziale Spaltung und entzog sie bis heute einer grundlegenden gesamtgesellschaftlichen Auseinandersetzung.
Thomas Hobbes forderte 1651 einerseits uneingeschränkte Freiheit jedes Menschen als Naturrecht und andererseits einen Leviathan als übergeordnete Macht: »Unter dem Naturrecht, von den Gelehrten gewöhnlich ius naturale genannt, versteht man die Freiheit jedes Menschen, seine Kräfte nach seinem eigenen Ermessen zu gebrauchen, um für seine Selbsterhaltung, d. h. für die Sicherung seines Lebens zu sorgen – und folglich auch seine Freiheit, alles zu tun, was ihn seinem Urteil und seinen Überlegungen zufolge dieses Ziel am besten erreichen läßt.«18 Jeder muss sich also gegen alle anderen durchsetzen. Deshalb Hobbes weiter: »Das Zusammenleben ist den Menschen also kein Vergnügen, sondern schafft ihnen im Gegenteil viel Kummer, solange es keine übergeordnete Macht gibt, die alle im Zaum hält«19
»Es bedurfte nicht erst eines Pinochet, um zu beweisen, daß blutige Diktatur, Polizeistaat und Todesschwadronen sehr gut vereinbar sind mit konsequentem Wirtschaftsliberalismus und freier Marktwirtschaft.«20
Bernard Mandeville überträgt 1723 die Spaltung der Ökonomie auf Bildung und Ausbildung in sehr zynischer Form: »Gedeihen und Glück jedes Staats und Königreichs erfordern […], dass die Kenntnisse der arbeitenden Armen auf den Bereich ihres Berufes beschränkt bleiben und niemals über das hinausgehen, was mit ihrer Tätigkeit verbunden ist. Je mehr ein Schäfer, Pflüger oder sonstiger Landmann von der Welt weiß und von Dingen, die seiner Arbeit oder Beschäftigung fremd sind, umso weniger wird er geeignet sein, ihre Strapazen und Härten heiter und zufrieden zu ertragen.«21
Mandeville vertrat bereits die Ansicht, dass die Menschen ohne »Arbeit gebende« Kapitalisten unfähig wären, »nach Maßgabe ihrer Bedürfnisse und Fähigkeiten Häuser zu bauen, Kunstwerke anzufertigen usw. Er setzt damit bereits jene totale »Privatisierung der Welt« voraus, deren Kehrseite die ebenso totale Lohnabhängigkeit der Massen ist. Der Selbstzweck der Kapitalverwertung schiebt sich zwischen Mensch und Natur, enteignet die Kooperationsfähigkeit und überträgt sie auf die Kapitalform, sodass sich die Individuen daran gewöhnen sollen, nichts mehr für sich und füreinander tun zu können ohne Dazwischenkunft eines 'Geldverdienens'.«22
1758 veröffentlichte der Physiokrat François Quesnay, Leibarzt Ludwig des XV. und der Madame Pompadour sein berühmtes »Tableau économique«, dessen Eingangsworte aufhorchen lassen: »Wir brauchen weder etwas zu suchen noch etwas zu finden, denn alle menschlichen Verhältnisse werden von bewunderungswürdigen Gesetzen regiert, deren Wahrheit sich jedem aufzwingt, der einmal die Augen öffnet, und deren Autorität ein mit Vernunft begabter Mensch ebensowenig bestreiten kann wie die Gesetze der Geometrie. Diese Gesetze zu verstehen, heißt, ihnen zu gehorchen.«23
Seine Lehre fand die besondere Aufmerksamkeit von Fürsten und Staatsmännern wie Kaiser Joseph II. von Österreich, Katharina der Großen von Russland, König Gustav III. von Schweden etc. Die natürliche Ordnung, die der Liberalismus durch Beseitigung aller Schranken und Verbote, durch Entfesselung des reinen Konkurrenzprinzips einführen will, ist die Ordnung der Vorsehung. Es besteht eine prästabile Harmonie, die Welt läuft von selbst und es bedarf keiner »Kommandowirtschaft«.
Adam Smith führte diese Gedanken 1759 weiter aus: »Der Ertrag des Bodens erhält zu allen Zeiten ungefähr jene Anzahl von Bewohnern, die er zu erhalten fähig ist. Nur dass die Reichen aus dem ganzen Haufen dasjenige auswählen, was das Kostbarste und ihnen Angenehmste ist. Sie verzehren wenig mehr als die Armen; trotz ihrer natürlichen Selbstsucht und Raubgier […] teilen sie doch mit den Armen den Ertrag aller Verbesserungen. […] Von einer unsichtbaren Hand werden sie dahin geführt, beinahe die gleiche Verteilung der zum Leben notwendigen Güter zu verwirklichen, die zustande gekommen wären, wenn die Erde zu gleichen Teilen unter alle ihre Bewohner verteilt worden wäre und so fördern sie, ohne es zu beabsichtigen, ja ohne es zu wissen, das Interesse der Gesellschaft und gewähren die Mittel zur Vermehrung der Gattung. Als die Vorsehung die Erde unter eine geringe Zahl von Herren und Besitzern verteilte, da hat sie diejenigen, die sie scheinbar bei der Teilung übergangen hat, doch nicht vergessen und nicht ganz verlassen. Auch diese letzteren genießen ihren Teil von allem, was die Erde hervorbringt. In all dem, was das wirkliche Glück des menschlichen Lebens ausmacht, bleiben sie in keiner Beziehung hinter jenen zurück, die scheinbar so weit über ihnen stehen. […] Es macht uns Vergnügen, die Vervollkommnung eines so schönen und großartigen Systems zu betrachten und wir sind nicht ruhig, bis wir jedes Hindernis, das auch nur im mindesten die Regelmäßigkeit seiner Bewegungen stören oder hemmen kann, beseitigt haben.«24
Jenseits aller Freiheitsideologie sieht Smith das Prinzip der mechanischen Selbstregulation unabhängig vom Willen der beteiligten Menschen: »Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers und Bäckers erwarten wir das, was wir zum Essen brauchen, sondern davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen. Wir wenden uns nicht an ihre Menschen-, sondern an ihre Eigenliebe und wir erwähnen nicht die eigenen Bedürfnisse, sondern sprechen von ihrem Vorteil.«25
Für Kapitalanlagen gilt das Gleiche: Wenn er [der Anleger] es vorzieht, die nationale Wirtschaft anstatt die ausländische zu unterstützen, denkt er eigentlich nur an die eigene Sicherheit und wenn er dadurch die Erwerbstätigkeit so fördert, daß ihr Ertrag den höchsten Wert erzielen kann, strebt er lediglich nach eigenem Gewinn. Und er wird in diesem, wie auch in vielen anderen Fällen, von einer unsichtbaren Hand geleitet, um einen Zweck zu fördern, den zu erfüllen er in keiner Weise beabsichtigt hat.«26
Das Uhrwerk dieser aufgezogenen, subjektlosen Selbstregulation ist laut Smith der Preismechanismus, der die Bewegung der ökonomisierten Gesellschaft steuert: »Eine Ware wird […] zu dem verkauft, was man als ihren natürlichen Preis bezeichnet, wenn der Preis genau dem Betrag entspricht, der ausreicht, um nach den natürlichen Sätzen die Grundrente, den Arbeitslohn und den Kapitalgewinn zu bezahlen, welche anfallen, wenn das Produkt erzeugt, verarbeitet und zum Markt gebracht wird.«27
»Der Liberalismus als Ur- und Stammideologie aller modernen Ideologien, die allesamt blind von derselben axiomatischen Grundlage eines warenproduzierenden Systems und der »abstrakten Arbeit« (Erwerbsarbeit für Geld) als dessen Tätigkeitsform ausgehen, hatte in der Epoche zwischen Thomas Hobbes und Adam Smith bereits seine zentralen Widersprüche versammelt: einerseits das Postulat der »freien« und unbehelligten Individualität, andererseits das repressive Zwangsungeheuer des »Leviathan«; einerseits das Prinzip der Eigenverantwortlichkeit und des Aushandelns von Verträgen (Arbeitsverträgen, Geschäftsverträgen usw.) zwischen angeblich autonomen Subjekten, andererseits die Voraussetzung einer subjektlosen, automatischen Gesellschaftsmaschine des Kapitals mit einem selbstregulativen Preismechanismus; einerseits das Versprechen einer segenspendenden, wohlfahrtssteigernden Wirkung der »unsichtbaren Hand«, andererseits die weltweite Produktion einer künstlichen (nicht mehr aus natürlichen Restriktionen hervorgehenden) wie historisch beispiellosen Massenarmut.«28
Nach Robert Kurz war auch der geheime Sinn des Kantschen aufklärerischen Imperativs, der Mensch solle aus der »selbstverschuldeten Unmündigkeit« herausgehen und »sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen bedienen« nie etwas anderes, als sich dem kapitalistischen »System der Vernunft« nicht nur äußerlich zu unterwerfen, sondern es zu verinnerlichen.
Kurz kritisiert: »Auch die Vermutung Kants, eine kooperative, im nicht-warenförmigen Sinne genossenschaftliche Produktionsweise würde ihre Mitglieder »zu einem arkadischen Schafsleben einschläfern« setzt wie bei seinen liberalen Vorgängern jedes »höhere Streben« und jede menschliche Initiativkraft mit der Selbstbehauptung in der Trivialität von Marktbeziehungen gleich.«29
Auch der große Modernisierungsphilosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der die kapitalistische Weltvernunft zum totalen Weltgeist stilisierte, kann auf diesen Nenner gebracht werden: »Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit«.30
Der Glücksphilosoph Jeremy Bentham propagierte zwar das »größtmögliche Glück der größten Zahl«, hält aber eine Verfassung, die die Umverteilung des Reichtums festlegt, für gefährlich, weil durch die Gleichmacherei jeder Ansporn zur Arbeit ausgelöscht würde. Er sieht aber auch ein Sicherheitsproblem. Polizei, Militär, Richter und Henker müssen durch eine Volks- und Industriepädagogik ergänzt werden. Die über Mandevilles Vermittlung des »notwendigen« Wissens hinausgeht.
Bentham forderte Dressuranstalten, die, architektonisch angelehnt an spezielle Tierschauen, panoptisch eine Überwachung der Insassen ermöglichten, ohne dass diese ihre Überwacher wahrnehmen konnten. Das erinnert an die Videoüberwachung, die heute schrittweise auf die ganze Gesellschaft ausgedehnt wird.
»Wie der physikalischen Weltmaschine Newtons die gesellschaftliche Weltmaschine der Marktwirtschaft bei Smith entsprochen hatte, so mutierte nun auch das Hobbessche Ungeheuer »Leviathan« allmählich zur Staatsmaschine und deren pädagogischer Auftrag zur allgemeinen Gehirnwäsche stellte sich folgerichtig […] als »pädagogische Maschine« dar.«31
»Um das demokratische Endstadium des liberalen Totalitarismus kritisch zu begreifen« müssen wir »verstehen, daß die Modernisierungsdiktaturen seit Bentham nur prototypische Aggregatzustände der marktwirtschaftlichen Demokratie oder demokratischen Marktwirtschaft selber waren und daß wir nun freiwillig, weil »alternativlos«, in einem einzigen Benthamschen Gesamtzuchthaus sitzen.«32
Zu Malthus schreibt Robert Kurz: »War Bentham zuständig für die Dressur der Beschäftigten, so wurde es Malthus für den Umgang mit den »Überflüssigen«. […] War die Pseudo-Naturalisierung des Sozialen im 18. Jahrhundert und namentlich bei Adam Smith noch mit eher physikalischen Metaphern im Sinne des mechanistischen Newtonschen Weltbildes begründet worden, so macht Malthus nunmehr den ersten Schritt zur Biologisierung der gesellschaftlichen Krise […]. Denn sein ideologisch konstruiertes Bevölkerungsgesetz firmiert als angeblich biologisches Grundgesetz der gesellschaftlichen Entwicklung. Aus der biologischen Natur entnimmt er willkürlich die »dauernde Neigung aller Lebewesen, sich weit über das Maß der für sie bereitgestellten Lebensmittel zu vermehren. […] (Malthus 1824/1826, Bd.1 S. 14)««33
1.2.2. Neoliberalismus
Nach der Weltwirtschaftskrise von 1929-32 war der Glaube an die unsichtbare Hand des Marktes verblasst. Der Liberalismus sollte aber neben dem sich etablierenden Sozialismus und Keynsianismus weiter existieren und auch das Dritte Reich überstehen.
Die einzelnen Schulen wie die Freiburger und die Chicagoer Schule, aber auch Vertreter der Österreichischen Schule wie Friedrich August von Hayek hatten kaum Kontakt zueinander. Auf Einladung von Louis Rougier kam 1938 ein erstes internationales Treffen in Paris zustande, das Colloque Walter Lippmann. Der offizielle Zweck des Treffens bestand darin, die von Walter Lippmann in seinem Buch The Good Society aufgeworfenen Ideen zu diskutieren. Neben Rougier und Lippmann nahmen 24 weitere Intellektuelle wie Raymond Aron, Friedrich August von Hayek, Ludwig von Mises, Michael Polanyi, Wilhelm Röpke (später Berater von Ludwig Erhard), Bruce Hopper und Alexander Rüstow teil.34
Nach langer kontroverser Diskussion schlug Alexander Rüstow den Begriff »Neoliberalismus« vor. Diese Wortschöpfung sollte der Abgrenzung der neuen liberalen Konzepte von dem Laissez-faire-Liberalismus des 19. Jahrhunderts dienen und war die Bezeichnung einer breiten und heterogenen theoretischen Strömung. Neben der wirtschaftsgeschichtlichen Bedeutung ist er politisches Konzept, Entwicklungsmodell, Ideologie und akademisches Paradigma. Der Neoliberalismus sollte als antikommunistischer und antikapitalistischer Dritter Weg verstanden werden.
Die Einigkeit unter den frühen Neoliberalen hielt jedoch nur kurz. Während Neoliberale wie Rüstow forderten, dass der Staat bei Fehlentwicklungen in die Wirtschaft korrigierend eingreifen solle, war Mises der Ansicht, dass der Staat lediglich intervenieren dürfe, um Markteintrittsbarrieren zu beseitigen. Neoliberale wie Rüstow sahen die Entwicklung von Monopolen als Folge des Laissez-faire-Liberalismus, Neoliberale wie Mises hingegen als Folge staatlicher Intervention. Uneinigkeit herrschte auch in der Frage der Sozialpolitik.
Einige Jahre später wurden die Differenzen zwischen den Neoliberalen und den Altliberalen untragbar. Rüstow war enttäuscht, dass Mises an den alten Vorstellungen vom Liberalismus festhielt, die er für spektakulär gescheitert hielt und als Paleoliberalismus bezeichnete. Mises sah im Ordoliberalismus nicht mehr als einen »ordo-interventionism«, der sich im Ergebnis nicht von totalitärem Sozialismus unterscheide.
In seinem Werk Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft entwickelte Alfred Müller-Armack 1946 das Konzept der »Sozialen Marktwirtschaft«. Der Markt und das Soziale seien dabei nicht als Gegensätze zu verstehen. Die Konsumentensouveränität und der Wettbewerb wirkten Machtkonzentrationen entgegen. Unter Einbeziehung von Elementen der christlichen Sozialethik sollte die Soziale Marktwirtschaft die Mängel eines ungezügelten Kapitalismus ebenso wie die der zentral gelenkten Planwirtschaft vermeiden und stattdessen das Prinzip der Freiheit auf dem Markte mit dem des sozialen Ausgleichs verbinden.
Für den Vollstrecker der Sozialen Marktwirtschaft, Ludwig Erhard, war »der Markt an sich sozial« und brauchte nicht erst »sozial gemacht zu werden.« Erhard hatte ein wesentlich stärkeres Engagement für die freiheitliche und marktwirtschaftliche Komponente als die Schöpfer des theoretischen Konzeptes der Sozialen Marktwirtschaft. Seine Zielvorstellung war die Utopie einer entproletarisierten Gesellschaft von Eigentumsbürgern, die keiner Sozialversicherungen mehr bedürften.
Ein erster Bedeutungswechsel wird im Staatsstreich Augusto Pinochets in Chile vom 11. September 1973 gesehen: Pinochet besetzte die zentralen Stellen der Wirtschaftspolitik mit Chilenen, die seit 1955 in Chicago bei Friedman studiert hatten. Sie wurden als Chicago-Boys bekannt. Die unter Pinochet umgesetzte Wirtschaftspolitik war von den fundamentalistischen Theorien Friedmans und Hayeks inspiriert. Es kam innerhalb des autoritären Regimes somit zu einem weitreichenden Rückzug des Staates aus der Wirtschaft, dessen Folgen hoch umstritten sind. Oppositionelle Wissenschaftler in Chile kritisierten die von Ideen der Chicagoer Schule sowie Friedrich August von Hayek beeinflussten radikalen Reformen durch Milton Friedmans Chicago-Boys. Von Chile aus verbreitete sich dennoch der Neoliberalismus auch in die angelsächsische Welt.
Heute wird das Wort Neoliberalismus von Wissenschaftlern vorwiegend zur Bezeichnung von Marktfundamentalismus verwendet, nicht selten im Zusammenhang mit der Wirtschaftspolitik Ronald Reagans (Reaganomics) und Margaret Thatchers (Thatcherismus).35 Denn neoliberale Ökonomen empfehlen in Krisensituationen mantraartig drei Maßnahmen:
Deregulierung, also mehr »Frei«-Handel für Unternehmen,
Privatisierung von öffentlichem Eigentum und
Abbau des Sozialstaates.
Wendy Brown36 schreibt, dass Neoliberalismus mehr sei als eine Wirtschaftspolitik, eine Ideologie oder eine Neuordnung des Verhältnisses von Staat und Wirtschaft. Vielmehr handle es sich um eine Neuordnung des gesamten Denkens, die alle Bereiche des Lebens sowie den Menschen selbst einem ökonomischen Bild entsprechend verändere – mit fatalen Folgen für die Demokratie.
Andreas Weber weist darauf hin, dass neoliberale Konzepte des Marktes, die private Renditeerwartungen in den Vordergrund stellten, einen Raubbau an der Biosphäre befördern und dem Gemeinwohl schaden würden, denn alles Geld, das scheinbar aus dem Nichts verdient werde, stamme aus irgendeiner Liquidation von sozialem, menschlichem oder natürlichem Kapital.
Noam Chomsky vertritt die Ansicht, der Neoliberalismus habe seit Ronald Reagan und Margaret Thatcher weltweite Hegemonie erlangt. Dies habe zur Privilegierung weniger Reicher auf Kosten der großen Mehrheit geführt. Große Konzerne und Kartelle beherrschten das politische Geschehen in den USA. Der freie Markt bringe somit nicht im Geringsten eine Wettbewerbsordnung hervor. Durch den politischen Einfluss großer Unternehmen auf die US-amerikanischen Parteien werde dauerhaft die Demokratie untergraben.
Für Robert Kurz war der Liberalismus eine Perversion der menschlichen Gesellschaft: »Schon der Name ist nicht allein irreführend, sondern geradezu eine perfide Verdrehung. Denn diejenige Betätigung und Mentalität, die bis dahin bei allen Völkern und Zeiten als eine der niedrigsten und verächtlichsten gegolten hatte, nämlich die Verwandlung von Geld in mehr Geld als Selbstzweck, die darin eingeschlossene abhängige Lohnarbeit und damit die unaussprechliche Selbsterniedrigung des Sichverkaufen-Müssens, wurde zum Inbegriff menschlicher Freiheit umredigiert. Diese Besudelung des Freiheitsbegriffs, die im Lobpreis der Selbstprostitution gipfelt, hat die erstaunlichste Karriere in der Geschichte des menschlichen Denkens gemacht.«37
1.3. Trennung der Produktion von der Reproduktion
»Alle Entwicklung der menschlichen Gesellschaft über die Stufe tierischer Wildheit hinaus
fängt an von dem Tage, wo die Arbeit der Familie mehr Produkte schuf, als zu ihrem
Unterhalt notwendig war«
Friedrich Engels, 1878
Handel, Bergbau und Plantagenwirtschaft erforderten bereits hohe Investitionen, durch die entsprechend zahlungsfähigen Eliten weiterer Reichtum zufiel. Auch an Kriegen konnten sich Investoren umfänglich bereichern. Zudem spalteten Privatisierung und Repression die Gesellschaft.
Dazu Fabian Scheidler: »Nicht nur der Krieg entwurzelte und traumatisierte die Menschen, sondern auch das neue ökonomische Regime. Gemeinschaftliche und subsistente Wirtschafts- und Lebensformen wurden mit Gewalt zerschlagen. Die Einhegung von Gemeindeland, die erzwungene Besteuerung in Münzgeld und die Repression gegen Arme und Vagabunden nahmen immer mehr Menschen ihre Lebensgrundlage und zwangen sie dazu, ihre nackte Arbeitskraft auf dem freien Markt zu verkaufen und miteinander zu konkurrieren. Lebensformen, die auf Kooperation beruhten, wurden nach und nach zurückgedrängt zugunsten eines rücksichtslosen Überlebenskampfes.«38
Eine systematische und kontinuierliche Weiterentwicklung der Bereicherungsmöglichkeiten lieferte die Industrialisierung, die sich schließlich weltweit flächendeckend ausbreitete. Motor war der unstillbare Erfindergeist des Menschen, der sich seine Arbeit erleichtern wollte. Häufig sich wiederholende nervtötende Arbeitsabläufe begann er zu mechanisieren. Spinnen und Weben wurde durch zunächst wasserbetriebene Spinnmaschinen (ab 1738) und von Tieren getriebene Webmaschinen (ab 1728 in Lyon) ersetzt. Hinzu kam die 1712 von Thomas Newcomen erfundene und 1769 von James Watt verbesserte Dampfmaschine. Diese Maschinen erforderten hohe Investitionen, die das Budget der noch in der häuslichen Umgebung tätigen Handwerker überstieg.
Marx und Engels schreiben: »Die bisherigen kleinen Mittelstände, die kleinen Industriellen, Kaufleute und Rentiers, die Handwerker und Bauern, alle diese Klassen fallen ins Proletariat hinab, teils dadurch, daß ihr kleines Kapital für den Betrieb der großen Industrie nicht ausreicht und der Konkurrenz mit den größeren Kapitalisten erliegt, teils dadurch, daß ihre Geschicklichkeit von neuen Produktionsweisen entwertet wird. So rekrutiert sich das Proletariat aus allen Klassen der Bevölkerung.«39
Leistungsfähige Investoren errichteten Manufakturen und Fabriken. Damit setzten sich diese Investoren zwischen Reproduktion und Produktion. Die Menschen waren gezwungen, ihren Lebensunterhalt in diesen neu entstandenen Manufakturen und Fabriken zu erwerben. Sie reproduzierten sich deshalb immer weniger über ihre Tätigkeiten auf ihrem eigenen Grund und Boden oder in ihren häuslichen Werkstätten, sondern über Geld aus der ungeschützten Umgebung industrieller Produktionsstätten. »Indem sie nur noch durch das Joch der »Arbeitsmärkte« an die Reproduktion ihres eigenen Lebens herankommen konnten, mußten sie ihre gesamte produktive Tätigkeit dem abstrakten Selbstzweck des Geldes (aus Geld mehr Geld machen) ausliefern.«40
Der Mensch wurde aber nicht nur Produzent von Produkten, die er nicht selbst nutzte, sondern auch Nutzer von Produkten, die er nicht selbst hergestellt hatte. Diese Produkte wurden und werden ihm über wachsende profitmaximierende Handelsketten zugeführt. Er wurde also Ausbeutungsobjekt in beiderlei Hinsicht, als Produzent und als Konsument.
Dazu Robert Kurz 1997: »Historisch hat sich der Markt von den Grundstoffen, den Vor- und Zwischenprodukten immer weiter vorgeschoben und immer mehr reproduktive Bezüge okkupiert; nicht nur bis zu den Endprodukten, die direkt in die Konsumtion eingehen, sondern darüber hinaus bis zur Vermittlung der Konsumtion selber in Form von Dienstleistungen und bis in den Intimbereich.«41
Weil die Kapitaleigner immer mehr Geld aus dem Arbeitsprozess und der Gesellschaft herauszogen, um sich selbst zu bereichern bzw. die immer umfangreichere in ihren Händen befindliche Infrastruktur auszubauen, war für die Arbeit der Erwerbstätigen immer weniger Geld vorhanden. Diese verarmten zunehmend und wohnten schließlich mit ihren Familien zur Miete in ärmlichsten städtischen Behausungen.
Diese »externen Investoren«, okkupierten jedoch nicht nur die Infrastruktur, sondern zunehmend auch die Ressourcen. Diese Bereiche wurden und werden als strategische Kapitalanlage betrachtet und an Börsen gehandelt. Das Gemeingut Erde ist in die falschen Hände, in die Hände von gewissenlosen externen Investoren geraten und gehört immer weniger denen, die von ihm leben. Bereits mehr als 60 Millionen (Gallup 2009: 2050 eine Milliarde) mittel- und rechtlose Menschen befinden sich weltweit auf der Flucht, leben in Massenunterkünften oder in Zeltstädten. Auch die roten Listen von Tieren und Pflanzen werden immer länger. In Deutschland hat die »Insektenmasse« seit den 80er Jahren bereits um rund 80 %, die Zahl der Wirbeltiere um 60 % abgenommen.
1.4. Geld und Eigentum
Mit der Sesshaftigkeit hat der Mensch begonnen, in wachsendem Umfang Lebensmittel und Bedarfsgegenstände zu produzieren. Damit nicht jeder alles selbst produzieren musste, begann man zu tauschen oder stellte Schuldscheine aus. Der für für einen anderen Arbeitende bekam einen seiner Leistung entsprechenden Schuldschein. Wenn er Produkte oder Dienstleistungen von anderen benötigte, konnte er den Schuldschein einlösen und dieser konnte wiederverwendet oder vernichtet werden.
Mit der Differenzierung der Produktpalette und der damit verbundenen weiteren Arbeitsteilung wurde ein Medium erforderlich, das die für die Herstellung der Produkte oder die zum Erbringen der Dienstleistungen benötigte Arbeit allgemeinverständlich repräsentierte. Aus den anfänglichen Schuldscheinen entwickelte sich das Geld als gesetzliches Zahlungsmittel.
Die König oder später die Kommune bzw. der Staat prägte Münzen oder druckte Geldscheine. »Geld« wurde über Banken verwaltet und in Umlauf gebracht. Der Produzent von Produkten oder Dienstleistungen bekam die entsprechenden Münzen oder Scheine, die er beliebig verwenden konnte.
Das Geld konnte auch verwendet werden, um andere für sich arbeiten zu lassen, Das verleitete den Geldgeber dazu, sich seine Investition finanzieren zu lassen. Dem Erbringer der Leistungen wurde nicht der volle Wert seiner Arbeit vergütet, sondern nur soviel zugestanden, wie er für seine und seiner Familie Reproduktion benötigte. Die Differenz, den Mehrwert, eignete sich der Investor an.
Die Arbeit wurde abstrakt, indem mit wachsender Industrialisierung vom einzelnen Produzenten zunehmend nur noch Produktteile hergestellt und die fertigen Produkte über globale Märkte vermittelt wurden. Produzent und Konsument kannten sich persönlich nicht mehr. Robert Kurz schreibt in diesem Sinne: »In der Moderne ist Geld nichts anderes als die gesellschaftliche Darstellungsform verausgabter abstrakter Arbeitskraft, die über die Reproduktionskosten hinaus den berühmten Mehrwert produziert.«42 Das leistungslose Kapitaleinkommen war geboren.
Heute dienen primär Bankguthaben als Zahlungsmittel, die per Überweisung oder Kreditkartenzahlung übertragen werden können. Kredit von einem Investor oder einer Bank ist eine Vorauszahlung auf noch zu leistende Arbeit. Das Risiko eine nicht erfolgende Rückzahlung abzusichern und die Bearbeitung der Aus- und Rückzahlung inklusive eventuell erforderlicher Mahnungen lässt sich der Investor finanzieren, zudem verlangt er den Mehrwert in Form von Zinsen, Dividende, Profit, Rendite etc.
Es gibt folgende Haupttypen des Geldes als gesetzliches Zahlungsmittel:
Währung, Warengeld oder Bargeld. Das Bargeld kann aus werthaltigen oder nichtwerthaltigen Wertgegenständen oder Münzen sowie Banknoten bestehen.
Giralgeld, Geschäftsbankengeld, Kreditgeld, Bankguthaben oder Buchgeld. Voraussetzung für die Entstehung von Kreditgeld ist die Bildung einer Gläubiger-Schuldner-Beziehung. Leistung und Gegenleistung erfolgen nicht zum gleichen Zeitpunkt. Die Schuld der Bank, aus der Sicht des Kunden sein Bankguthaben, erfüllt die Funktion eines allgemein anerkannten Zahlungsmittels. Mit dieser »Schuld der Bank« kann der Kunde beispielsweise Rechnungen begleichen.
Zentralbankgeld und Zentralbankreserven. Im Gegensatz zu Kreditgeld, welches nur durch Verschuldung entstehen kann, wird Zentralbankgeld ohne jeglichen Verschuldungszwang erzeugt.
Giralgeld und Zentralbankgeld werden auch als Fiatgeld bezeichnet.
Die gesetzliche Geldmenge besteht also aus Bargeld und Fiatgeld.43 Zusätzlich werden Geldmengenaggregate gebildet, die Klaus Simon folgendermaßen beschreibt44:
M1 umfasst den Bargeldumlauf und täglich fällige Einlagen (z. B. Girokonten)
M2 umfasst M1 plus kurzfristige Termin- und Spareinlagen mit einer Laufzeit bis zu zwei Jahren oder einer Kündigungsfrist bis zu drei Monaten (z. B. Sparbücher)
M3 ergänzt M2 noch um den Bestand sog. marktfähiger Instrumente: Repogeschäfte, Geldmarktfondszertifikate, Geldmarktpapiere sowie Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis zu zwei Jahren.
Die Bundesbank weist neben M3 auch Giralgeldpositionen ohne zeitliche Einschränkung aus. Diese Menge ist knapp doppelt so groß wie M3 und 18 mal so groß wie der Bargeldumlauf. Sowohl das Volumen der Guthaben als auch das der Kredite wächst unaufhörlich.
Zu den Krediten schreibt Otto Veit 1966: »Solches Kreditgeld ist volkswirtschaftlich nicht 'ungedeckt', wie manchmal gesagt wird. Bankmäßig liegt die Deckung in dem Anspruch gegen den Schuldner; volkswirtschaftlich liegt sie in der antizipierten Güterleistung, die der Schuldner erbringen muß, um den Kredit einzulösen«45.
Grundsätzlich existieren zwei Geldkreisläufe: Der Geldkreislauf der Banken untereinander und mit der Zentralbank sowie der Geldkreislauf der Banken mit den Nichtbanken.
Den Guthaben stehen die ausgereichten Kredite gegenüber, wobei die gesamte Guthabenmenge symmetrisch weitgehend der Gesamtmenge ausgereichter Kredite entspricht.
Eine Lösung des Geldproblems wird oft in Parallelwährungen gesehen. Seit Oktober 2001 wurden in Bremen, Chiemgau, Ainring, Pfaffenhofen, Göttingen, Witzenhausen, Gießen, Hagen, Schopfheim, Siegen, Berlin, Düsseldorf, Dresden, Kamenz, Zwönitz, Hitzacker (Elbe), Neustadt (Dosse) und Schleswig-Holstein regionale Geldscheinringe eingeführt, bei
denen es um eine gezielte Belebung regionaler Wirtschaftskreisläufe geht46.
Bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden auch im Bereich der Genossenschaften häufig Parallelwährungen eingeführt. So hat beispielsweise Eduard Pfeiffer, um die Regale in seinen Läden mit Waren füllen zu können, 1863 Gutscheine an seine künftigen Kunden ausgegeben, die sie nach der Eröffnung der Läden wieder gegen Waren einlösen konnten.
Doch der Einsatz solcher Parallelwährungen auf privater oder genossenschaftlicher Ebene hat damals auf beiden Seiten, bei den Herausgebern solcher Wertscheine und bei den Nutzern, zu ständigen Problemen geführt: Die Herausgeber verschwanden mit der Kasse und die Nutzer fälschten die Wertscheine. 1894 wurde dann durch eine Novellierung des Genossenschaftsgesetzes der Einsatz von Wertscheinen untersagt.
Michael Unterguggenberger, der Bürgermeister der 4.200 Seelen zählenden Gemeinde Wörgl im Tiroler Österreich, Sozialdemokrat und Anhänger der Ideen Silvio Gesells, gab am 31. Juli 1932, dem Höhepunkt des damaligen Finanzcrashs, eine Währung in Form von kleinen gelben, blauen und rosa Scheinen heraus, die er »Arbeitswertbestätigungen« nannte. Zur Begründung der neuen Währung sagte er über das bestehende Geld: »Es versickert in den Zinsenkanälen und sammelt sich in den Händen weniger Menschen, die das Geld nicht mehr dem Warenmarkt zuführen, sondern als Spekulationsmittel zurückhalten«47. Der Wert dieser Währung schrumpfte allerdings pro Monat um ein Prozent und musste deshalb mit entsprechenden Marken wieder auf den alten Wert gebracht werden. Jeder versuchte, die Scheine nicht zu sparen, sondern möglichst schnell wieder loszuwerden. So füllte sich auch »die leere Rathauskasse rapide, denn um das Schwundgeld wieder loszuwerden, zahlten die Wörgler Steuern im Voraus.«48
Diese Währung wurde zunächst von der Gemeinde als Lohn ausgegeben, dann aber auch von den regionalen Unternehmen übernommen: »Wörgler Kaufleute und Fabrikanten hatte Bürgermeister Unterguggenberger dazu gebracht, dieselbe Summe an ausgegebenem Freigeld in österreichischen Schilling in einem Bankdepot zu hinterlegen – wer dem Schwundgeld nicht traute, konnte es dort umtauschen, allerdings gegen eine Gebühr von zwei Prozent.«49
Drei Straßen und die Volksschule wurden an die Kanalisation angeschlossen. Eine Eisenbetonbrücke über einen Gebirgsbach und eine Skisprungschanze wurden gebaut. Die Scheine trugen die Aufschrift: »Lindert die Not, schafft Arbeit und Brot«. Während die Arbeitslosigkeit in Österreich weiter stieg, sank sie in Wörgl.
Den Bürgern kam es so vor, »als habe jemand mit dem Flugzeug einen Haufen Scheine abgeworfen. Dabei ist kaum mehr Geld da als vorher. Im Schnitt sind bloß 5500 Schilling in Arbeitswertbestätigungen im Umlauf. Die Scheine zirkulieren nur schneller. Das neue Geld sorgt für eine überraschende Einigkeit in Wörgl. Im Rest des Landes ringen Sozialdemokraten, Austrofaschisten und Nationalsozialisten um die Macht. Parteiarmeen liefern sich Schießereien. Eine Zeitung titelt: Weg mit dem Parlament, die Diktatur muss her! In Wörgl aber schlichtet der Erfolg des Freigelds jeden Streit. Der Gemeinderat steht einstimmig hinter dem Bürgermeister. Rechte und Linke stoßen im Wirtshaus auf den Aufschwung an.«50
Der Höhenflug endete abrupt. Nachdem rund 200 weitere österreichische Gemeinden angekündigt hatten, das »Wunder« wiederholen zu wollen, schaltete sich Ende 1932 die Nationalbank ein. Die Wörgler verstießen gegen das alleinige Recht der Bankem, Geld in Umlauf bringen zu dürfen. Am 1. September 1933 verkündete Michael Unterguggenberger das Ende des Experiments. »Der gestoppte Geldfluss schlug den Arbeitern das Werkzeug aus der Hand«, schrieb der enttäuschte Bürgermeister in einem Fazit. Auch in anderen Ländern stoppten nationale Währungshüter Freigeld-Experimente.
Nach dem Muster von Wörgl hat auch der Verein »Berliner Regional« am 3. Februar 2005 den »Berliner« in Form von Wertgutscheinen herausgegeben. Er konnte an jedem Donnerstag während des Wochenmarkts auf dem Kollwitzplatz 1:1 gegen Euro eingetauscht werden. Er sollte die regionale Produktion stützen und fördern. Aber beispielsweise eine Bäuerin aus dem Berliner Umland, die einen Marktstand auf dem Kollwitzplatz hatte und sich deshalb verpflichtet sah, mitzuwirken, teilte mir mit: »Mit dem Regional kann ich nichts anfangen, ich kaufe nichts in Berlin und meine MitarbeiterInnen auch nicht. Sie wollen ihren Lohn in Euro ausbezahlt bekommen. Ich kann den Berliner nur verschenken.«
Wie Parallelwährungen sich auf höherer Ebene auswirken, kann vielleicht am Beispiel der DDR demonstriert werden. Die (Ost-)Mark konnte in gewisser Hinsicht als Parallelwährung zur DM angesehen werden. Die Löhne wurden in der Landeswährung ausgezahlt, aber die Unternehmen versuchten sämtliche Produkte nach Möglichkeit in DM zu verkaufen. Für den Bürger blieb der in DM nicht verkäufliche Rest. Wenn er seine besonderen Wünsche erfüllen wollte, musste er seine Landeswährung in DM umtauschen um dann in den Intershops einkaufen zu können. Ähnlich könnte es den Bürgern anderer Länder wie beispielsweise Griechenland gehen, wenn die Drachme als Parallelwährung zum Euro eingeführt würde.
Wenn Parallelwährungen eingeführt würden, sollten sie nur von staatlichen Stellen herausgegeben werden und auch zur Entrichtung von Steuern eingesetzt werden können. Eine Gemeinde beispielsweise kann bei Fälschungen sofort die Gendarmerie einsetzen und macht sich auch nicht mit der Kasse aus dem Staub. Bei privaten Währungen besteht jedoch die Gefahr des Diebstahls der Kasse und auch der Fälschung der Wertscheine. In beiden Fällen müssen Gerichtsverfahren eingeleitet werden um – mit entsprechender Verzögerung oder in nur eingeschränktem Umfang – entstandene Schäden zu beheben.
Geld ist der Transmissionsriemen von der Arbeit zum Eigentum. Doch es gibt zwei Grundformen des Eigentums, das private Eigentum und das Gemeingut.
Bezüglich des Gemeingutes gab es im Nachkriegsdeutschland zwei Einflusssphären: die der drei westlichen Alliierten, die die altrömischen Vorstellungen des Privateigentums vertraten und durchsetzten und die des östlichen Alliierten, der die altgriechischen Vorstellungen des Gemeineigentums oder Volkseigentums vertrat. Entsprechendes hat sich im Grundgesetz des Westens bzw. der Verfassung des Ostens niedergeschlagen.
Das Grundgesetz enthält zwar den Artikel 14, der Missbrauch von Eigentum mit Enteignung belegt, aber dieser Artikel wurde mit der Zeit immer einseitiger zugunsten des Privateigentums ausgelegt.
Die Verfassung der DDR enthielt in Artikel 12 die Formulierung: »Die Bodenschätze, die Bergwerke, Kraftwerke, Talsperren und großen Gewässer, die Naturreichtümer des Festlandssockels, Industriebetriebe, Banken und Versicherungseinrichtungen, die volkseigenen Güter, die Verkehrswege, die Transportmittel der Eisenbahn, die Seeschifffahrt sowie der Luftfahrt, die Post- und Fernmeldeanlagen sind Volkseigentum. Privateigentum daran ist unzulässig.«
Ein Staat, der das Privateigentum protegiert entwertet das Arbeitseinkommen. Allerdings hat die DDR aus dem Volkseigentum kein wirkungsvoll organisiertes Gemeingut entwickelt, sondern eine Pateienhierarchie praktiziert.
Die Geldmenge und das Angebot von Produkten und Dienstleistungen müssen sich in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander befinden. Ist die Geldmenge niedriger als dieses Angebot, kommt es zu Preissenkungen und der Gefahr einer Deflation. Ist die Geldmenge zu hoch, kommt es zu Preissteigerungen und zur Gefahr der Inflation, die beispielsweise 1923 extreme Ausmaße angenommen hatte.
»Wir akzeptieren 50 Euro heute nur, weil wir davon ausgehen, dass wir morgen noch etwas dafür bekommen. Der bekannte Inflationsforscher Peter Bernholz hat schön beschrieben, dass alle Hyperinflationen »überraschend« gekommen sind. Zu viel Geld gab es lange davor, aber erst der Vertrauensverlust hat zu einer Flucht aus dem Geld und zur völligen Entwertung geführt.«51
Des Menschen Leben verläuft in drei Grundphasen: In der ersten Phase, der Kindheit und Jugend, benötigt er mehr von der Gesellschaft, als er ihr geben kann, in der zweiten Phase, der Lebensmitte, gibt er ihr – soweit nicht arbeitslos oder krank – mehr, als er von ihr braucht und in der dritten Phase, dem Alter, ist es wieder umgekehrt. Das über das Umlageverfahren hinaus bei den Besserverdienern vorhandene Geld der Lebensmitte wird in Banken, Lebens- und Altersversicherungen, Aktienpaketen und Fonds angespart. So entstehen immense Geldsummen, die nicht nur in der Realwirtschaft, sondern auch auf den Finanzmärkten untergebracht werden.
Um Investitionen zu tätigen werden sowohl diese überschüssigen Gelder, aber darüber hinaus auch Kredite eingesetzt. Kredite sind Vorgriffe auf noch zu leistende Arbeit. Auf den Finanzmärkten wird mit Krediten, die auch als Derivate verpackt sind, und schließlich auch mit Futures und »Over the Counter« gehandelt und gewettet. Alles läuft in dem Glauben, dass die Vorgriffe auf die noch zu leistende Arbeit möglich sind. Aber inzwischen hat die globale Summe dieser »Vorgriffe« mehr als das Zehnfache der realen Bruttoinlandsprodukte aller Länder der Erde überschritten. Das Vertrauen in das Geld ist entsprechend gesunken. Die globale Ökonomie könnte jederzeit kollabieren.
Durch den Profit kommen immer umfangreichere reale und schließlich auch – außerhalb der Realwirtschaft – virtuelle Kapitalien, sogenannte Finanzblasen oder Heuschreckenkapitalien, zustande, die es ermöglichen würden, ein Vielfaches von dem zu kaufen, was auf dem gesamten Globus an Produkten und Dienstleistungen zur Verfügung steht. Damit ist auch das Geld als Tauschmittel entsprechend entwertet.
Zur Veranschaulichung, was allein der Zins zur der Vermehrung des Geldes beitragen kann, sei das allen Ökonomen geläufige Gleichnis des Josephspfennigs angeführt: Wenn Joseph seinem Sohn Jesus bei dessen Geburt einen einzigen Pfennig zurückgelegt hätte, wäre dieses »Kapital« bei einer jährlichen Verzinsung von 5 % mit Zinseszinsen im Jahre 2000 auf den fiktiven Gegenwert von 132 Milliarden Erdkugeln aus purem Gold angewachsen. In der gesamten Geschichte der Menschheit wurden aber schätzungsweise erst 155.000 t Gold geschürft, die in einen Würfel der Kantenlänge 20 Meter passen würden.52
Es ist deshalb auch den Christen an mehreren Stellen der Bibel ein Zins- und Wucherverbot auferlegt:
2. Buch Mose (Exodus) 22 , Vers 24:
»Wenn du Geld verleihst an einen aus meinem Volk, an einen Armen neben dir, so sollst du an ihm nicht wie ein Wucherer handeln; du sollst keinerlei Zinsen von ihm nehmen.«
3. Buch Mose (Levitikus) 25, Vers 35-37:
»Wenn dein Bruder neben dir verarmt und nicht mehr bestehen kann, so sollst du dich seiner annehmen wie eines Fremdlings oder Beisassen, dass er neben dir leben könne; und du sollst nicht Zinsen von ihm nehmen noch Aufschlag, sondern sollst dich vor deinem Gott fürchten, dass dein Bruder neben dir leben könne. Denn du sollst ihm dein Geld nicht auf Zinsen leihen noch Speise geben gegen Aufschlag.«
5. Buch Mose (Deuteronomium) 23, Vers 20:
»Du sollst von deinem Bruder nicht Zinsen nehmen, weder für Geld noch für Speise noch für alles, wofür man Zinsen nehmen kann.«
Luther schrieb 1540: »Darum ist ein Wucherer und Geizhals wahrlich kein rechter Mensch; er sündigt auch nicht eigentlich menschlich! Er muß ein Werwolf sein, schlimmer noch als alle Tyrannen, Mörder und Räuber, schier so böse wie der Teufel selbst! Er sitzt nämlich nicht als ein Feind, sondern als ein Freund und Mitbürger im Schutz und Frieden der Gemeinde und raubt und mordet dennoch gräulicher als jeder Feind und Mordbrenner. Wenn man daher die Straßenräuber, Mörder und Befehder rädert und köpft, um wieviel mehr noch sollte man da erst alle Wucherer rädern und foltern, alle Geizhälse verjagen, verfluchen und köpfen.«53
Die Katholische Kirche hatte noch in ihrem Gesetzbuch (Codex Juris Canonici, Kanon 1543) von 1917/18 die Regelung, dass ein Darlehensvertrag keinen Gewinn rechtfertige, allerdings verbunden mit dem Zusatz, dass weltliches Gesetz eine abweichende Vereinbarung erlauben könne. Beides wurde im Zuge der Neufassung 1983 ersatzlos gestrichen, das Verbot des Gewinns aus dem Darlehensvertrag damit also endgültig und vollständig aufgehoben, obwohl erkennbar auch damals schon solche Gewinne erwerbstätige Bürger und die Gesellschaft zunehmend belasteten.
1.5. Ausbeutung von Produzent und Konsument
»Die Mehrheit der gewöhnlichen Bevölkerung versteht nicht, was wirklich geschieht. Und
sie versteht noch nicht einmal, dass sie es nicht versteht.«
Noam Chomski
Die Ausbeutung von Konsument und Produzent beschrieben bereits 1848 Marx und Engels im Kommunistischen Manifest: »Ist die Ausbeutung des Arbeiters durch den Fabrikanten soweit beendigt, daß er seinen Arbeitslohn bar ausgezahlt bekommt, so fallen die anderen Teile der Bourgeoisie über ihn her, der Hausbesitzer, der Krämer, der Pfandleiher usw.«54
Offensichtlich haben sie sich allerdings mit dem zweiten Teil dieser Ausbeutung im privaten Bereich nicht weiter befasst, sondern im Gegenteil, sie rieten ab von Verbraucherinitiativen der Daseinsvorsorge, speziell von Konsumgenossenschaften.55,56 Es ist wohl deshalb alles Denken und Handeln der gesamten Linken weltweit durch eine beachtenswerte Einseitigkeit gekennzeichnet: sie befasst sich vorrangig mit der Arbeit, dem Betrieb und der Produktion statt mit dem Leben, dem Zuhause und der Reproduktion. In diesem Text wird von der Ausbeutung des Arbeiternehmers als Produzent ausgehend die Entfaltungsmöglichkeit des Arbeitnehmers als Konsument von Waren und Dienstleistungen ins Zentrum gerückt.
Der Wert jeder kapitalistisch produzierten Ware W stellt sich nach Marx57 dar in der Formel:
Der Wert der Ware (W) setzt sich aus dem konstanten Kapital (c), dem variablen Kapital (v) und dem Mehrwert (m) zusammen. Im konstanten Kapital (c) sind die Kosten für die Ressourcen, die gesamte Infrastruktur inklusive Software, Lizenzen, vorgefertigte Teile, Transport, Werbung, Steuern etc. enthalten. Durch den Produktionsprozess wird dieses konstante Kapital des Investors um den Wert der vom Arbeitnehmer investierten Arbeit vermehrt. Der Arbeitnehmer erhält allerdings nur den Teil v (variables Kapital) dieses Wertes als Arbeitnehmerentgelt58. Den Teil m (Mehrwert) kassiert der Investor als Zins, Rendite, Profit etc.
Als Konsument muss der Bürger aber mit seinem als Beschäftigter erhaltenen Lohn v den Wert der Ware (W) begleichen. Er muss also, da im Wert der Ware (W) alle Kosten (c, v und m) enthalten sind, als Konsument den Mehrwert somit ein zweites Mal entrichten. Mit anderen Worten: Er bezahlt mit W auch den Mehrwert, der ihm vom Lohn abgezogen wird.
Hinter dem Preis einer Ware verbergen sich unterschiedlich komplex vernetzte Produktionsketten, von denen nur eine hier schematisch dargestellt wird. Auf der untersten Ebene steht c für die Rohstoffe: Boden, Erdöl, Metall, Kohle etc. sowie die gesamte Infrastruktur inklusive aller Verkehrswege etc.. Neu eingesetzt wird immer wieder Arbeitskraft, von der allerdings auf jeder Ebene der Mehrwert abgezogen wird. Vom Anfang bis zum Ende der Wertschöpfungskette streitet sich also der Anleger – weil er angeblich c geliefert habe – mit dem Arbeitnehmer (v) um den Anteil (m) am Arbeitsergebnis. Auf jeder Ebene wird also der Kette der Mehrwert (m) entzogen, der mit dem W in das c der nächsthöheren Stufe einfließt. So enthält das c der obersten Ebene die Mehrwerte aller darunter liegenden Teilprozesse und beträgt nach Helmut Creutz durchschnittlich 40 % des Preises der Ware59. (Auch die Steuern der einzelnen Produktionsebenen werden als Teil von c in W weitergereicht und machen ebenfalls einen erheblichen Teil des Preises des Endproduktes aus.)
1. Wertschöpfungskette
Anzumerken ist, dass nicht nur die Endstufe einer Produktionskette, sondern jede Produktionsstufe für sich in die Berechnung des Bruttoinlandsproduktes einfließt und dass die sogenannte Mehrwertsteuer oder besser Umsatzsteuer zwar weitergereicht wird, sich aber nicht auf den Mehrwert, sondern den Wert des Gesamtproduktes bezieht.
Die Produktionskette repräsentiert sowohl historisch als auch aktuell die Herstellung jedes Produktes: Nachdem der Mensch sesshaft geworden war, hat er sich, wie oben bereits beschrieben, Schritt für Schritt die Werkzeuge geschaffen, mit denen er sich seine Arbeit erleichtern und immer leistungsfähigere Gerätschaften herstellen bzw. Dienstleistungen erbringen konnte, die ihn schließlich in die Lage versetzten, selbst komplexeste Produktionsschritte zu automatisieren.
Würde ein Betrieb von den Arbeitnehmern besetzt werden, würde der Mehrwert für sie und die Konsumenten erst dann entfallen, wenn es ihnen gelungen wäre, den Schuldendienst für alle Stufen der Produktionskette vollständig geleistet zu haben und auf allen diesen Produktionsstufen keine Dividende etc. mehr ausgeschüttet werden müsste. Da sie aber in der Regel nicht in der Lage sind, das erforderliche Kapital aufzubringen, bleibt die Abschöpfung des Mehrwerts in Form der Hypothekenzinsen für Belegschaft und Kundschaft erhalten. Nur wenn das erforderliche Kapital nicht von »externen Investoren«, sondern von den Abnehmern/der Kundschaft, also den »internen Investoren« aufgebracht werden könnte, würde die Abschöpfung des Mehrwerts vermieden.
Auf höherer Ebene betrachtet investiert der »externe Investor« also Geld (G) in den Produktionsprozess, um über den Mehrwert (m) mehr Geld (G') zurückzubekommen. Dieses Geld kann er entweder verbrauchen, in die eigene oder andere Infrastruktur investieren, Ressourcen erwerben etc..
2. Produktionsprozess
Über die Produktion hinaus wird jedoch die nationale und globale Geldmenge durch weitere Quellen, insbesondere die kapitalgedeckte Alterssicherung in Form von Pensionsfonds und Lebens- oder Altersversicherungen aller Art genährt.
1.6. Kapitalgedeckte Alterssicherung
In Deutschland sorgen seit vielen Jahrzehnten immer etwa zwei Drittel der Gesellschaft durch ihre Arbeit für das zu versorgendes Drittel, unabhängig davon, ob es Kinder oder Senioren sind.60
Entscheidend ist aber, dass es möglichst wenige Arbeitslose gibt, die versicherungspflichtigen Arbeitsstunden ausreichend hoch bleiben (seit 1991 sehr konstant um 60 Milliarden pro Jahr), die zwei Drittel der Gesellschaft ausreichend gut qualifiziert sind und ihre Produkte und Dienstleistungen möglichst vollständig abgesetzt werden können. Dies setzt allerdings ein ausreichend qualifiziertes und qualifizierendes Bildungswesen voraus.
3. Kapitalgedeckte Alterssicherung
Die gesetzliche Alterssicherung erfolgt in Deutschland seit 1957 im Wesentlichen über ein Umlageverfahren61, das allerdings u. a. hinsichtlich der Eliminierung der Kinderkasse durch Adenauer, einer fehlenden Freigrenze und seiner Beitragsbemessungsgrenze verbesserungsbedürftig ist62. Besteht aber in der zweiten Lebensphase über den Beitrag zum Umlageverfahren hinaus ein Überschuss, ergibt sich das Problem, diesen zu speichern. In der Regel geschieht dies über eine kapitalgedeckte Alterssicherung. Es häuften sich damit erhebliche Kapitalmassen an, die über Versicherungen, Banken und Fonds verwaltet und in der Realwirtschaft oder auf den Finanzmärkten (von denen sie dann als »Heuschreckenkapital« zurückkommen) eingesetzt werden. Es wurde Biertischgespräch, welche Rendite diese Anlagen ergaben und welchen dieser Einrichtungen man deshalb sein Geld anvertrauen sollte.
Durch den wachsenden Niedriglohnsektor besteht die Notwendigkeit, die gesetzliche Alterssicherung immer weiter abzusenken. Den Bürgern wird geraten, sich kapitalgedeckt abzusichern. Um noch wenigstens etwas Rendite herauszuholen, sehen sich die Menschen gezwungen, die riskantesten Papiere zu erwerben. Ihnen wird dann Gier vorgeworfen.
In den USA erfolgt die Alterssicherung seit 1860 kapitalgedeckt über Pensionsfonds, von denen zunächst in der Regel Staatsanleihen erworben wurden. Charles Wilson, Präsident von General Motors, vertrat die Ansicht, es sei unvertretbar, den Staat durch die Pensionsfonds so hoch zu verschulden, und hat 1950 durchgesetzt, dass für die Erwerbstätigen Investment-Trusts eingerichtet werden, die in Industrieaktien investieren sollten.63 Damit wurden allerdings die Altersanwartschaften vom Staat auf die Industrie übertragen und durch die Finanz- und Wirtschaftskrise (speziell 2005-09) sitzen die amerikanischen Rentner jetzt zu großen Teilen buchstäblich auf der Straße. Die Gewerkschaften hatten ihren anfänglichen Widerstand angesichts der zunächst durch den Korea- und Vietnamkrieg sehr hohen Renditen eingestellt und haben somit die jetzige Altersarmut mitzuverantworten.
Nach Peter Drucker besaßen über diese Pensionsfonds die Erwerbstätigen in den USA bereits 1976 mehr als ein Drittel des Eigenkapitals der US-amerikanischen Wirtschaft. Dieser Anteil sollte nach Drucker bis zur Jahrtausendwende weit über zwei Drittel betragen. Drucker wörtlich: »Den Pensions-Fonds wird, mit Ausnahme des landwirtschaftlichen und staatlichen Sektors, bis dahin praktisch ganz Amerika »gehören«, und für die beiden ausgenommenen Bereiche werden sie eine wichtige Finanzierungsquelle sein.« Er nennt dies Pensionsfondssozialismus, wobei die Rentensparer allerdings keinen Einfluss darauf hatten, wo ihr Geld investiert wurde.64 Bereits vor der Jahrtausendwende verfügten jedoch diese Pensionsfonds über solche Kapitalmassen, dass sie in den USA keine ausreichenden Anlagemöglichkeiten mehr fanden und mit ihnen über die USA hinaus auf dem Weltmarkt und die Finanzmärkte gehen mussten.
Hervorzuheben ist insbesondere, dass die finanzielle Stärke der kapitalgedeckten Alterssicherung ermöglichte, innerhalb von nur 50 Jahren zwei Drittel der Infrastruktur und der Ressourcen der USA zu erwerben. In Deutschland haben allein die privaten Rentenversicherungen im Jahr 2015 Beiträge von mehr als 92 Milliarden Euro eingenommen.65
Das Problem der Speicherung überschüssiger Gelder sollte nicht über anonyme Fonds erfolgen, sondern könnte beispielsweise auch durch direkte Investitionen in geeignete Projekte – zunächst der Daseinsvorsorge – gelöst werden. Das wäre z. B. über Geschäftsanteile bei Verbrauchergenossenschaften (Wohnen, Wasser, Energie, Konsum etc.) möglich, die eine geregelte Verwaltung ihrer Finanzen bieten und aus denen diese Geschäftsanteile bei Bedarf wieder zu Verfügung ständen.
Wie oben erwähnt, schwärmte Peter F. Drucker bereits 1976 vom Pensions-Fonds-Sozialismus, der die Arbeitnehmer der USA reicher gemacht habe als alle anderen Arbeitnehmer der Welt und den Staat vor einer unerträglichen Schuldenlast bewahrt habe. 66Doch diese Rechnung wurde ohne den Wirt gemacht, das Geld wäre beim Staat besser aufgehoben gewesen als bei der Industrie.
Harald Schumann und Christiane Grefe führen zum Problem der kapitalgedeckten Rente aus: »Entgegen der vor allem von Vertretern der Finanzindustrie und den von ihr bezahlten Ökonomen verbreiteten Behauptung macht dies die Renten in alternden Gesellschaften nicht sicherer. Die Höhe der möglichen Rentenzahlungen hängt immer vom wirtschaftlichen Erfolg einer Gesellschaft insgesamt ab, ganz gleich auf welchem Wege er zustande kommt. Der Unterschied zur Umlagefinanzierung ist lediglich, dass die Kapitaldeckung keine Umverteilung zwischen Reich und Arm zulässt und wesentlich höhere Verwaltungskosten verursacht, die als Gebühreneinnahmen der Finanzindustrie zufließen.«67
Frédéric Lordon spricht von einer Geiselnahme der Arbeitnehmer über die Pensionsfonds: