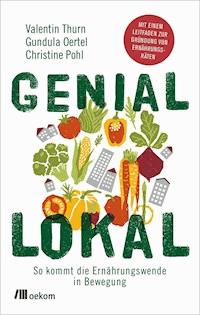Valentin Thurn, Gundula Oertel, Christine Pohl
Genial lokal
So kommt die Ernährungswende in Bewegung
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2018 oekom verlag MünchenGesellschaft für ökologische Kommunikation mbH,Waltherstraße 29, 80337 München
Lektorat: Christoph Hirsch, oekom verlagKorrektorat: Maike SpechtUmschlaggestaltung: www.buero-jorge-schmidt.deUmschlagabbildung: © AVTG/iStockphot
E-Book: SEUME Publishing Services GmbH, Erfurt
Alle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-96238-514-9
Inhalt
PrologErnährungsdemokratie jetzt!
EinleitungAlle Macht den Räten?
TEIL 1
1. Was macht die Stadt satt?
2. »Fruchtbringende« Beziehungen zwischen Stadt und Land
3. Gutes Essen für alle?
4. Unsere Verantwortung für globale Gerechtigkeit
5. Von lokalen Lösungen zum systematischen Wandel
TEIL 2
6. Leuchttürme der Ernährungswende
Hansalim: 2000 Bauern versorgen 1,5 Millionen Verbraucher
»Unglaublich essbares« Todmorden
Capital Growth – nahrhaftes Wachstum in London
Mustergültiges Kopenhagen: Die Stadt als Wegbereiter zukunftsfähiger kommunaler Esskultur
7. Die Welt der Ernährungsräte – wo gibt es was?
Food Policy Councils – Ernährungsräte rund um den Globus
Experten im Gespräch
Ernährungsräte im deutschsprachigen Raum
Der Ernährungsrat Köln und Umgebung
Der Ernährungsrat Berlin für eine zukunftsfähige Ernährungs- und Landwirtschaftspolitik in der Region
Nationale und internationale Netzwerke und Allianzen
Ein Netzwerk der Ernährungsräte
8. Tipps und Empfehlungen für Gründungsinitiativen
Eine für alle – gibt es die ideale Struktur für Ernährungsräte?
Do it yourself: Wie gründen wir einen Ernährungsrat?
Tipps von A bis Z
ServiceZum Nachforschen, Kontakteknüpfen und Weiterlesen – Quellen, Links und Adressen
Prolog
Ernährungsdemokratie jetzt!
»Eine neue soziale Bewegung entsteht!«, freute sich eine der Teilnehmerinnen am ersten Vernetzungskongress der Ernährungsräte letztes Jahr im November. Und viele der rund 120 ernährungspolitischen Aktivisten, die aus mehr als 40 Städten in Deutschland, Südtirol, Österreich und der Schweiz nach Essen gekommen waren, stimmten ihr zu. In den zwei Tagen voller spannender Berichte aus dem In- und Ausland, dicht gepacktem sachlichen Austausch und heißen Diskussionen wurde Aufbruchstimmung spürbar.
Der Gedanke, dass die immer zahlreicher werdenden lokalen Ernährungsräte zu einer machtvollen Bewegung zusammenwachsen, begeistert viele. Der demokratische Wandel unserer Nahrungsversorgungssysteme hat tatsächlich begonnen. Und er kann sich schon jetzt nicht nur auf erste lokale Initiativen stützen, sondern auch auf ein wachsendes Netzwerk ernährungspolitisch aktiver Bürgerinnen und Bürger.
Wir Veranstalterinnen (das heißt die Autorinnen und der Autor dieses Buches und weitere Aktive aus den Ernährungsräten Köln und Berlin) waren von Anfang an überzeugt, dass Netzwerke die bei uns noch junge ernährungspolitische Bewegung stärken würden. Von vielen lokalen Gründungsinitiativen hatten wir gehört, dass sie dringend Ratschläge suchten und sich dafür einen zentral organisierten persönlichen Erfahrungsaustausch mit anderen Gründerinnen und Gründern wünschten.
Obwohl wir bei den ersten Gesprächen über unser Vorhaben im Mai 2016 noch ziemlich lückenhafte Vorstellungen davon hatten, an wie vielen Orten die Saat für Ernährungsräte schon keimte, hofften wir natürlich, dass viele Initiativen Lust auf ein Treffen hätten, egal in welcher Phase ihrer Entwicklung. Dass sich in so kurzer Zeit so viele Menschen in Deutschland und seinen Nachbarländern für das Konzept der Ernährungsräte einsetzen würden, hätten wir allerdings nie gedacht! Die Nachfrage überstieg die Zahl der verfügbaren Plätze auf der Teilnehmerliste schließlich bei Weitem.
Für den produktiven Austausch in Essen konnten wir zwar schon auf erste eigene Erfahrungen mit den Themen, Zielen, Arbeitsweisen und Strukturfragen zurückgreifen, die Gründungsinitiativen ebenso wie bereits aktive Räte im deutschsprachigen Raum derzeit wohl am meisten beschäftigen. Doch zum Glück blicken in anderen Teilen der Welt ernährungspolitische Aktivisten in »Food Policy Councils« auf oft schon mehrere Jahrzehnte erfolgreicher Arbeit zurück. Einige ihrer erfahrensten Gründer und Experten aus den USA, Kanada, Großbritannien und Brasilien haben wir deshalb ebenfalls eingeladen, damit sie ihr Wissen mit uns teilen und uns »Frischlinge« in zentralen Fragen beraten.
Mit dabei war Wayne Roberts, ein charismatischer und stets zum Scherzen aufgelegter Mensch, der zehn Jahre lang den Toronto Food Policy Council leitete. Nicht zum ersten Mal traf Wayne hier auf Mark Winne, der in den USA schon fast drei Jahrzehnte lang in der ernährungspolitischen Gründerszene aktiv ist. Er arbeitet unter anderem als Berater für das Projekt Food Policy Networks beim Center for a Livable Future an der Johns-Hopkins-Universität und stellt dort seine Expertise aus der Zusammenarbeit mit über 100 Food Policy Councils zur Verfügung. Mark war es auch, der uns gleich eingangs zur Wahl des Mottos für unseren Kongress »Ernährungsdemokratie jetzt!« beglückwünschte. Er erklärte uns dazu, der Begriff der »Food Democracy«, wie ihn Tim Lang, Professor für Food Policy an der Londoner City University, Ende der 1990er-Jahre geprägt hat, sei tatsächlich auch in den USA längst zum Synonym für das gemeinsame Ziel der Food Policy Councils geworden. Das Ziel nämlich, einen Politikwechsel anzustreben, der schließlich gutes Essen für alle zugänglich macht.
Dazu kam Leon Ballin von der britischen Soil Association, der dort als Chefnetzwerker für das Sustainable-Food-Cities-Projekt verantwortlich ist und die ernährungspolitische Szene Großbritanniens aus der Nähe kennt. Mit Bruno Prado aus Brasilien war schließlich auch einer der Pioniere des Engagements für Ernährungssouveränität eingeladen. Als Mitglied im Rat für Ernährungssicherheit der Region Rio de Janeiro konnte er uns von den Erfolgen der Anti-Hunger-Arbeit in Brasilien berichten, die maßgeblich dem nationalen System der Ernährungssicherheits-Räte zu verdanken sind.
Alle vier Referenten lenkten den Blick auf mögliche Vorbilder in ihren Herkunftsländern, die uns Antwort liefern könnten auf viele unserer Fragen. Etwa wie man es am besten anfängt, einen Ernährungsrat auf die Beine zu stellen; welche Akteure dafür in den Städten angesprochen werden sollten; welche Rechtsform passend wäre oder welche Hindernisse es geben könnte und auch, wie man diese überwindet. Mit anschaulichen Beispielen aus ihrer ernährungspolitischen Erfahrung haben sie uns vor Augen geführt, was Ernährungsräte erreichen können.
Ihre lebhaften Schilderungen haben uns neue Wege gezeigt und Mut für unsere zukünftige Arbeit gemacht, uns aber auch in vieler Hinsicht in unserem gegenwärtigen Vorgehen und unseren Zielen bestärkt. Nicht zu vergessen ihre freundschaftliche Mahnung, bei all unserem ernährungspolitischen Engagement nur ja den Spaß an der gemeinsamen Sache nicht zu kurz kommen zu lassen. Vor allem Wayne fand, wir sollten öfter mal ein kulinarisches Fest feiern und unsere Erfolge immer auch genüsslich voll auskosten. Darin konnten wir unseren Ratgebern sofort entsprechen, indem nämlich der Kongress am Samstag nach dem Abendessen ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden tanzte.
Heiß diskutiert wurde in Essen zudem, ob es »die beste« Struktur für Ernährungsräte geben könne. In anderen Workshops ging es um das Verhältnis der Bewegung zu konventionell wirtschaftenden bäuerlichen Betrieben und um die Frage, ob »bio« und »regional« in zukunftsfähigen Ernährungssystemen immer zwingend zusammengehören müssten. Oder ganz praktisch darum, wie wir uns finanzielle Unterstützung erschließen und wie wir unsere Ziele durch wirksame Öffentlichkeitsarbeit in die Medien bringen können.
Am Ende des Treffens schließlich stand fest: Alle aktiven Ernährungsräte und die vielen Gründungsinitiativen aus dem deutschsprachigen Raum wollen als Netzwerk verbunden bleiben, Wissen teilen, neue Ideen gemeinsam ausarbeiten und so der Ernährungswende »von unten« ordentlich Schubkraft verleihen. Hierbei und bei allen anderen wichtigen Fragen zur Gründung eines Ernährungsrates soll künftig das vor Ort gegründete Netzwerk der Ernährungsräte helfen. Wir sind gespannt, wie sich die Szene entwickelt und wer (wieder oder neu) dabei sein wird, wenn vom 23. bis 25. November 2018 der zweite Vernetzungskongress in Frankfurt am Main stattfindet.
Wir denken, unser Buch kann ebenso dazu beitragen, den eigenen ernährungspolitischen Horizont zu erweitern, wie es hilft, einen Gründungsprozess systematisch vorzubereiten und eine anfangs vielleicht noch recht lockere, unstrukturierte Gruppierung zu einem arbeitsfähigen Bündnis zu entwickeln. Diesen beiden Hauptanliegen folgt es daher auch in seiner Struktur.
Im ersten Teil gehen wir vor allem den Fragestellungen nach, die auf den nötigen Politikwechsel selbst zielen. Etwa wie die Chancen für eine relokalisierte Versorgung und Nahrungssicherheit der Städte und Kommunen aus wissenschaftlicher Perspektive stehen, wie ökologische Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit in einer zukunftsfähigen Ernährungsstrategie vereint werden und wie Bürgerinnen und Bürger die Bestimmungsmacht über ihre Teller, die heute schon sehr weitgehend in der Hand von Konzernen liegt, tatsächlich zurückerobern können.
Der zweite Teil stellt eine vielseitige Handreichung zur Gründung von Ernährungsräten bereit. Dort findet sich reichlich praxisorientiertes Rüstzeug, das dabei hilft, regional angepasste Strategien zu entwerfen und lokale Ernährungsräte zu einem politisch wirkungsmächtigen und strukturell gut handhabbaren Instrument ihrer Durchsetzung zu machen. Hier geben wir nicht nur Antwort auf (fast) alle Fragen, die beim Essener Treffen gestellt wurden, sondern auch auf viele, die uns aus Diskussionen bekannt sind, die in lokalen Initiativen geführt wurden und werden.
Köln und Berlin, Oktober 2018
Einleitung
Alle Macht den Räten?
Manche nannten ihn »Sandino-Dröhnung«. Nicht ganz zu Unrecht, denn der so genannte, politisch korrekte Kaffee aus dem Nicaragua vom Ende der 1970er-Jahre brannte eher Löcher in die Magenwand, als ein Genuss zu sein. Exquisiter Kaffeegenuss stand allerdings auch nicht im Vordergrund für die »räterepublikanisch« verfassten Kollektive und Wohngemeinschaften, denen damals nichts anderes in die Tassen kam. Ihnen ging es dabei ausschließlich um die Solidarität mit den Kleinbauern Nicaraguas und ganz besonders um deren Zugang zu Grund und Boden für den eigenen Kaffeeanbau. Daher auch der Spitzname für den Soli-Kaffee, der direkt auf die Sandinisten Bezug nimmt, die 1979 gegen die Contra-Rebellen kämpften, den Diktator Somoza stürzten und schließlich eine Landreform gegen die mächtigen Großgrundbesitzer Nicaraguas durchsetzten.
Inzwischen arbeiten Ex-Contras und Ex-Sandinisten erfolgreich bei Soppexcca, dem Verband der nicaraguanischen Kaffeekooperativen, zusammen. Und sie legen großen Wert auf die Feststellung, dass ihr Kaffee heute nicht nur fairer bezahlt wird als damals, sondern auch besser schmeckt.
Aber selbst wenn Sandino-Kaffee jetzt nicht mehr dröhnt – die Anlässe zur Solidarität hiesiger Konsumentinnen und Konsumenten mit rechtlos enteigneten Kleinbauern und ländlichen Arbeitssklavinnen in aller Welt sind seither eher mehr geworden als weniger. Weder den konventionell erzeugten und gehandelten Kaffeebohnen aus Südamerika oder afrikanischen Ländern noch den sensationell billigen italienischen oder spanischen Tomaten im Supermarktregal sieht man die ausbeuterischen Bedingungen an, unter denen sie teils erzeugt und geerntet werden. Genauso wenig wie den dicken, leuchtend roten Erdbeeren von den Großplantagen im Norden Deutschlands oder dem schnurgeraden, blütenweißen Spargel, der südlich von Berlin auf großer Fläche unter Folien zur Frühreife getrieben wird, zum Schaden vieler Insektenarten.
Alles kann anders werden
Immer mehr Menschen beginnen jetzt zu erahnen, welche sozialen, ökonomischen und ökologischen Probleme ihre Nahrungsversorgung weltweit verursacht, und sie wollen sich den unverstellten Blick hinter die Kulissen der globalen Agrarwirtschaft nicht länger verwehren lassen. Doch noch funktioniert der Großteil des Lebensmittelmarktes weiter ganz unsolidarisch und ohne einen Gedanken an rücksichtslos ausgebeutete Landlose oder ebenso rücksichtslos ausgebeutete Böden, weil er unseren verschwenderischen westlichen Konsumstil zum kleinen Preis weiter bedienen will. Bleibt die Frage, wie wir dagegen ankommen. Oder wie stark der Einfluss einer Minderheit einsichtsvoll fair und ökologisch konsumierender Bürgerinnen und Bürger auf einen zukunftsfähigen Wandel tatsächlich werden kann, den die übergroße Mehrheit der Politik noch gar nicht auf dem Schirm zu haben scheint.
Der kollektive Wille, ökologische Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit im globalen Maßstab zusammenzubringen, wächst jedenfalls zusehends. Das beweisen nicht nur die Bauern und Bürger, die seit acht Jahren bei den »Wir haben es satt«-Demonstrationen in Berlin gemeinsam marschieren. Sondern auch die vielen ernährungspolitisch Engagierten, die das Gefühl eint, die Zeit zum solidarischen Handeln sei gekommen. Ihre Art, die Ernährungswende »von unten« zu betreiben, besteht landauf, landab in der Gründung von Ernährungsräten, die Ernährungspolitik als bürgerschaftliche Initiative organisieren. Als eine Bewegung von Menschen, die sich persönlich verantwortlich fühlen für eine Nahrungsversorgung, welche schonend und solidarisch mit Mensch und Umwelt umgeht. Und für ein Ernährungssystem, das nicht wenige Große am globalen Markt verdienen lässt, sondern viele Kleine in der Region am guten Essen für alle!
Ihr gemeinsamer Ausgangspunkt ist die überall gleiche Feststellung, wonach unsere gegenwärtigen Ernährungssysteme – lokal, national oder global – in keiner Hinsicht den Ansprüchen genügen, die man an Zukunftsfähigkeit stellen muss: Sie sind weder nachhaltig noch gerecht. Im Gegenteil: Sie bemänteln soziale Benachteiligung und Verschwendung lediglich mit dem Anschein von Fülle und Vielfalt. Während die Bevölkerungskonzentration in den Städten immer weiter zunimmt, werden die Folgen unserer industrialisierten und globalisierten Ernährungsweise immer deutlicher sichtbar.
Gleichwohl behandeln weite Teile der Politik die herkömmliche, vorwiegend auf billige Masse orientierte Nahrungsproduktion, welche Erzeugung und Konsum räumlich und zeitlich immer stärker voneinander trennt, als wirtschaftlich alternativlos. Nur noch ein Bruchteil dessen, was Städter heute essen und trinken, stammt vom nahen Land. Diese von aktuellen Studien gut belegte Tatsache gehört – nicht zuletzt hinsichtlich der Nahrungssicherheit in Zeiten des Klimawandels – zu den heikelsten und weitreichendsten Risiken globalisierter Lebensmittelmärkte.
Die einzig zukunftsfähige Antwort darauf sind Ernährungsstrategien, welche die Nahrungsversorgung der Städte und Kommunen stärker auf eine lokale Basis stützen. Das heißt, die konsequente »Relokalisierung« urbaner Ernährungssysteme muss als das Kernstück des nötigen Wandels betrachtet werden. Ausreichend geeignete Flächen dafür gäbe es in vielen Regionen, auch dafür häufen sich in jüngster Zeit die wissenschaftlichen Belege. Die entsprechenden Studienergebnisse setzen allerdings voraus, dass wir die heute zu Ernährungszwecken pro Kopf beanspruchte Fläche auf ein sozialökologisch verträgliches Maß reduzieren können. Was gut erreichbar wäre mit einer politischen Rahmensetzung für weniger Fleischverbrauch und Lebensmittelverschwendung. Und womit auch schon der Hinweis verbunden ist, dass ökologisch nachhaltige Regionalversorgung ohne eine deutliche soziale Komponente Gefahr liefe, als bloß elitäres Gourmetprojekt für reiche Bio-Konsumenten zu enden.
Zivilgesellschaftliche Expertise füllt politische »Leerstellen«
Dass das Feld der Stadternährungspolitik derzeit noch auf weiter Flur unbestellt ist, hat aber nicht nur Nachteile, lässt dies doch einer »Ernährungspolitik von unten« den Raum, tatsächlich einen demokratischen Wandel in unserem Ernährungssystem durchzusetzen. Erfahrene Experten aus den Food Policy Councils in den USA und Kanada beklagen allerdings, dass der gesellschaftliche Wandel sich nur sehr langsam in der Regierungspolitik widerspiegelt. Mark Winne, Berater des US-amerikanischen Food-Policy-Netzwerks, sagt beispielsweise: »Obwohl Ernährungsräte teils seit Jahrzehnten aktiv sind, kommt das Wort ›Ernährung‹ bis heute in der offiziellen Politik kaum vor. In keiner Stadt, in keinem Staat und auch nicht im Landwirtschaftsministerium der US-Regierung existiert eine Abteilung, die ›Ernährungs-irgendwas‹ heißt.«
In Großbritannien hat kurioserweise ausgerechnet das mehrheitliche Ja zum Brexit eine Situation geschaffen, die den Neuanfang in der Entwicklung der Ernährungssysteme unausweichlich macht – was von den Food-Aktivisten des Landes als die oben schon erwähnte Chance begriffen wird, A People’s Food Policy an diese Leerstelle zu setzen, einen Empfehlungskatalog, der zeigt, wie Ernährungspolitik aussehen müsste, wenn Menschen und nicht Profitinteressen in den Mittelpunkt gestellt würden. Auch die Initiativen im deutschsprachigen Raum sind durchaus gewillt, die bisherige politische Ignoranz gegenüber dem Thema als Steilvorlage zu nutzen, mit deren Hilfe ernährungspolitische Vorstellungen und Ziele aus der Bürgerschaft zur Grundlage eines konsequent gemeinwohlorientierten Transformationsprozesses werden können.
Das wäre etwas Neues, Zukunftsweisendes. Denn was Ernährungspolitik seit den 1950er-Jahren bis heute vor allem bestimmt, sind die Interessen der Agrarindustrie und die der Wissenschaftler und Lobbyisten, die ihr zuarbeiten. Es ist nur zu ihrem Vorteil, wenn der Schwerpunkt unserer Agrarpolitik auf der Steigerung von Hektarerträgen und inzwischen auch zunehmender Exportorientierung liegt. Vor allem Ersteres mag ursprünglich und in der Nachkriegszeit ein nachvollziehbares Ziel von Züchtung und Anbauweisen gewesen sein, weil es damals zuerst darum ging, möglichst viele Nahrungsrohstoffe zu möglichst geringen Kosten zu produzieren, damit das Sattwerden auch für einkommensschwache Familien erschwinglich blieb.
Heute wird zwar genug produziert, damit es für alle reichen könnte. Hunger und Mangelernährung sind aber eben nicht nur ein Problem, dem mit wirtschaftlichen Ertragszielen beizukommen wäre. Sie sind heute weltweit und damit auch hierzulande eher die Folge ungleicher Ressourcenverteilung und extrem ungerecht verteilter Einkommenschancen.
Beide, die Ziele von gestern ebenso wie die Gerechtigkeitslücken von heute, führen dazu, dass landwirtschaftliche Betriebe immer mehr zu Lieferanten billiger Rohstoffe für die industrielle Nahrungsmittelproduktion degradiert werden. Dies ist ebenso wenig hinnehmbar wie ein agrarindustriell bestimmtes Anbausystem, das für globale Märkte produziert statt für Menschen in der Region. Oder Supermarktregale, die mit kostengünstigen Kalorien aus den immer gleichen Standardzutaten vollgestopft werden. Hier findet sich eine Flut von Produkten, die, bunt verpackt und aufwendig beworben, eine Vielfalt von Geschmack und Qualität vortäuschen, welche tatsächlich nicht mehr ist als die bloß äußerliche Diversität von Marken! Alles dreht sich hier um Effizienz, Massenproduktion und Kostenvorteile.
Doch spätestens seit der letzten Jahrtausendwende haben sich die Prioritäten vieler Konsumenten zu verschieben begonnen. Neben einem steigenden Bewusstsein für die globalen Auswirkungen des Ernährungssystems haben der Klimawandel und die Finanzkrise mit dafür gesorgt, dass die Nahrungssicherheit von Städten, die Widerstands- und Anpassungsfähigkeit (Resilienz) von Anbausystemen und vielfältige Sortenverfügbarkeit nun stärker in den Fokus rücken. Vor diesem Hintergrund müssen die Erhaltung und Förderung kleinbäuerlicher, regionaler und ökologischer Landwirtschaft zum Kardinalziel urbaner Ernährungspolitik erklärt werden. Denn damit kann die Landkonzentration in wenigen Händen und zu einseitigen Anbauzwecken (Mais für Biokraftstoffe, beispielsweise auf Riesenflächen in Brandenburg) am besten aufgehalten und stattdessen die ortsangepasste Sorten- und Tiervielfalt gefördert und empfindliche Ökosysteme wie Böden und Gewässer geschützt werden. Ein derart zukunftsfähiges Anbausystem wäre zugleich eine intelligente Antwort auf die gewachsenen Anforderungen vieler Konsumenten an Nährwert und geschmackliche Qualität ihrer Lebensmittel.
Allmende statt Almosen!
Solange jedoch der Einfluss der Wirtschaftslobby auf die Politik noch so viel mehr Gewicht hat als das Interesse der Allgemeinheit an gesunden Böden, gesunden Tieren und Menschen und unbelasteter Qualitätsnahrung, kann sich zukunftsfähige Ernährungspolitik nicht durchsetzen. Genau das ist aber der Anspruch, den Ernährungsräte an die Verantwortlichen in den Stadt- und Kommunalverwaltungen haben: dass sie – nicht zuletzt mithilfe der in den Räten gesammelten Expertise – dafür sorgen, dass wir Konsumentinnen und Konsumenten die Kontrolle über unsere urbanen Ernährungssysteme zurückgewinnen können. Lebensmittel sind schließlich keine Ware wie jede andere. Ihre Erzeugung und die Teilhabe an ihrem Konsum dürfen nicht allein wirtschaftlichen Zielen dienen! Denn das Recht auf Nahrung ist ein schwarz auf weiß verbrieftes Menschenrecht. Nur macht Papier natürlich niemanden satt. Auch Kinder im »reichen Deutschland« nicht, in deren Elternhaus es für das Nötigste nicht reicht.
25 Jahre Existenz der Tafeln in Deutschland sind auch kein Grund zum Jubeln. Das dennoch mit offiziellen Festakten gefeierte Jubiläum sollte uns vielmehr eine Mahnung sein, endlich ernsthaft dafür zu sorgen, dass Almosen für hierzulande eineinhalb Millionen Menschen nicht länger als notdürftiger Ausgleich für den sozialstaatlichen Abbau herhalten müssen. Keiner Frau, keinem Mann und auch keinem Kind darf mehr ein Grundeinkommen versagt bleiben, das ihr menschliches Grundrecht auf genug qualitativ hochwertige Nahrung wahren kann.
Ernährungsdemokratie heißt für uns, dass die berechtigten Interessen der Allgemeinheit beim Essen und Trinken nicht länger auf dem Altar rein wirtschaftlicher Partikularinteressen geopfert werden. Nur ein zukunftsfähiges, demokratisch bestimmtes Ernährungssystem kann auch grundlegenden Verbraucherrechten den ihnen gebührenden Vorrang einräumen. Etwa ein allgemeines Verfügungsrecht über Saatgut und Tierzucht als Grundlage echter Wahlfreiheit bei allem, was auf unsere Teller kommt. Wenn Bürger und Bürgerinnen das Vertrauen zurückgewinnen, dass die Politik dabei auf ihrer Seite steht, dann stärkt das ihr Ja zur Demokratie mit Sicherheit mehr als jede Chance zur Stimmabgabe bei einer Wahl.
Vernetzt denken und handeln
Der Einfluss, den verschiedenste Politikbereiche darauf haben, wie wir Lebensmittel produzieren und wie unser Konsum- und Ernährungsstil aussieht, ist offensichtlich. Das reicht von Haushaltsentscheidungen über die Wirtschaftsförderung für Garten- und Landbau, über Flächennutzungspläne und Nutzungsarten von Stadtgütern bis zur Ernährungsbildung und zum Schulessen sowie weiteren Formen der Gemeinschaftsverpflegung. Und weiter von der Handelspolitik und politisch geduldeten Marketingstrategien der Nahrungsindustrie bis zu Gesundheitsversprechen auf Produktetiketten, von der Einkommenspolitik bis hin zur Stadtplanung und der Mietpreispolitik.
All diese Entscheidungsbereiche liegen in der Hand einzelner Verwaltungsebenen und verschiedener Ressorts. Und längst nicht alles kann auf kommunaler Ebene beeinflusst werden. Doch diese Streuung von Verantwortlichkeiten kann auch als Chance verstanden werden, zu experimentieren und lokale Erfolge zum Modell für andere werden zu lassen.
Eine zukunftsfähig und regional gedachte Ernährungsstrategie für Städte und die sie umgebenden Regionen müsste auch Antwort geben auf die Frage, wie von der billigen Massenproduktion von Lebensmitteln wegzukommen wäre, ohne gleichzeitig das schmale Budget der einkommensschwächsten Konsumenten weiter zu strapazieren, die sich schon jetzt nur das einfachste Essen vom Discounter leisten können. Oder wie man mit Kleinbauern umgeht, die auf gesteigerte Erträge und Exportchancen hoffen, weshalb ihnen zusätzliche Umwelt- und Tierschutzauflagen als existenzielle Bedrohung erscheinen müssen.
So viel ist sicher: Der nötige Wandel wird nur gelingen, wenn er über mehrere Jahre geplante Anpassungsschritte an neue Rahmenbedingungen für alle vorsieht: mit klar vorgezeichneten Zeithorizonten und einer ressortübergreifenden Zusammenarbeit aller politisch Verantwortlichen, die dabei eine gemeinsame Vision verwirklichen wollen. Und es ist klar, dass dies nur im Rahmen einer sorgfältig geplanten und sektoral integrativen Ernährungsstrategie denkbar ist. Wobei auch die klügste und weitsichtigste lokale Strategie auf lange Sicht nur als Teil einer zukunftsfähig erneuerten nationalen Ernährungspolitik erfolgreich sein wird.
Die Richtung, in der unser Ziel liegt, bestimmt das politische Konzept der Ernährungssouveränität als konkrete Utopie.
»Ernährungssouveränität bedeutet das Recht von Individuen, Gemeinschaften, Völkern und Staaten, ihre eigene Landwirtschafts-, Arbeits-, Fischerei-, Ernährungs- und Bodenpolitik zu bestimmen unter Berücksichtigung ihrer jeweils spezifischen ökologischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Bedingungen. Das Konzept beinhaltet sowohl das Recht auf Nahrung wie auch das Recht, Nahrungsmittel zu produzieren. Das Recht auf Nahrung garantiert allen Menschen den Zugang zu sicheren, nahrhaften und kulturell angepassten Lebensmitteln sowie den Zugang zu den notwendigen Ressourcen, um Nahrungsmittel produzieren und sich und ihre Gesellschaften erhalten zu können.« (International Planning Committee on Food Sovereignty 2004)
So gesehen, muss sich eine zukunftsfähige Ernährungsstrategie, die diesen Namen verdient, auf jedem ihrer Entwicklungsniveaus an diesem Konzept messen lassen. Vor allem um zu beweisen, dass sie die Ernährungsdemokratie als ihr Ziel nie aus den Augen verliert. Ernährungsräte sollten ihre Stadt- und Kommunalverwaltungen deshalb auffordern, lokale ernährungspolitische Strategien stets im direkten Dialog mit der regionalen Bevölkerung zu entwerfen.
Denn nur wenn der strategisch geplante Transformationsprozess breite Unterstützung von allen Seiten erfährt, werden sich die lokalen Ernährungssysteme in Zukunft wieder vorwiegend auf regionale Landwirtschaft und Verarbeitung stützen, dabei Natur- und Umweltschutz vom Acker bis zum Teller und den Zugang zu guten Lebensmitteln für alle selbstverständlich werden lassen, gestärkte lokale Märkte, faire Preisbildung und existenzsichernde Einkommen und vieles mehr erreichen.
TEIL 1
Kapitel 1
Was macht die Stadt satt?
Was »regional« bedeuten soll, »wie viel Region« die Stadtversorgung braucht und warum mehr Agrobiodiversität nottut
Woher werden in einem zukunftsfähigen Ernährungssystem die Lebensmittel stammen, die täglich in unseren Städten und Gemeinden verzehrt werden? Aus der Perspektive moderner urbaner Ernährungspolitik gibt es auf diese Frage nur eine, buchstäblich naheliegende Antwort: aus der Region natürlich! Und auf den ersten Blick scheint auch klar, was damit gemeint ist.
Die nähere Betrachtung zieht jedoch Anschlussfragen nach sich: Wo soll man zum Beispiel im konkreten Einzelfall die räumlichen Grenzen ziehen, die den Begriff der Region, wie er hier verstanden wird, zweckmäßig und sinnvoll definieren? Reden wir von 50 oder doch eher von 100 Kilometern und mehr im Umkreis einer Stadt? Und ab welchem Prozentsatz an Produktzutaten, die aus einer per Definition festgelegten Entfernung stammen, soll ein Produkt überhaupt als regional gelten dürfen?
Die Frage nach den räumlichen Grenzen dessen, was in Bezug auf die Nahrungsversorgung einer Stadt oder Kommune als urbane Umgebung oder Region definiert werden kann, stellt sich aber noch auch aus anderer Perspektive. Wer den Systemwandel anstrebt, muss im Voraus wissen, wie groß der Flächenbedarf für die Nahversorgung einer bestimmten Einwohnerzahl (jetzt und in der näheren Zukunft) sein wird und ob die ermittelte Größenordnung überhaupt zur Verfügung steht oder zumindest verfügbar gemacht werden könnte.
Dies führt schließlich zu Überlegungen, die unseren aktuellen Konsumstil genauso betreffen wie den der Zukunft – oder genauer: den wünschenswert zukunftsfähigen. Vermutlich wird die Mehrheit der Konsumentinnen und Konsumenten ihren Lebensmittelbedarf auch in Zukunft nicht ganz radikal auf lokal umstellen. Jedenfalls nicht so, dass der völlige Verzicht auf alles damit verbunden wäre, was in unseren Breiten nicht angebaut werden kann. Für Verfechter einer wirklich radikal interpretierten »Regionaldiät« zählen dazu nicht nur Kaffee, Tee, Kakao, Kokosnuss, Ananas und anderes mehr, sondern auch Zitrusfrüchte oder Olivenöl.
Gerechte Verteilung vorausgesetzt, werden in Zukunft jedem Erdbewohner maximal 2000 Quadratmeter Fläche für den gesamten Bedarf an landwirtschaftlich erzeugten Rohstoffen (zu Nahrungs- und weiteren Zwecken) zur Verfügung stehen. Wovon dann allerdings nur ein Teil als wohnortnah verfügbar in Betracht käme. Zu fragen wäre hier jedoch auch, wovon es jetzt und in Zukunft abhängt, wie groß dieser Anteil ist. Welchen Effekt zum Beispiel das prognostizierte Bevölkerungswachstum in den Städten haben wird, wie sich individuelle Konsum- und Ernährungsmuster auswirken und wie das Anbausystem den Flächenbedarf verändert, je nachdem, ob es vorwiegend auf ökologische Nachhaltigkeit setzt oder der konventionell agrarindustriellen Landwirtschaft verhaftet bleibt. Interessant ist in diesem Zusammenhang natürlich auch der Einfluss, den Stellgrößen wie individueller Fleischkonsum oder das Ausmaß der Lebensmittelverschwendung auf den ernährungsbedingten Flächenbedarf in einer bestimmten Region haben.
»Relokalisierte Nahrungsversorgung« – ein zentrales Ziel für den Systemwandel
Aus gutem Grund sehen Ernährungsrats-Initiativen eine wichtige, wenn nicht sogar die wichtigste treibende Kraft für den zukunftsfähigen Wandel in der »Relokalisierung« unserer urbanen Ernährungssysteme. Doch die Entwicklung geht noch immer in die entgegengesetzte Richtung, Produktion und Konsum werden räumlich und zeitlich immer weiter voneinander getrennt. Vor den Folgen dieser Trennung warnen immer mehr Wissenschaftler. Sie weisen darauf hin, dass dadurch Risiken wie der Klimawandel immer größer werden, wie auch die Abhängigkeit von globalen Märkten, die beide absehbar die Nahrungssicherheit auch in den Industrieländern bedrohen.
In der Theorie liegt der Ausweg aus dieser Sackgasse in einer konsequent lokal gegründeten Lebensmittelwirtschaft, die in erster Linie Menschen in ihrer Nähe versorgt. Unser jetzt noch weit überwiegend industriell geprägtes Anbausystem, das unter ständigem Wachstums- und Preisdruck steht und zu immer mehr Export in ferne Märkte zwingt, könnte so endlich der Vergangenheit angehören.
Doch die große Frage ist, ob und wo die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten eine systematisch geplante Relokalisierung der Nahrungsproduktion und -versorgung tatsächlich zulassen. Und welche Konsumstiländerungen dazukommen müssen, damit ein wirklich grundlegender Systemwandel davon ausgehen kann. Aktuell suchen verschiedene Forscherteams Antworten auf solche Fragen. Ihre Daten und wissenschaftlichen Schlussfolgerungen können der Zivilgesellschaft, etwa in Gestalt von Ernährungsräten und verwandten Initiativen, ebenso wie der lokal, national und für Europa verantwortlichen Politik wichtige Grundlagen für die weitergehende ernährungspolitische Diskussion und zukunftsfähige Strategien liefern.
Chancen zur regionalen Versorgung von Rotterdam, Mailand, London und Berlin
Anfang 2018 veröffentlichte der Stadtplaner und Agrarwissenschaftler Ingo Zasada vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) im brandenburgischen Müncheberg gemeinsam mit Forscherinnen und Forschern aus Großbritannien, den Niederlanden und Italien Ergebnisse einer groß angelegten Untersuchung. Im Fokus stand dabei die regionale Selbstversorgungskapazität von vier europäischen Metropolregionen: London, Rotterdam, Mailand und Berlin. Zasada und seine Kollegen wollten wissen, was genau die Voraussetzungen sind, unter denen die Einwohner der genannten Großstädte sich stärker mit regional erzeugten Lebensmitteln ernähren könnten. Wie viel Agrarfläche wäre heute nötig, um Berlin, Mailand, Rotterdam oder London ausreichend mit Nahrungsmitteln zu versorgen? Und wie viel im Jahr 2050, wenn voraussichtlich noch deutlich mehr Menschen in diesen Metropolen leben werden?
Die Ausgangslage für dieses Studiendesign erwies sich als in allen vier Regionen gut vergleichbar. Überall hat das globalisierte Nahrungssystem dafür gesorgt, dass nur ein Bruchteil der Lebensmittel, die in der Stadt konsumiert werden, vom nahen Land stammt. In allen Befragungen geben die Verbraucherinnen und Verbraucher der regionalen Herkunft ihrer Nahrungsmittel den Vorzug. Aber in der Realität werden ihnen die meist weit gereisten Produkte in ihrem Einkaufskorb einfach ungefragt aufgezwungen. Dabei wäre es allein schon deshalb vernünftiger, Nahrungsmittel dort zu produzieren, wo sie auch verbraucht werden, weil nicht zuletzt ihr Transport über weite Strecken den Klimawandel beschleunigt.
In einem ersten Schritt sichtete die Forschungsgruppe nationale Statistiken, die Auskunft über verbreitete urbane Ernährungsgewohnheiten sowie aktuelle Verbrauchsdaten zu Obst und Gemüse, Milchprodukten, Fleisch, Getreide und mehr geben. Daraus ermittelte sie für jede der vier Regionen die Anbaufläche, die pro Person zu Ernährungszwecken beansprucht wird. Daten über die jeweilige Agrarproduktion, deren Ertrag von Klima, Boden und anderen lokalen Faktoren abhängt, flossen ebenso in die Berechnungen ein wie Flächenanteile für Lebensmittel, die nicht mit Rohstoffen aus europäischen Anbauregionen erzeugt werden können – zum Beispiel Kaffee, Tee oder Schokolade.
Auch der mengenmäßige Lebensmittelverbrauch pro Kopf und Jahr unterschied sich in den untersuchten Städten kaum: Er liegt aktuell im Schnitt bei rund 1000 Kilogramm. Dennoch werden dafür an die vier verschiedenen Regionen ganz unterschiedliche Flächenansprüche gestellt. In Berlin sind es unter gegenwärtigen Bedingungen 2052 Quadratmeter Ackerfläche, die beansprucht werden, in London 1862, in Mailand 2093 und in Rotterdam 1718. Die Differenzen erklären die Forscher mit der Verschiedenheit der vorherrschenden Ernährungsstile in den vier Metropolen.
Aus diesen Zahlen ergibt sich die Gesamtfläche, die zur Deckung des Nahrungsbedarfs der jeweiligen Stadtbevölkerung als Anbaufläche genutzt werden müsste. Und schon hier zeigt sich, welchen Einfluss allein die natürlichen Gegebenheiten auf die Chancen zur Selbstversorgung einer Stadt haben. Rotterdam (über 600.000 Einwohner), Mailand (über 1,2 Millionen Einwohner) und London (über acht Millionen Innenstadtbewohner und bald 23 Millionen Bewohner der Metropolregion) könnten ihre Nahrungsversorgung nicht auf eine ausreichend große Umlandfläche stützen. Weder jetzt noch 30 Jahre später, wenn die Bevölkerung weiter angewachsen sein wird. Dafür sind die Ränder dieser Städte zu dicht besiedelt, die Böden nicht fruchtbar genug, oder das verfügbare Ackerland wird durch Gebirge oder Meer begrenzt.
Abb. 1: Die Abbildung vergleicht einerseits den Flächenbedarf für den herkömmlichen Landbau mit flächendeckendem Bioanbau bei sonst gleichbleibenden Rahmenbedingungen. Und andererseits den theoretischen Selbstversorgungsgrad in Berlin und Umland, den Ingo Zasada und Kollegen als Verhältnis von vorhandener zu benötigter Agrarfläche auf Gemeindeebene berechnet haben. Quelle: Zasada et al. (2017), © Grafik: Berliner Zeitung, Sabine Hecher
Berlin ist hier die Ausnahme mit sehr guten Zukunftschancen für die Relokalisierung des städtischen Ernährungssystems. Was den Flächenbedarf angeht, zeigen Zasadas Zahlen, dass die Berlinerinnen und Berliner ihren Nahrungsbedarf künftig problemlos mit regionalen Produkten decken könnten. Das Berliner Umland ist stark landwirtschaftlich geprägt und dünn besiedelt. Von den 14.600 Quadratkilometer Acker und Grünland, die in einem Radius von etwa 110 Kilometern um die Stadt zu finden sind, würde sogar schon die Hälfte, nämlich 7300 Quadratkilometer, ausreichen, um die Nahrungsversorgung vollständig durch regionale Erzeugnisse zu decken.
Abb. 2: Aktueller Lebensmittelkonsum der Berliner Bevölkerung links (Jährlicher Durchschnittswert in Kilogramm pro Person) und benötigte Agrarfläche zur Deckung des Lebensmittelkonsums (in Quadratmetern pro Person) in Abhängigkeit der Ernährungsweise rechts. Daten aus: Agrarbericht Brandenburg 2016, © Grafik: Berliner Zeitung, Sabine Hecher
Wie die Abbildung auf Seite 26 zeigt, kann das Land Brandenburg genug produzieren, um auch Lebensmittel für Berlin bereitzustellen. Nur in wenigen Teilen des Bundeslandes kommen Werte für einen Selbstversorgungsgrad von unter 25 Prozent vor. Das liegt im einzelnen an Bevölkerungszahl und Siedlungsfläche (wie in Cottbus und Frankfurt/Oder), an großen Waldflächen (Eberswalde), an großen Wasserflächen (z. B. Brandenburg Stadt) oder an raumgreifenden Tagebauen wie in der Lausitz im Südosten Brandenburgs.
Abb. 3: Gesamte im Jahr 2017 landwirtschaftlich genutzte Fläche Brandenburgs, differenziert nach Nutzungsarten und Viehbeständen. Daten aus: Agrarbericht Brandenburg 2016, © Grafik: Berliner Zeitung, Sabine Hecher
Für alle vier Städte wurden im Rahmen dieser Studie verschiedene Szenarien durchgerechnet mit jeweils unterschiedlichen Annahmen zu 1. Bioanbau, 2. Ernährungsweise, 3. Lebensmittelverlusten und 4. Bevölkerungsdichte. Wenig überraschend, benötigt konsequent ökologischer Anbau mehr Fläche, je nach Region zwischen 36 und 41 Prozent. Ein Mehrbedarf entsteht natürlich auch durch die bis 2050 geschätzte Zunahme der Bevölkerungsdichte, in den urbanen Kernzonen genauso wie in der Besiedlung ausgedehnter Randzonen.
Doch das individuelle Konsumverhalten hat hier noch viel größere Auswirkungen, etwa wenn mehr Fleisch gegessen wird oder mehr regionale Bioprodukte gekauft werden. Starken Einfluss hat zudem, in welchem Ausmaß Lebensmittel bei Anbau und Ernte, in der Verarbeitung, im Handel und in den Haushalten verschwendet werden. All dies sind wirkmächtige Stellschrauben, wenn es um zukunftsfähig begrenzte Flächenansprüche pro EinwohnerIn geht. So legen Zasada und seine Kollegen ihrem Szenario »Lebensmittelverluste« die Zahl von 17 Prozent für alle Nahrungsmittel zugrunde, die im Laufe der Produktions- und Handelskette verloren gehen, und weitere 14 Prozent für private Haushalte. Verschwendete Lebensmittel machen demnach über 30 Prozent der gesamten Produktion aus, die in den Bedarf verfügbarer Anbaufläche einkalkuliert wurden. Werden diese Verluste ganz oder wenigstens zum größten Teil vermieden, so die Studie, kann das den ernährungsbedingten Flächenfußabdruck (land footprint) sehr viel nachhaltiger verkleinern, als ihn andere Faktoren wachsen lassen.
Ernährungssicherheit für Berlin
Was den engen Zusammenhang städtischer Ernährungsmuster mit dem Flächenbedarf und entsprechenden regionalen Versorgungskapazitäten für die Stadt Berlin angeht, waren Wissenschaftler der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg schon 2017 zu teilweise vergleichbaren Ergebnissen gekommen. Esther Hönle, Toni Meier und Olaf Christensen lenken den Blick in ihrer Studie zunächst auf die Diskussion, die sich um die weltweite Ernährungssicherung dreht. Ihre Begründung für diesen Ausgangspunkt ist einleuchtend: »Die zukünftige Welternährungssicherung wird häufig im Hinblick auf Bevölkerungswachstum und Klimawandel diskutiert. Dabei gelten die Länder des globalen Südens als besonders vulnerabel (verletzlich). Ernährungssicherheit ist jedoch auch für den globalen Norden aufgrund der zunehmenden Bevölkerungskonzentration in Städten von besonderer Aktualität. Dabei steht nicht Nahrungsknappheit, sondern die ›Delokalisation‹ von Produktion und Ernährung im Vordergrund, welche die Stadt stark von externen Faktoren abhängig macht.«
Vor diesem Hintergrund verglichen die WissenschaftlerInnen den Berliner Flächenbedarf bei heutigen Ernährungsgewohnheiten mit den regionalen Flächenkapazitäten der Umgebung und untersuchten Handlungsoptionen zur Verringerung der ermittelten Flächenansprüche. Ihr Fazit: Knapp zwei Drittel der benötigten Agrarfläche für den Bedarf der Berlinerinnen und Berliner stünden im Inland zur Verfügung. Ein großer Teil davon direkt vor den Toren der Stadt. Rein flächenbezogen wäre die Umstellung auf mehr regionale Versorgung Berlins also kein Problem, darin stimmt die Untersuchung prinzipiell mit Ingo Zasadas Schlussfolgerungen überein. Allerdings geben Hönle, Meier und Christensen zu bedenken, dass die Fläche, die gegenwärtig zur Ernährung einer Person gebraucht wird, noch deutlich größer ist, als ökologisch verträglich wäre.
Daraus ergeben sich Fragen nach der Resilienz (Widerstandsfähigkeit) des städtischen Ernährungssystems und nach den regionalen Versorgungsmöglichkeiten. Notwendige Bedingung für einen zukunftsfähigen Wandel wäre aus Sicht der Forscher etwa, die heute zu Ernährungszwecken pro Kopf beanspruchte Fläche deutlich zu reduzieren und damit die Umweltbelastung zu senken. Was besonders effektiv mit weniger Fleischverbrauch und drastisch verringerter Lebensmittelverschwendung erreichbar wäre.
Weiterhin stellen die Forscher fest, »dass auch ein Umdenken in der inländischen (regionalen) Produktion nötig wäre, um die Selbstversorgungskapazität Berlins zu erhöhen«. Denn bisher bauen viele Brandenburger Landwirte nur wenige Kulturen an, in der Hauptsache Mais, Raps und Weizen. Das meiste davon trägt aber weder zur Nahrungsversorgung der Berliner Bevölkerung noch zu einer im Lande bleibenden Wertschöpfung bei. Es füllt stattdessen Futtertröge oder speist Tanks und Heizkessel. Für den menschlichen Genuss gedachte Kulturen, vor allem Obst, Gemüse, Nüsse oder Hülsenfrüchte, sind dagegen viel zu selten. Ausreichend Flächen für einen zukunftsfähigen Kulturwechsel im Brandenburger Landbau wären jedenfalls vorhanden. Und, so betonen die Forscher ausdrücklich, für die Verbraucherinnen und Verbraucher müsste mit einer neuen, stärker auf lokale Produkte gestützten Esskultur ja keineswegs der komplette Verzicht auf Kiwis, Kakao oder Kaffee einhergehen.
Könnte Hamburg 100 % regional und bio essen?
Eine Studie der HafenCity Universität Hamburg kam Ende 2016 zu dem Ergebnis, die Hamburger Region könnte zu hundert Prozent mit Biolebensmitteln aus einem 100-Kilometer-Radius versorgt werden. In ihrer Studie ermittelte Sarah Joseph den Flächenbedarf für verschiedene Hamburger Ernährungsweisen.
Zwei Faktoren waren für ihre Berechnung von zentraler Bedeutung. Zum einen die Bevölkerungsdichte: Sie ging von einem Umlandradius von 100-Kilometern aus, in dem 293 Einwohner pro Quadratkilometer landwirtschaftlicher Nutzfläche leben. Zum anderen der Fleischkonsum pro Kopf und Jahr, weil dieser den größten Einfluss auf die beanspruchte landwirtschaftliche Fläche hat. Es zeigt sich, dass ökologische Produktion zwar mehr Fläche braucht, es aber dennoch möglich wäre, die Bevölkerung aus einem Umkreis von 100 Kilometer Radius rund um Hamburg vollständig mit regional erzeugten Biolebensmitteln zu versorgen, wenn drei Viertel der landwirtschaftlichen Flächen der Region für den Anbau ökologischer Nahrungsmittel genutzt würden. Vorausgesetzt, die Hamburgerinnen und Hamburger ließen beim Essen an zwei, besser noch an drei oder vier Tagen der Woche das Fleisch weg.
Mit ihren Empfehlungen für den nötigen landwirtschaftlichen Umstellungsprozess bricht Sarah Joseph schließlich eine Lanze für alternative Ernährungsnetzwerke, vor allem für verschiedene Formen von Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaften. Unter anderem seien sie in der Lage, die Zahlungsbereitschaft für regionale ökologische Lebensmittel zu erhöhen und damit zugleich für mehr Fairness bei Erzeugerpreisen und Löhnen zu sorgen.
Millionenmetropole Wien: Weltmeisterin der regionalen Gemüseversorgung
In Österreichs Hauptstadt hat das Umweltbundesamt 2017 den Bedarf und die Verfügbarkeit von regional angebautem Gemüse analysiert. Die Pilotstudie fand im Auftrag der Landwirtschaftskammern Wien und Niederösterreich, der niederösterreichischen Landesregierung sowie der Wiener Umweltschutzabteilung statt. Sie hatte das erklärte Ziel, mit ihren Daten zur Optimierung der regionalen Versorgung beizutragen. Das im Sommer des Jahres veröffentlichte Ergebnis erlaubt den Schluss, dass »der Gemüsebedarf von 2,5 Mio. Einwohner(inne)n in Wien und den Umland-Gemeinden bereits jetzt regional gedeckt werden« kann. Umweltstadträtin Ulli Sima äußerte sich in der Presse sichtlich stolz auf ihre Stadt: »Als einzige Millionenmetropole weltweit können wir uns mit Gemüse selbst versorgen. Dazu kommen der hohe Genussfaktor und die garantierte Gentechnikfreiheit der heimischen Produkte. Lokale Produktion sichert zudem Arbeitsplätze und kurze Transportwege schonen die Umwelt.«
In der Studie wurden exemplarisch drei Lebensmittelpfade untersucht: der Außer-Haus-Verzehr – dazu zählen Großküchen und die Gemeinschaftsverpflegung –, der Lebensmitteleinzelhandel und die Direktvermarktung. Darüber hinaus wurden Vertreter und Vertreterinnen aller drei Sektoren nach Absatzmengen und nach ihrer Sicht auf Potenziale ebenso wie auf mögliche Lieferengpässe befragt. Danach scheint in erster Linie der Bedarf an Zwiebeln und Karotten gut aus der Region gedeckt zu werden. Gemüseangebote außerhalb der regionalen Erntezeiten und für verarbeitete Produkte sind jedoch meist Importware. Vor allem in der Außer-Haus-Verpflegung fehlt oft noch jeder Hinweis auf die Herkunft.
Seine Studie beweise, sagt das Umweltbundesamt, dass der Bedarf an Gemüse in Wien und seinem Umland mengenmäßig – ungeachtet der Sorte – durch die Ernteerträge in der Region gedeckt werden kann. Es werden jährlich sogar etwa 80.000 Tonnen Gemüse mehr produziert, als benötigt werden. Die Nachfrage nach bestimmten Sorten ist allerdings größer als das Angebot. Dazu zählen Champignons, Blumenkohl und andere Kohlsorten, Melonen, Paprika, Pfefferschoten, Tomaten, Rote Bete, Salat und Zucchini. Andere Gemüsearten werden dagegen im Überschuss produziert und aus Wien sowie den Umlandgemeinden exportiert, etwa Erbsen, Karotten, Weißkohl, Sellerie, Spargel, Spinat und Zwiebeln. Ließen die Wiener allerdings das eine oder andere Schnitzel zugunsten von mehr Gemüse weg, müsste dessen Anbau im Umland leicht zulegen. Damit entstünde nämlich ein zusätzlicher Bedarf von etwa 20.000 Tonnen im Jahr.
Freiburg, einst regionale »Wiege des Ökolandbaus«, isst heute eher global
Die Stadt Freiburg ließ als Erste in Deutschland die Frage untersuchen, welchen Anteil regionale Produkte am Lebensmittelkonsum ihrer Einwohner haben. Die im Mai 2016 veröffentlichten Daten, die Heidrun Moschitz vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FibL) in Frick gemeinsam mit einer Reihe Fachkolleginnen gesammelt und analysiert hat, zeigen: Die Region versorgt die Freiburgerinnen und Freiburger derzeit nur mit 12 bis 20 Prozent, während der Löwenanteil vom globalen Markt stammt! Dabei sind die ermittelten Anteile von regionaler oder globaler Herkunft in den einzelnen Produktgruppen sehr unterschiedlich. Guten Absatz finden Rindfleisch (zu rund 80 Prozent regionaler Herkunft) und Milch (Regionalanteil immerhin 70 Prozent) aus dem näheren Umfeld (laut Moschitz aufgrund historisch gewachsener und noch intakter Strukturen). Obst und Gemüse hingegen stammen je nach Sorte nicht selten zu 80 bis über 90 Prozent von weiter oder sehr weit her. Letzteres übrigens trotz historischer Strukturen, deren Biobetriebe in den 1960er-Jahren als »Wiege des Biolandbaus in Deutschland« gerühmt wurden.
Für die Erhebung der Daten wurden insgesamt 121 Produzenten, Händler und Großverbraucher Freiburgs befragt. Das Freiburger Umweltdezernat sprach anlässlich der Veröffentlichung der Studie von einem Appell an die Stadt, ihre Konsumenten und die regionalen Erzeuger einander näherzubringen. Es moniert, dass das Konsumverhalten und der Lebensstil, den die genannten Zahlen offenbaren, den kommunalen Klimaschutz- und Nachhaltigkeitszielen entgegenstehen. Da dem Bereich der Ernährung rund ein Drittel aller Kohlendioxid-Emissionen zuzuschreiben sei, liefere die Studie nun aber wichtige Grundlagen für Aktionen der Stadtverwaltung, um die nachhaltige Produktion und Distribution regionaler Lebensmittel zu fördern.
Regionale Versorgung für Basel: »gering bis mittel« gesichert
Ebenfalls 2016 hat das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FibL) auch eine aktuelle Nachhaltigkeitsbewertung des Ernährungssystems der Stadt Basel vorgelegt. Im Rahmen des Projekts »Ernährungssystem Basel« analysierten Heidrun Moschitz, Jan Landert, Christian Schader und Judith Hecht das städtische Ernährungssystem mit all seinen Akteurinnen und Akteuren im Detail. Ihre Ergebnisse belegen zwar vielfältige Beziehungen der landwirtschaftlichen Betriebe im Kanton zur Baseler Bevölkerung. Damit ist aber nur teilweise die Direktvermarktung ihrer Produkte gemeint, andere Verbindungen entstehen im Bereich Landschafts- und Naturschutz und wieder andere durch Angebote für die Freizeitgestaltung und Bildung der Städterinnen und Städter (z. B. »Schule am Bauernhof«).
Auch die Nachhaltigkeit der Verwaltungsaktivitäten in und um Basel wurde bewertet, in 51 Themengebieten anhand von 97 verschiedenen Nachhaltigkeitsindikatoren. Die Studie fand dabei viele gute Ansätze, benannte aber auch einiges an Verbesserungspotenzial. So werden beispielsweise die Unterstützung des regionalen Biolandbaus und die Bevorzugung saisonaler Produkte und vegetarischer Mahlzeiten an Schulen gelobt. Zugleich monieren die Wissenschaftlerinnen, dass »die Lohngleichheit in den untersuchten Betrieben noch nicht überall gleichermaßen adressiert wird und generell der Anteil von Bio- und Fair-Trade-Produkten noch gering ist«. Ebenso werden große Lücken in der ökologischen Nachhaltigkeit des gesamten städtischen Konsums konstatiert.
Die Nachhaltigkeitsbewertung habe gezeigt, sagen Moschitz und ihre Kollegen, dass im Kanton Basel bereits heute eine Vielzahl von Maßnahmen in Richtung einer nachhaltigen Ernährung umgesetzt werden und der Kanton diesbezüglich sogar über seine Stadtgrenzen hinaus politisch Einfluss nimmt, mit dem erklärten Ziel, den ökologischen Fußabdruck des urbanen Ernährungssystems in produktiver Kooperation mit der ländlichen Region des Kantons zu verkleinern. Was die regionale Landwirtschaft aber tatsächlich zur Versorgungssicherheit der Stadtbevölkerung mit Lebensmitteln beiträgt, schätzen die FibL-Wissenschaftler insgesamt doch eher als »gering bis mittel« ein.
Die Datenbasis zur Diskussion regionaler Ernährungsstrategien ist da!