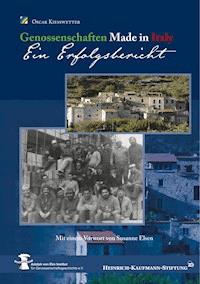
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Bei 60 Millionen Einwohnern gibt es in Italien insgesamt rund 80.000 Genossenschaften, in Deutschland sind es bei 80 Mio. Einwohnern nur 8.000. Wenn man das Buch von Oscar Kiesswetter liest, bekommt man eine Ahnung von den Ursachen dieses Unterschiedes. Die italienische Verfassung enthält einen unmissverständlichen Auftrag an die Staatsorgane, die Genossenschaften wirksam zu fördern. Kiesswetter beschreibt, wie vielfältig die Initiativen waren und sind, diesem Auftrag nachzukommen. Zahlreiche Gesetze, Dekrete, Verordnungen, Steuerregelungen und Gerichtsurteile, die vielfach keine Entsprechung in Deutschland finden, legen Zeugnis davon ab.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die große Liebe der Deutschen
zu Italien ist mir oft ein Rätsel:
Kennen sie dieses Land
und seine Bewohner wirklich?
Oder gilt ihre Sehnsucht etwas,
das sie aus der Ferne vielleicht idealisieren?
Giovanni di Lorenzo
Saviano, R./Di Lorenzo, G.:
Erklär mir Italien! Köln, 2017, S. 9.
Inhalt
Zum Geleit
Vorwort
Warum dieses Buch?
Die Aktualität des genossenschaftlichen Gedankens aus italienischer Sicht
Die Position der Vereinten Nationen
Die globale Definition des Internationalen Genossenschaftsbundes
Die Antwort Italiens auf die Empfehlungen der I.L.O
Die Starthilfe eines Italieners für die Mitteilungen der EU
Die Entstehung der italienischen Genossenschaftsbewegung
Die ersten Genossenschaftsgründungen in Italien
Die intellektuelle Differenzierung
Die Diktatur, der Zweite Weltkrieg und der Neubeginn nach 1945
Die genossenschaftliche Gegenwart in Italien
Besonderheiten des italienischen Genossenschaftswesens
Die Verankerung in der Verfassung
Excursus: Ein Vergleich mit der Verfassung des Freistaats Bayern
Die Auflagen für Genossenschaften
Die Förderung der Genossenschaften
Die Aufsicht über Genossenschaften
Excursus: Die Kosten der Revision
Andere Besonderheiten italienischer Genossenschaften
Die Mutualitätsfonds
Die Unteilbarkeit der Rücklagen
Die überwiegende Gegenseitigkeit
Excursus: Die überwiegende Gegenseitigkeit ope legis
Die Sozialgenossenschaften – Cooperative sociali
Die wechselseitigen Hilfsgesellschaften
Die sozialen Probleme in der Nachkriegszeit
Das Interesse für die Gemeinschaft wird zur sozialen Aufgabe
Die soziale Aufgabe wird zum Gesetz
Der parlamentarische Verlauf des Gesetzes Nr. 381/1991
Excursus: Das erste Regionalgesetz für Sozialgenossenschaften
Das Gesetz Nr. 381/1991 in seiner aktuellen Fassung
Ausblick auf die Zukunft der italienischen Sozialgenossenschaften
Die dringende Neudefinition der Benachteiligten
Die Sozialgenossenschaften der zweiten Generation
Conclusio
Cooperative di comunità – Die Bürgergenossenschaften
Die ersten Regionalgesetze zu den cooperative di comunità
Das Gesetz der Region Apulien
Das Gesetz der Region Ligurien
Das Gesetz der Region Abruzzen
Andere regionale Bestimmungen
Das Warten auf ein staatliches Rahmengesetz
Erste Erfahrungen italienischer Bürgergenossenschaften
I Briganti di Cerreto
La Valle dei Cavalieri
Comunità Cooperativa di Melpignano
Bürgergenossenschaft Obervinschgau BGO
Weitere Ansätze für neue Bürgergenossenschaften
Conclusio
Weitere genossenschaftliche Erfolgsmodelle in Italien
Garantiegenossenschaften
Cooperative del sapere
Cooperative Libera Terra
Genossenschaften für die Betriebsnachfolge
Das Marcora-Gesetz
Die italienischen Genossenschaften in den Krisenjahren
Die Sonderposition des arbeitenden Mitglieds
Südtirol als Schnittstelle unterschiedlicher Genossenschaftskulturen
Die Reform der italienischen Genossenschaftsbanken
Die genossenschaftliche Bankengruppe
Die Neuordnung der Raiffeisenkassen in Südtirol
Sozialgenossenschaften in Südtirol
Ein genossenschaftlicher Fremdenführer für Südtirol
Schlusswort
Anlage
Die Bestimmungen des italienischen ZGB zu den Genossenschaften
Zum Geleit
Bei 60 Millionen Einwohnern gibt es in Italien insgesamt rund 80.000 Genossenschaften, in Deutschland sind es bei 80 Mio. Einwohnern nur 8.000.
Wenn man das Buch von Oscar Kiesswetter liest, bekommt man eine Ahnung von den Ursachen dieses Unterschiedes.
Die italienische Verfassung enthält einen unmissverständlichen Auftrag an die Staatsorgane, die Genossenschaften wirksam zu fördern. Kiesswetter beschreibt, wie vielfältig die Initiativen waren und sind, diesem Auftrag nachzukommen. Zahlreiche Gesetze, Dekrete, Verordnungen, Steuerregelungen und Gerichtsurteile, die vielfach keine Entsprechung in Deutschland finden, legen Zeugnis davon ab.
Selbsthilfe in vorbildlicher Form bieten die Mutualitätsfonds, in die alle Genossenschaften drei Prozent ihres Reingewinns einzahlen und aus denen genossenschaftliche Projekte, u. a. Neugründungen finanziert werden.
Einen großen Vorteil bieten die teilweise steuerfreien Gewinnzuweisungen an die unteilbaren Rücklagen der Genossenschaft, die maßgeblich zur Sicherung des Eigenkapitals beitragen und die niemals an die Mitglieder ausgezahlt werden dürfen.
Neue gesellschaftliche Herausforderungen werden mit neuen genossenschaftlichen Formen beantwortet, wie z. B. den Sozialgenossenschaften oder den Genossenschaften zur Übernahme insolventer Firmen durch die Belegschaften und schließlich die Bürgergenossenschaften, die vor allem in ländlichen Zonen Infrastrukturaufgaben übernehmen, die von staatlichen und kommunalen Einrichtungen nicht mehr geleistet werden können.
Dies alles kann nur funktionieren, weil es offenbar in den Parlamenten, den staatlichen und kommunalen Verwaltungen, den Parteien, der Kirche und nicht zuletzt in den Genossenschaftsverbänden Menschen gibt, die begeisterte Genossenschafter*innen sind, die neue Ideen aufgreifen und vorantreiben.
Die deutsche Genossenschaftsdiskussion beschränkt sich oft auf die Frage, ob Buchhaltung und Bilanzen der Genossenschaften genauso geprüft werden müssen, wie bei Kapitalgesellschaften. Das kreative Potential, das in den Genossenschaften steckt, fällt dabei hinten runter.
Dieses Buch bietet nicht nur einen Ausflug in eine andere Genossenschaftswelt. Es gibt Anregungen, zu erkennen, wieviel Chancen auch bei uns bestehen, das Leben in viel größerem Umfang genossenschaftlich zu gestalten. Hier wie in Italien gilt der Grundsatz: „Mehr Genossenschaft – mehr Wohlbefinden.“
Burchard Bösche
Heinrich-Kaufmann-Stiftung
Vorwort
Gilt die Sehnsucht vielleicht etwas, was sie aus der Ferne idealisieren?1
Dem Autor dieses Bandes, einem intimen Kenner des Italienischen Genossenschaftswesens ist zu danken, dass er diese Dokumentation und Kommentierung der Besonderheiten der Italienischen Genossenschaftskultur vorlegt und sie in Bezug setzt zum deutschsprachigen Nachbarraum.
Oscar Kiesswetter ist Südtiroler und bewegt sich somit auf der Nahtstelle zwischen italienischsprachigem und deutschsprachigem Kulturraum. Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Entstehungshintergründe, der zeithistorischen Entwicklungen und die Ausprägungen der spezifischen Genossenschaftskulturen in diesen beiden europäischen Ländern lassen sich aus der alpinen Höhenperspektive deutlich erkennen und benennen.
Wie alle Genossenschaften sind auch die italienischen und die deutschen den internationalen Grundsätzen verpflichtet, die von der International Cooperative Alliance (ICA) 1995 formuliert wurden. Doch auch wenn beide Länder dies, sowie nicht nur eine ihrer Sprachen und kulturelle Prägungen als Gemeinsamkeit haben, verweist bereits die Gegenüberstellung der gesetzlichen Grundlagen der italienischen und der bayerischen Verfassung auf zwei verschiedene Linien, die sich seit dem frühen 20. Jahrhundert herausgebildet und im weiteren Verlauf, auseinanderentwickelt haben. Um zu verstehen, warum das so ist, müssen wir uns mit einigen historischen Weichenstellungen in beiden Ländern befassen: Artikel 45 der italienischen Verfassung von 1947 besagt: Die Republik erkennt die soziale Funktion der Kooperation, der Gegenseitigkeit und der nicht spekulativen Ziele an.2 Die gesellschaftliche Funktion von Genossenschaften und ihr nicht primär profitorientierter Charakter werden also explizit betont. Dies definiert Genossenschaften als soziale und solidarische Unternehmen und als Gegenentwürfe zur Ökonomie der Profitmaximierung.
In Italien entwickelte sich eine diversifizierte Genossenschaftslandschaft von unten, die aus dem Kontext der Zivilgesellschaft, kreativ und wirksam auf sich je verändernde gesellschaftlichen Fragen und Problemlagen antwortete.
Dies hat Kiesswetter ausführlich dargestellt und die jeweiligen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen skizziert. Er dokumentiert dabei auch die analogen Phasen gesellschaftlicher und genossenschaftlicher Entwicklungen, von der Organisation von Arbeit, Existenzsicherung und grundlegender Versorgung bis in die 1970er Jahre, zum anschließenden Aufbruch der Sozialgenossenschaften zur Organisation der sozialen und gesundheitlichen Dienste, die der Veränderung der Familienstrukturen, der Urbanisierung und der wachsenden Erwerbstätigkeit der Frauen Rechnung tragen sowie der Bürgergenossenschaften, die komplexe Aufgaben des Gemeinwesens, wie den Erhalt der Infrastrukturen oder die öko-soziale Entwicklung des Gemeinwesens verfolgen und auch als Alternative zur Privatisierung anzusehen sind.
Bewundernswert auch, der Kampf der kleinen Sozialgenossenschaften der Libera-Terra-Bewegung gegen das organisierte Verbrechen. Dies ist ein weltweit einzigartiges und heldenhaftes Beispiel des erfolgreichen Zusammenspiels zivilgesellschaftlicher Kräfte der Genossenschaftsbewegung mit staatlichen Kräften im Kampf für eine Kultur der Legalität.
Bemerkenswert am italienischen Weg ist, dass der Veränderungsdruck von unten auch zur permanenten Anpassung der gesetzlichen Grundlagen geführt hat, während Deutschland fast fünfzig Jahre an einer einzigen Genossenschaftsreform gearbeitet hat, die dann 2006 endlich erlassen wurde.
Das italienische Genossenschaftswesen konnte zudem die historische Phase des italienischen Faschismus weitgehend unbeschadet überleben, denn in Italien existieren gesellschaftstragende Strukturen unterhalb der jeweiligen Regime. Darum ist Italiens Genossenschaftskultur so lebendig. Sicher liegt einer der Gründe darin, dass Menschen in Italien vielfach Lösungen für politische, soziale und ökonomische Probleme immer selber schaffen mussten. Es gibt, insbesondere im Süden Italiens Bereiche, bei denen man von Staatsversagen sprechen kann und was den Arbeitsmarkt betrifft, auch von Marktversagen. Die neueste Studie über das organisierte Verbrechen im Umgang mit Geflüchteten in der Landwirtschaft zeigt erschreckende Zahlen aber keine staatliche Intervention.3
Mit Blick auf die Sozialgenossenschaften, die oft als beispielhafte Ansätze sozialer Innovation anzusehen sind ist zu betonen, dass es in Italien vielfach an Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens mangelt und Betroffene bzw. ihre Angehörigen zur genossenschaftlichen Selbsthilfe griffen und greifen müssen. Während Deutschlands Wohlfahrtswesen unter der Macht und dem Eigeninteresse der Wohlfahrtskonzerne erstarrt und sich immer weiter von den Interessen der Anspruchsberechtigten des Sozialstaates entfernt, hat Italien zwar kreative lokale Sozialgenossenschaften, aber diese sind keine Regeleinrichtungen und garantieren damit nicht die generelle Versorgung im jeweiligen Bereich.
Für das deutsche Verständnis des Genossenschaftswesens lässt sich stellvertretend Artikel 153 der bayerischen Verfassung von 1946 heranziehen, der zwar zunächst erstaunlich kritisch klingt, jedoch auch den spezifisch mittelständischen Charakter des deutschen Genossenschaftswesens spiegelt: Die selbständigen Kleinunternehmen und Mittelstandsbetriebe (…) sind in der Gesetzgebung und Verwaltung zu fördern und gegen Überlastung und Aufsaugung zu schützen. Sie sind in ihren Bestrebungen, ihre wirtschaftliche Freiheit und Unabhängigkeit sowie ihre Entwicklung durch genossenschaftliche Selbsthilfe zu sichern, vom Staat zu unterstützen. (…)
Der sozialreformerische Charakter von Genossenschaften wurde in Deutschland seit Anfang des 20. Jahrhunderts nicht nur vernachlässigt, sondern z. T. explizit negiert. Genossenschaften dienten der Stärkung der Kleinunternehmen gegenüber den großen industriellen Konzernen aber auch gegenüber den Habenichtsen, die als nicht selbsthilfefähig4 deklariert wurden. Während der Zeit des Nationalsozialismus wurden Genossenschaften als demokratische Strukturen systematisch bekämpft und der Großteil bis Anfang der 1940er Jahre aufgelöst (Brendel 2011).
Genossenschaften als demokratische Alternativen, die von den Mitgliedern demokratisch gesteuert werden, waren nicht mit dem Führerprinzip vereinbar. Die kapitalorientierten Genossenschaften im Kredit- und Wohnungsbereich wurden dem Führerprinzip unterstellt – verloren aber damit ihren Kern genossenschaftlicher Wirtschaftskultur – und wurden zum Zusammenschluss in große Einheiten gezwungen, was mit einem Verlust der Mitgliederidentifikation einherging. Sozialreformerische Konsum- und Produktivgenossenschaften wurden verboten.
Deutschlands Genossenschaftswesen hat sich von diesem Identitätsverlust auch in der Nachkriegszeit und den folgenden Jahrzehnten nur schwer erholt. Das historische Gedächtnis für die genossenschaftliche Alternative war gelöscht und monopolartige Verbände kontrollierten und kontrollieren weiterhin die Genossenschaftslandschaft, die in der Folge erstarrte und auch aufgrund der hohen Kosten und des enormen Aufwandes kaum neue Gründungen verzeichnete.
Hierzu trug auch die besondere Entwicklung im Osten Deutschlands bei, wo staatskollektivistische Genossenschaften kaum Bezüge zur demokratischen Genossenschaftskultur erkennen ließen. Gerade in der Phase der Wende hätten genossenschaftliche Lösungen für zahlreiche DDR-Betriebe eine Alternative zur Schließung oder zur Übernahme durch Investoren dargestellt, doch sowohl die mächtigen Kapitalinteressen als auch die Hoffnungen der Bevölkerung nach den Erfahrungen der Mangelwirtschaft ließen diese Lösungen nicht zu. Das falsche Verständnis, das mangelnde öffentliche Interesse und das fehlende historische Gedächtnis waren sowohl Folgen als auch Ursachen einer marginalen Position der Genossenschaften in der deutschen Unternehmenslandschaft.5
Genossenschaften als lebensweltlich verankerte Form des Wirtschaftens, gewinnen vor dem Hintergrund der ökosozialen Wende eine neue Bedeutung. Sie kompensieren nicht nur Mängel und Fehler der Funktionssysteme Staat und Markt, sondern sind durchaus auch in ihrer eigenen Logik als gesellschaftliche Innovatoren, Korrektive und Gegenentwürfe zur reinen Kapitallogik zu betrachten. Aus der Perspektive der gesellschaftlichen Erfordernisse sind Genossenschaften Medien der Transformation und einer Entwicklung im Kontext der reflexiven Modernisierung.6 Die Auseinandersetzung mit dem italienischen Genossenschaftswesen öffnet die Perspektive für neue Politiken der Möglichkeit.
Susanne Elsen
Prof. Dr. Susanne Elsen
Full Professor Social Sciences
Free University of Bolzano
Viale Ratisbona 16
I - 39042 Bressanone (BZ)
1 Giovanni di Lorenzo Saviano, R./Di Lorenzo, G.: Erklär mir Italien! Köln, 2017, S. 9.
2 La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.
3 CGIL FAI 2016 Agromafie e Caporalato. Roma: EDIESSE
4 Elsen, Susanne 2007 Die Ökonomie des Gemeinwesens. Weinheim und München: Juventa.
5 Elsen, Susanne, Walk, Heike 2016 Genossenschaften und Zivilgesellschaft. Historische Dynamiken und zukunftsfähige Potentiale einer öko-sozialen Transformation. In: Forschungsjournal Soziale Bewegungen. 29. Jahrgang, Heft 3, 2016, S. 60-73.
6 Elsen, Susanne (Hrsg.) 2011 Ökosoziale Transformation. Perspektiven und Ansätze von unten. Neu-Ulm: AG SPAK Bücher.
3. Warum dieses Buch?
Während andere Unternehmensformen in Italien eine krisenbedingte Negativentwicklung aufweisen, verzeichnet die Statistik der letzten Jahre eine Gründungswelle neuer Genossenschaften. Mitten im Konjunkturtief der Jahre 2008-2011 hat sich die Anzahl der jährlichen Neugründungen nahezu verdoppelt: Von allen Genossenschaften, die eine Bilanz über das Geschäftsjahr 2011 veröffentlicht haben, waren 10.400 Unternehmen nicht älter als vier Jahre und übten ihre Tätigkeit vornehmlich in der Lebensmittelverarbeitung, im Dienstleistungssektor und im Sozialbereich aus.7
Der wachsende Bedarf an Betreuung einer alternden Bevölkerung und die Kürzungen der Staatsausgaben stellen für die genossenschaftliche Selbsthilfe neue Herausforderungen dar, welchen der movimento cooperativo, die italienische Genossenschaftsbewegung, mit innovativen Geschäftsmodellen begegnet, die eine bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit an neue soziale und wirtschaftliche Bedürfnisse aufweisen.
Vor diesem Szenario ist die Entscheidung zum vorliegenden Sachbuch in deutscher Sprache über die Genossenschaften in Italien entstanden. Denn Kenntnisse über positive Erfahrungswerte sind der beste Weg zur Stärkung der genossenschaftlichen Identität und zur Verbreitung der Best Practices.
In Italien hat das Genossenschaftswesen seit seiner Entstehung, auch aufgrund der besonderen geopolitischen und ideologischen Situation, immer wieder Lösungen entwickelt, die im Vergleich zu anderen europäischen Ländern interessante Besonderheiten oder beachtliche Unterschiede aufweisen:
Nach dem Zweiten Weltkrieg ist der Wiederaufbau mit einer vorwiegend in genossenschaftlicher Form betriebenen und hauptsächlich von Genossenschaftsbanken finanzierten Bautätigkeit bewältigt worden.
Zu Beginn der Achtzigerjahre des vorigen Jahrhunderts haben genossenschaftliche Initiativen den für die Beschäftigungslage verheerenden Ausstieg des Staates aus der Schwerindustrie aufgefangen.
8
Vor fünfundzwanzig Jahren sind die ersten
cooperative sociali
, Sozialgenossenschaften entstanden, die heute aus einem bürgernahen Sozial- und Gesundheitswesen nicht mehr wegzudenken sind. Der progressive Rückzug der öffentlichen Hand aus diesem kostenintensiven Bereich schafft in Italien auch heute noch immer wieder neuen Handlungsspielraum für mitgliedergetragene Sozialunternehmen.
9
Auch im neuen Jahrtausend bringt eine zeitgemäße Interpretation des genossenschaftlichen Förderauftrages innovative Modelle hervor, die zunehmend auch in gemeinwirtschaftlicher Hinsicht aktiv werden. Dazu gehören u. a.:
Die
cooperative di comunità
10
, die aus einem kollektiven Bewusstsein heraus entstehen und in abwanderungsgefährdeten oder strukturschwachen Randgebieten meist auf Betreiben der Einwohner
bottom-up
gegründet werden. Wo öffentliche Körperschaften überfordert und Privatunternehmer nicht interessiert sind, kann die genossenschaftliche Selbsthilfe Maßnahmen entwickeln, um die Nahversorgung sicherzustellen und somit die Abwanderung einzudämmen, aber auch, um alte Berufe zu bewahren, um nachhaltigen Fremdenverkehr zu fördern und lokale Produkte zu vermarkten oder um aktiven Umweltschutz und ökologische Energiegewinnung zu betreiben.
Die Genossenschaften, die im Kampf gegen die Unterwanderung des Wirtschaftsgeschehens durch das organisierte Verbrechen beschlagnahmte Liegenschaften und landwirtschaftliche Güter verwalten und sie dadurch einer legalisierten Nutzung zuführen. Unbescholtene Mitarbeiter der früheren Inhaber verarbeiten als Mitglieder von genossenschaftlichen Betrieben die meist landwirtschaftlichen Produkte und vermarkten sie innerhalb des Netzwerkes der italienischen Konsumgenossenschaften.
11
Die im kulturell-kreativen Bereich tätigen Genossenschaften, die ein innovatives Netzwerk gebildet haben, um eine nachhaltige Nutzung der immateriellen Ressourcen Italiens zu gewährleisten. Einer Studie des Verbandes der italienischen Handelskammern Unioncamere
12
zufolge, wächst der kulturell-künstlerische Bereich seit fünf Jahren ununterbrochen auch in wirtschaftlicher Hinsicht, sowohl mit seinem Umsatz, der mit fast neunzig Milliarden Euro einen Anteil von sechs Prozent des BIP darstellt, als auch mit den wachsenden Beschäftigungszahlen, zu denen immer öfters auch arbeitslose Jugendliche und Jungakademiker gehören.
Das Wirken dieser und anderer italienischer Genossenschaftsmodelle wird vielfach auch im Ausland beobachtet, wo privatrechtliche Initiativen noch wenig konsolidiert sind, wenn es darum geht, benachteiligte Menschen in Gesellschaft und Arbeitswelt zu integrieren oder bürgergetragene Vorhaben zur Regionalentwicklung und zur Sicherung der Nahversorgung zu starten.
Dieses Buch richtet sich vornehmlich an Akteure, Institutionen, Sozialwissenschaftler und Studenten im deutschsprachigen Raum, die am Auf- und Ausbau von Sozialunternehmen interessiert sind und bewährte Modelle made in Italy kennenlernen und theoretisch vertiefen möchten.
Nach einem kurzen historischen Hinweis auf die Entstehung der italienischen Genossenschaftsbewegung werden, zum besseren Verständnis des italienischen Modells, einzelne landesspezifische Merkmale und Eigenarten erörtert.
Darauf folgt eine Analyse der wichtigsten Aspekte der Sozialgenossenschaften, mit besonderer Berücksichtigung ihres Wirkens bei der Eingliederung von Benachteiligten in den Arbeitsmarkt.
Auf die Beschreibung der jüngsten Entwicklungen bei den neuen Bürgergenossenschaften, die mit maßgeschneiderten Unternehmensstrategien auf lokale Bedürfnisse in ihrem Einzugsgebiet eingehen, folgt die Erörterung weiterer Sondermodelle, die im internationalen Vergleich die Vielfalt der italienischen Genossenschaften und ihr aktuelles Innovationspotenzial beweisen.
Die besondere Position der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol als Schnittstelle der Genossenschaftskulturen aus dem deutschen und dem italienischen Sprachraum wird in einem separaten Kapitel behandelt.13 Wegen der fehlenden Sprachbarrieren und des kulturellen Erfahrungsvorsprungs ist Südtirol eine erstrangige Adresse für einen Studienaufenthalt zu diesem Thema. Im Hinblick auf einen erhöhten grenzüberschreitenden Wissensaustausch kann das vorliegende Buch als einführende Lektüre dienen und deutschsprachigen Interessierten einen ersten allgemeinen Wissensstand vermitteln. Es enthält zahlreiche Beispiele zu besonders innovativen Genossenschaften in Südtirol sowie Informationen zu aktuellen Entwicklungen in bestimmten Sparten, sodass spezifische Anliegen eventuell auch mit Anfragen vor Ort vertieft werden können.14
Durch grenzüberschreitende Kontakte und Studien kann das Genossenschaftswesen geeignete Managementmethoden entwickeln und fördern, die den demokratischen Werten und der langfristigen Ausrichtung des Genossenschaftsmodells entsprechen und die das Potenzial des Genossenschaftsvorteils voll nutzen.15
Besonders wichtig erscheint dafür ein praxisnaher Ansatz, mit Hinweisen auf den aktuellen gesetzlichen Rahmen und mit konkreten Beispielen aus den verschiedensten Bereichen, in denen italienische Genossenschaften derzeit aktiv sind oder in nächster Zukunft agieren könnten.
Trotzdem müssen auch Angaben und Zitate aus dem italienischen Zivilrecht oder aus der Sondergesetzgebung für Genossenschaften gemacht werden, selbst wenn ihr Wortlaut dem Interesse des ausländischen deutschsprachigen Lesers nur bedingt entsprechen dürfte.
Wo die wörtliche Wiedergabe gesetzlicher Bestimmungen für das bessere Verständnis der Rechtslage oder der Zusammenhänge erforderlich ist, werden die entsprechenden Quellen im italienischen Originaltext angeführt und mit einer deutschen, wortgetreuen oder sinngemäßen Übersetzung versehen, die vom Autor verfasst ist.
Die zitierten Stellen aus der Verfassung sind der amtlichen deutschen Übersetzung entnommen, die auf der Homepage der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht ist.
Zitate in deutscher Sprache aus dem Zivilgesetzbuch sind der Übersetzung entnommen, die Max W. Bauer, Bernhard Eccher, Bernhard König, Josef Kreuzer und Heinz Zanon im Auftrag der Südtiroler Landesregierung im Jahr 2010 vorgenommen haben und die seitdem vom Amt für Sprachangelegenheiten in der Landesverwaltung aktualisiert wird.
Die in diesem Buch enthaltenen Links zu Webseiten Dritter verweisen lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung und verursachen keine Haftung für deren Inhalte.
Um eine leichtere Lesbarkeit des Textes zu gewährleisten wird auf geschlechtsspezifische Differenzierungen verzichtet.
7 Vgl. Borzaga, C. (Hrsg.): La cooperazione italiana negli anni della crisi, Trento, 2014, S. 8.
8 Vgl. Kiesswetter, O.: Fare rete – Das italienische Genossenschaftswesen und die Aktualität seiner sozialen Funktion, in Elsen, S./Lorenz, W. (eds.): Social Innovation, Participation and the Development of Society, Bozen, 2014, S. 303-322.
9 Vgl. Stenico A./Kiesswetter, O.: Die Rolle der Genossenschaften bei der Auslagerung öffentlicher Dienste – Das Beispiel Italiens, in: Zeitschrift für das gesamte Genossenschaftswesen ZfgG [53] 4/2003, S. 262–271.
10 Wörtlich übersetzt bedeutet dieser Begriff Genossenschaften der Gemeinschaft oder Genossenschaften für die Gemeinschaft. Da im zweisprachigen Südtirol die erste Initiative dieser Art den Begriff Bürgergenossenschaft gewählt hat, wird im folgenden Text diese Bezeichnung verwendet.
11 Vgl. Kiesswetter, O.: Die Wirtschafts- und Reformpolitik in Italien als Herausforderung für innovative Genossenschaften, in: Brazda, J./Dellinger, M./ Rößl, D. (Hg.): Genossenschaften im Fokus einer neuen Wirtschaftspolitik, Wien, 2013, S. 1285-1294.
12 Die Studie Io sono cultura (auf Deutsch: Ich bin Kultur) berechnet für den Kulturbereich einen Multiplikator von 1,8, d. h. jeder Euro, der für kulturelle oder kreative Zwecke ausgegeben wird, verursacht weitere 1,8 Euro Wertschöpfung in verwandten Bereichen wie Tourismus, Kommunikation und Denkmalpflege. Siehe: www.symbola.net/assets/files/IoSonoCultura_2017_DEF_1498646352.pdf
(Zugriff 29.06.2018).
13 Für eine rein geschichtliche Betrachtung des Genossenschaftswesens in Südtirol vgl. Pichler, W./Walter, K.: Zwischen Selbsthilfe und Marktlogik, Bozen, 2007.
14 Besondere Aufmerksamkeit wird der Bildung einer eigenen Bankengruppe unter den Südtiroler Raiffeisenkassen im Rahmen der staatlichen Reform der Genossenschaftsbanken gewidmet.
15 Übersetzung des Autors aus der italienischen Fassung des Blueprint Il piano del decennio per le cooperative veröffentlicht von der Alleanza Internazionale delle Cooperative Seite 18.
https://ica.coop/en/media/library/member-publication/blueprint-co-operative-decade-february-2013 (Zugriff 29.06.2018).
4. Die Aktualität des genossenschaftlichen Gedankens aus italienischer Sicht
Aussagen zur Bedeutung der Genossenschaften beginnen meist mit einer Analyse der sozioökonomischen Situation bei den zeitlichen Ursprüngen der Bewegung im neunzehnten Jahrhundert und enden mit einer Bewertung der davon ausgelösten positiven Entwicklungen.
Aufgrund der vornehmlich informativen Zielsetzung dieses Buches erscheint es jedoch zielführend, mit einem zeitgemäßen Ansatz zu beginnen und darauf hinzuweisen, dass genossenschaftliche Unternehmen, nach ihrer Entwicklung während des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg, seit Beginn des neuen Jahrtausends wieder vermehrt im Mittelpunkt der allgemeinen Aufmerksamkeit stehen.
In Italien beschäftigt sich die öffentliche Diskussion, in Anbetracht politischer, sozialer und wirtschaftlicher Veränderungen, zunehmend mit der Suche nach Selbstorganisationspotenzialen zur Lösung von Problemen. Dabei erweisen sich Genossenschaften mit ihren besonderen Wesensmerkmalen als wirksame Akteure der ökosozialen Entwicklung, weil sie aus dem Kontext der Gemeinschaft entstehen und eine demokratische Unternehmenstätigkeit mit sozialen Elementen verbinden.
Genossenschaften sind nicht nur eine bewährte Rechtsform für kleine Unternehmen, sondern werden mehr und mehr als eine globale Bewegung anerkannt, die für sozialverträgliches, demokratisches und verantwortungsvolles Denken und Handeln steht. Insbesondere die italienischen Sozialgenossenschaften gelten als sozial- und wirtschaftspolitisch motivierte Ansätze integrierter Problemlösungen, bzw. als kooperative Organisationsformen für eine Verknüpfung des örtlichen Arbeitskräftepotentials mit vorhandenen und neuen Tätigkeiten im lokalen Gemeinwesen.16
Sinngemäß gilt diese Definition auch für die Programme zu einer eigenständigen Regional- und nachhaltigen Stadtentwicklung, die von den weiter unten analysierten Bürgergenossenschaften verwirklicht werden.
Wie der UN-Generalsekretär formulierte, erinnern Genossenschaften die internationale Gemeinschaft daran, dass es möglich ist, wirtschaftliches Handeln und soziale Verantwortung zu verbinden.17
Zu diesem erhöhten Stellenwert haben Studien, Aktionen und Sensibilisierungsaufrufe großer internationaler Institutionen beigetragen, auf welche in Folge kurz eingegangen wird, um deren Auswirkungen auf italienische Genossenschaften und ihre Verbände darzustellen.
4.1. Die Position der Vereinten Nationen
Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat zu einem gesteigerten Interesse beigetragen, indem sie im Laufe der 54. Tagung am 17. Dezember 1999 die Resolution Nr. 54/123 verabschiedet hat, mit der die Regierungen aufgefordert werden, der Rolle und dem Beitrag der Genossenschaften die nötige Aufmerksamkeit zu widmen.
Der von der UNO für das neue Jahrtausend formulierte Resolutionstext enthält unter anderem den Auftrag … die Möglichkeiten der Genossenschaften im Hinblick auf die Erreichung der Ziele der sozialen Entwicklung … in vollem Umfang zu nutzen und … geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um ein förderliches Umfeld für den Aufbau von Genossenschaften zu schaffen …18
Der am 14. Mai 2001 vorgelegte Bericht des UN-Generalsekretärs über die Umsetzung dieser Resolution19 enthält erste Leitlinien, um die Pläne der einzelnen Staaten zur Entwicklung von Genossenschaften zu vereinheitlichen. Darin wird die Empfehlung formuliert, dass das nationale Recht der Mitgliedsländer den Grundsätzen der Genossenschaftsidentität aus dem Jahre 1995 Rechnung tragen sollte.
Die verstärkte Bewusstseinsbildung seitens der Vereinten Nationen zugunsten der modernen Genossenschaftsbewegung hat im Jahr 2012 ihren Höhepunkt erreicht, als die UNO das Internationale Jahr der Genossenschaften ausgerufen hat.20
Das International Year of Cooperatives (I.Y.C.) ist weltweit genutzt worden, um die Sichtbarkeit genossenschaftlicher Initiativen in der breiten Öffentlichkeit zu verbessern und ihren Bekanntheitsgrad als demokratische Unternehmen zu erhöhen, die dauerhaft einen Beitrag für ihre Mitglieder und die Gemeinschaft leisten.21
Im Vorfeld dieser einjährigen internationalen Sensibilisierungskampagne ist auch die Fachdebatte, die bisher hauptsächlich betriebswirtschaftlich ausgerichtet war und vorwiegend die ökonomische Leistung und Stabilität von Genossenschaften thematisierte, um einen wichtigen Bereich erweitert worden. Vor dem Hintergrund der internationalen Finanz- und Konjunkturkrise ist eine Rückbesinnung auf die demokratiepolitische und gemeinwohlfördernde Bedeutung von Genossenschaften erfolgt. Seitdem wird – auch innerhalb der italienischen Verbände – in der Diskussion vermehrt die Genossenschaft als Form solidarischer Ökonomie hervorgehoben, die ein demokratisches Organisationsmodell für die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Belange auf lokaler und regionaler Ebene darstellt.
Nach dem I.Y.C. hat auch die breite Öffentlichkeit ein Bewusstsein entwickelt, dass genossenschaftliche Unternehmen richtigerweise wirtschaftliche Ziele verfolgen, dass sie aber durchwegs auch eine soziale und kulturelle Dimension haben, da sie nicht auf Kapitalinteressen und Wachstum ausgerichtet sind. Sie verfolgen vorwiegend die Förderung ihrer Mitglieder und die Deckung ihrer jeweiligen Bedürfnisse, wobei sie ihr ökonomisches Potential aus der Bündelung von Mitgliedsressourcen beziehen. Dieselben Mitglieder – und nicht Investoren – legen die Bestimmung von Wertschöpfung und -verteilung fest. Ihre aktuelle Neuausrichtung ist nicht zu verstehen als Rückfall in die Vormoderne, sondern als Vorgriff auf Wege in eine andere, eine reflexive Moderne.22
Aus italienischer Sicht war das I.Y.C. tatsächlich eine Gelegenheit, die man nur einmal im Leben bekommt, wie es die I.C.A.-Präsidentin formuliert hat.23 Im Laufe des Jahres haben Verbände, Forschungseinrichtungen und lokale Körperschaften mit zahllosen Veranstaltungen wirksame Öffentlichkeitsarbeit betrieben, sodass der Beitrag genossenschaftlicher Unternehmen für nachhaltige Lebensräume und soziale Absicherung auch von neuen Bevölkerungsschichten erkannt worden ist. Die Kenntnis der besonderen Fähigkeit, die Gesellschaft mit der Schaffung von Arbeitsplätzen und Einkommen zu stärken, hat bewirkt, dass Genossenschaften von der öffentlichen Meinung seit 2012 mehr und mehr als ein mitgliedergelenktes Unternehmensmodell wahrgenommen werden, das durch die Betonung zentraler Werte eine Vision voranbringt, mit der soziale Grundsätze in das Wirtschaftsleben integriert werden können.
In Italien sind anlässlich der Internationalen Tagung Promoting the understanding of cooperatives for a better world24 Rolle und Bedeutung von Genossenschaften vor dem Szenario der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise thematisiert worden. In den meisten Staaten haben Genossenschaften erfolgreicher auf die Krise geantwortet als Investor-Owned-Firms. Die Stabilität von Genossenschaften ist seitdem mehr und mehr gewürdigt worden und Entscheidungsträger wie Meinungsmacher interessieren sich dafür, welche Rolle die Genossenschaften einnehmen könnten bei der Bewältigung der einschneidenden Folgen der globalen Krise, sowie bei der Reformierung jenes Systems, das die Krise teilweise miterzeugt hat.
Das Abschlussdokument der Konferenz, die einen der Höhepunkte des I.Y.C. 2012 in Italien darstellt, weist darauf hin, dass italienische Genossenschaften alle Merkmale besitzen, um in dynamischer und innovativer Weise an der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft teilhaben zu können. Ihre nachweislich vorhandene Anpassungsfähigkeit ermöglicht eine positive Reaktion auf Krisenzeiten, auch wenn sie nicht ausschließlich ein Unternehmensmodell für Krisensituationen sind. In Italien wächst die Nachfrage nach genossenschaftlichem Wirken, verstanden als Alternative zur traditionellen, marktorientierten Wirtschaftstätigkeit. Der Übergang Italiens von der Industrienation zu einer Dienstleistungsgesellschaft hat bei den Menschen das Bedürfnis ausgelöst, wieder an Entscheidungs- und Produktionsprozessen teilhaben zu können.
Diese größere Bekanntheit und die gesteigerte Wertschätzung haben in den Folgejahren dazu beigetragen, dass die hartnäckige Rezession in Italien von zahlreichen Arbeitssuchenden und Arbeitslosen auch dadurch bekämpft worden ist, dass sie vermehrt innovative Kleinunternehmen in genossenschaftlicher Form gegründet und damit den Sprung in die unternehmerische Selbständigkeit gewagt haben.25
4.2. Die globale Definition des Internationalen Genossenschaftsbundes
Eine italienische Leseart kann man zum Teil auch bei den Grundsätzen anwenden, die von der International Co-operative Alliance (I.C.A.)26 beim Kongress in Manchester im Jahre 1995 anlässlich ihres hundertjährigen Bestehens formuliert worden sind und die eine weltweit anerkannte Definition des gemeinsamen Wertesystems genossenschaftlicher Unternehmen darstellen.27
Diese global gültigen Grundsätze stellen Richtlinien dar, mit deren Hilfe kooperative Unternehmen ihre Werte in die Praxis umsetzen:
Freiwillige und offene Mitgliedschaft
Demokratische Entscheidungsfindung durch die Mitglieder
Wirtschaftliche Mitwirkung der Mitglieder
Autonomie und Unabhängigkeit
Ausbildung, Fortbildung und Information der Mitglieder
Kooperation zwischen Genossenschaften
Engagement für die Gemeinschaft
Auch in Italien bilden sie die Prinzipien, mit denen Genossenschaften ihre zeitlosen Wertvorstellungen wie Selbsthilfe, Eigenverantwortlichkeit, Demokratie28 und Gleichheit verfolgen. Insbesondere die beiden letzten I.C.A.-Grundsätze sind aus italienischer Sicht relevant, weil deren praktische Umsetzung entscheidend zur Entstehung typischer italienischer Unternehmensmodelle beigetragen hat:
Das sechste Prinzip, die Kooperation zwischen Genossenschaften, wird in Italien konkret und aktiv verwirklicht und hat u. a. zur Bildung der sogenannten
externen Mutualität
geführt.
29
Die Wirksamkeit der Mitgliederförderung wird durch eine effiziente Zusammenarbeit der örtlichen, regionalen, nationalen und internationalen Verbandstrukturen erhöht, was wiederum auch die Bewegung selbst indirekt stärkt. Diese Kooperationsbereitschaft macht genossenschaftliche Netzwerke krisenresistenter, wie die Erfahrungen in der Nachkriegszeit aber auch in der jüngsten Rezessionsphase beweisen.
30
Sie bewährt sich aber auch in Zeiten eines regelmäßigen Wirtschaftswachstums, indem sich italienische Genossenschaften zunehmend auch an Netzwerken mit anderen Unternehmensformen beteiligen. Die italienische Industriepolitik setzt seit Jahren verstärkt auf das Instrument der Vernetzung, um durch diese Kooperationsform die Schwächen der durchwegs kleinstrukturierten italienischen Unternehmen zu kompensieren, ohne deren Selbständigkeit und Effizienz durch dauerhafte Zusammenschlüsse oder gar Verschmelzungen einzuschränken. Der Verband der italienischen Handelskammern Unioncamere hat in der Studie
Cooperazione, non profit e imprenditoria sociale: economia e lavoro
31
aufgezeigt, dass fünfzehn Prozent der im Handelsregister eingetragenen Unternehmensnetzwerke die Präsenz einer oder mehrerer Genossenschaften unter den Teilnehmern aufweisen. Aus dieser Untersuchung geht außerdem hervor, dass sieben Prozent aller Genossenschaften an Netzwerken beteiligt sind, während von den aktiven Unternehmen in anderen Rechtsformen insgesamt nur 4,7 % Teil eines Netzwerkes sind, was wiederum beweist, dass Genossenschaften eine größere Bereitschaft zum Networking haben.
Das siebte I.C.A.-Prinzip, wonach sich Genossenschaften gezielt für die nachhaltige Entwicklung der Gemeinschaft einsetzen, indem sie auch ihr soziales und territoriales Umfeld fördern, prägt derzeit die jüngsten Entwicklungen in Italien. Das Engagement für die Gemeinschaft als besondere Form der sozialen Verantwortung ist das Unternehmensziel eines innovativen Genossenschaftsmodells, dessen Zweck über die Förderung der eigenen Mitglieder hinausgeht und die Abdeckung von aktuellen oder zukünftigen Bedürfnissen der gesamten Bevölkerung anstrebt. Die Entwicklung des territorialen Umfeldes und die Produktion von Dienstleistungen, die grundsätzlich für die gesamte lokale Gemeinschaft erbracht werden, stärken die Verankerung des Unternehmens im Lokalbereich, wodurch die Grenzen zwischen Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern verschwimmen. Wo die Erfordernisse einer effizienten Verwaltung die zuständigen Lokalkörperschaften überfordern und Privatunternehmer nicht interessiert sind, übernimmt einmal mehr die Genossenschaftsform die Rolle der Selbstverwaltung und Selbstbestimmung. Dieses Modell greift zwar auf langfristige Erfahrungswerte der Genossenschaftsbewegung zurück, weist aber einen hohen Innovationswert auf.
32
Im Unterschied zu deutschen Genossenschaften, für deren Engagement in der Kommunalverwaltung die Geschäftsfelder Energie und Wasser bzw. Abwasser besondere Relevanz haben
33
, wirken in Italien diese Genossenschaften je nach Bedarfslage und brachliegenden Ressourcen sowohl gegen Abwanderung als auch für aktiven Umweltschutz, sie tragen zur Bewahrung alter Berufe bei, betreiben die Vermarktung lokaler Produkte und erbringen vielseitige Dienste an der Gemeinschaft. Dabei gewährleisten sie unter Einbeziehung aller Mitglieder den Transport und die Verpflegung von Schülern ebenso wie Breitbandanschlüsse, sie sichern die Nahversorgung und den Denkmalschutz, führen Postämter weiter, die von der Postverwaltung eingestellt werden, betreuen Freizeitaktivitäten und die sportliche Infrastruktur ganzer Dörfer und nutzen leer stehende Häuser für einen nachhaltigen Fremdenverkehr.
Der Internationale Genossenschaftsbund hat bereits vor Abschluss des Genossenschaftsjahrs 2012 für die Folgejahre ein genossenschaftliches Jahrzehnt ausgerufen, um die bedeutende Schwungkraft des I.Y.C. zu konsolidieren. Während dieser Dekade sollen die aufgezeigten Grenzen anderer Geschäftsmodelle und das weltweite Bedürfnis nach Nachhaltigkeit genutzt werden, um vor allem junge Menschen in Genossenschaften einzubinden.
Wichtigstes Ergebnis der vom I.Y.C. angestoßenen Entwicklung ist die Blaupause des Internationalen Genossenschaftsbundes (I.G.B.) für eine Dekade der Genossenschaften 2012-2020, ein strategisches Dokument, das die Generalversammlung des I.G.B. in Manchester am 30. Oktober 2012 verabschiedet hat.
Diese Blaupause enthält die ehrgeizige Vision 2020, wonach bis dahin die Genossenschaften als die von den Bürgern bevorzugte Unternehmensform und als führendes Modell für wirtschaftliche, soziale und ökologische Nachhaltigkeit anerkannt sein sollten.34
4.3. Die Antwort Italiens auf die Empfehlungen der I.L.O.
Auch die Internationale Arbeitsorganisation I.L.O.35 spricht sich für breite gesellschaftliche Partizipation an der Genossenschaftsentwicklung aus, aber im Unterschied zur Stellung der Vereinten Nationen geht es dieser Institution mehr um den Kampf gegen soziale und ökonomische Diskriminierung, den genossenschaftlich organisierte Unternehmen erfolgreicher führen können als andere Kapitalgesellschaften.
Die I.L.O. hat in der Vergangenheit vor allem die Rolle der Genossenschaften für die wirtschaftliche und soziale Förderung in Entwicklungsländern thematisiert. Seit 2002 tritt sie vermehrt für eine globale gesellschaftliche Vermittlung der genossenschaftlichen Werte ein. Sie definiert die Genossenschaften in allen Ländern, ungeachtet ihres Entwicklungsstands, als eine zukunftsfähige Form für die lokale Wirtschaftsentwicklung, für Strategien gegen die Benachteiligung sowie für den Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung.36
In jüngster Zeit hat die I.L.O. das Thema wieder aufgegriffen und untersucht, wie das genossenschaftliche Geschäftsmodell zur nachhaltigen Entwicklung im Sinne der UN-Agenda 2030 beiträgt.37 Die Ergebnisse zeigen, dass Genossenschaften im konkreten Handeln und mit ihrem Engagement auf lokaler Ebene zur Erreichung nachhaltiger Entwicklungsziele beitragen können, weil sie in Bereichen aktiv werden, in denen die Privatinitiative der Unternehmen oder die Leistungen des Staates ausfallen. Daher übernehmen sie eine Schlüsselrolle im Gesundheitswesen und in der Pflege oder fördern gleichrangige Handelsbeziehungen und Wertschöpfungsketten durch ihr Engagement bei alternativen Formen des Handels.38
Während sich die Debatte um Entwicklungsziele der UN-Agenda verstärkt, fördert die I.L.O. aktiv das Modell der Genossenschaften als wichtiges Instrument zur Erreichung nachhaltiger Entwicklung, in der
Überzeugung, dass die Werte und Prinzipien, die kooperativ geführte Unternehmen verkörpern, auf die steigenden Anforderungen der wirtschaftlichen Entwicklung, auf Umweltschutz und soziale Gleichheit in der globalisierten Welt Antworten geben können.39 Bereits nach der Entscheidung der UNO für eine genossenschaftsfreundlichere Umwelt hatte die Internationale Arbeitsorganisation die Förderung der Genossenschaften zum Schwerpunkt der eigenen Aktivitäten gemacht. Das bekannteste Dokument der I.L.O. zum Genossenschaftswesen ist die Empfehlung Nr. 193 vom 20. Juni 200240, die ausdrücklich feststellt, dass eine ausgeglichene Gesellschaft einen starken öffentlichen und privaten Sektor erfordert, aber ebenso starke Genossenschaften.41
Konkret gesprochen sollten die Regierungen einen förderlichen politischen und rechtlichen Rahmen schaffen, der Natur und Aufgabe der Genossenschaften entspricht.42 Sie sollten sich ferner an den genossenschaftlichen Werten und Grundsätzen orientieren, u. a. um
eine möglichst rasche, einfache, kostengünstige und effiziente Registrierung von Genossenschaften zu ermöglichen,
die Bildung angemessener Reserven, von denen zumindest ein Teil nicht teilbar sein könnte, und die Bildung von Solidaritätsfonds in Genossenschaften zu fördern,
Maßnahmen für die Überwachung von Genossenschaften vorzusehen, die ihre Eigenständigkeit achten und die nicht weniger kostengünstig als die für andere Unternehmen sind,
den Beitritt von Genossenschaften zu genossenschaftlichen Strukturen zu erleichtern,
die Entwicklung von Genossenschaften als autonome und selbstverwaltete Unternehmen zu fördern, insbesondere in Bereichen, in denen ihnen eine bedeutende Rolle zukommt oder in denen sie Dienste leisten, die von anderen nicht angeboten werden.
Die I.L.O. begründet ihre Aufforderung an die Regierungen, Genossenschaften zu fördern mit dem Hinweis, dass sie eine bedeutende Funktion als Stütze der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung einnehmen.43 Diese Rolle übernehmen sie, indem sie marginale, nur der Sicherung des Lebensunterhalts dienende Tätigkeiten umwandeln in gesetzlich geschützte Arbeitsformen, die voll in das Wirtschaftsleben integriert werden können. Wörtlich verlangt die Empfehlung die Förderung besonderer Maßnahmen, um Genossenschaften als vom Geist der Solidarität geprägte Unternehmen und Organisationen in die Lage zu versetzen, auf die Bedürfnisse ihrer Mitglieder und der Gesellschaft einzugehen, einschließlich der Bedürfnisse benachteiligter Gruppen, damit sie in die Gesellschaft eingegliedert werden.
Italien hat im Vorfeld der Arbeitskonferenz 2002 mit zahlreichen Bemerkungen zur Ausarbeitung des endgültigen Wortlautes beigetragen.44 Die Erläuterung derselben würde den Informationsgehalt dieses Buches übersteigen, aber im Verlauf der folgenden Ausführungen wird nachgewiesen werden, dass das italienische Genossenschaftswesen eigenständige Unternehmensmodelle hervorgebracht hat, die den Zielen der Empfehlung entsprechen. Italien hat bereits Unterstützungsmaßnahmen für die Tätigkeiten von Genossenschaften eingeführt, die bestimmten sozial- und staatspolitischen Zielen dienen, die Beschäftigung fördern oder benachteiligten Gruppen bzw. Regionen zugutekommen.45
Die von der I.L.O. geforderten Elemente, insbesondere die Eingliederung benachteiligter Menschen, die Entwicklung ihrer unternehmerischen und Führungsfähigkeiten oder eine Wirtschaftsleistung, die den sozialen und wirtschaftlichen Bedürfnissen der Gemeinschaft gerecht wird, sind strategische Merkmale, die italienische Genossenschaften bereits kennzeichnen.46
4.4. Die Starthilfe eines Italieners für die Mitteilungen der EU
Im Jahr 2004 ist auch die EU-Kommission aktiv geworden und hat, nach einer umfassenden Konsultationsphase, in einer Mitteilung an das Europäische Parlament den gesellschaftlichen Beitrag von Genossenschaften gewürdigt und mit klaren Worten ihre Förderung in Europa als Priorität festgesetzt.47
Wenn man die Arbeitsweise der EU berücksichtigt, kann man wohl davon ausgehen, dass die Initialzündung für dieses gesteigerte Interesse einige Zeit vor den ersten öffentlichen Verlautbarungen erfolgt sein dürfte.
Aus italienischer Sicht ist die viel beachtete Rede des damaligen Kommissionsvorsitzenden Romano Prodi48 beim Kongress der Genossenschaften Europas in Brüssel am 13. Februar 2002 der Startschuss für die Sensibilisierungskampagne der EU zugunsten des Genossenschaftswesens.
In dieser Ansprache kündigt der Präsident an, dass die Kommission alles in ihrer Macht Stehende tun wird, um Arbeit und Gedeihen der Genossenschaften in Europa zu fördern. Denn sie tragen zur Verwirklichung der wirtschaftlichen, sozialen und politischen Ziele Europas bei und beweisen damit, dass der Geist der Solidarität, der ihren Geschäftszweck prägt, keineswegs im Widerspruch steht zum Unternehmergeist, sondern dass beide zusammen positive Wirkungen zeitigen.
Genossenschaften sind die einzigen Unternehmen, deren Reichtum nicht von ihrem Kapital, sondern von ihren Mitgliedern abhängt und sie unterscheiden sich auch dadurch von anderen Gesellschaftsformen, dass sie mehr auf Wertvorstellungen als auf Ressourcen gründen. Weiters definiert Prodi in seiner Ansprache die Genossenschaften als wettbewerbsorientierte Unternehmen, die eigenständig, wirtschaftlich produktiv und innovativ sind.
Als freie Vereinigungen bieten sie ihren Mitgliedern und der gesamten Gesellschaft einen erheblichen Zusatznutzen und dieser Mehrwert kann Europa dabei helfen, Lösungen zu finden für bedeutende Herausforderungen, wie die Wettbewerbsfähigkeit auf globalisierten Märkten, die regionale Entwicklung in struktur- und kapitalschwachen Gebieten und die soziale Verantwortung der Unternehmen.
Am Ende der Konsultationsphase hat sich die Kommission den Standpunkt zu eigen gemacht, dass das Potenzial der Genossenschaften bisher nicht voll genutzt worden ist und dass ihr Image auf nationaler und auf europäischer Ebene, auch in neuen Mitgliedstaaten und Kandidatenländern, verbessert werden kann und soll. Die von der EU-Kommission verlangte Förderung trägt dem Umstand Rechnung, dass die Genossenschaften einen positiven und zunehmend wichtigen Beitrag zur Erreichung gemeinschaftspolitischer Ziele auf den Gebieten der Beschäftigung, der sozialen Eingliederung und der Regionalentwicklung leisten können.
Insbesondere erscheinen die in genossenschaftlicher Form eingerichteten Arbeitsplätze für die Sozialwirtschaft förderungswürdig, da diese auch von Personen gegründet und verwaltet werden können, die andernfalls keinen Zugang zum Arbeitsmarkt hätten. Von sozialer Ausgrenzung betroffene Bevölkerungsgruppen können von Genossenschaften wirksam in die Arbeitswelt und in die Gesellschaft integriert werden.
Genossenschaften stellen unternehmerische Lösungen zur Deckung eines noch unbefriedigten Bedarfs auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet bereit und können, insbesondere wenn entsprechende öffentliche oder private Initiativen fehlen, Arbeitsplätze schaffen, zur Flexibilität des Arbeitsmarktes beitragen und ein nachhaltiges, auf Solidarität basierendes Wachstum fördern, gerade weil sie nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet sind.
Diese institutionelle Wortmeldung zum Schutz und zur Förderung des Genossenschaftswesens hat in nahezu allen Staaten Europas ein bewussteres Interesse für genossenschaftliche Unternehmensformen vor allem in innovativen Bereichen ausgelöst. Die Genossenschaften beantworten diese Einstellung mit einer geringeren Krisenanfälligkeit und einer konstanten Beschäftigungslage auch in Zeiten von Konjunktureinbrüchen. Italienische Genossenschaftsbanken sind vom schweren Vertrauensverlust in andere Akteure der Kapitalmärkte weitgehend verschont geblieben, ein Beweis dafür, dass kooperative Prinzipien die unternehmerische Tätigkeit positiv beeinflussen und vor kapitalistischen Exzessen bewahren können.
Auch die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 19. Februar 2009 zur Sozialwirtschaft (2008/2250(INI))49 enthält wichtige Hinweise auf die bedeutende Rolle der Genossenschaften als Akteure der Sozialwirtschaft bei der Umsetzung der Ziele der Lissabon-Strategie, allerdings beschränkt sich die spezifische Relevanz für das vorliegende Buch auf die Person der Referentin, die italienische EU-Parlamentarierin Patrizia Toia.
Die jüngste und vorerst letzte Maßnahme, die unmittelbar von dem gesteigerten öffentlichen Interesse für das Genossenschaftswesen zeugt, ist ein Beschluss des Europäischen Parlaments, der sich mit dem Beitrag der Genossenschaften zur Überwindung der Krise auseinandersetzt.50
Dieses Dokument erkennt ausdrücklich die Fähigkeit der Genossenschaften an, vor allem in Krisenzeiten eine entscheidende Rolle für die europäische Wirtschaft zu spielen, indem sie Wirtschaftlichkeit mit Solidarität verbinden, qualitativ hochwertige Arbeitsplätze schaffen, den sozialen, wirtschaftlichen und regionalen Zusammenhalt stärken und Sozialkapital hervorbringen. Die EU betont dabei, dass Genossenschaften mit ihren Beschäftigungszahlen eine größere Reaktionskraft auf Konjunktureinbrüche beweisen und widerstandsfähiger reagieren als konventionelle Unternehmen, denn trotz der Krise kann man in innovativen Wirtschaftszweigen Neugründungen und zusätzliche Arbeitsplätze verzeichnen. Diese Entwicklung ist laut EU auf die besondere Fähigkeit der Genossenschaften zurückzuführen, sich kurzfristig und erfolgreich an veränderte soziale und wirtschaftliche Verhältnisse anzupassen.
Aus italienischer Sicht ist der EU-Beschluss Beitrag der Genossenschaften zur Überwindung der Krise bemerkenswert, weil im achten Punkt der Einleitung des Dokuments die positive Erfahrung italienischer Sozialgenossenschaften bei der Verwaltung konfiszierter Vermögen der Mafia51 ausdrücklich anerkannt wird, was den Schutz der Rechtsordnung als zusätzliches Element ihrer Unternehmenskultur beweist.
Nach diesen aus italienischer Sicht formulierten Überlegungen müssen zwei abschließende Feststellungen zum Verhältnis zwischen den Beschlüssen und Aktionen internationaler Organisationen und der Genossenschaftsbewegung in Italien formuliert werden.
Alle Institutionen stimmen darin überein, den Genossenschaften eine bedeutende Rolle bei ökosozialen Transformationsprozessen einzuräumen, weil sie Bedarfshaltungen in unternehmerisches Handeln und Problemsituationen in Projekte umwandeln. Daher werden sie auch in Zukunft praxisnahe Antworten für Einzelne und für die Gemeinschaft liefern können, wenn die Staaten geeignete Rahmenbedingungen für Genossenschaften schaffen, die ihrem Potenzial eine volle Entfaltung ermöglichen, wie es den Empfehlungen und Richtlinien der großen politischen Organisationen entspricht.52 Italienische Genossenschaftsmodelle liefern bereits seit Jahren den Beweis dafür, dass dies umfassend möglich ist: Ein gesellschaftlicher Auftrag für Genossenschaften steht nicht im Widerspruch zum ersten Förderauftrag, sondern stellt einen eigenständigen, mit dem ersten voll kompatiblen zweiten Förderauftrag dar, der in den folgenden Kapiteln noch mehrfach erwähnt wird.
16 Vgl. Elsen, S.: Gemeinwesenarbeit und Gemeinwesenökonomie im Zeitalter der Globalisierung, in: Klöck,T. (HG.): Solidarische Ökonomie und Empowerment. Jahrbuch Gemeinwesenarbeit 6, Neu-Ulm, 1998, S. 69-99.
17 Ban Ki-Moon, UNO-Generalsekretär bei der Vorstellung des Internationalen Jahres der Genossenschaften 2012.
18 Das Interesse der UNO beruht auf der Feststellung, dass die Genossenschaften zu einem wichtigen Faktor der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung werden, da sie die breitestmögliche Mitwirkung von Frauen und allen Bevölkerungsgruppen, namentlich auch von Jugendlichen, älteren Menschen und Behinderten, am Entwicklungsprozess fördern und es in zunehmendem Maße ermöglichen, den Bedarf der Menschen an grundlegenden sozialen Diensten wirksam und kostengünstig zu decken. Siehe http://www.un.org/depts/german/gv-54/band1/ar54123.pdf (Zugriff 29.06.2018).
19 Vgl. Report of the Secretary-General Cooperatives in social development.
www.un.org/documents/ecosoc/docs/2001/e2001-68.pdf (Zugriff 29.06.2018).
20 Resolution A/RES/64/136 - Proclamation of 2012 as International Year of Cooperatives.
21 Als Vorreiter dieser Initiative gilt die Resolution 47/90 vom 16.12.1992, mit der die Generalversammlung den ersten Samstag im Juli 1995 anlässlich des hundertsten Jahrestages der Gründung des I.G.B. zum Internationalen Tag der Genossenschaften erklärt. Seitdem feiern die UNO und der I.G.B., der bereits 1923 den Tag der Genossenschaften ausgerufen hatte, diesen Event gemeinsam.
Siehe: www.unric.org/html/german/resolutions/A_RES_47_90.pdf (Zugriff 29.06.2018).
22 Vgl. Elsen, S./Walk, H.: Genossenschaften und Zivilgesellschaft: Historische Dynamiken und zukunftsfähige Potenziale einer öko-sozialen Transformation, erschienen im Forschungsjournal Soziale Bewegungen 29. Jahrgang Heft 3, September 2016 (S. 60-73).
23 Zitat aus der Rede der I.C.A.-Präsidentin Dame Pauline Green anlässlich der Generalversammlung der International Co-operative Alliance in Cancun (Mexiko) am 14.11. 2011.
24 Die Tagung hat in Venedig am 15.-16. März 2012 stattgefunden. Der deutschsprachige Konferenzbericht Verbreitung der Genossenschaftsidee für eine bessere Welt ist vom Forschungsinstitut EURICSE veröffentlicht worden. Siehe: www.euricse.eu/wp-content/uploads/2015/03/venice_german_final_0.pdf (Zugriff 29.06.2018).
25 Siehe Kapitel 9.4.2. Die italienischen Genossenschaften in den Krisenjahren.
26 Im deutschen Sprachgebrauch wird für die I.C.A. vielfach auch die Bezeichnung Internationaler Genossenschaftsbund (I.G.B.) verwendet.
27 Vgl. Münkner H-H. (2013), Worldwide regulation of co-operative societies – an Overview, Euricse Working Paper n. 53, S. 4.
28 Zusätzlich zum Pro-Kopf-Stimmrecht wird der demokratische Grundsatz in Italien mit dem im Art. 2525 ZGB verankerten Verbot eines Anteilsbesitzes über 100.000 Euro verstärkt.
29 Die wichtigsten Formen der externen Mutualität werden im Kapitel 6.5. Andere Besonderheiten italienischer Genossenschaften erläutert.
30 Die von der italienischen Bewegung entwickelten, innovativen Kooperationsformen zur Rettung von Arbeitsplätzen durch Fortführung von Krisenunternehmen in genossenschaftlicher Form werden im Kapitel 9.4.1. Das Marcora-Gesetz näher erläutert.
31 Der Titel der Studie lautet auf Deutsch Genossenschaftswesen, Non Profit und Sozialunternehmen: Wirtschaft und Arbeit. Die Untersuchungsergebnisse sind auf der Homepage des Verbandes veröffentlicht http://www.unioncamere.gov.it/download/3100.html (Zugriff 29.06.2018).
32 Das Modell der cooperative di comunità, wörtlich Genossenschaften der Gemeinschaft wird im Kapitel 8. Die Bürgergenossenschaften erläutert.
33 Vgl. Klemisch, H./ Vogt, W.: Genossenschaften und ihre Potenziale für eine sozial gerechte und nachhaltige Wirtschaftsweise, in: WISO Diskurs, November 2012, S. 38.
34 Vgl. Münkner, H.-H.: Rückblick auf das Internationale Jahr der Genossenschaften 2012, in: Vorträge und Aufsätze des Forschungsvereins für Genossenschaftswesen FGO in Wien.
https://genos.univie.ac.at/veroeffentlichungen/vortraege-und-aufsaetze (Zugriff 29.06.2018).
35 Die 1919 erfolgte Gründung der International Labour Organization I.L.O. geht auf die im Rahmen des Vertrages von Versailles vorgenommene geopolitische Neuordnung nach dem Ersten Weltkrieg zurück; sie war beim Völkerbund angesiedelt und sollte den Weltfrieden auf der Grundlage sozialer Gerechtigkeit sichern. Seit 1946 ist sie eine Sonderorganisation der UNO mit Sitz in Genf, ihre primäre Aufgabe ist die Ausarbeitung internationaler Arbeits- und Sozialstandards. Die aktuell 187 Mitgliedsstaaten entsenden Regierungsvertreter, Gewerkschafter und Beauftragte von Arbeitgeberorganisationen.
36 Die Empfehlung Nr. 127 vom 1. Juni 1966 enthielt eine Aufforderung an die Entwicklungsländer, die Rolle der Genossenschaften im Hinblick auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu fördern, die Empfehlung Nr. 193 vom 3. Juni 2002 richtet sich an alle Staaten und Regierungen.
37 Die UN-Resolution 66/288 vom 27. Juli 2012 Die Zukunft, die wir wollen erkennt ausdrücklich den Beitrag an, den Genossenschaften und Kleinstunternehmen zur sozialen Inklusion und zur Armutsminderung leisten. http://www.un.org/depts/german/gv-66/band3/ar66288.pdf (Zugriff 29.06.2018).
38 Vgl. Cooperative movement engagement in sustainable development and the post-2015 process.
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_248497/lang--ja/index.htm (Zugriff 29.06.2018).
39 Vgl. Genossenschaften als Schlüssel zur nachhaltigen Entwicklung
http://www.ilo.org/berlin/presseinformationen/WCMS_305892/lang--de/index.htm (Zugriff 29.06.2018).
40 Der Wortlaut der Empfehlung betreffend die Förderung der Genossenschaften ist veröffentlicht unter www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r193_de.htm (Zugriff 29.06.2018).
41 Die I.L.O. definiert in ihrer Empfehlung Nr. 193 die Genossenschaften als eine eigenständige Vereinigung von Personen, die sich freiwillig zusammengeschlossen haben, um durch ein in Gemeinschaftseigentum befindliches und demokratisch geleitetes Unternehmen ihre gemeinsamen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse und Bestrebungen zu erfüllen.
42 Siehe I.L.O.-Empfehlung Nr. 193, zweiter Abschnitt Politischer Rahmen und die Rolle der Regierungen.
43 Vgl. Rodrigues Guerra, R.: Inklusion und Teilhabe durch Arbeitnehmergenossenschaften, Wiesbaden, 2017, S. 46-67.
44 Siehe: http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc90/rep-iv-2a.htm (Zugriff 29.06.2018).
45 Siehe I.L.O.-Empfehlung Nr. 193, § 7, 2. Absatz: Solche Maßnahmen könnten u. a. und soweit möglich Steuervergünstigungen, Darlehen, Zuschüsse, Zugang zu Programmen für öffentliche Arbeiten und besondere Vorkehrungen im öffentlichen Beschaffungswesen einschließen.
46 Einzelne Sonderformen italienischer Genossenschaftsunternehmen, die der I.L.O.-Empfehlung in besonderem Ausmaß gerecht werden, werden in späteren Kapiteln im Detail erläutert.
47 Das Konsultationspapier Genossenschaften im Unternehmen Europa und alle eingegangenen Beiträge sind unter folgendem Link veröffentlicht:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:52004DC0018 (Zugriff 29.06.2018).
Die endgültige Mitteilung der Kommission über die Förderung der Genossenschaften in Europa trägt die Nummer KOM/2004/0018ist und ist unter folgendem Link veröffentlicht (Zugriff 29.06.2018).
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004DC0018&rid=1
48 Romano Prodi ist in der Provinz Reggio Emilia geboren, die eine Hochburg der italienischen Genossenschaftsbewegung ist. Der Wortlaut der Rede Mehrwert der Genossenschaften ist veröffentlicht unter: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-02-66_de.htm (Zugriff 29.06.2018).
49 Siehe: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0062+0+DOC+XML+V0//DE (Zugriff 29.06.2018).
50 Entschließung des EU-Parlaments (2012/2321(INI)) vom 2. Juli 2013: Beitrag der Genossenschaften zur Überwindung der Krise. (Zugriff 29.06.2018).
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013IP0301&rid=1
51 Siehe Kapitel 9.3. Cooperative Libera Terra.
52 Vgl. Ringle, G./Göler von Ravensburg, N.: Der genossenschaftliche Förderauftrag, in: WDP Wismarer Diskussionspapiere, 4/2010, S. 40-41. www.fww.hs-wismar.de/forschung-kooperationen/veroeffentlichungen/wismarer-diskussionspapiere/jahrgang-2010 (Zugriff 29.06.2018).
5. Die Entstehung der italienischen Genossenschaftsbewegung
Genossenschaften haben eine lange Geschichte, die bis zur industriellen Revolution zurückreicht, sind aber kein Überbleibsel aus dem 19. Jahrhundert.53
Mit dieser Aussage setzt die EU den Beginn der modernen Genossenschaftsbewegung richtigerweise in die Mitte des 19. Jahrhunderts und stimmt damit weitgehend mit der historischen Aufarbeitung der ersten kooperativen Ansätze überein.
Aus italienischer Sicht muss jedoch, der Vollständigkeit halber, auch ein früherer Ansatz zu genossenschaftsähnlichen Zusammenschlüssen erwähnt werden, den Historiker bereits im antiken Rom verzeichnen. Dort haben sich schon im Altertum freie Bürger als Angehörige gleicher Berufe zu Collegien zusammengeschlossen, zum Beispiel um gemeinsam militärische Ausrüstungen zu produzieren oder den komplexen Getreideimport aus den Provinzen nach Rom abzuwickeln, aber vor allem um bei großen Veranstaltungen die Verköstigung der Zuschauermassen nach dem Prinzip Brot und Spiele zu übernehmen.54
Diese Vereinigungen sind vielfach vom römischen Senat gefördert worden, weil sie das Funktionieren des Staates in jenen Bereichen gewährleisteten, die dieser allein nicht bewältigen konnte. Gerade diese Subsidiarität im effizienten römischen Imperium erscheint aus heutiger Sicht bemerkenswert, da sie zwei Jahrtausende später im internationalen Vergleich immer noch eine relevante Eigenart des italienischen Genossenschaftswesens darstellt, die noch näher erläutert werden wird.
5.1. Die ersten Genossenschaftsgründungen in Italien
Die Gründung der ersten Genossenschaften in der Neuzeit findet in Italien fast zeitgleich mit anderen europäischen Ländern statt, wenn auch vielfach in Unkenntnis der ausländischen, vor allem englischen Erfahrungen. Es sind in erster Linie Konsum- und Produktionsgenossenschaften, die nach dem gegenseitigen Solidaritätsprinzip ihre Mitglieder bei der gemeinsamen Bewältigung elementarer Probleme, wie steigende Lebenshaltungskosten und Arbeitslosigkeit, unterstützen.
Zaghafte Liberalisierungstendenzen begünstigen im damals noch geteilten Italien die zahlenmäßige Entwicklung von Genossenschaften zum Schutz minderbemittelter Gesellschaftsgruppen, die ungeschützt den großen sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen ausgesetzt sind. Entsprechend dem Identitätsprinzip sind die Mitglieder gleichzeitig Miteigentümer und Kapitalgeber, aber auch Entscheidungsträger in der Vollversammlung und schließlich Geschäftspartner als Abnehmer oder Lieferanten.
Die Albertinische Verfassung55 schafft im Jahre 1848 klare normative Rahmenbedingungen, indem erstmals das Recht auf freie Vereinsbildung gewährt wird und somit neue, auf kollektiver Selbsthilfe basierende Organisationsformen entstehen können. Das Statut ist die erste Verfassung in einem Reich auf italienischem Boden und hat bewirkt, dass auch die ersten Genossenschaftsgründungen im Königreich Piemont-Sardinien erfolgt sind. 1854 entsteht in Turin die erste Konsumgenossenschaft56 und zwei Jahre später in Altare, in der Provinz Savona, die erste Produktionsgenossenschaft für die Verarbeitung von Kunstglas.57





























