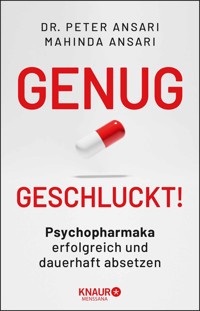
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur MensSana eBook
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Raus aus der Medikamentenfalle – Wege, Informationen und Tipps zum erfolgreichen Absetzen von Psychopharmaka Anhaltende Schlaflosigkeit, Panikattacken, Brainzaps, innere Unruhe, Psychosen: Psychopharmaka-Entzug gehört zum Schlimmsten, was ein Mensch erleben kann. Vor allem, weil es die Menschen unvorbereitet trifft und sie mit ihren Schwierigkeiten völlig allein sind. Das Thema "Absetzen" ist bisher noch nicht im medizinischen Alltag angekommen. Menschen, die ihre Medikamente reduzieren oder absetzen möchten, erhalten kaum Hilfe und nur wenig Informationen. Sie setzen ihre Medikamente viel zu schnell ab und geraten dadurch in entsetzliche Krisen. Die Absetzexperten Dr. Peter Ansari und Mahinda Ansari setzen auf einen Sanften Entzug. Sie wissen aus jahrelanger Erfahrung, dass nur ein sehr langsames, schrittweises Reduzieren zum Erfolg führt. Ihr Ratgeber zeigt ganz genau, wie es funktioniert. Er enthält individualisierbare Absetzpläne, weist auf Schwierigkeiten hin und erklärt, was nach dem erfolgreichen Absetzen zu beachten ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Dr. Peter Ansari / Mahinda Ansari
Genug geschluckt!
Psychopharmakaerfolgreich und dauerhaft absetzen
Mit Illustrationen von Anna Ansari
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Raus aus der Medikamentenfalle – Wege, Informationen und Tipps zum erfolgreichen Absetzen von Psychopharmaka
Anhaltende Schlaflosigkeit, Panikattacken, Brainzaps, innere Unruhe, Psychosen: Psychopharmaka-Entzug gehört zum Schlimmsten, was ein Mensch erleben kann. Vor allem, weil es die Menschen unvorbereitet trifft und sie mit ihren Schwierigkeiten völlig allein sind. Das Thema „Absetzen“ ist bisher noch nicht im medizinischen Alltag angekommen. Menschen, die ihre Medikamente reduzieren oder absetzen möchten, erhalten kaum Hilfe und nur wenig Informationen. Sie setzen ihre Medikamente viel zu schnell ab und geraten dadurch in entsetzliche Krisen.
Die Absetzexperten Dr. Peter Ansari und Mahinda Ansari setzen auf einen Sanften Entzug. Sie wissen aus jahrelanger Erfahrung, dass nur ein sehr langsames, schrittweises Reduzieren zum Erfolg führt. Ihr Ratgeber zeigt ganz genau, wie es funktioniert. Er enthält individualisierte Absetzpläne, weist auf Schwierigkeiten hin und erklärt, was nach dem erfolgreichen Absetzen zu beachten ist.
Inhaltsübersicht
Widmung
Zum Anfang
1. Bittere Pillen
Pillenmedizin auf dem Prüfstand
2. Wege
Was ist psychisch krank?
Psychiatrische Diagnosen
Leben mit einer psychischen Krankheit
Leben mit Angst und Panikattacken
Leben mit Depressionen
Leben mit Trauer
Leben mit Zwängen
Leben mit Psychosen
Leben mit bipolarer Erkrankung
Leben mit Schizophrenie
Leben mit Fehlbehandlung
Leben im Entzug
3. Informationen und Tipps
Psychopharmaka
Biochemie
Serotonin
Antidepressiva
ADHS-Medikamente
Lithium
Retardpräparate
Generika
Fehlbehandlungsrisiko
Hochsensibilität
Kinder und Jugendliche
Burnout
Rückenschmerzen
Wechseljahre
Senioren
Notsituationen
Psychiatrische Kliniken
Schwere Verläufe
Suizid
Behandlung
Psychoanalyse
Einmalmethode
Niedrigdosis, Monotherapie und Bedarfsmedikation
Entzug
Zeitverzögerte Entzugssymptome
Der Gewöhnungseffekt
Entzugskrisen
4. Sanfter Entzug
Absetztreppen
Exakt
Einfach
Für Eilige
Besonders sicher
Dosierungen
Medikamente als Tropfen
Tablettenschneiden
Die mfc-Methode
Tapering-Strips
Kugelzählmethode
Wasserlösemethode
5. Alternativen
Pflanzliche Unterstützung
Ginseng
Ginkgo
Johanniskraut
Rosenwurz
Maca
Baldrian
Melisse
Hopfen
Lavendel
Passionsblume
Ashwagandha
Nahrungsergänzung
Omega-3-Fettsäuren
Vitamin D3
Vitamin B12
Eisen
L-Tryptophan
5-HTP
Magnesium
Bitterstoffe
Psychotherapie
Psychosoziale Hilfen
Sport
Entspannungstechniken
Yoga
Progressive Muskelentspannung
Autogenes Training
Tai Chi
Qi Gong
Meditation
Kreative Therapien
Musik
Massagen
Lichttherapie
Soziale Kontakte
Schutz vor zu vielen Reizen
Spiritualität
6. Fragen und Antworten
Übersicht
Absetzen?
1. Wie kann ich Krankheitssymptome von Absetzsymptomen unterscheiden?
2. Mit welchen Problemen muss ich beim Absetzen rechnen?
3. Warum sind Psychopharmaka oft wirkungslos und machen trotzdem große Schwierigkeiten beim Absetzen?
4. Hat jeder, der Psychopharmaka absetzt, diese Schwierigkeiten?
5. Ich bin durch das Absetzen in Zustände geraten, die ich nicht mehr aushalten kann. Soll ich die Medikamente wieder einnehmen?
6. Was muss ich beachten, wenn ich Psychopharmaka absetzen möchte?
7. Ich will meine Medikamente absetzen. Gibt es außer der empfohlenen 10-Prozent-Methode noch andere Möglichkeiten?
8. Sind das nach mehreren Monaten ohne Tabletten immer noch Entzugssymptome?
9. Kann ich während des Entzuges arbeiten?
10. Gibt es Gründe, die gegen einen Absetzversuch sprechen?
Arzt?
11. Mein Arzt sagt, ich muss die Medikamente ein Leben lang einnehmen. Wie ist das einzuschätzen?
12. Können Sie mir einen Arzt oder eine Klinik empfehlen?
13. Was soll ich tun, wenn meine Krankenkasse/mein Arbeitgeber/mein Betreuer/mein Psychiater/der Amtsarzt mich zur Medikamenteneinnahme zwingen will?
Medikamente?
14. Ich nehme Psychopharmaka und habe sexuelle Funktionsstörungen. Sind diese dauerhaft?
15. Ich nehme Psychopharmaka – bin ich süchtig?
16. Ich nehme seit vielen Jahren Psychopharmaka und bin immer weniger belastbar geworden. Liegt das an den Medikamenten?
17. Ich habe das Gefühl, die Medikamente vergiften mich. Ist da etwas dran?
18. Raten Sie auch manchen Menschen, die Medikamente weiter einzunehmen?
19. Ist es sinnvoll, ein neues Medikament auszuprobieren, wenn das alte nicht wirkt?
Methoden?
20. Was hilft bei Schlaflosigkeit?
21. Kann man allein über die Ernährung eine psychische Erkrankung bessern?
22. Was hilft bei Depressionen, wenn ich keine Antidepressiva einnehmen möchte?
23. Was muss ich nach dem erfolgreichen Absetzen beachten?
Zum Schluss
Danke
Anhang
Literatur
Für alle Menschen, die sich beim Absetzen ihrer Medikamente allein gelassen fühlen.
Zum Anfang
Die psychiatrische Wissenschaft steckt noch in der Unwissenheit des tiefsten Mittelalters fest. Damals glaubte man, ein Ungleichgewicht der Körpersäfte sei für seelische Erkrankungen verantwortlich. Heute soll ein Ungleichgewicht der Botenstoffe diese Erkrankungen verursachen. Beide Theorien sind veraltet und widerlegt. Und dennoch werden Millionen von psychiatrischen Patienten dauerhaft mit Medikamenten behandelt, die ein imaginäres Ungleichgewicht im Gehirn beseitigen sollen. Es wird behauptet, diese Medikamente verursachen keine Abhängigkeit und seien leicht abzusetzen. Das widerspricht jedoch den Erfahrungen unzähliger leidender Menschen, die von ihren Psychopharmaka abhängig geworden sind und sie nicht mehr loswerden. Sie alle fühlen sich allein gelassen in einer Welt, in der ihr Leid hartnäckig geleugnet wird.
Dieses Buch beschäftigt sich mit Methoden zum Absetzen von Psychopharmaka. Dies entspricht dem Bedürfnis der Patienten, aber nicht dem medizinischen Alltag. Das Thema ist bisher weder in den Arztpraxen noch in den Kliniken dieses Landes angekommen. Die Bezeichnung »Entzug« darf nur in Zusammenhang mit Tranquilizern und Schlafmitteln verwendet werden. Entzug von Neuroleptika, Lithium, ADHS-Medikamenten und Antidepressiva existiert in den Handbüchern der Medizin schlichtweg nicht.
Bereits beim Verfassen unseres Buches Unglück auf Rezept, in dem wir über die Gefahren von Antidepressiva aufklären, war uns klar, dass wir den Menschen irgendwann auch einen Weg aufzeigen müssen, wie sie von den Medikamenten wieder loskommen.
Seit dem Erscheinen der ersten Auflage im Jahr 2016 sind wir ausschließlich mit der Begleitung von Patienten im Psychopharmaka-Entzug beschäftigt. Diese Erfahrungen geben wir im Folgenden weiter. Im Kapitel 6 finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen, die uns hierzu immer wieder gestellt werden.
Wir sind keine Gegner von Psychopharmaka. Eine kurzfristige Verschreibung kann durchaus sinnvoll sein, wir warnen aber vor einer Dauermedikation. Denn jede Verschreibung benötigt eine Befristung und ein therapeutisches Ziel, das erreicht werden soll.
Dieses Buch ist auch keine Aufforderung, alle Medikamente sofort abzusetzen. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist eine Warnung davor, dies unüberlegt und schnell zu tun. Das Absetzen von Psychopharmaka kann schwerste Krisen auslösen. Wir beschreiben, wie man diese am besten umgeht. Ein sehr langsames, schrittweises Reduzieren ist dabei der sicherste Weg, insbesondere wenn man die Medikamente über Jahre eingenommen hat. Die Betroffenen sollten sich dafür Unterstützung suchen – auch darüber schreiben wir in diesem Buch.
Die Medikamente abzusetzen bedeutet nicht gleich, die ganze Krankheit losgeworden zu sein. Deswegen zeigen wir im Kapitel 2 einen möglichen Umgang mit den verschiedenen Krankheitsbildern auf und erklären, was wirklich hinter einer psychischen Krankheit steckt. Es geht dabei nicht darum, diese Krankheiten zu definieren. Das ist mit unserem heutigen Wissen, unserer Meinung nach, auch gar nicht möglich.
Wir wollen seelisches Leid nicht verharmlosen. Aus eigener schmerzhafter Erfahrung wissen wir, wie schwer es auszuhalten ist und wie stark es das Leben verändern kann. Unser Anliegen ist vielmehr, psychischen Krankheiten den Schrecken zu nehmen. Dazu ist es notwendig, sie aus der Ecke der Unheilbarkeit herauszuholen. Das Wissen darüber, wie man die Medikamente absetzt, ist der Schlüssel dazu.
Der Weg zur Medikamentenfreiheit ist einzigartig und höchst persönlich. Deswegen haben wir diesmal auf Fallbeispiele verzichtet. Sie wären nur bedingt hilfreich. Wir müssen unseren eigenen Weg raus aus der Medikamentenfalle finden.
Möge dieses Buch Sie dabei unterstützen.
Herzlichst
Dr. Peter und Mahinda Ansari
1Bittere Pillen
Pillenmedizin auf dem Prüfstand
In Europa und in den Vereinigten Staaten sind Medikamente die dritthäufigste Todesursache nach Herzerkrankungen und Krebs.1 Die Menschen sterben an Unverträglichkeiten, an Über- oder Unterdosierungen oder an Wechselwirkungen. Verschreibungspflichtige Medikamente töten in Deutschland jährlich 58000 Menschen.2 Das sind zwanzigmal so viele, wie im Straßenverkehr sterben.3 Die Dunkelziffer ist bedeutend höher, denn die Ursache der meisten Todesfälle bleibt für den Arzt, die Öffentlichkeit und die Behörden verborgen. Nicht weniger bitter sind die 500000 Notaufnahmen durch Medikationsfehler, die sich nach Schätzungen des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte jährlich in Deutschland ereignen.4 Mindestens eine Million Klinikaufenthalte sind die Folge unerwünschter Nebenwirkungen.
Industriell gefertigte Tabletten als Massenprodukt gibt es erst seit knapp 140 Jahren, heute dominieren sie die Gesundheitskultur. Wer krank ist, muss Pillen schlucken. 749 Millionen Arzneimittelpackungen bekamen die gesetzlich Versicherten in Deutschland im Jahr 2020 verordnet.5 Für jeden Versicherten täglich etwa 1,5 Tabletten. Dazu wurden im selben Jahr noch 701 Millionen Packungen rezeptfreier Arzneimittel verkauft.
Wir werden so überschwemmt von Pillen, dass ihre Rückstände unser Trinkwasser verseuchen. Wenn Wissenschaftler das Trinkwasser westlicher Länder untersuchen, finden sie dort stets Rückstände von Medikamenten, vor allem von Antibiotika und Antidepressiva. Die Kläranlagen können diese gar nicht oder nur unvollständig herausfiltern.
Für die Pillenflut sind verschiedene Faktoren verantwortlich. Ärzte wissen, wie sie Medikamente verschreiben, aber nicht, wie diese wieder abgesetzt werden. Das wird besonders bei älteren Menschen deutlich. Je länger ein Mensch lebt, desto mehr Medikamente bekommt er verordnet. Bei über 70-Jährigen sind Dauertherapien mit acht bis zehn Medikamenten pro Tag normal. Dadurch kommt es zu Einschränkungen der Nierenfunktion. Heute sind bereits zwei Drittel der Bewohner von Pflegeheimen nierenkrank.6
Die Pillen werden nicht abgesetzt, und mit der Verschiebung von Grenzwerten werden immer neue Patienten geschaffen. Dieses Spiel wird seit einigen Jahrzehnten in vielen Bereichen der Medizin praktiziert. Im Jahr 2018 wurden in den USA die Grenzwerte für Bluthochdruck gesenkt. Dadurch wurden über Nacht 35 Millionen gesunde Bürger zu behandlungsbedürftigen Bluthochdruck-Patienten.7
Das Gleiche passierte mit den Cholesterinwerten, dem behandlungsbedürftigen Übergewicht und den Blutzuckerwerten. So wurde der Blutzucker-Grenzwert, der zwischen gesund und krank unterscheidet, um 10 Prozent abgesenkt, wodurch viele Millionen Menschen zu »Zuckerkranken« wurden. Anscheinend reichte diese Erhöhung des Patientenstammes nicht aus, denn kurz darauf erfanden Diabetologen eine neue Diagnose namens »Prädiabetes«. Damit ist es möglich, »risikobewussten« Menschen weit unterhalb des alten Grenzwertes dauerhaft blutzuckersenkende Medikamente zu verschreiben. Medikamente sind ein florierendes Geschäft, mit dem sehr viel Geld verdient wird. Im Jahr 2020 wurden damit allein in Deutschland 61,4 Milliarden Euro umgesetzt.8 Es gelingt nicht, die Ausgaben für Medikamente einzudämmen. Sie steigen von Jahr zu Jahr an. Die Pharmaindustrie tut das Ihrige, um die Pillenflut auf immer neue Höchststände anschwellen zu lassen. Sie erzwingt die Zulassung potenziell schädlicher Medikamente mit gefälschten Studien und besticht Ärzte. Dafür hat nahezu jedes große Pharmaunternehmen schon Strafen in Milliardenhöhe kassiert.9 Medikamentenstudien sind sehr teuer und werden deshalb fast ausschließlich von den Pharmafirmen selbst angefertigt. Natürlich wollen sie ihre Produkte in möglichst gutem Licht darstellen. Deswegen existieren keine Studien zu Wechselwirkungen und zu schädlichen Folgen einer Dauermedikation. Die Untersuchungen zur Nützlichkeit von Medikamenten verlaufen in der Regel nur sechs Wochen bis drei Monate. Ohne dass es also einen Nachweis über einen langfristigen Nutzen gibt, werden viele dieser Medikamente über Jahre verschrieben.10 In der Pharmaforschung werden auch keine vorerkrankten Menschen oder über 65-Jährige berücksichtigt. Das ist sicherlich einer der Hauptgründe für die vielen Todesfälle durch Medikamente.11
Der natürliche Wunsch des Menschen, sein Leiden einfach mit einer Tablette zu beenden, lässt den Medikamentenpegel noch weiter ansteigen. Manche schlucken lieber Pillen, als gesunde Lebensweisen zu etablieren. Viele Krankheiten ließen sich durch Ernährungsumstellung, mehr Bewegung oder regelmäßige Ruhe- und Entspannungsphasen kurieren. Aber es kostet Zeit, Geduld und Kraft, sich aus ungesunden Verhaltensmustern zu befreien.
Medizin ist, was die Krankenkassen bezahlen. Ein ausführliches Gespräch über gesunde Lebensführung kann der Arzt nicht abrechnen. Schnell ein Rezept auszustellen lohnt sich für ihn mehr. Damit kann man bestenfalls Symptome lindern, aber keine Ursachen beseitigen. Viele Krankheiten erklären sich aus der Lebenssituation des Patienten, doch die bleibt bei dem nur wenige Minuten dauernden Arztgespräch in der Regel unberücksichtigt. Das veranschaulicht die folgende Anekdote:
Ein Arzt ruft bei seinem Klempner an. »Ich habe einen Notfall. Mein Keller steht unter Wasser«, klagt er.
Der Klempner antwortet: »Ich habe in den nächsten vierzehn Tagen keinen Termin mehr frei. Bitte melden Sie sich später wieder.«
Der Arzt reagiert empört: »Aber ich habe doch vor Kurzem Ihre Schwiegermutter noch als Notfall in meiner Praxis behandelt.«
Der Klempner lässt sich überreden und fährt zur Villa des Arztes. Der öffnet ihm erleichtert die Tür und führt ihn direkt zum Keller. Der Klempner bleibt oben an der Treppe stehen und sieht hinab. Das Wasser steht mindestens 50 Zentimeter hoch. Er greift in seine Werkzeugtasche, zieht zwei Dichtungsringe heraus, wirft sie ins Wasser und sagt zum Arzt: »Wenn es nicht besser wird, melden Sie sich in vierzehn Tagen noch mal bei mir.«
Ähnlich wie die Dichtungsringe werfen wir Pillen in ein Geschehen, das wir nicht verstehen und dessen Ursachen wir nicht kennen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Dichtungsringe ihren Weg zum Leck finden und es verschließen. Vielleicht sind sie nicht einmal das Problem. Genauso unwahrscheinlich ist, dass Tabletten ihren Weg zur Krankheitsursache finden und diese einfach beheben. Die meisten Tabletten sind überflüssig. Nach Einschätzung der Weltgesundheitsbehörde WHO sind nur 0,4 Prozent von den über 103000 erhältlichen Arzneimitteln unverzichtbar.12
Brauchen wir die ganzen Medikamente also gar nicht, sondern eher ein Umdenken?
Wenn wir nicht in der riesigen Medikamentenwelle untergehen wollen, müssen wir uns zurück zur Quelle bewegen. Zu einer Medizin, in der es wieder um den Menschen geht und Medikamente nicht mehr überschätzt werden. Wir müssen uns daran erinnern, dass fast jede Tablette mit der Zeit wirkungslos wird. Der Körper kann die Medikamentenwirkung abschwächen oder aufheben. Er kann gegenläufige Prozesse aktivieren oder die Ausscheidung des Wirkstoffs verstärken. Aus diesen Gründen benötigt jede Verordnung wie gesagt eine Befristung.
Wir wissen eigentlich: Wer wenig oder keine Medikamente einnimmt, lebt gesünder und bewertet seine Lebensqualität höher. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass sich sogar das hilfreichste Medikament bei Dauergebrauch gegen den Konsumenten wenden und ihm Schaden zufügen kann.
Jahrein, jahraus Medikamente einzunehmen hat wenig mit Kranksein, aber viel mit Abhängigkeit zu tun. Besonders schmerzhaft ist die Abhängigkeit von Psychopharmaka. Um sich daraus zu befreien, ist es wichtig, der Krankheit den Schrecken zu nehmen und zu lernen, mit ihr zu leben.
2Wege
Was ist psychisch krank?
Es ist nahezu unmöglich, eine Grenze zwischen normalem menschlichem Verhalten und krankhaftem zu ziehen. Die Bandbreite menschlicher Verhaltensweisen ist unbegrenzt. Der berühmte Psychiater und Forscher Allen Frances formuliert das so: »Psychische Störungen und Normalität sind beide poetische Begriffe – so gestaltlos, verschiedenartig und wandelbar, dass wir niemals in der Lage sein werden, eine klare Grenze zwischen ihnen zu ziehen.«13
Vor einigen Jahren wollten Forscher einen Faktor finden, der allen psychisch kranken Menschen gemeinsam ist. Sie erhofften sich, dadurch einen neuen Ansatzpunkt für die Behandlung zu finden. Ein solcher Faktor wurde nicht gefunden.14 Psychische Krankheiten zogen sich durch alle Epochen der Menschheit, fanden sich in jedem Teil der Welt, in jeder Gesellschaftsschicht und jedem Alter. Lediglich eine einzige Gemeinsamkeit konnten die Experten entdecken, und das war: soziale Isolierung. Sie scheint nicht nur eine Begleiterscheinung psychischer Krankheiten zu sein, sondern diese gleichzeitig zu bedingen. Anstelle von Medikamenten scheinen Patienten Nähe und Fürsorge anderer Menschen zu benötigen.
Ein Modell, das seit Jahrzehnten zur Erklärung von psychischen Erkrankungen herangezogen wird, ist die erhöhte Vulnerabilität. Der Begriff leitet sich vom lateinischen vulnus für »Wunde« ab und bedeutet »Verwundbarkeit« oder »Verletzbarkeit«. Menschen mit einer hohen Vulnerabilität werden unter Stressbelastung schneller krank als solche mit einer niedrigen Vulnerabilität. Nach diesem Modell gelten Menschen mit psychischen Erkrankungen als leichter verletzbar als andere Menschen.
Im Grunde kann man sich fragen, ob es überhaupt richtig ist, im Zusammenhang mit seelischem Leid von Krankheit zu sprechen. In der somatischen Medizin existieren für die meisten Erkrankungen deutlich abgrenzbare Unterschiede zwischen dem Kranken und dem Gesunden. Es gibt einheitliche Symptome sowie Therapien, die bei allen Patienten ähnlich wirken. Der Beginn, der Verlauf und die Dauer bis zur Genesung sind absehbar. In der psychiatrischen Medizin ist das anders. Die Symptome, unter denen die Patienten leiden, sind sehr unterschiedlich und die Krankheitsverläufe nicht prognostizierbar. Die psychiatrischen Mediziner wissen nicht einmal, ob und wie ihre Medikamente wirken. Wenn man vom Faktor der Hilfebedürftigkeit des Kranken absieht, gibt es kein Kriterium, das den Begriff der Krankheit rechtfertigt.
Der Dalai Lama hat fast die gesamte Welt bereist. Immer wieder thematisiert er die Zunahme von psychischem Leid in der westlichen Welt. Im kargen Tibet geboren, beschäftigt er sich in vielen Schriften damit, warum Menschen, die alles haben, so unglücklich sind. Er berichtet von einem seiner Besuche im Westen:
»Ich war bei einer sehr reichen Familie zu Gast, die in einem großen, gut ausgestatteten Haus lebte. Alle waren ganz reizend und zuvorkommend zu mir. Das Dienstpersonal las einem jeden Wunsch von den Augen ab, und in mir wuchs allmählich das Gefühl, dass dies hier vielleicht der Beweis dafür war, dass Reichtum eben doch eine Quelle für Glück sein könnte. Meine Gastgeber strahlten immer entspannte Zuversicht aus, doch als ich in einem Badezimmer hinter einer halb geöffneten Schranktür eine ganze Ansammlung von Beruhigungs- und Schlafmitteln entdeckte, wurde mir wieder schmerzhaft bewusst, dass zwischen dem äußeren Schein und der inneren Wirklichkeit eine große Lücke klafft.«15
Wer von außen betrachtet »normal« und glücklich wirkt, leidet unter denselben Schwierigkeiten wie alle anderen. Warum wird ansonsten der ehemals schönste Mann der Welt, der eine bezaubernde Frau und sechs Kinder hat und auch beruflich zu den erfolgreichsten Menschen der Welt gehört, zum Alkoholiker? Warum erhängt sich ein beliebter Schauspieler und Komiker, der zuvor noch wegen seines sozialen Engagements gefeiert wurde, in seinem Wohnhaus mit einem Bademantelgürtel?
Bei genauer Betrachtung ist eine psychische Krankheit eigentlich nichts anderes als eine empfindsamere Reaktion auf das Leben, die eine Eigendynamik entwickelt hat. Warum soll man Menschen, die seelische Qualen durchleiden, das Leben noch schwerer machen, indem man ihnen einredet, sie seien chronisch krank?
Viel hilfreicher wäre es, die Aufmerksamkeit auf die vielen Jahre seelischer Gesundheit zu lenken, die jeder Mensch durchlebt, und darauf, dass das Leid vorübergehen wird. Dem Kranken würde eine Zentnerlast von den Schultern fallen, Angst und Verzweiflung wäre der Boden entzogen, und die Wunden könnten schneller verheilen.
Die Autorin und Psychologin Arnhild Lauveng hatte schon in ihrer Jugend die Diagnose »Schizophrenie« erhalten. In ihrem Buch Morgen bin ich ein Löwe beschreibt sie, wie sie sich zuerst von den Medikamenten und dann aus dem krank machenden Medizinsystem befreit:
»Als ich krank wurde, sagte man mir, die Krankheit sei chronisch und ich würde nie wieder gesund werden. Im Laufe der Krankheit wurde das noch oft wiederholt … Ich weiß, dass mir der ständige Fokus auf die Hoffnungslosigkeit geschadet hat.«16
Psychische Krankheiten sind qualvoll und kaum auszuhalten. Der Betroffene erlebt eine unglaubliche Verlagerung seines Daseins in den Kopf. Sein Gedankenapparat hat sich selbstständig gemacht und die Kontrolle übernommen. Es ist dem Kranken unmöglich, bei dem zu sein, was im gegenwärtigen Moment geschieht. Hilflos ist er seinen Gedanken und den Ausgeburten des Verstandes ausgeliefert.
Psychisch krank zu werden ist der Anfang einer langen Reise. Der Reise zu uns selbst und zur Entmachtung unseres Verstandes, die wir alle antreten müssen, wenn wir wirklich inneres Glück und inneren Frieden erleben möchten.
Psychiatrische Diagnosen
Wenn es nicht möglich ist, eine Grenze zwischen »normalem« und »krankem« Verhalten zu ziehen, dann ist es logischerweise genauso wenig möglich, psychiatrische Diagnosen zu vergeben. Manche sind sogar schädlich, da sie zur Pathologisierung von normalem menschlichem Verhalten führen. Daher haben wir Diagnosen wie zum Beispiel »Bipolar II«, »Borderline«, »Zyklothymia« nicht berücksichtigt.
In diesem Buch orientieren wir uns an den konventionellen Bezeichnungen, sind uns aber bewusst, wie wenig passend diese oft sind und wie stark sie sich im Verlaufe eines Lebens ändern können. Die Zusammenstellung der psychischen Krankheiten in diesem Kapitel ist natürlich nicht vollständig. Wir haben uns auf häufige Diagnosen beschränkt. Die Beschreibung von psychischen Krankheiten ist ein unmögliches Unterfangen. Darum geht es in diesem Kapitel auch nicht. Und wie gesagt: Die Medikamente loszuwerden bedeutet nicht, automatisch auch die Krankheit loszuwerden. Es geht uns daher nicht um die Beschreibung von Krankheiten, sondern um den langfristigen Umgang damit – das Leben mit einer psychischen Krankheit.
Wenn wir die Betroffenen beispielsweise als »Schizophrene« oder »Manisch-Depressive« bezeichnen, bedienen wir eine Konvention, die ihnen sicherlich nicht gerecht wird. Es ist eine Verlegenheitslösung, die die Menschen nicht auf ein Krankheitsbild reduzieren soll. Anders ist es jedoch nicht möglich, eine Hilfestellung für Menschen zu leisten, die diese Diagnose erhalten haben.
In Westfinnland wird seit 45 Jahren das erfolgreichste Psychiatriekonzept der Welt praktiziert. Es heißt »Open Dialogue« und basiert auf einem intensiven Akutprogramm.17 In diesem Teil von Finnland gibt es kaum schwere Verläufe von psychisch Erkrankten. Das Projekt hat die höchste Wiedereingliederungsquote von ehemals psychisch Erkrankten in den Arbeitsmarkt. Beim »Open Dialogue« wird frühestens nach einem halben Jahr eine Diagnose vergeben, oft wird auch ganz darauf verzichtet. Erstaunlicherweise hat man dabei erfahren, wie gut psychiatrische Behandlungen ohne Diagnosen auskommen. Es wird symptomatisch behandelt, das bedeutet, man versucht, die Symptome zu lindern, die auftreten, ohne das Ganze in ein passendes Diagnoseschema zu stopfen.
Das wird dem Umstand gerecht, dass sich die menschliche Psyche wandelt und verändert. Viele Patienten verändern sich durch die Einnahme von Medikamenten so sehr, dass die ursprüngliche Diagnose nicht mehr passt. Auch durch eine Psychotherapie oder durch neue Lebensumstände kann sich der Mensch verändern. Eine Diagnose verbleibt ein Leben lang in den Akten. Sie ist nur dann sinnvoll, wenn eine gezielte Therapie zur Verfügung steht. In der psychiatrischen Behandlung wird mit Psychopharmaka behandelt. Die sind alles andere als eine gezielte Therapie. »Psycho-Pharmaka« bedeutet »Arzneien für die Psyche«. Die Psyche kann aber mit Medikamenten gar nicht erreicht werden. So widersprüchlich der Begriff ist, so zweifelhaft ist auch die Wirkung dieser Mittel. Kein Psychiater kann erklären, wie die Medikamente wirken und wie ein Patient darauf reagieren wird.
Die Vergabe einer Diagnose verlagert die psychiatrische Behandlung in einen übersichtlichen, aber fiktiven somatischen Raum, den sie in Zukunft eigentlich verlassen muss.
Leben mit einer psychischen Krankheit
Die gute Nachricht ist, mit einer psychischen Krankheit kann man sehr gut leben und ein erfülltes Leben genießen. Es ist nicht gesagt, dass vermeintlich psychisch Gesunde unbedingt glücklicher und erfolgreicher sind als vermeintlich psychisch Kranke. Nach dem Durchleben einer krankhaften Episode bleiben bei den meisten Betroffenen keine Schäden zurück. Die schlechte Nachricht ist, psychische Krankheiten dauern lange. Sie sind langwieriger als körperliche Erkrankungen und völlig unpraktisch. Während man bei einer Grippe ungefähr abschätzen kann, wann man wieder am Leben teilhaben wird, wirft einen eine psychische Erkrankung erst mal aus dem Leben heraus. Denn eine Episode kann mehrere Monate anhalten. Und wie so oft gilt: Ist die Krankheit erst einmal ausgebrochen, kann sie wiederkommen.
Fast jede psychische Erkrankung entwickelt sich auf derselben Basis: Der Mensch möchte die Dinge anders haben, als sie sind. So, wie sich sein Leben oder Teile seines Lebens gestalten, wird es von ihm abgelehnt.
Beim Menschen, der zu Depressionen neigt, ist das besonders deutlich zu erkennen. Die Dinge laufen nicht so, wie er sich das wünscht, er erfährt Schmerzen und rutscht in Negativitäten ab. Irgendwann entwickeln diese Negativitäten ein reges Eigenleben und stellen sich gern auch ohne ersichtlichen Auslöser ein. Es entstehen im Gehirn regelrechte Autobahnen mit negativen Gedankenmustern. Der Autor und Betroffene Kester Schlenz schreibt darüber in seinem Buch Ich bin bekloppt … und ich bin nicht der Einzige: »Die Angst hatte in meinem Gehirn gut ausgebaute gedankliche Autobahnen errichtet, auf denen sie mit einem Porsche raste, wann immer es ihr passte.«18
Bei einem Menschen, der die Fähigkeit zum Wahn hat, ist es nicht anders. Jeder Geist ist zu seinem eigenen Schutz mit der Fähigkeit ausgestattet, die schmerzhaft erlebte Realität zu verlassen und in andere Welten einzutauchen. Diese Fähigkeit wird »Wahn« oder »Schizophrenie« genannt. Werden traumatische oder stark kränkende Situationen erlebt, die der Geist nicht verarbeiten kann oder will, flieht er in eine andere Welt, in der dieser Schmerz ausgeblendet ist.
Auch Panikattacken sind, solange sie nicht entzugsbedingt entstehen, ein Zeichen dafür, dass traumatische Erlebnisse nicht richtig verarbeitet wurden und sich jetzt ihren Weg an die Oberfläche bahnen.
Angststörungen werden vom Betroffenen häufig abgelehnt, da sie nicht kompatibel sind mit den Anforderungen der modernen Gesellschaft. Aus diesem Widerstand gegen die Angst entwickelt sich häufig eine Depression.
Die Manie ist eine Möglichkeit des Geistes, sich trotz unbefriedigender Lebensumstände euphorisch, selbstbewusst und glücklich zu fühlen.
Auch Zwangsgedanken und -handlungen sind bei genauerer Betrachtung nichts anderes als eine Möglichkeit des Geistes, von erlittenen Schmerzen abzulenken und diese durch umfassende, alles überlagernde Gedankenschleifen so lange zu ersetzen, bis nichts anderes mehr Bestand hat.
Bei Suchterkrankungen ist allgemein bekannt, dass sie nichts anderes sind als eine Flucht vor bedrückenden Lebenssituationen.
Es handelt sich also bei jeder psychischen Erkrankung um eine zugegebenermaßen ungeschickte Strategie des Geistes zur Schmerzvermeidung. Was ursprünglich als Hilfe des Geistes gedacht war, entwickelt im Laufe der Zeit leider oftmals eine unliebsame Eigendynamik.
Wenn wir lernen, den Schmerz nicht zu vermeiden, sondern auszuhalten, können wir erkennen, dass unser Schmerz ein Hinweis ist auf etwas, das in uns freigelegt werden will.
Es gibt ein schönes Gleichnis, das dies ein wenig verdeutlicht:
»Eine Auster sprach zu ihrer Nachbarin: ›Ich trage großen Schmerz in mir. Schwer ist er und rund, und ich habe große Not.‹
Die andere Auster antwortete mit Selbstzufriedenheit: ›Gelobt sei der Himmel und das Meer, denn ich habe keine Schmerzen. Es geht mir gut, innen und außen.‹
In diesem Augenblick kam ein Krebs vorbei und hörte die beiden Austern. Darauf sagte er zu derjenigen, die innen und außen unversehrt war:
›Ja, dir geht es wohl gut; doch der Schmerz, den deine Nachbarin in sich trägt, ist eine Perle von hinreißender Schönheit.‹«19
Hier könnte man therapeutisch ansetzen, indem man dem Leidenden hilft, sich aus der Rolle des zu lebenslanger Krankheit Verurteilten zu befreien, und ihn unterstützt, seinen Schmerz in eine Perle von »hinreißender Schönheit« zu verwandeln.
Aber nicht nur die Behandler sind angehalten, neue Wege auszuprobieren, weil die alten in eine Sackgasse führen. Auch der Patient selbst kann eine Menge zur Heilwerdung beitragen. Wobei Heil-Werden jedoch nicht bedeutet, völlig symptomfrei durch das Leben zu gehen. Das kann kein Mensch. Es bedeutet, das Schmerzhafte in das Leben zu integrieren. Psychische Krankheiten können als Wachstumsschübe zur inneren Reife genutzt werden.
Wichtig ist, sich beim ersten Auftreten von psychischen Symptomen sofort Hilfe zu suchen und nicht zu warten, bis eine manifestierte Krankheit entstanden ist. Da auf Therapieplätze bekannterweise mehrere Monate gewartet werden muss, ist hier Kreativität gefragt.
Während des Durchlebens einer krankhaften Episode ist genug Zeit, sich mit seinen wahren Wünschen, den erlittenen Verletzungen, dem Ungelebten auseinanderzusetzen und die Wirklichkeit umzugestalten. Eine psychische Krankheit ist der direkteste Aufschrei, zu dem die Seele fähig ist. Es ist eine Aufforderung, sich auf den Weg nach innen zu begeben und nach den wirklichen Bedürfnissen unserer Seele zu leben. Ob man diesen Weg lieber mit oder ohne Medikamente geht, spielt eine untergeordnete Rolle. Wichtig ist nur, dass die Medikamente nach dem Abklingen der Symptomatik wieder abgesetzt und nicht dauerhaft eingenommen werden. Denn das Leben ohne Medikamente wird von allen Betroffenen als lebenswerter beschrieben.
Manche Menschen sind von Natur aus vulnerabler als andere. Sie werden vom Leben mehr berührt als vermeintlich Gesunde. Während ein empfindsamer Mensch bereits in eine Krise gerät, wenn er kritisiert wird, können einem anderen auch schlimmste Kränkungen kaum etwas anhaben. Geraten vulnerable Menschen in die Mühlen unseres maroden Medizinsystems, werden sie so lange zu kranken Menschen geformt, bis sie selbst davon überzeugt sind. Anstatt auf ihre besondere Empfindsamkeit einzugehen, werden die Betroffenen mit Medikamenten ruhiggestellt und geraten beim Absetzen derselben in entsetzliche Krisen.
Die meisten Menschen, die psychiatrisch in Erscheinung treten, sind solche, die am Leben leiden. Das Leben ist für jeden schmerzvoll, und vor dem Leben kann sich keiner schützen. Ein sogenanntes »normales Leben« gibt es nicht. Unsere Gesellschaft hat noch keinen geeigneten Weg gefunden, mit leicht verletzbaren Menschen so umzugehen, dass sie gestärkt aus der Behandlung hervorgehen. Der Lei(d)tgedanke der Psychiatrie, dem Ganzen eine biochemische Komponente zu unterstellen, ist verlockend, führt aber in die Irre. Ganz abgesehen davon, dass es keinen stichhaltigen Beweis für die Theorie des biochemischen Ungleichgewichts im Gehirn gibt, hält sie die Betroffenen davon ab, sich mit ihrer persönlichen Situation zu beschäftigen und sie zu verändern.





























