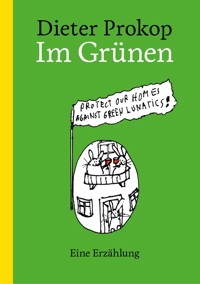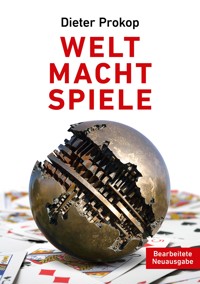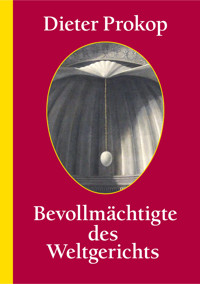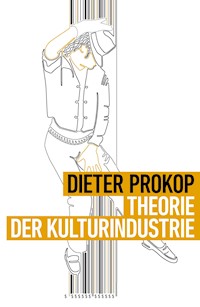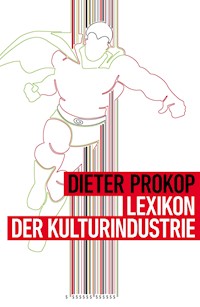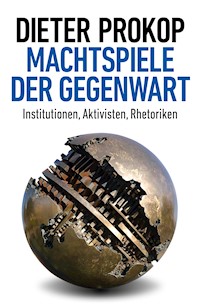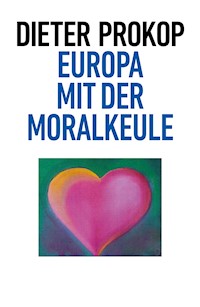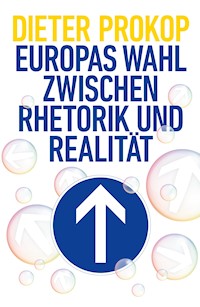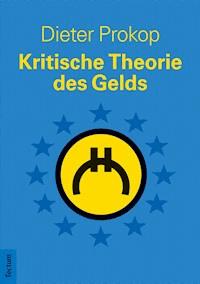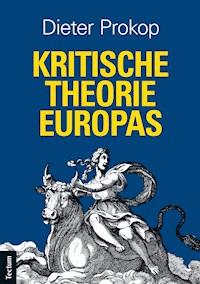14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Dies ist ein Geschichtsbuch über die Medien-Inszenierung von Macht und menschlichen Interessen, Leiden und Lachen, Sensationen und Spaß. Es ist ein Buch über populäres Theater, Gladiatorenkämpfe, Tierhetzen, öffentliche Propagandabilder, kommerzielle Kirchenbilder, Newe Zeytungen, Flugblätter, populäre Bücher, Zirkus, Penny-Presse, Music Hall, investigative Massenpresse, Film, Radio, Fernsehen, Internet. Das Buch bietet reichhaltiges Material und ist klar und verständlich geschrieben. Es beginnt mit der Antike ab ca. 500 vor unserer Zeitrechnung und bezieht das römische Kaiserreich und das Mittelalter ein: Die Zeit der Griechen brachte mit dem Theater das erste öffentliche Räsonieren. Und seither gibt es Theorien über die Medien und die Massen. Das römische Kaiserreich brachte mit öffentlichen Propagandabildern die erste Public Relations. Und die Konflikte zwischen dem Dionysischen und dem Apollinischen. Der Ablasshandel im Mittelalter brachte gefühlvolle Bilder und die erste Kulturindustrie und damit erstmals den Medien-Kapitalismus. Dessen Entwicklung wird bis heute, bis zum digitalen Fernsehen, Multimedia und Internet dargestellt. Dabei geht es immer um das Schicksal der Interessen, die sich auf die Medien richten: das Interesse an der Entfaltung von Vernunft und Solidarität; das Interesse an den Gefühlen der Rührung, des Schreckens, am Lachen; das Interesse an feudalistischer, absolutistischer oder demokratischer Repräsentanz. Die realen und die theoretischen Auseinandersetzungen um diese Interessen werden in dem Buch anschaulich geschildert und analysiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 949
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
GESCHICHTE DER KULTURINDUSTRIE
DIETER PROKOP
GESCHICHTE DER KULTURINDUSTRIE
Dieter Prokop ist Professor em. für Soziologie an der Goethe-Universität in Frankfurt.
Bearbeitete Neuausgabe des Titels »Der Kampf um die Medien. Das Geschichtsbuch der neuen kritischen Medienforschung «, Hamburg 2001
© 2017 Dieter Prokop
Coverillustration, Layout und Satz: Oliver Schmitt, Mainz
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN 978-3-7345-9871-5 (Paperback)
ISBN 978-3-7345-9872-2 (Hardcover)
ISBN 978-3-7345-9873-9 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhalt in Kürze
Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis befindet sich am Ende des Buchs
Einleitung
Vorspiel: 500–300 v. u. Z.
Athenische Demokratie: Subjektbildung der Bürger
TEIL I: 40 v. u. Z.–1400
ZWISCHEN REPRÄSENTANZ VON MACHT, DIONYSISCHEM FEST UND IDENTITÄTSBILDUNG: ÖFFENTLICHE BILDER, ÖFFENTLICHE SPIELE
40 v. u. Z. – 400 u. Z.
Römisches Kaiserreich: Repräsentanz zentralistischer Macht
400–1000
Feudalismus: Repräsentanz der Idee des Göttlichen
1000–1400
Früher Handels-Kapitalismus, Spät-Feudalismus: Ausbildung von Individualität
TEIL II: 1400–1880
ZWISCHEN PROPAGANDA, SENSATIONEN UND STANDARDISIERTEN GEFÜHLEN: ÖFFENTLICHE BILDER, FRÜHE ZEITUNGEN, POPULÄRE BÜCHER, ZIRKUS, PENNY-PRESSE, MUSIC HALL
1400–1650
Handels-Kapitalismus, früher Produktions-Kapitalismus, Absolutismus: Hinwendung zur realen Welt
1650–1770
Bürgerliche Zivilgesellschaft, Merkantilismus, Absolutismus: Human Interests und öffentliche Kritik
1770–1820
Produktions-Kapitalismus, bürgerliche Revolution: Interessenvertretung der politischen Parteien
1820–1880
Laissez-faire-Kapitalismus, Massengesellschaft, Bürger-Macht, Kämpfe um Pressefreiheit: Unterhaltung und Meinungsbildung der neuen Massen«
TEIL III: 1880 bis Anfang 21. Jahrhundert
ZWISCHEN IRRATIONALISTISCHER MARKTSEGEMENTIERUNG UND DENKENDEM PUBLIKUM: SENSATIONSPRESSE, FILM, RADIO, FERNSEHEN, INTERNET
1880–1914
Oligopol-Kapitalismus, Massenproduktion, Aufstieg der Werbung: Klarheit und Einfachheit des Medien-Erlebens
1914–1945
Fordismus, Massenkaufkraft, stabilisierter Oligopol-Kapitalismus: Stabilisierung der Konsumenten-Märkte, sicheres Spiel mit dem Unvertrauten
1945–1970
Soziale Marktwirtschaft, Motorisierung, Freizeitgesellschaft: Privatisierung des Lebens
1970–1990
Postfordismus, Dienstleistungsgesellschaft: Segmentierung der Konsumenten-Märkte, Grenzerweiterungen im Spiel mit dem Unvertrauten
1990 bis Anfang 21. Jahrhundert
Digitale Ökonomie, supranationaler Kapitalismus, Deregulierung, Gegenreform: Flexibilisierung, Lebenskampf und das neue Zeitalter der Medien-Taylorisierungrung
Literaturverzeichnis
Einleitung
Dies ist ein Geschichtsbuch über die Medien-Inszenierung von Macht und menschlichen Interessen, Leiden und Lachen, Sensationen und Spaß. Es ist ein Buch über populäres Theater, Gladiatorenkämpfe, Tierhetzen, öffentliche Propagandabilder, kommerzielle Kirchenbilder, Newe Zeytungen, Flugblätter, populäre Bücher, Zirkus, Penny-Presse, Music Hall, investigative Massenpresse, Film, Radio, Fernsehen, Internet. Es ist das Buch eines Soziologen, der die Grenzen der Fachwissenschaften überschreitet.
Genügt es nicht, über weltweite Netze Fakten abzurufen? Ist nicht Geschichte etwas fürs Museum, für Touristen und für Hollywoodfilme? Leben wir nicht in einer Zeit, in der historischer Ballast nicht gebraucht wird, im Posthistoire, in dem es keine Geschichte gibt, sondern Standard-Systeme und Standard-Systemlösungen?
Die Antwort: Zurück zu gehen in der Geschichte hat den Sinn, zu überlegen, was anders hätte verlaufen können. Mehr Wahrheitssuche? Mehr Realismus? Mehr Demokratie? Bessere Information? Mehr Vielfalt? Mehr Kreativität? Mehr Qualität? Bessere Unterhaltung? Mehr Spaß? Mehr Verrücktes? Alles von diesem »Anderen« wäre wünschenswert. Wer das Andere will, muss die historischen Interessenkonstellationen erforschen, die dafür verantwortlich sind, dass es nicht mehr davon gab und gibt.
Aber gibt es nicht genug aktuelle Kämpfe? Haben wir nicht genug daran, den globalen Krieg der Konzerne um die Neuen Medien zu verstehen? Bietet nicht das Internet neue Aufregungen? Blicken wir doch vorwärts!
Die Antwort: Nicht ohne Grund wird die Macht der heutigen supranationalen Konzerne, auch der Medienkonzerne, mit der Macht absolutistischer Fürsten verglichen. Deshalb ist es nützlich, zu sehen, was Feudalismus – und Absolutismus – mit den damaligen Massen und Massenmedien anstellten. Es gab damals nicht nur Folter und Scheiterhaufen, sondern auch subtile Mittel der Manipulation der Gefühle und des Verstands, die den heutigen gleichen. Und woher sollen die Vorstellungen darüber kommen, was heute besser sein könnte und wie das begründbar ist, wenn nicht aus der Analyse der historischen Entwicklung von Identität, Öffentlichkeit, Räsonnement und Amüsement?
Ich beginne mit der Antike ab ca. 500 vor unserer Zeitrechnung und beziehe das Mittelalter ein. Das ist ungewöhnlich. Man erwartet eher, dass eine Geschichte der Massenmedien mit der Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert beginnt oder mit dem Aufkommen regelmäßig erscheinender Zeitungen im frühen 17. Jahrhundert. Man konzentriert sich auf die Schrift und vergisst die öffentlichen Bilder und Spiele.
In der Antike, in Athen im 5. Jahrhundert v. u. Z., entstand das Theater. Bei den Römern gab es öffentliche Bilder, eine staatliche Repräsentanzkultur; außerdem gab es Gladiatorenkämpfe und Wagenrennen. Bei Platon, den Judäern und frühen Christen findet man die Anfänge der Bilderfeindlichkeit, an der bis heute die visuellen Medien zu leiden haben. Und im Mittelalter gab es mit gefühlvollen Kirchenbildern und dem Ablasshandel die erste kommerzielle Kulturindustrie. Und es gab populäre Balladen und Erzählungen. Warum also erst mit dem Buchdruck beginnen?
Aber gehört nicht das Theater in die Theaterwissenschaft, die Kirchenbilder in die Kunstgeschichte und die Balladen und Erzählungen in die Klassische Philologie? Was mischt sich ein Soziologe ein?
Die Antwort: Wissenschaftliche Arbeitsteilung muss sein, doch ist es notwendig, über deren Ränder zu blicken. Für die Publizistik- und Kommunikationswissenschaft jedenfalls kann es kein Schaden sein, wenn man von der Welt mehr erfährt als Zeitungsgeschichte. Die Kulturindustrieforschung präsentiert ein strukturanalytisches Vorgehen, das die historischen Medien-Strukturen, deren Existenz und Dauerhaftigkeit, aus wirtschaftlichen politischen, gesellschaftlichen Interessenlagen erklären möchte, also aus den Vorteilen, die der Gesellschaft oder Teilen der Gesellschaft aus den betreffenden Medien-Strukturen entstanden. Dabei geht es auch um deren Ergebnisse, um die Produktstrukturen, d. h. die Inhalte und die Gestaltungsweisen.
Manche nennen das, was ich Interessen oder Vorteile nenne, »Funktionen«. Wenn sie feststellen, dass die Medien die Gefühle der Menschen bewegt haben, nennen sie das »Gefühlsfunktion«. Wenn mittels Medien Propaganda gemacht wurde, sprechen sie von einer »Propagandafunktion«. Wenn mittels Medien öffentliche Debatten geführt wurden, gilt das als »Diskursfunktion«. Oft ist von »gesellschaftlichen Steuerungs- und Orientierungsfunktionen« oder von »gesellschafts- und herrschaftsstabilisierenden Funktionen« der Medien die Rede.
Wenn man jedoch alles und jedes als »Funktionen« benennt, hat man außer der Befriedigung, alles benannt zu haben, keine weitere Erkenntnis.Was haben wir davon, wenn uns angesichts des Reformationslieds »Nun treiben wir den Papst hinaus« ein Medienwissenschaftler erklärt, dass dieses Lied die »Funktion des Kampfs« hat? (Faulstich 1998, S. 171). Meist wird hinzugefügt, das analysierte Objekt habe »normierende und damit gruppenstabilisierende Funktion«, und man merkt die Zufriedenheit des Wissenschaftlers damit, dass wieder einmal Menschen im Kollektiv untergingen. Und an Schlichtheit nicht zu überbieten ist die These des Systemtheoretikers Niklas Luhmann, die Medien hätten die Funktion, überflüssige Zeit zu vernichten (1996, S. 96).
Eine kritische Geschichte der Massenmedien ergibt sich erst, wenn man historische Interessenkonstellationen analysiert.Nehmen wir die idealisierenden Bilder, Reliefs und Herrscher-Statuen im Römischen Reich zur Kaiserzeit: Wenn wir die historischen Interessen beachten, können wir sagen: »Die Medien dienten im Römischen Reich zur Kaiserzeit dem kaiserlichen Interesse, mittels einer apollinischen Propagandakultur die Feinde des Herrschers, konkurrierende Despoten ebenso wie Demokraten, durch Diffamierung des Dionysischen zu bekämpfen.« Damit sind sowohl die Vorteile der damaligen Medien bezeichnet als auch die Art und Weise, in der die Vorteile realisiert werden.Erst das genauere Analysieren von Interessen schärft den Blick.
Die Geschichte der Medien war stets ein Kampf, den die Herrschenden, die Medien-Anbieter, die Künstler, die Journalisten und das Publikum – und nicht zuletzt die Wissenschaftler – gegeneinander und untereinander ausfochten. Sie alle hatten unterschiedliche Interessen.Historische Medien-Strukturen stabilisierten sich sich eine Zeitlang als Ergebnis derartiger – mittels Gewalt, Markt-Macht oder politischer Kompromisse beendeter – Interessenkämpfe. Am stabilisierten Zustand sind wir ebenso interessiert wie an den Kämpfen.
Die Interessenkämpfe, in die die Medien eingespannt waren und sind, will ich darstellen. Ein Interessenkampf ist zum Beispiel der zwischen Bürgern, die die freie öffentliche Diskussion, also Pressefreiheit fordern, und den absolutistischen Herrschern, die das verhindern wollen. In der frühen Neuzeit war es der Interessenkampf zwischen einer ordinären, grobschlächtigen, antiautoritären Festkultur der Bauern und Handwerker und einer damals von Staat und Kirche mit Gewalt durchgesetzten »Volkskultur« des einfachen, frommen Gemüts. Interessenkämpfe ergeben sich in der Praxis von Wirtschaft, Politik, Gesellschaft.
Der Ansatz der kritischen Medienforschung, den ich vertrete, untersucht – und sie bezieht den Unterhaltungsbereich und die Bilder mit ein –, wo und wie sich in der Mediengeschichte identitätsstärkende, solidarische, rational diskursive Kommunikations- und Entscheidungsformen entwickelten, durch welche Macht- und Wirtschafts-Strukturen und durch welche Theorien sie verhindert wurden und in welchen strukturellen Konstellationen sie sich trotz aller Machtund Wirtschafts-Interessen – und oft auch über sie vermittelt – durchsetzten.
Es ist sinnvoll,Problemkonfliktevon Interessenkämpfen zu unterscheiden. Problemkonflikte ergeben sich in der Wissenschaft, in der Theorie wie der empirischen Forschung. Ein Problemkonflikt ist zum Beispiel die seit Platon und Aristoteles geführte Debatte darüber, ob Unterhaltung dem Publikum schadet und deshalb zu zensieren ist oder ob sie eine befreiende Wirkung hat und deshalb frei sein muss. Wir werden feststellen, dass auch Probleme, die Philosophen und Medienforscher aufwerfen, von politischen und wirtschaftlichen Interessen geprägt waren – und bis heute sind.
Medien-Interessenkämpfe und Medien-Problemkonflikte herauszuarbeiten, ist die Absicht des Buchs.
Mit Medien meine ich Massenmedien. »Massen« definiere ich neutral als Bevölkerungsmehrheit oder als großes Publikum.Das ist eine formale Definition, aber das reicht. Auf eine inhaltliche Definition verzichte ich, denn auf die Vorurteile über »die Massen« kann ich verzichten.
Aber kann man denn heute noch von Massen als Bevölkerungsmehrheiten reden? Gibt es noch die großen Mehrheiten? Sind die Menschen heute nicht individualisiert? Gehen nicht zielgruppenorientierte Medien individuell auf jeden Einzelnen ein? Bereitet nicht das Internet den einseitig sendenden Massenmedien ein Ende? Wozu sich noch mit diesen alten »Massenmedien« beschäftigen?
Die Antwort: Man muss das, weil auch zielgruppenorientierte Medien – konventionell oder Internet – »Massenmedien« sind. Werbung, Marketing, Illustrierte, Formatradios, Fernsehkanäle versuchen, Zielgruppen anzusprechen, aber wir sollten uns nicht vorstellen, heute seien alle Medien und alle Menschen »individualisiert«. Das ist eine Marketing-Ideologie. Auch die zielgruppenorientierten Anbieter suchen heute möglichstweltweit vorhandeneZielgruppen, also »Massen«. Auch im Internet gibt es Portale, die vom breiten Publikum abgerufen werden, also von Massen. Also gibt es auch heute Massenmedien. Und darüber, wie man große Publika fasziniert – oder auch einschüchtert und diszipliniert –, erfährt man viel in der Mediengeschichte.
Was sind also Massenmedien?
1.Medien im Sinne von Massenmedien gibt es nur dort, wo es große Publika gibt, die real oder potenziell als Öffentlichkeit agieren. Die großen Publika sind nicht die Medien, aber sie sind deren Voraussetzung.
Keine Massenmedien waren die Kulte in der Frühzeit der Menschheit – Opferrituale, Regentänze, beschwörende Gesänge oder deren materielle Ergebnisse, z. B. die prähistorischen Höhlenmalereien, die ägyptischen Grabkammerbilder. Wenige Beteiligte praktizierten Rituale, es gab keine Öffentlichkeit.
»Öffentlichkeit« ist ein Begriff, der sich im 18. Jahrhundert einbürgerte. Er bezeichnet ein Publikum, das in Parlamenten, Cafés und Zeitungen Kritik äußern kann, wozu die Freiheit der Meinungsäußerung und der Presse gehört.Aber auch in der Antike und im Mittelalter gab es »Öffentlichkeit«. In Athen im 5. Jahrhundert v. u. Z. hatte das Theater ein kritisches Publikum. Das Publikum beurteilte die Qualitäten des Angebots. Das Theater war ein öffentliches Massenmedium. Im Mittelalter geschah die Repräsentanz von Macht im öffentlichen Raum. Das Publikum war in den Kirchen, auf Plätzen, später auf Marktplätzen präsent. Selbst wenn das Publikum unterdrückt wurde und öffentliche Mitteilungen zensiert wurden, hatten die öffentlichen Anbieter stets mit Ketzern, Kritikern, Aufständischen zu rechnen.
Der Medienhistoriker Werner Faulstich hält auch die Familie für eine Öffentlichkeit, er nennt das »kleinräumige Binnenöffentlichkeit« (1998, S. 116). Dann wären auch die Urlaubsbilder auf dem Tablet oder Smartphone, mit denen Leute ihre Mitmenschen langweilen, ein Massenmedium? Das kann nicht sein, dennin Öffentlichkeiten geht es immer um die prinzipielle Einbeziehung aller; in Öffentlichkeiten richten sich die Debatten stets auf das Koordinieren der Interessen aller in der Gesamtgesellschaft.
2.Massenmedien gibt es nur, wenn spezielle öffentliche Anbieter vorhanden sind, die mit ihrem Angebot spezielle Interessen verfolgen: Repräsentanz von Macht, Propaganda, Profit, Aufklärung. Die Anbieter selbst sind keine Massenmedien, sondern deren infrastrukturelle Voraussetzung.
Das Theater in Athen war ein öffentliches, staatliches Festspiel-Angebot. Wenn die Kirche im Mittelalter Bilder ausstellte und damit Ablassgelder kassierte; wenn sie diese Bilder massenweise produzierte und als Amulette und Andenken verkaufte, war sie ein öffentlicher Anbieter, mit dem Interesse der Machtdemonstration und des Profits.
An den Anbietern betrachten wir die Marktformen, die Produktionsweisen, die Formen der Auftragsvergabe, die Infrastrukturen für Kreativität und die Arten der Arbeitsteilung. Gab es viele Kleinanbieter oder wenige Großanbieter oder einen Monopolisten? Waren die Produktionsweisen handwerklich oder manufakturmäßig oder industriell?
Kein Massenmedium sind Sprache und Schrift. Sie sind Teil der Kultur oder »kulturelle Institutionen«. Man mag sie »Medium« nennen, aber dann ist auch die Luft, die wir atmen ein Medium. Manche Kommunikationswissenschaftler sagen genau das, ohne zu scherzen. So beginnt der Informatiker Michael Giesecke ein medienhistorisches Buch, das die Erfindung des Buchdrucks zum Gegenstand hat, mit einem Begriff von »Medium«, der auch die Luft einschließt, denn jedes Sprechen setze die Gasmoleküle der Luft in Schwingungen und jene transportieren eine »informative Spur« (1998, S. 73). Für Giesecke ist selbst ein Hut, der durch den Sand rollt, ein Medium: »Der Hut zeigt sich […] als Medium, welches zwischen dem Wind und den Dünen vermittelt. Gebrochen durch die materialen Eigenschaften des Hutes, eben seine Informationen, hinterlässt der Wind seine Spuren im Sand. Der Hut verformt sich, weil er als Medium zwischen dem Sand und der Windenergie vermittelt. Zugleich wirkt er aber auch auf die Luftmoleküle zurück.« (S. 39).
Überlassen wir es Informatikern, alte Hüte in den Sand zu setzen.
3.Massenmedien gibt es nur, wenn öffentlich präsentierte Produkte spezielle Inszenierungen anbieten. Diese Inszenierungen, wenn sie populär sind – d. h. bei Bevölkerungsmehrheiten beliebt sind, wahrgenommen, gekauft, debattiert werden – sind die eigentlichen Massenmedien.Statt »Inszenierungen« könnte man auch »Erzählungen« oder »Geschichten« sagen, doch würde man hierbei den Aspekt der Gestaltung ignorieren. »Inszenierungen« umfasst beides.
In den Medien-Inszenierungen verdichtet sich das, was Anbieter bezwecken oder was das große Publikum sucht, in speziellen Szenen. Die Pracht absolutistischer Machtdarstellung auf öffentlichen kaiserlichen Festen oder die anrührenden Maria-Jesuskind-Darstellungen auf den spätmittelalterlichen Ikonen oder die sensationell aufgemachten Pressenachrichten seit der frühen Neuzeit sind derartige »Inszenierungen«.
Natürlich können wir nicht alle Massenmedien berücksichtigen. Das Theater werden wir nur kurz streifen. Für Kirchenbilder interessieren wir uns nach dem 17. Jahrhundert nicht mehr. Manche Medien wie Zirkus, Music Hall, Comics kommen nur am Rande vor, Illustrierte und populäre Musik fast gar nicht. Man muss Schwerpunkte setzen. Wir versuchen, immer dort zu sein, wo sich in den jeweiligen Mainstream-Medien die wichtigen Veränderungen abspielen.
Menschen sind kein Massenmedium, weil Menschen die Inszenierenden sind, nicht das Inszenierte. Bei populären Schauspiel-Inszenierungen sind nicht die Schauspieler das Massenmedium, sondern die Inszenierungen. Faulstich nennt die fahrenden Sänger, die bei mittelalterlichen Festen auftraten, »Menschmedien« (1996). Dann wäre auch ein Prediger ein Menschmedium, und wenn er zum Medium Buch greift, wäre das bereits ein Medienverbund? Genau das behauptet Faulstich (1998, S. 147). Das erscheint mir falsch. Es ist auch nicht sinnvoll, angesichts der archaischen Verehrung von Göttinnen vom »Menschmedium Frau« (Faulstich 1997) zu sprechen. Erst wenn es von einem Klerus bewusst inszenierte Bilder gibt, entworfen mit dem Interesse an Repräsentanz oder an Profit, kann man jene Bilder Massenmedien nennen. Alles andere wäre mystifizierend. Heute spricht man wieder von Kult, Kultfiguren, Kultbüchern, und man kokettiert mit Schamanen und Zauberern. Aber das sind Inszenierungen, die von öffentlichen Anbietern für große, öffentliche Publika hergestellt werden. Heute sind »Kultbücher« oder »Kultfiguren« Teil der Massenmedien.
Manche könnten schließlich fragen: Geht es nicht am Wesen der Massen vorbei, wenn man sie bloß als Bevölkerungsmehrheit definiert und glaubt, sie könnten »Interessen« verfolgen? Folgt die Masse nicht dem Sog des Kollektivbewusstseins? Die Massen, die den Sportlern im Olympiastadion zujubeln und die Verlierer verdammen, hängen sie nicht ewigen Sieger-Mythen an? Sind die Reichen und Schönen in den massenbeliebten Fernsehserien, die intrigieren und leiden, nicht bloß eine Neuausgabe der intrigierenden und leidenden antiken Götter? Und das Bild von Maria mit dem Jesuskind, das sich schon so lange hält, ist das nicht ein Beweis für eine tiefverwurzelte Urfantasie von der harmonischen Mutter-Kind-Beziehung? Und wenn in den Science Fiction-Filmen Außerirdische aus dem All kommen, um die ins Chaos gefallene Menschheit zu vernichten, sind das nicht uralte apokalyptische Mythen?
Peter Sloterdijk schreibt: »Denn in der Masse versammeln sich die erregten Einzelnen nicht zu dem, was die Diskussionsmythologie ein Publikum nennt – vielmehr verdichten sie sich zu einem Fleck, sie bilden Menschen-Kleckse, sie strömen zu dem Ort, wo es am schwärzesten ist von ihnen selbst. Der Ansatz beim Menschenauflauf zeigt, dass es schon in der Urszene der kollektiven Ichbildung ein Zuviel an Menschenstoff gibt und dass die noble Idee, die Masse als Subjekt zu entwickeln, von diesem Überschuss a priori sabotiert wird.« (S. 13)
Kann man dann die Massen, wie wir das tun wollen, als Öffentlichkeit betrachten, in der Bevölkerungsmehrheiten Interessen verfolgen und Inszenierungen begutachten? Ja, man kann. Man muss! Das Publikum des griechischen Theaters und der Kirchenbilder im Mittelalter bestand nicht aus unkritischen Gläubigen. Das Bild von Maria mit dem Jesuskind ist kein Beweis für ewige Urphantasien der Massen, sondern für die Macht der Kirche, einschließlich der Scheiterhaufen; die mittelalterlichen Bilder wurden produziert, um denkende Menschen, »Ungläubige«, einzuschüchtern oder zu überreden. Macht hat politische und ökonomische Ursachen. Behauptungen über ein »kollektives Unbewusstes«, eine »Massenseele« oder »tief verwurzelte Urbedürfnisse« sollten wir nicht ernst nehmen. Selbst wenn noch im Jahr 2000 ein Buch mit dem TitelDas kollektive Unbewusste in der postmodernen Gesellschafterscheint und in dessen Klappentext behauptet wird, das kollektive Unbewusste halte uns »fest in seinem Bann«, kann dessen Autor, Walter L. Bühl, im Text nur Fakten darüber präsentieren, dass Bevölkerungsmehrheiten auch heute über Märchengestalten, Drachen, Helden, Führerfiguren und Stars fantasieren. Das bestreitet niemand. Man sollte von »Fantasietätigkeit« sprechen oder von »Fantasietätigkeit von Bevölkerungsmehrheiten«. Bühl dagegen präsentiert die alten mystifizierenden Begriffe: »kollektives Unbewusstes«, »kollektives Gedächtnis«, »Kollektivphantasien«, »Archetypen« etc. Das ist Unsinn. Fantasien sitzen nicht »tief im Unbewussten«, im Rückenmark oder irgendwelchen Gehirnhälften. Sie ergeben sich in historischen Situationen aufgrund von Interessenkonstellationen. Vieles wird über Generationen weitererzählt. Das ist alles.Die »irrationalen Massen« mit ihrem »kollektiven Unbewussten« sind ein Mythos. Daran glauben vor allem Elite-Menschen, die sich von »der Masse« abgrenzen möchten; verfassungsfeindliche Juristen; Möchtegern-Manipulateure in der Werbung; Anhänger der Astrologie.Wir müssen das nicht mitmachen. Bevölkerungsmehrheiten sind keine »schwarzen Flecken«, sie sind nicht irrational. Die Massen bestehen aus denkenden Menschen. Das festzustellen, ist keine »Schmeichelsoziologie«, wie Sloterdijk behauptet (2000, S. 15). Wir schmeicheln nicht.
Vorspiel: 500–300 v. u. Z.
ATHENISCHE DEMOKRATIE: SUBJEKTBILDUNG DER BÜRGER
Die Zeit der griechischen und römischen Kultur gehört zur »Antike«, zum »Altertum«. Diese Epoche begann um 3000 v. u. Z. – d. h. vor unserer Zeitrechnung – mit dem Aufstieg der minoischen Kultur auf Kreta. Sie endete mit dem Ende des Römischen Reichs im 5. Jahrhundert. Wir konzentrieren uns auf die Blütezeit der griechischen Kultur im 5. und 4. Jahrhundert (500–300 v. u. Z.). Sie ist wichtig, weil hier erstmals ein populäres Massenmedium entstand, das Theater, und auch die ersten Medientheorien.
Dichtung und Theater
Geldwirtschaft, Binnenhandel, Festspiele und Demokratie
Seit dem 7. Jahrhundert hatte es in Griechenland fahrende Vortragskünstler gegeben, »Rhapsoden« genannt, die auf Festen und bei Wettkämpfen oder Siegesfeiern auftraten, oft vor einem Publikum, das in die Tausende ging (Faulstich 1997, S. 194). Sie trugen in einer Art Sprechgesang, mit schauspielerischer Emphase, Liebeslieder, Totenklagen, Trinklieder, Kampflieder vor und auch Werke der Klassiker, die Dichtung Homers,OdysseeundIlias(8. Jahrh.). Ihr Vortrag wurde meist mit der Khitatra, einer Art Gitarre begleitet, von ihnen selbst oder von Musikern. Es gab unter dem fahrenden Volk auch Gaukler, Clowns und Possenreißer, die Spottlieder auf Zeitgenossen sangen und klamaukhafte Szenen spielten.
Ende des 7. Jahrhunderts änderte sich alles. Das Münzgeld wurde eingeführt, im 6. Jahrhundert wurde Griechenland eine Fernhandelsmacht. Als Folge entstand ein intensiver Binnenhandel, mit Kleinhandel und Kleingewerbe. Alles zusammen führte zu Reichtum der Bürger. Die Sklavenarbeit bot billige Arbeitskräfte, es gab doppelt so viel Sklaven wie freie Bürger. Unter den freien Eigentümern waren die Bauern, Handwerker und Kaufleute diejenigen, die Produktion und Handel vorantrieben. Die Bürger wurden einflussreicher und gerieten in Konflikt zu den aristokratischen Großgrundbesitzern, die traditionell Griechenland beherrschten. In den Kämpfen siegten im 6. Jahrhundert Diktatoren, Tyrannen wie zum Beispiel Peisistratos (rg. 560, 546–528/527). Um beim Volk Sympathiewerbung für sich und damit Stimmung gegen die Aristokratie zu machen, richteten die Tyrannen Festspiele, »Dionysien« ein. Das waren religiöse Feste zu Ehren des Gottes Dionysos, der bei der Bevölkerung beliebt war. Das größte Fest, ca. 560 v. u. Z. von Peisistratos eingerichtet, waren die Großen Dionysien in Athen, die jährlich in der zweiten Märzhälfte stattfanden. Daneben gab es weitere Feste, um die Zeit der Sommer-Sonnenwende die Pan-Athenäen, zur Winter-Sonnenwende die Lenäen.
Dionysos war ein vor allem bei der Landbevölkerung beliebter Gott der Vegetation und speziell des Weins, der Fruchtbarkeit und des irdischen, »tierischen« Vergnügens, er war ein Erdengott, der Gut und Böse, Leben und Tod gleichermaßen verkörperte. Er wurde meist als orgiastisch Feiernder dargestellt. Während der Dionysos-Feste wurden Opferprozessionen veranstaltet: Die Prozession ging meist von einem Fluss oder dem Meer aus, dem Ursprung des Lebens. Körbe mit Opfergaben wurden vorangetragen; dann folgte ein großer Phallos, der von mehreren Männern getragen wurde; dann ein Chor, der die phallische Hymne sang. Die Umzugsteilnehmer machten einen Höllenlärm, sie stießen gellende, orgiastische Schreie aus und verwendeten grell klingende Instrumente. Der Zug hielt an verschiedenen Altären, wo Tänze aufgeführt und Tieropfer dargebracht wurden. Die Zeremonie stammte aus alten Fruchtbarkeitsriten, die das Wiederaufleben der Natur nach dem Winter beschworen. Das war der religiöse Teil der Feste. Es gab außerdem öffentliche Speisungen, Wett-Trinken, sportliche und musische Wettkämpfe, Fackelläufe.
Die größte Attraktion der Feste waren die neuen Theaterwettbewerbe, die Aufführung von Tragödien, Satyrspielen und Komödien.Bei den Großen Dionysien in Athen wurden an den ersten drei Tagen jeweils drei Tragödien eines Dichters aufgeführt. Besonders ergreifend war in den Tragödien der Kommos, das Klagelied, das Chor und Schauspieler gemeinsam sangen und das seine Ursprünge in rituellen Totenklagen hat. Es war tränentreibend. Zum Schluss gab es zur Entspannung ein Satyrspiel, am vierten Tag drei Komödien verschiedener Autoren.
Ende des 6. Jahrhunderts, 510 v. u. Z., vertrieb der athenische Staatsmann Kleisthenes den Tyrannen Hippias und begann mit Reformen, die Grundlage der athenischen Demokratie wurden. Jene wurde im 5. Jahrhundert durchgesetzt. Entscheidende Struktur war die Volksversammlung, waren aber auch z. B. Geschworenengerichte. Der demokratische Herrscher Perikles (rg. 450– 429 v. u. Z.) setzte ein Bürgerechtsgesetz durch, das die athenischen Bürger gegenüber der Aristokratie stärkte. Es gab zwar kein durch eine Verfassung abgesichertes Recht auf Meinungsfreiheit, aber doch eine Art freiheitliches Gewohnheitsrecht, freimütiges Reden wurde als Bürgertugend angesehen. (F. Schneider, S. 6 ff.) Wichtig ist auch, dass Athen im 5. Jahrhundert den Attischen Seebund beherrschte, ein Reich von ca. 400 Städten und ca. 2 Mio. Einwohnern. Athen trieb Steuern und Abgaben ein, wurde reich und konnte sich die Theater-Festspiele leisten.
Perikles errichtete 445 v. u. Z. den größten überdeckten Raum in jener Zeit, das Odeion, einen Saal mit einem Zeltdach. Dort fanden während der Pan-Athenäen Flötenspiel-, Leierspiel- und Gesangswettbewerbe und Dichtungs-Lesungen statt. Perikles führte auch ein »Schaugeld« ein, mit dem der Theaterbesuch der ärmeren Bürger subventioniert wurde, denn jene sollten an den im Theater verhandelten öffentlichen Angelegenheiten ebenso teilhaben wie an der Volksversammlung.
Das erste Freilichttheater war in Athen das Dionysos-Theater, erbaut Ende des 5. Jahrhunderts. Es hatte U-förmig angeordnete Sitzreihen für mehr als 10.000 Zuschauer, einen kreisrunden Tanzplatz, die Orchestra, und die »Szene«, ein Holzgerüst, aus dem in späteren Theaterbauten die Bühne wurde. Die Götter sprachen vom Dach der Szene, und es gab »Flugmaschinen«, hölzerne Kräne für Göttererscheinungen (»Deus ex machina«) und Blitz- und Donnermaschinen.
Theater als erstes Massenmedium
Das Theater war ein erstes Massenmedium, und es war zugleich das erste demokratische:
1. Es wurde vom Staat oder der Stadt finanziert und organisiert. Das Programm der Festlichkeiten wurde von einer Volksversammlung beschlossen. Der Eintritt war frei.
2. Es erreichte ein großes öffentliches Publikum. Das Publikum war das Volk von Athen und Umgebung. Die Theater fassten bis zu 17.000 Zuschauer. Den größten Teil des Publikums stellte die städtische Mittelschicht der Handwerker und Gewerbetreibenden, Männer und Frauen. Die Theater waren für Vollbürger, für Besitzende und für Sklaven offen. Es gab keine Sitzordnung, die Schichten und Geschlechter waren nicht voneinander getrennt.
3. Die Teilnehmer waren ein öffentliches Publikum. Die Inszenierungen zielten auf möglichst große Attraktivität (Stumm, S. 163 ff.). Die Stücke wurden dem Publikum vor der Aufführung von den Dichtern präsentiert, sie erläuterten Thema, Handlungsverlauf und den Sinn der Dramen. Während der Vorstellung wurde laut kritisiert, gelegentlich mussten die Dichter eingreifen und kritisierte Passagen rechtfertigen. Das Publikum stürmte bei Missfallen auf die Bühne und verprügelte schlechte Schauspieler
Demokratische kulturelle Repräsentanz
Es entstanden im 5. Jahrhundert neben den berühmten Tragödien von Aischylos, Euripides und Sophokles ca. 1.260 klassische Tragödien. Die meisten Stoffe waren dem Publikum aus der Mythologie, den »Heldensagen« vertraut: Ödipus, Medea, Elektra, Orest, die Troja-Sage etc. Die Schauspieler trugen Masken, sie wirkten vor allem durch Sprechen und Gestik, gelegentlich auch Gesang. Die weiblichen Rollen wurden von Männern gespielt. Zu den Aufführungen gehörten Chöre, die im Wechsel mit den Schauspielern sprachen, sangen und tanzten. Auch das war ein neues, demokratisches Element, denn die Aristokraten hatten die traditionellen Chöre bevorzugt, die Bürger dagegen mochten den dialogischen Wechselgesang (Kuch, S. 27 ff.). Um 480 v. u. Z. entstanden Komödien ohne Chor und mit zusammenhängender Handlung. Sie waren bei allem intelligenten Witz oft derb und zotig.
In demokratischen Zeiten – während der Herrschaft des Perikles – wurden in die Darstellung der Mythen auch politische Themen verpackt. Während der Dionysien gab es »Rügefreiheit«. So kritisierten Komödien die Politiker, die Außen- und Innenpolitik, die Korruption, die sozialen Verhältnisse. Ihnen wurde polemisch die »gute alte Zeit« entgegengesetzt. Auch kleine Leute aus dem Volk waren oft die »guten« Helden dieser Komödien. Manche Komödien, wie die von Aristophanes (ab 427 v. u. Z.), waren politisches Kabarett.
Im 4. Jahrhundert, als Athen nicht mehr mächtig war, wurden die Theaterstücke unpolitisch, sie dramatisierten nur noch die klassischen Mythen. Die Komödien wurden »Lustspiele«. Sie behandelten jetzt Alltagsthemen: Liebe, Eifersucht, Verwechslungen, Intrigen. Beliebte Charaktere waren jetzt Lebemänner, Parasiten, Köche, Hetären. (Andresen et al. 1965)
Erste Medientheorien, erster Problemkonflikt: Massenmedien als falscher Schein oder als Befreiung?
Repräsentanz des Idealen und Bilderfeindlichkeitbei Platon
Es gab also damals Massenmedien – und es gab Wissenschaftler, die weder die Medien noch die Massen mochten und nach Zensur riefen: Platon.
Platon (427–347 v. u. Z.) war Schüler von Sokrates (407–399 v. u. Z.); Gründer der philosophischen Akademie (387 v. u. Z.), die von Spenden unterhalten wurde; Gründer des philosophischen Idealismus. Er gehörte zu einem der vornehmsten und reichsten Geschlechter Athens. Er lebte in einer Zeit, in der, nach dem Peloponnesischen Krieg (431–404 v. u. Z.), die Macht Athens und die attische Demokratie zerfielen.
Dichtung, Theater und auch Malerei waren für Platon Trugbilder. Sie seien unvollkommen und scheinhaft, von der Wahrheit weit entfernt. Die Dichtung sei im Bereich der Begierden befangen, sie wende sich nicht an die Vernunft, sondern an die Triebe und Leidenschaften, also an die niederen Kräfte der Seele, sie erzeuge eine angenehme Stimmung – dionysische Selbstvergessenheit –, eine Lust, die man nicht gern missen möchte. Aber damit zerstöre Dichtung die Vernunft (Der Staat, 10. Buch, 604 e).
Platon entwarf seine Kritik, um den religiösen Weisheitsanspruch der Dichtung zu bekämpfen, die alte Vorstellung vom Dichter als »Seher der Weltmächte« (Krüger, S. 48). Dichtung, so meine Platon, sei bloß »Mimesis«, Nachahmung. Platon verwendete diesen Begriff in diffamierender Absicht. Im Prinzip könnte man darunter auch eine schöpferische Nachgestaltung verstehen, aber er meinte damit ein unintelligentes Imitieren: Der Dichter ahme mythische Personen nach, die alten Sagengestalten, die Götter. Er spreche, als sei er einer von ihnen. Dichtung, so sagte Platon, bleibt im Banne des Eindrucks, sie produziert bloß Reste der mythischen Geistesverfassung, von Inspiration geprägtes, zufälliges Wissen, Meinung. Homer zum Beispiel, bloß ein »Dichter«, habe überhaupt keine praktische Erfahrung gehabt, weder in der Politik, noch in der Erziehung von Menschen, noch in der Kriegskunst, seine Werke seien also vom »wahren Sein« weit entfernt (10. Buch, 595a ff.).
Dichtung, Theater und Malerei produzieren Bilder. Auch die Erzählungen der fahrenden Rhapsoden, auch die Deklamationen der Theaterchöre riefen beim Publikum bildhafte Vorstellungen wach. Dagegen wandte sich Platon. Er wollte, dass der Verstand die Bilder durchschaut. Der Medienpädagoge Karl-Hermann Schäfer schreibt hierzu: »Diese Abwendung von der sinnlichen Wahrnehmung und von der sinnlichen Bilderwelt Homers bedeutet eine Revolution in der abendländischen Geschichte der Bildung. Die rationale Reflexion lässt den einheitlichen Zusammenhang von bildhaft beschriebenen Situationen und mündlicher Sprache bei Homer auseinandertreten […]. Das sinnlichkonkrete Sprachverständnis der Zuhörer der Rhapsoden, das in der sinnlichen Bilderwelt Homers sein Fundament findet, verwandelt sich in rationale Reflexionsprozesse, die in Platons Welt der Ideen verankert sind […].« (S. 91). Anders gesagt:Platon war ein Bilderfeind, er sah in den erzählten oder inszenierten Bildern von vornherein nur falschen Schein.
Die Dichter stellen, selbst wenn sie Realität abbilden, bloß Abbilder von Abbildern her, meinte Platon. Denn bereits die Phänomene in der Realität seien nur Abbilder der ewigen, überirdischen Ideen. Jene seien nur erkennbar für die Philosophen, die den Scheinbildern misstrauen und zu den dahinterliegenden Urformen des Wahren, Schönen, Guten vordringen. Eigentliches Wissen könne nur die Wissenschaft herstellen.
Um das plausibel zu machen, entwarf Platon inDer Staat(um 370 v. u. Z.) ein Gleichnis: Menschen stehen in einer Höhle, aber sie sind derart gefesselt, dass sie sich nicht umdrehen und nur geradeaus sehen können. Hinter ihnen brennt ein Feuer, das die Höhle beleuchtet. Zwischen den Gefesselten und dem Feuer geht ein Weg vorbei. Auf diesem Weg gehen Menschen vorbei. Vor dem Weg ist eine Mauer, »wie die Schranken, die die Gaukler vor den Zuschauern aufbauen und über die hinweg sie ihre Kunststücke zeigen«. Die auf dem Weg vorbeilaufenden Menschen unterhalten sich: »Stelle dir nun längs der kleinen Mauer Menschen vor, die allerhand Geräte vorübertragen, so, dass diese über der Mauer hinausragen, Statuen von Menschen und anderen Lebewesen aus Stein und Holz und in mannigfacher Ausführung. Wie natürlich, redet ein Teil dieser Träger, ein anderer schweigt still.« Die Gefesselten können all das nicht sehen. Sie sehen vor sich auf der Wand die Schatten, die das Feuer projiziert: die Schatten von den hinten am Weg vorbeigehenden Menschen und der Gegenstände. Ein Echo reflektiert die Stimmen der Menschen. Da die Gefesselten von der Realität hinter sich nichts wissen, glauben sie, die Schatten sprächen zu ihnen. Sie kennen Ursache und Wirkung nicht, halten falsche, verzerrte Abbilder für Realität. (7. Buch, 514a)
Wir könnten in dem Höhlengleichnis die erste Medientheorie sehen – und fast eine prophetische Vorwegnahme heutiger Medien. Wirft nicht auch das Fernsehen bloße Abbilder, Schatten und Töne, den »falschen Schein«, bloß »Simulation« der Realität, in die Wohnzimmer-Höhlen?
Allerdings blendete Platon den Verstand der Gefesselten von vornherein aus: Die Gefesselten könnten die Schattenbilder, die sie zu sehen gezwungen werden, für genauso erzwungen halten wie ihre Lage. Platon erwähnte das nicht. Und warum schloss Platon grundsätzlich aus, dass auch Schattenbilder Realität wiedergeben können? Die Leute hinter den Gefesselten »tragen allerhand Geräte vorbei«, auch Statuen, und sie reden ein wenig, manche »schweigen still«. Warum fällt es ihnen gar nicht ein, etwas zu sagen, wodurch die Gefesselten sich ihrer Fesselung bewusst würden? Sie müssen selbst in Ritualen gefesselt sein, in einer Prozession vielleicht, wer trägt sonst schon Statuen herum. Oder es sind Schauspieler, die die Gefesselten mit ihren Schattenbildern täuschen.
Platon hatte das Höhlengleichnis in propagandistischer Absicht entworfen, als Bild des Falschen. Er wollte die Philosophie an die Stelle der Dichtung setzen, Vernunft an die Stelle der Besessenheit, Wissen an die Stelle der Intuition – und das Ideale an die Stelle des Wirklichen.
Zum Bild der in der Höhle Gefesselten gehörte für Platon das Gegenbild eines Menschen, der von seinen Fesseln gelöst wird – aber nicht von den statuentragenden Leuten auf dem Weg – und die Realität um sich wahrnehmen kann. Er kann die vorbeigehenden Menschen sehen, die Statuen, das Feuer. Er kann aus der Höhle heraustreten und die Sonne sehen. Das Fortschreiten zur Realität bedeutete für Platon aber nicht das Erkennen materieller Strukturen, sondern das war für ihn ein Gleichnis für ein Fortschreiten ins Licht, für den Aufstieg der Seele zur Idee des Guten. Er schrieb: »Meine Ansicht darüber geht jedenfalls dahin, dass unter dem Erkennbaren als letztes und nur mit Mühe die Idee des Guten gesehen wird; hat man sie aber gesehen, so muss man die Überlegung anstellen, dass sie für alles die Urheberin alles Richtigen und Schönen ist. Denn im Sichtbaren bringt sie das Licht und seinen Herrn hervor; im Einsehbaren aber verleiht sie selbst als Herrin Wahrheit und Einsicht. Sie muss man erblickt haben, wenn man für sich oder im öffentlichen Leben vernünftig handeln will.« (7. Buch, 517 a–d).
Im Interesse der Vernunft entwarf Platon einen autoritären Idealstaat. Die Philosophen sollten darin herrschen und die Dichter verbannt werden (3. Buch, 397e ff.). Erlaubt soll nur eine Kultur sein, die »Richtiges« über das Göttliche und die Menschen »wiedergibt«. Die Dichtkunst müsse daran gehindert werden, das »schlechte Ethos« zu produzieren. In seinem Idealstaat verbietet Platon alles, was ihn an der Dichtung störte: dass schlechte Menschen mit einem Happy End belohnt werden, während gute Menschen oft ein unglückliches Schicksal erleiden; dass die Götter böse sind, sich bekriegen, den Menschen schaden; dass die Götter beim Publikum Angst auslösen: Kinder werden unnötig erschreckt; dass die menschlichen Helden keine Vorbilder sind: zu verweichlicht, zu unbeherrscht, zu habgierig, aufsässig, grausam. Das alles wollte Platon verbieten. (Der Staat, 2. u. 3. Buch)
Platon verbot in seinem Phantasiestaat auch das Lachen. Lachen über das Komische hatte seinen Ursprung in den dionysischen Kulten, in der Ekstase, im Orgiastischen, auf jeden Fall im Überschreiten der Konventionen. Der Soziologe Peter L. Berger schreibt: »Die komische Erfahrung ist orgiastisch – wenn nicht im archaischen Sinn einer rasenden Entrücktheit, so doch in dem metaphorischen Sinne, dass sie zusammenbringt, was Konvention und Moral streng getrennt sehen wollen. Sie gibt jegliche ernsthafte Anmaßung der Lächerlichkeit preis – auch die des Heiligen. Insofern ist die Komik aller öffentlichen Ordnung gefährlich.« (1998, S. 20). Platon meinte, »wenn sich jemand einem heftigen Lachen ergibt, so ruft das auch nach einem heftigen Umschwung« (Der Staat, 3. Buch, 388e). Deshalb sei das Lachen aus der sauberen Kultur, die er sich wünschte, zu verbannen, Platon wandte sich auch hier gegen die Dichter, gegen das homerische Gelächter, das Lachen der Götter in HomersIliasundOdyssee.Bei Homer lachten selbst die Götter aus Niedertracht, sie bestätigten sich im Lachen, dass sie dem Belachten überlegen sind. Es war ein Lachen ohne Abgründe, ohne Leiden. Gerhard Nebel beschreibt das so: »Zeus lacht, als die verprügelte Artemis ihm ihre Prügel klagt, allesamt lachen die Götter über den hinkenden Hephaistos, sie lachen das niedere Lachen der Schadenfreude […]. Die Götter] halten kein Leid aus, im Unterschied zu den verachteten Menschen, die die Kraft des Duldens haben, sie schütteln die Wasser des Schicksals ab und springen, sobald es kritisch wird, hinweg.« (1959, S. 212 f.). Dazu Platon: »[…] unermessliches Lachen erscholl bei den seligen Göttern, als sie sahn, wie Hephaistos [hinkend] in emsiger Eil umherging; das dürfen wir nicht gelten lassen.« Platons Problem: Wenn sogar die Götter lachen, über das, was sie angerichtet haben, dann darf man auch über die Taten der irdischen Herrscher lachen. Lachen ist der Anfang der Respektlosigkeit.
Demokratie dürfe es nicht geben, denn nur der Philosoph, der verständige Mann könne die Mimesis, das unintelligente Nachgemache der Dichter durchschauen. Der Masse sei das unmöglich, sie erliege durch lebhaftes Mitempfinden der Mimesis der Dichter, und von deren »schlechtem Ethos« werde ihre Seele geprägt (Der Staat, 3. Buch, 393c ff.). Die Masse solle statt dessen den Regierenden untertan sein und sich den Freuden des Essens, des Trinkens und des Liebens widmen (389d-e).
So war das Höhlen-Bild nicht ein harmloses Gleichnis, sondern ein Programm für Zensur. Politisch korrekt war für Platon nur das Ideale. Es sollte nur ideale Götter und ideale Menschen geben. Unter dieser Maxime ist Unterhaltung natürlich unnötig und unmöglich.
Identitätsfindung durch Rührung, Schrecken und Lachen bei Aristoteles
Aristoteles (384–322 v. u. Z.) war Mitglied in Platons Akademie (367–347) und zunächst dessen Schüler; Lehrer Alexanders des Großen (343–334); Gründer einer Philosophenschule (334). In Athen war Aristoteles ein Metöke, ein zugereister Fremder.
Aristoteles sagte gegen Platon: Es existieren keine Ideen außerhalb der Erfahrung. Was in der Seele des Menschen liegt, sind Widerspiegelungen der Natur. Nichts existiert im Bewusstsein, was nicht durch sinnliche Erfahrung gebildet wurde: »Alle Menschen streben von Natur nach Wissen; dies beweist die Freude an Sinneswahrnehmungen, denn diese erfreuen an sich, auch abgesehen von dem Nutzen, und vor allen anderen die Wahrnehmung mittels der Augen. Denn nicht nur zu praktischen Zwecken, sondern auch wenn wir keine Handlung beabsichtigen, ziehen wir das Sehen so gut wie allem andern vor, und dies deshalb, weil dieser Sinn uns am meisten Erkenntnis gibt und viele Unterschiede offenbart.« (Metaphysik 980a).
So war auch die Dichtung für Aristoteles nicht Abbild von Abbildern, sondern Nachbildung von Wirklichkeit. Aristoteles nahm das Göttliche nicht mehr ernst. Die Dichtung war für ihn nichts anderes als literarische Fiktion, die Genregesetzen gehorcht und auf bestimmte Wirkungen abzielt.
Die Dichtung zersetzt nicht die Vernunft, sondern sie befreit die Leidenschaften, meinte Aristoteles. Er war für die »gemäßigte Leidenschaftlichkeit«. Auch gefährliche Kräfte könne man zu guten Zwecken verwenden, so wie die Medizin sich der Gifte zur Heilung bedient.
In derPoetikvon Aristoteles (um 334 v. u. Z.) – dem ersten wissenschaftlichen Werk über die Dichtkunst – findet sich die bekannte Passage über die Tragödie: »Die Tragödie ist Nachahmung einer guten und in sich geschlossenen Handlung von bestimmter Größe, in anziehend geformter Sprache, wobei diese formenden Mittel in den einzelnen Abschnitten je verschieden angewandt werden – Nachahmung von Handelnden und nicht durch Bericht, die Jammer [éleos] und Schauder [phóbos] hervorruft und hierdurch eine Reinigung [kátharsis] von derartigen Erregungszuständen bewirkt.« (6. Buch, Abs. 1).
Über »Jammer«, éleos, schreibt der Aristoteles-Herausgeber Manfred Fuhrmann: »Die aristotelische Poetik verlieh dem Begriff eine ethische Komponente: Eleos sei der Verdruss über ein großes Übel, das jemanden treffe, der es nicht verdient habe; wer Eleos empfinde, nehme an, dass das Übel auch ihn selbst oder eine ihm nahestehende Person treffen könne.« (S. 162). Damit diese Wirkung eintritt, muss, so sagte Aristoteles, das Dargestellte dem durchschnittlichen Zuschauer nachvollziehbar sein. Es muss den Regeln der Wahrscheinlichkeit folgen. (Poetik, 9. Buch, 1452a). Statt »Jammer« könnte man auch »Rührung« sagen (M. Fuhrmann, 1994, S. 162), manche übersetzen das auch mit »Mitleid«. Diese abschwächenden Begriffe sind angemessener für das aufgeklärte 4. Jahrhundert, in dem das Theater ein Unterhaltungsbetrieb war. Keine Tragödie löste mehr Jammer aus, allenfalls Rührung oder Mitleid. Für »Schauder« wären »Schrecken« oder »Furcht« die abschwächenden Begriffe.
Neu bei Aristoteles war dessen Begriff von Reinigung, Katharsis, die sich einstellt, wenn man sich von Rührung und Schrecken ergreifen lässt.Das war ein Ausdruck aus der Medizin, der die Entfernung schädlicher Stoffe aus dem Körper bezeichnete. Er hat aber auch seine Wurzeln in den damaligen moralischerzieherischen Reden und Schriften, die aus Anlässen wie Geburt und Tod entworfen wurden und Hoffnung geben, Trost spenden, die Menschen »läutern« wollten (Nachov 1983, S. 195 ff.).
Auch der Musik schrieb Aristoteles die Wirkung der Katharsis zu: Man lässt sich von Gefühlen – Rührung, Schrecken – erfassen, »[…] und alle erleben eine Reinigung und eine angenehme Erleichterung.« (Politik, 8. Buch, 1342a). Aristoteles hielt deshalb auch orgiastische Musik, wenn in Maßen genossen, für unschädlich. Was »orgiastische« Musik damals war, ist heute nicht mehr bekannt, Aristoteles sprach von »ruckartiger und chromatisch verdrehter Melodik«.
Man kann vermuten dass Aristoteles auch der Komödie, dem Vergnügen und Gelächter eine Reinigung der Leidenschaften zuschrieb (Stumm, S. 205 f.) – anders als Platon, das Lachen gehörte für Aristoteles in den Bereich des Angenehmen (Rhetorik, 1. Buch, 1372a). Aristoteles’ Definition der Komödie: In ihr werden die Menschen als schlechter dargestellt als sie in Wirklichkeit sind (Poetik, 2. Buch, 1448a). Die Nachahmung von schlechten Menschen wird von der Komödie insoweit geleistet, »als das Lächerliche am Hässlichen teilhat. Das Lächerliche ist nämlich ein mit Hässlichkeit verbundener Fehler, der indes keinen Schmerz und kein Verderben verursacht, wie ja auch die lächerliche Maske hässlich und verzerrt ist, jedoch ohne den Ausdruck von Schmerz.« (Poetik, 5. Buch, 1449a). Aristoteles bezog sich auf Satire und Kabarett des 5. Jahrhunderts v. u. Z.
Man sollte heute statt von »Reinigung« besser von »Befreiung« sprechen.Denn Katharsis ist bei Aristoteles keine harmlose Kur für die »Seele«, sie hat nicht nur eine »psychohygienische Funktion« (Faulstich 1997, S. 216). Rührung und Schrecken bewirken Veränderungen: Tränen fließen; man kriegt eine Gänsehaut. Beim Lachen wird das Zwerchfell geschüttelt. Durch Rührung und Schrecken, Vergnügen und Gelächter lebt man Situationen des Lebens nach und bearbeitet sie. Die Herstellung des Gleichgewichts hat Folgen: »angenehme Erleichterung« – aber auch mehr Lebenstüchtigkeit. Man reinigt die normalen, natürlichen Gefühle von allem Übermäßigen, Abnormen. Die Leidenschaften werden gezügelt. Aristoteles idealisierte damit die »goldene Mitte«, das Gemäßigte, Harmonische, Angemessene (Nachov, S. 198). Idealisierung oder nicht –die dabei entstehende Verbindung von gemäßigten Leidenschaften und Vernunft gehört zur Fähigkeit, realitätstüchtig zu werden.Zugleich geschah die Reinigung nicht nur mittels des Weinens oder Lachens, sondern das Tragische oder Komische wurde in den Stücken auch erörtert, es wurde argumentiert, philosophiert. Der Verstand war bei Rührung und Schrecken nicht ausgeschaltet. Deshalb ist Katharsis nicht nur Reinigung, sondern Befreiung. Insofern ist Katharsis für alle Herrschaftsideologien schädlich.
Dieser Rückblick zeigt Dimensionen auf, in denen die Problemkonflikte in Bezug auf die Massenmedien damals ausgefochten wurden: falscher Schein; angebliche Gefährlichkeit von Bildern; angebliche Notwendigkeit von Zensur im Interesse des Idealen;befreiende Wirkung von Rührung, Schrecken und Lachen. Wie wir sehen werden, unterscheidet sich das nicht sehr von den heutigen Debatten, selbst wenn die Begriffe, die Medien und die Gesellschaftssysteme andere sind.
Wir überspringen die Phase nach Alexander I (rg. 498–454 v. u. Z.), des Hellenismus (332–31 v. u. Z) – ab ca. 150 v. u. Z. spricht man auch von der Römerzeit –, in der zwar ein Markt neuer religiöser, philosophischer und wissenschaftlicher Vorstellungen entstand und eine reichhaltige Bildkultur. Wir tun das, weil wir eine Auswahl treffen müssen.
Teil I
40 v. u. Z – 1400 u. Z.
Zwischen Repräsentanz von Macht, dionysischem Fest und Identitätsbildung: öffentliche Bilder, öffentliche Spiele
40 v. u. Z. – 400 u. Z.
RÖMISCHES KAISERREICH: REPRÄSENTANZ ZENTRALISTISCHER MACHT
Wir beginnen mit dem Römischen Reich. Da wir Schwerpunkte setzen müssen, konzentrieren wir uns auf den Kaiser Octavian / Augustus, dennjener entwickelte zwecks Durchsetzung seiner Macht erstmals eine differenzierte Propagandakultur. Sie wird heute als Vorläufer der Public Relations angesehen(Binder, S. 47).Wichtiger ist, dass wir in der Propagandakultur des Octavian / Augustus einen politischen Interessenkampf vorfinden, der das Verhältnis von Leidenschaften und Vernunft betrifft. Das ist bis heute für die Medientheorie von Interesse.
Ein politischer Interessenkampf: das Apollinische gegen das Dionysische
Wer das Bild hat, hat die Macht: Imagepflege des Kaisers Octavian / Augustus
Das Römische Reich war unter Julius Caesar (rg. 59–44 v. u. Z.) zur Weltmacht geworden. Nach seinem Tod wurde das Reich als Triumvirat regiert, von drei gleichberechtigten Herrschern, den Triumvirn, die ihre Herrschaftsbereiche aufteilten. Octavian beherrschte Italien und den Westen; Marcus Antonius Kleinasien und Syrien; der Schwächste, M. Aemilieus Lepidus, beherrschte Gallien.
Octavian, Adoptivsohn Caesars und dessen Großneffe (Enkel der Schwester Caesars), kämpfte um die Alleinherrschaft, vor allem gegen Marcus Antonius. Er kämpfte auch auf der Ebene der Imagepflege. Er setzte durch, dass Caesar zwei Jahre nach seinem Tod zum Gott erklärt und in den Götter-Staatskult aufgenommen wurde. Damit konnte sich Octavian »Imperator, Caesar divi filius« nennen, Befehlshaber, Sohn des göttlichen Caesar.Octavian war der erste, der bewusst ordnungsstiftende Massenmedien einrichtete. Er entwickelte einePropagandakultur, die sich mit Darstellungen seiner Person und der von ihm bevorzugten Götter an ein öffentliches Publikum wandte.Diese Darstellungen waren als Statuen und auf Reliefs auf den Foren, den öffentlichen Plätzen und in den Tempeln aufgestellt. Zum Image eines Herrschers gehörte es in der Antike, sich einem bestimmten Gott besonders verbunden zu fühlen. Augustus identifizierte sich mit Apollo, den er als Ordnungsgott auffasste.
Apollo war der Gott des delphischen Orakels, »Pythios« genannt. Von der dortigen Priesterschaft wurden erstmals in Griechenland Menschenwürde und Recht gepflegt, und deshalb war Apollo hoch angesehen. Apollo war der Wahrheitskünder, der Gott der Mäßigung und der Ichstärke. Apollo wurde von den Römern als Gott aller Harmonie und Ordnung verehrt. Aus Apollo sprach die Weisheit der Individuation, die Weisheit dessen, der Träume und Realität zu verbinden weiß, realitätstüchtig ist, eine Identität hat (Nietzsche 1871).
Octavians Gegenspieler Marcus Antonius identifizierte sich mit dem Gott Dionysos, der auch Bakchos und von den Römern Bacchus genannt wurde. Marcus Antonius’ unterschiedliche Gott-Präferenz symbolisierte einen politischen Konflikt, denn Dionysos wurde im Osten des Reichs verehrt. Dionysos – und Aphrodite, die von den Römern Venus genannt wurde – war Symbol freizügigen, hellenistischen Lebensgefühls. Man huldigte ihnen mit »Gelagen«, d. h. mit kultivierten Fress- und Sexorgien, berühmt wurden die Gelage der ägyptischen Königin KleopatraVII, der Geliebten des Marcus Antonius; und die Gelage des Lucullus. Sie dienten dem Genuss, der Befreiung vom Alltag, der Steigerung der Lebenskräfte. Es war die hellenistische Form der Erlösung von allen Übeln. Marcus Antonius ließ sich auf Gemälden und Statuen als Dionysos darstellen und gab sich auch sonst »dionysisch«: Er ließ sich in der Öffentlichkeit, wie oft auch Dionysos, auf einer Liege, Kline genannt, tragen. Im Osten des Reichs zog er in die Städte stets mit einer Horde von Possenreißern ein, deren Späße und Zoten berüchtigt waren. Man nannte sie »Dionysocolaces«, Parasiten des Dionysos (Lever, S. 92).Die Possenreißer des Marcus Antonius standen auch für die alte griechisch-hellenistische Meinungs- und Redefreiheit.
Tatsächlich waren die dionysischen Kulte, wie der von Caesar erneuerte Bacchus-Kult, strikt geregelte religiöse Rituale. Dazu gehörten rituelle Reinigungen, das feierliche Verlesen heiliger Formeln, tanzende Bacchantinnen und die Enthüllung eines großen Phallus, den man den Neuaufgenommenen auf den Kopf fallen ließ, was ihnen ewige Seligkeit nach dem Tode versprach. Der Kult wurde von einer streng hierarchischen Priesterschaft geregelt. Es gab unter dem Deckmantel der Religion viel sexuelle Aktivitäten, gewalttätige Ausschweifungen und Verbrechen. Auf den berühmten Wandgemälden in der Villa dei Misteri, der Villa der Mysterien in Pompeji (ca. 50 u. Z.) gibt es, neben einer bacchantisch Tanzenden, eine leidend kniende Frau, Objekt einer Flagellation (Kindlers Malerei Lexikon Bd. 14, S. 306). Dionysos war nicht nur Gott des glücklichen Rauschs und der Verzückung, sondern auch der Gott des Grauens, des Exzesses und der Auslöschung des Individuums. Das wurde von der Propaganda des Octavian ausgenutzt. Den »westlichen« Römern war die dionysische Kultur des Ostens zu affektbetont, zu ekstatisch. Dionysos erschien auf Propagandabildern, die von Octavian in Auftrag gegeben wurden, oft als Betrunkener. In einem Relief aus jener Zeit besucht der Gott das Haus eines seiner Anhänger, der ihn, auf einer Kline lagernd, begrüßt. Dionysos wird begleitet von einer orgiastisch tanzenden Anhängerschaft. Dionysos scheint betrunken, schlaftrunken. Er stützt sich auf einen Knaben. Sein Kinn ist auf die Brust gesunken, die Augen sind geschlossen.Damit wird angedeutet, dass das Dionysische nicht nur Lebenskraft, sondern auch Selbstvergessenheit bedeutet.(Zanker 1987, S. 71)
Zur Auseinandersetzung zwischen römischer Tugend und dionysischer Genusskultur und schreibt der Archäologe Paul Zanker: »Was Antonius mit seinen Leuten und der Kleopatra im Osten trieb, war [für die Propagandamaschinerie des Octavian] ein Ausbund derselben Verweichlichung und Sittenverderbnis, die Rom in den letzten Generationen in den Abgrund gebracht hatten. Auch erinnerten sich die Alten noch, wie der König Mithridates als ein neuer Dionysos die Kräfte des Ostens an sich gebunden und Roms Herrschaft bedroht hatte. Dagegen könnte sich der Apolloschützling [Octavian] als Mann der Ordnung und Moral profilieren. Schon früher hatte Apollo in kritischen Augenblicken auf der Seite der Römer gestanden.« (S. 65). Der Gott der Individuierung stand auf der Seite der Macht.
Im Jahr 31 v. u. Z. wurden Marcus Antonius und Kleopatra von Octavian in der Seeschlacht bei Actium besiegt. Nach seinem Sieg war Octavian Alleinherrscher, der erste römische Kaiser (rg. 31 v. u. Z – 14 u. Z.). Im Jahr 27 v. u. Z., erhielt er vom Senat den Ehrennamen »Augustus«, »der Erhabene«, und als solcher ist er uns bekannt. Nach ihm ist unser Monat August benannt. Auf einem Relief, das ein Jahr nach Actium entstand, wird Apollo – als propagandistisches Gegenbild zum betrunkenen Dionysos – als Siegesgott dargestellt. Dieser Gott schreitet, er braucht niemanden, der ihn stützt. Hinter ihm hüpft kein feierndes Volk, es schreitet seine Schwester Diana und seine Mutter Latona. Sein Kinn ist erhoben, er blickt die Siegesgöttin Victoria an. Dahinter ein prächtiger Tempel, den Augustus gestiftet hatte. (Zanker, S. 71)
Repräsentanz von Tugend
Von griechisch-hellenistischer Meinungs- und Redefreiheit war bei Augustus nichts mehr vorhanden. Redefreiheit war nicht mehr ein Gewohnheitsrecht der Bürger, sondern ein Recht, das der Herrscher gewähren konnte, meist aber nicht gewährte.Augustus entwickelte ein Programm öffentlicher Repräsentanz, in dem die Werte der pietas und virtus, der Frömmigkeit und Tugend propagiert wurden.Mars, der Kriegsgott, wurde als friedlich gewordener Ordnungsgott dargestellt. Auch Venus wurde umgedeutet: Aus der Liebesgöttin Venus wurde Pax, die Ehe-, Fruchtbarkeits-, Mutterschafts- und Friedensgöttin. Das war auch ein Programm gegen die damals stark sinkende Geburtenrate. Auf der Ara Pacis Augustae, dem Friedensaltar in Rom (9 v. u. Z.) trägt sie zwei Putten auf dem Arm. Eine dieser Putten langt wie ein Säugling nach der Brust, die andere hält eine der Früchte empor, die auf dem Schoß der Göttin liegen. Unter ihr lagert friedlich ein Ochse, ein Lamm frisst Gras.
Vorher,vor Augustus, hatte es viel private Prachtentfaltung der Reichen gegeben, die öffentlichen Tempel aber waren verkommen und die Heiligtümer zerfallen.Die neuen Bilddarstellungen gab es an öffentlichen Bauten, auf Tempel-Wandbildern, Statuen. Es gab sie auch auf Münzen.Jene trugen seit jeher das Bild und damit den Machtanspruch des Herrschers in alle Gegenden des Reichs.
Stets ließ Augustus sich als Sieger feiern: Der kniende besiegte Barbar, der als Zeichen seiner Unterlegenheit seine Feldzeichen überreicht, wurde auf Münzen und Monumenten weit verbreitet. Die Siege des Augustus und die Festtage seiner Götter wurden regelmäßig gefeiert. Die Bevölkerung erlebte das Jahr als eine Abfolge von Feiern zu Ehren des Kaisers, seiner Familie und seiner Götter. Zanker schreibt: »Die Bilder des Siegeszeremoniells, des Herrscherkults, der kaiserlichen Selbstdarstellung, der Ehrenmonumente und der Herrscherpanegyrik [der Huldigung] bildeten ein einheitliches ›System‹, dessen Struktur schon am Ende der Regierungszeit des Augustus voll ausgebildet war. […] Dank der ständigen Wiederholung der rituellen Abläufe von Zeremoniell und Fest und dank der festen Bildformeln konnte sich der Herrschaftsmythos wie eine eigene Wirklichkeit vor das Auf und Ab des tatsächlichen historischen Geschehens schieben. Die Bilder für militärische Glorie, für gottgeschützte Ordnung und für zivile Sicherheit und Wohlfahrt überhöhten den Alltag […].« (S. 238)
Nach seinem Tod wurde auch Augustus zum Gott erklärt, »Augenzeugen« hatten ihn sogar in den Himmel auffahren gesehen.
Die augusteische Bilderkultur erhielt sich bis zum Ende des 2. Jahrhunderts.Ein Beispiel ist die Trajanssäule in Rom aus dem Jahr 114, eine Art Litfasssäule für Kriegspropaganda. Man sieht Darstellungen der Feldzüge des Kaisers Trajan in Dakien, dem heutigen Rumänien: Die Römer erobern eine Stadt, die Barbaren fliehen. Man sieht eine Schlacht gegen die Daker und ein Bild von den siegreichen Soldaten, die vor einer eroberten Festung Getreide ernten (Gombrich, S. 123). Alles, was zu sehen ist, ist ruhmreich. Was nicht ruhmreich war, wurde nicht dargestellt.
Unterhaltungs-Medien
Theater, Circus: Gladiatoren, Action, Tierhetzen und spottendes Publikum
Das Theater war auch im Römischen Reich ein Massenmedium. Auch kleinere Städte besaßen ihre Theater für Schauspiele und Theater für Gladiatorenkämpfe, ovale Amphitheater. Pompeiji, die kleine Stadt mit 20.000 Einwohnern, hatte ein Theater mit 2.500 Sitzplätzen, eines mit 5.000 Plätzen und ein Amphitheater für Gladiatorenkämpfe mit 20.000 Plätzen.
In Rom hatte es lange Zeit keine Theater gegeben. Der römische Senat erlaubte nur provisorische Holztheater, die für die großen Götterfeste errichtet wurden. Das erste ständige Theater, im Jahr 55 v. u. Z. von Pompeius erbaut, wurde als Tempel getarnt. Es war ein offener Bau mit im Halbkreis angeordneten, aufsteigenden Zuschauerreihen.
Das erste steinerne Rundtheater entstand in Rom im Jahr 29 v. u. Z., es war ein ovales Amphitheater für Gladiatorenkämpfe. Als Gladiatoren wurden zunächst Sklaven oder Verbrecher ausgewählt. Die Kämpfe gingen ums Leben, das Publikumsgebrüll entschied, ob ein unterlegener Gladiator getötet werden sollte oder überleben durfte. Gladiatorenkämpfe waren hochbeliebt. Später wurde Gladiator ein richtiger Beruf, siegreiche Gladiatoren verdienten viel Geld.
Kaiser Augustus baute im Jahr 11 v. u. Z. ein großes Theater, das Marcellustheater. Die Aufführungen wurden mit hohen Summen vom Staat und von reichen Spendern finanziert. Sie wurden von den Leitern der Schauspieltruppen organisiert. Jene schlossen mit dem Chef des Polizei- und Ordnungsamts, dem Ädilen, einen Vertrag, kauften vom Dichter das aufzuführende Stück und verpflichteten Schauspieler und Musiker. Gespielt wurde an Festtagen, es gab viele, für Venus, Mars etc.; es gab Siegesfeiern, kaiserliche Geburtstage, Tempeleinweihungen. Die Darbietungen dauerten oft den ganzen Tag, auch mehrere Tage. Das Publikum wurde kostenlos bewirtet. Es war daran gewöhnt, laut Gefallen und Missfallen zu äußern. Auch in Gegenwart des Kaisers tat es das. und das auch zu politischen Angelegenheiten. Es protestierte gegen die strengen Ehegesetze des Augustus, gegen hohe Lebensmittelpreise und Steuern. Es durfte laut über die Herrschaften lästern, Spottlieder singen etc.
Das Publikum hatte dieses Recht auf Spott auch zu anderen Gelegenheiten: Bei den Triumphzügen der Kriegshelden durch Rom wurde der Held von einem servulus, einem Possenreißer begleitet, der ihm immer wieder zurief: »Denke daran, dass Du sterblich bist«. Die Bevölkerung durfte dem Helden während seines Triumphzugs ungestraft Beschimpfungen, Beleidigungen und Anzüglichkeiten zubrüllen.
In den Theatern wurden Tragödien und Komödien in der Tradition der griechischen Vorbilder aufgeführt. Es ging immer um Massenattraktivität. Die Troja-Sage wurde in Rom bevorzugt, denn die Römer glaubten, von den Trojanern abzustammen. Seit ca. 150 v. u. Z. wurde ohne Masken gespielt, Mimik und individueller Ausdruck wurden möglich. Bei den Tragödien bevorzugte das Publikum Musik und tragischen Einzelgesang, die tragische Oper.Ansonsten war beim Publikum vor allem beliebt, was wir heute »Action« nennen: Viel Handlung, möglichst spektakulär.Wenn von einer Schlacht die Rede war, durfte das nicht nur erzählt werden, es mussten Reiter und Fußvolk auf der Bühne zu sehen sein. Wenn es um Eroberungen der Römer ging, wurden Tiere aus den eroberten Gebieten gezeigt. Der Theaterhistoriker Paul Frischauer schreibt: »Es genügte den Römern nicht, von einem Mord zu hören; sie wollten zusehen, wie der dem Tod Geweihte, von einem Dolch getroffen, blutend zu Boden sank.« (S. 423).
Ein weiteres Massenvergnügen waren die Wagenrennen im Circus Maximus, einer riesigen, ovalen Rennbahn. Auch die Wagenlenker verdienten viel Geld. Sie wurden von den politischen Parteien gesponsert, schon damals schmückten sich die Politiker mit Sport-Stars.
Bei großen Anlässen fanden im Circus auch Tierhetzen statt, Löwen und Panther wurden in Show-Veranstaltungen zu Tode gehetzt, oder sie wurden, ebenso wie Krokodile, Nilpferde, Nashörner, Elefanten, von Gladiatoren im Kampf getötet. Wilde Tiere zerfleischten sich gegenseitig. In seinem Lebensbericht rühmte sich Augustus, acht Gladiatoren-Festspiele mit insgesamt 10.000 Kämpfern aufgeführt zu haben, außerdem 26 Tierhetzen mit insgesamt 3.500 erlegten Tieren (Andresen et al. 1995)
Ein nie endender Interessenkampf: »verkehrte Welt« gegen herrschende Ordnung
Zur Zeit des Augustus feierten die Römer ab dem 17. Dezember drei Tage lang ein dionysisches Fest, die Saturnalien. Während der Saturnalien durfte nicht gearbeitet werden, Schulen und Gerichte waren geschlossen, es durfte keiner hingerichtet und kein Krieg geführt werden.Die Saturnalien produzierten ein Bild der »verkehrten Welt«.Die Sklaven waren »frei«: Die Herren mussten die Rolle von Dienstboten einnehmen und die Sklaven bedienen. Sie mussten von ihren Sklaven in der Öffentlichkeit Befehle entgegennehmen, vor ihnen singen, tanzen und, zur Begeisterung der Zuschauer, unzüchtige Posen einnehmen. Den Sklaven wurde gestattet, den Herren alles zu sagen, was sie wollten. Die Herren durften ihre Sklaven später deswegen nicht bestrafen.
Die Möglichkeit des Rollentauschs ließ die Utopie von einem goldenen Zeitalter sichtbar werden, in dem alle Menschen alles können und gleich sein könnten.Das Fest war ursprünglich ein eintägiges Bauernfest zum Ende der Feldarbeit gewesen und wurde später auf sieben Tage ausgedehnt. Es hielt sich bis zum Ende der Antike. Im Mittelalter wurde es als Narrenfest an Weihnachten gefeiert. Es lebte im 19. Jahrhundert als »Karneval« wieder auf.
Die Massen: Proletarier und Sklaven
Im Römischen Reich gab es vier soziale Schichten:
Patrizier:das waren Adelsgeschlechter, die Oberschicht. Sie hatten den meisten Grundbesitz und sie beherrschten die hohen Ämter, stellten die Senatoren. Ihre Ratsversammlung war der Senat in Rom. Die Patrizier stellten die obersten römischen Beamten, die beiden Konsuln, die sich gegenseitig beaufsichtigten. Sie wurden für ein Jahr gewählt. Die Angehörigen der Oberschicht wurden von Augustus veranlasst, viel Geld für die öffentlichen Bauten, Tempel, Statuen, Bilddarstellungen, Theateraufführungen, Gladiatorenkämpfe etc. zu spenden. Die Stifter fungierten auch als Priester bei den Kaiserfesten, die die Rituale vollzogen und die Spiele eröffneten.
Plebejer,auch »Plebs« genannt: freie Bürger, Handwerker, freie Bauern. Heute würde man diese Teile der Bevölkerung die »Mittelschicht« nennen. Eine reiche Schicht innerhalb der Plebs waren die vornehmen Geschäftsleute, die equites. Sie waren reich, weil der politisch engagierten Adelsschicht bestimmte Geldgeschäfte, die Einziehung von öffentlichen Einkünften, verboten waren. Die Vertretung der Plebejer war die Volksversammlung. Ihre gewählten Vertreter waren die Tribunen. Wie die Konsuln wurden sie für ein Jahr gewählt.
Oberschicht und Mittelschicht sprachen im gesamten römischen Reich Latein und dachten »römisch«.
Proletarier:die besitzlosen, rechtlosen Landarbeiter und Arbeitslosen. Das einzige, was sie besaßen, war Nachkommenschaft, »proles« genannt, daher der Name »Proletarier«. Die Landarbeiter schufteten als Abhängige auf den großen Landgütern, den Latifundien. Die vielen Arbeitslosen in den Städten wurden mit kostenlosen Getreideabgaben ernährt und mit öffentlichen Spielen unterhalten, sie erhielten »panem et circenses«.
Sklaven:Die für die Latifundien benötigten Sklaven wurden von Seeräubern aus Kleinasien und dem Schwarzen Meer geliefert.
Die Unterschicht dachte und sprach nicht lateinisch-römisch, sondern keltisch, illyrisch, britisch, phrygisch, lydisch etc., die Sprachen ihrer Herkunftsländer.
Informations-Medien
Nicht öffentlich, keine Massenmedien: Post, Zeitungen
Es gab in der römischen Kaiserzeit zwar öffentliche Propaganda-Bilder, Spiele etc., aber keine Nachrichten, so wie wir das heute täglich gewohnt sind. Es gab zwar öffentliche Räume, Versammlungen, Ankündigungen von Gladiatorenkämpfen, aber keine öffentlichen Informationen über das politische und gesellschaftliche Tagesgeschehen. Die kaiserliche Politik und auch die Gesellschaft der Oberschicht waren ein Arkanbereich, d. h. mehr oder weniger geheim. Auch jene Nachrichten, die über weite Strecken übermittelt wurden, waren für die breite Bevölkerung unzugänglich, sie interessieren uns hier nur, weil damit erste Infrastrukturen der Informationsverbreitung geschaffen wurden.
Zur Übermittlung von Nachrichten gab es in der Antike Brieftauben, Flaggensignale, Feuersignale, Läufer und auch eine Pferde- oder Schiffspost. Augustus organisierte auch eine Staatspost, genannt »cursus publicus«. Sie beförderte nur amtliche Briefe. Jene wurden auf Holz-, Metall- oder Wachstäfelchen, Tonscherben, Leinen, Leder, Papyrus oder Pergament geschrieben. Es gab staatliche Postboten, »tabelarii« genannt. Für sie standen Wagen und Pferde an den großen Straßen bereit, die Kosten mussten die Provinzverwaltungen bezahlen. Befördert wurden auch Personen. Der Begriff »Post« entstand aus der damaligen Bezeichnung der Stationen als »posita statio«, Depot-Station. Die kaiserliche Post schaffte pro Tag ca. 75 km, bei dringenden Nachrichten ging es noch schneller. Eine dringende Nachricht brauchte von Rom nach Mainz nur 7 Tage.
Vorläufer des Plakats: Dipinti
Es gab auch öffentliche Verlautbarungen: Ab 59 v. u. Z. ließ Caesar dieacta diurna senatus et populiveröffentlichen, die täglichen Berichte über die römischen Senatssitzungen und Volksversammlungen und deren Beschlüsse, Reden, Urteile. Sie wurden auf eine mit Gips geweißte Holztafel geschrieben, die vor dem Kapitol aufgestellt wurde. Abschriften wurden an alle römischen Städte gesandt. Private Unternehmer schrieben sie ab, fügten sonstige Nachrichten aus der Stadt hinzu und verkauften sie im gesamten Römischen Reich. Diese Korrespondenzen wurden auch in den Provinzen regelmäßig bezogen. Manche sehen in ihnen die ersten »Zeitungen«, was nicht sinnvoll ist, denn es gab kein breites öffentliches Publikum. Im Jahr 1, unter Kaiser Augustus, wurden diese Korrespondenzen zu einem Organ kaiserlicher Propaganda. Die Veröffentlichung der Senatsprotokolle wurde abgeschafft, in den Korrespondenzen durften nur noch die Taten der kaiserlichen Familie gerühmt werden.
Es gab weiß gekalkte Wände, auf die mit schwarzer oder roter Farbe Wahlaufrufe gemalt wurden, Ankündigungen von Gladiatorenkämpfen und Theateraufführungen, Gasthausempfehlungen, private Bekanntmachungen, Vermietungs-Angebote, Verlustmeldungen.
Heute nennt man das Plakate oder Graffiti. Im 1. Jahrhundert sprach man von »Dipinti«, von Wandmalereien. Man malte diese Dipinti auch auf Hausfassaden, wobei man wenig Rücksicht auf die dort angebrachten Malereien nahm. In Pompeji hat man solche Schriftmalereien ausgegraben. Es gab dort Wahlaufrufe wie »Die Fischer schlagen Popidius Rufus als Aedilen [Stadtdezernenten] vor.« Eine andere Schrift: »Die Holzarbeiter und Holzkohlenverkäufer bitten euch, Marcellinus zu wählen.« Eine andere, über einem Wandgemälde angebrachte Schrift ist ebenfalls eine Wahlkampfparole: »Cuculla will C. Iulius Polybius als Duovirn [Gemeinderat].« Und darunter eine Schrift: »Ich fordere Euch auf, Holocinius Priscus zum rechtsprechenden Duovirn zu wählen. Er ist der öffentlichen Verwaltung würdig.« Die Schriften wurden von den Kandidaten, von Privatleuten und von Vereinen in Auftrag gegeben. Es gab auch Schriften, die populäre Schauspieler ehrten: »Actus, komm bald wieder!« und die Inschrift: »Bovios gibt den Christen, diesen grausamen Hassern, Kredit«. (Durant, Bd. 5, S. 26; Varone 1993; zur Westen, S. 14)
In Pompeji hat ein professioneller Schriftenmaler eine Anzeige, die für einen Gladiatorenkampf warb, signiert mit »Scr. Aemilius Celer singulus ad lunam«, »Das schrieb Aemilius Celer allein bei Mondschein«.