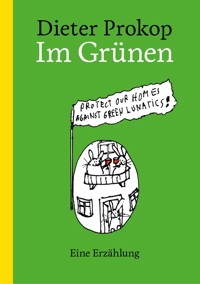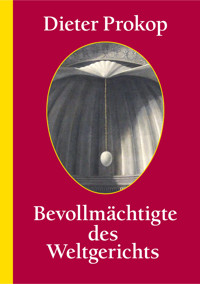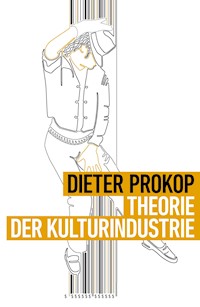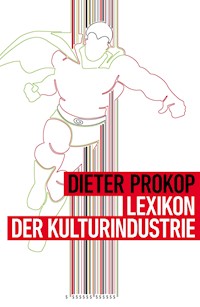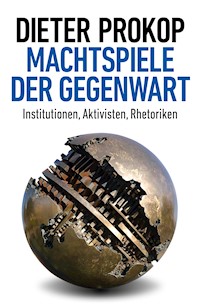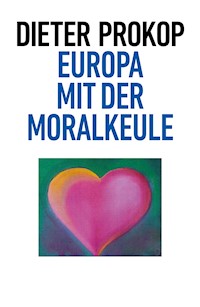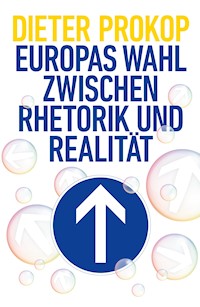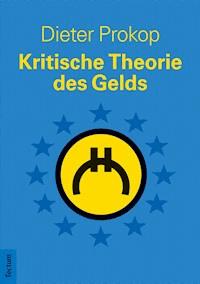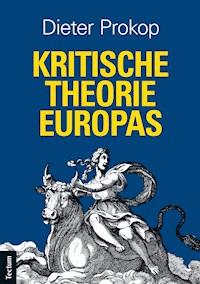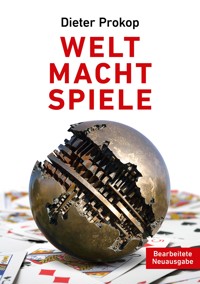
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Hier stehen rationale Fragen im Vordergrund: die Menschenrechte und Bürgerrechte. Die universalen Rechte werden in dem Schlagwort »Für alle!« konzentriert. Darüber wird vergessen, dass der rationale Gesellschaftsvertrag auch das »Für mich!« und das »Für uns!« kennt: Eigentum zum Beispiel, ein »Für mich!«, ist ein Menschenrecht. Und es gibt auch ein »Für uns!«: die den Bürgerinnen und Bürgern durch die Verfassungen ihrer Staaten Bürgerrechte real garantierten. Allerdings gibt es den rationalen, demokratischen Gesellschaftsvertrag nur, wenn die Politiker und die Bevölkerungen auch in der Lage und bereit sind, gegenüber der Welt eine rationale sachliche, realitätstüchtige Sicht auf die Sachen, ihren Nutzen, ihren Wert und ihre Qualität einzunehmen. Ohne realistische und realitätstüchtige Sicht der Welt gibt es auch keinen Frieden. Die Weltmacht-Politik bewegt sich von multilateralen Verträgen und damit Freihandelszonen zu bilateralen Aktionen und Verträgen. In dieser Welt wird geblufft und getäuscht, um Vorteile herauszuholen. Das ist eine Welt des Deal-Makings, des Pokerspielens und der Erpressung mittels »Sanktionen«, praktiziert von den Mächtigsten der Welt. Das hängt mit oligopolistischen Wirtschaftsstrukturen zusammen, in denen das Deal-Making und das Bluffen allgemein üblich sind. Das ist nicht harmlos. Beim realen Pokerspiel geht es um viel Geld, aber in der politischen Welt als Pokerspiel geht es um Anderes: um Öl- und Gasvorkommen und Bodenschätze. Damit auch um Bündnisse: NATO, EU versus Eurasische Wirtschaftsunion. Und auch um Infrastrukturen: um die inzwischen zerstörte Northstream 2-Pipeline und in Bezug auf China um die »Neue Seidenstraße.« Diese Welt wird durch die außerhalb der Parlamente zunehmende Macht der Blogger und der NGOs, der Nongovernment Organizations bestimmt. Die politischen Influencer und NGOs sind Selbstvermarkter in den Social media – übergriffige Selbstvermarkter. Sie fordern für sich und ihre Follower Sonderrechte, die über formale Gleichheitsrechte hinausgehen, wie sie in Demokratien mit den Bürgerrechten garantiert werden. Sie kämpfen für »Gleichheit« – doch verstehen sie darunter Quoten. Qualität gibt es für sie nicht, denn Geld und Posten erreichen sie in der Quoten-Gesellschaft auch ohne Qualitfikation. Eine der Gefahren besteht in der Auffassung, dass der moralisch auf der Seite des »Guten« stehende Mensch sich über das Recht und die Gesetze stellen dürfe. Eine andere Gefahr ist die Verdrehung von Realitäts-Wahrnehmung durch Hypes und Hysterien.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Dieter Prokop
WELT MACHT SPIELE
Bearbeitete Neuausgabe
Dieter Prokop ist Professor em. für Soziologie an der Goethe-Universität in Frankfurt.
© 2020, 2023 Dieter Prokop. Aktualisierte und bearbeitete
Neuausgabe von »Machtspiele der Gegenwart. Institutionen,
Aktivisten, Rhetoriken«
Verlag & Druck: tredition GmbH,
Halenreie 40–44 / 22359 Hamburg
ISBN 978-3-347-93765-9 (Paperback)
ISBN 978-3-347-93766-6 (Hardcover)
ISBN 978-3-347-93767-3 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Covermotiv: Sphera Grande von Arnaldo Pomodoro in Pesaro
© Pamela Panella | Dreamstime.com
und Stocksnapper | Dreamstime.com
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Teil 1. Der rationale gesellschaftsvertrag
Über das Zustandekommen gesellschaftlicher Ordnung
Der Mensch als Gott und als Wolf
Warum die Menschen, diese Wölfe, einen Gesellschaftsvertrag abschließen
Die Begrenztheit des göttlichen wie des wölfischen Menschen
In den demokratien: die quintessenz von freiheit. zwischen verschiedenen systemen: die quintessenz von friedlicher koexistenz
»Für alle!« Der rationale Gesellschaftsvertrag auf supranationaler Ebene
Wieso der Westfälische Frieden von 1648 noch heute das Vorbild sein muss
Die UNO als rationaler Wächter der Menschenrechte
Welt-Gerichtsbarkeit: Internationaler Gerichtshof; die Menschenrechts-Gerichte
»Für mich!« In Demokratien ist Eigentum ein Menschenrecht
Individualität, Ichstärke und Eigentum
Allerdings gibt es kein Menschenrecht auf persönliches Lebensglück
»Für uns!« Das soziale Eigentum einer Bevölkerung gehört nicht der ganzen Welt
Sozialleistungen gehören den Staatsbürgern und nur denen, die eingezahlt haben
»Volk« versus »Bevölkerung«
Die fatale Entwicklung der Welt. Wie die Glaubenskämpfer den rationalen Gesellschaftsvertrag zerstören
Die Zerstörung eines vernünftigen »Für alle!«: der »Migrationspakt« und der »Globale Umweltpakt« der UNO
Die Verdrehung des berechtigten »Für mich!«: Staatsknete für Unterwerfung
Das Ende eines vernünftigen »Für uns!«: Pässe und Sozialleistungen für alle
Produktive versus unproduktive Regulierung
Die guten Ziele: Mehr Demokratie wiederherstellen! Mehr friedliche Koexistenz wiederherstellen! Mehr gestaltungsfähige Rationalität entwickeln!
Rationalität will keine Glaubenskämpfe, sondern die Suche nach Gestaltungsfähigkeit
Zweifeln, Vergleichen, Realismus, Realitätstüchtigkeit
Versöhnung. Den Sachen eine rationale Identität geben
Vergleich. Wie das Erkennen objektiver Qualitäten in der Praxis funktioniert
Äquivalententausch. Die materielle und kulturelle Basis von Rationalität
Teil 2. Kritik des weltmacht-pokerspiels
Globalisierung. Freiheit der Weltmärkte, Unfreiheit des Allgemeinwohls
Vom Fordismus zur neoliberalen-marktradikalen Politik
Bekämpfung des Sozialstaats. Die World Trade Organization (WTO)
Pragmatische Verständigung. Die Gipfeltreffen der G7 und G20
Oligopol, deal-making und pokern
Deal-Making statt Gewaltkonkurrenz im Oligopol
Konventionen des pokerns
Bluffs, Täuschung, Unkalkulierbarkeit
Der fatale wechsel von friedlicher koexistenz zu wirtschaftskämpfen, glaubenskämpfen und kriegen
»America First«. Das Deal-Making von Präsident Trump
Die Herstellung von Unkalkulierbarkeit
Neoliberale-marktradikale Politik trotz aller taktischen Schutzzölle
Wie Donald Trump schon als New Yorker Immobilien-Tycoon Poker spielte
China. Pokern mit Bilanzen und mit der »Neuen Seidenstraße«
Präsident XI Jinping, Chef einer Parteidiktatur
Geopolitik. Die weltweiten Interessen Chinas
Bilanzfälschungen. Das Schneeballsystem der faulen Kredite
»Neue Seidenstraße«. Investitionsschub und Handels-Infrastruktur bis Europa
Die corona-weltkatastrophe
Die Pandemie zwischen Pokerspiel und Regierungsversagen
Wenn Jeder sich als Erleuchteter fühlt, der, weil erleuchtet, über den Gesetzen steht
Gefahren leichtsinnigen weltmacht-pokerspiels
Was, wenn der Aufbau von Drohkulissen aus dem Ruder Läuft?
Russlands Kriegspoker gegen das Völkerrecht
Von friedlicher Koexistenz – zu westlicher Übergriffigkeit – zu Russlands Krieg
Der Ukraine-Krieg. Versuch einer objektiven soziologischen Diagnose
Notwendig: die Wiedereinrichtung friedlicher Koexistenz
»America Only«. Präsident Bidens Pokern mit »Sanktionen«
Der Wirtschaftskrieg gegen Russland, China, die Niederlande, Deutschland etc.
Die technologisch erfolgreichen in ostasien; die warlords in nahost; und die geldgierigen eliten in afrika
Die Technologie-Meister. Ein Blick auf Japan, Ostasien, Indien,
Blutrache-Kämpfe von Militärs und Warlords: Nahost, Arabien
Das Desinteresse der Herrscher an ihrer Bevölkerung: Afrikas Fatalität.
Teil 3. Kritik des idealistischen imperativs
Strukturveränderung der Welt-Öffentlichkeit 2.0. Neue Zwänge opportunistischer Selbstvermarktung
Von den alten Medien zu den »Social media« und zur »Identity politics«
Lifestyles – ein Kampfmittel der sich selbst vermarktenden Milieus
Das Basteln an der eigenen Idealbiografie
Die Moralismus-Schauspieler. Der Öko-Lifestyle als frohe Botschaft
Selfies. Die neue Kommunikationspflicht der idealen Selbstdarstellung
Shitstorms. Mit puritanischen Benimmregeln die Welt terrorisieren
Warum man dennoch Katzenvideos nicht verachten sollte
Die »Torheit der Regierenden«
Selbsttäuschung, Wunschdenken
Die Torheit des idealistischen, absoluten, universalistischen Imperativs
Das fatale zerstörungswerk im namen des glaubens und des opportunismus
»Flüchtlingskrise«. Die Torheit des »Welt ohne Grenzen«-Hypes
Flüchtlinge versus illegal eingereiste Sozialleistungs- und Spenden-Akquisiteure
Alles mit allen Menschen auf dem Globus teilen
Ein »humanitärer Imperativ« mit weltmissionarischer Absicht
Moral versus Moralismus
Der kategorische Imperativ: zu militant für die Demokratie
Deutsche Egozentrik
Der lockere Umgang der Regierung mit dem Grundgesetz
Migranten als Niedriglohn-Dienstboten. Das deutsche »Fachkräfteeinwanderungsgesetz«
Die Notwendigkeit einer EU-Grenzschutzpolizei und das Desinteresse der EU-Grenzstaaten
Wie die Regierung Scholz 2022 Merkels Willkommenskultur wiederholte
Mittepopulismus
Populismus ist heute nicht mehr wie bei Mussolini, Hitler und Riefenstahl
Warum Stimmungs-Werbung die falsche Wahlkampfstrategie ist
»Gesellschaft der Singularitäten«. Wenn Soziologen ignorieren, dass Menschen denken
Warum die »Gesellschaft der Singularitäten« eine der »Generalitäten« ist
Der »Nudge«-Schnickschnack
Die postmoderne Zerstörung von Objektivität und Qualität
Objektivität versus »Framing«, »Wording« etc.
»Dekonstruktion«: Alles nur »Erzählung«?
Der seltsame »Konsens«, der in Wirklichkeit Opportunismus ist
»Klimakrise«. Der Größenwahn der »Rettet die Welt«-Hysterie
Vernünftige Ökologie versus propagandistischer Ökologismus
Die Tatsache: 0,87 Grad Celsius globale Erwärmung seit der kleinen Eiszeit
Die Tatsache: 8 CM Anstieg des globalen Meeresspiegels
Der seltsame apokalyptische »Konsens«. Wenn »Experten« in Wirklichkeit Lobbyisten sind
»Vorsorge« – wichtiger als jede Tatsache?
Die ökologistische Zerstörung von Wirtschaft und Industrie
Lobbyisten des Katastrophismus: WWF, Club of Rome, IPCC und andere
Der Katastrophismus der UNO als zerstörerische Kraft
Das fatale Verbandsklagerecht. Von der Aarhus-Konvenstion der UNO zur Deutschen Umwelthilfe
Wenn Richter ökologistische Glaubensfragen über alles Andere stellen
Weitere Lobbyisten des Katastrophismus: die Regierung, die Solar- und Windkraftindustrie
Fridays for Public Relations. Awareness schaffen mittels eines Gesetzesbruchs
»Green Deal«. Auch die EU und die EZB auf dem Weg zur Weltrettungs-Religion
Propaganda fide. Die Verbreitung des Glaubens
Kugel-Ontologie. Und: Wie jetzt statt Gott »der Mensch« die beste aller Welten schafft
Der Mensch als Schöpfer? Aber: Im Schöpfungsmythos gibt es keine Demokratie
Apokalypsen-Gnosis. Und: Wie jetzt »der Mensch« sogar das Ende der Welt aufhält
Apokalypsen-Gnosis im Bundesverfassungsgericht
Wie das BVerfG die Klimakatastrophen-Propaganda zur Staatsreligion erklärte
Unglaublich: ein Urteil ohne Faktencheck
Impossibilium nulla obligatio – Unmögliches ist nicht verpflichtend
»Verhaltensweisen erheblich umgestalten«: die Kompetenz-Anmaßung des BVerfG
Trostlos. Der fatale Weg zur »Konsensdemokratie« und zum Klientel-Versorgungsstaat
Warum »Konsensdemokratie« nicht akzeptabel ist
»Identity politics«. Von der toleranten Multikultur zur intoleranten »Diversity«
Wenn Zielgruppen zurückschießen
Die Macht der NGOs. Der Missbrauch der Begriffe »Nichtregierungsorganisation« und »Zivilgesellschaft«
Wie Fernsehjournalisten die NGOs zu quasi-parlamentarischen Parteien machten
»Räte« überall, die nicht einmal so demokratisch wie ein Stadtrat sind
Wo »Klientel« ist, ist immer auch ein Fressnapf
Kurzes Schlusswort
Literatur
Welt Macht Spiele
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Das zustandekommen gesellschaftlicher ordnung
Literatur
Welt Macht Spiele
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
TEIL 1
DER RATIONALE GESELLSCHAFTSVERTRAG
»Das Publikum ist nicht dumm; es bietet seinerseits dem Wahnsinn Trotz, der auf seine Kosten lebt.« Voltaire ([1766] 1970: 183)
DAS ZUSTANDEKOMMEN GESELLSCHAFTLICHER ORDNUNG
Der Mensch als Gott und als Wolf
Der rationale Gesellschaftsvertrag ist mehr als eine rationalistische Idee und ein Rechtssystem. Er ist eine Institution der Friedenssicherung in einer Welt von Wölfen.
Wirtschaft, Politik, Gesellschaft sind Systeme der überindividuellen Ordnung, auch des Friedens. Sie sind jedoch auch Systeme der egoistisch verfolgten Interessen. Thomas Hobbes hatte das im 17. Jahrhundert im Rahmen der Frage nach der »Natur des Menschen« in der Form einer Antinomie ausgedrückt, also als Widerspruch zweier Sätze, von denen jeder Gültigkeit beanspruchen kann. Hobbes schrieb:
»Nun sind sicher beide Sätze wahr: Der Mensch ist ein Gott für den Menschen, und Der Mensch ist ein Wolf für den Menschen; jener [d. h. ein Gott], wenn man die Bürger untereinander, dieser [d. h. ein Wolf], wenn man die Staaten untereinander vergleicht. Dort [d. h. bei den Bürgern untereinander] nähert man sich durch Gerechtigkeit und Liebe, die Tugenden des Friedens, der Ähnlichkeit mit Gott; hier [d. h. bei den Staaten untereinander] müssen selbst die Guten bei der Verdorbenheit der Schlechten ihres Schutzes wegen die kriegerischen Tugenden, die Gewalt und die List, d. h. die Raubsucht der wilden Tiere, zu Hilfe nehmen.« ([1642] 1959: 59, Kursivierung im Original, [ ] hinzugefügt)
Warum die Menschen, diese Wölfe, einen Gesellschaftsvertrag abschließen
Innerhalb eines Staats:
Gott für den Menschen kann der Mensch innerhalb eines Staats sein. Denn, so Hobbes, hier besteht die Möglichkeit, dass die Menschen als Wölfe irgendwann doch den rationalen Gesellschaftsvertrag realisieren – trotz des im Naturzustand bestehenden Kriegs aller gegen alle, also trotz des wölfischen Überlebens- und Verteilungskampfs. Wenigstens sind die Wölfe im Rahmen ihres eigenen Lebenszusammenhangs – im Klartext: im Rahmen des Staats, in dem sie leben – daran interessiert, Frieden herzustellen. Weil sie einsehen, dass ein Gesellschaftsvertrag besser ist, als sich gegenseitig umzubringen. Deshalb beschließen die Wölfe, sich – in ihrem Staat – einem Herrscher oder einem Gremium von Herrschern unterzuordnen. Ein derart rationaler Gesellschaftsvertrag ist also nichts Altruistisches. Was dem Allgemeinwohl dient, dient auch dem Eigeninteresse der Einzelnen. Dabei sind die Wölfe so schlau, sich dem Herrscher oder dem Gremium von Herrschern nicht total zu unterwerfen, denn der Vertrag gilt – jedenfalls stellte Hobbes sich das so vor – nur, solange vertragsgetreu regiert wird. Falls der Herrscher das nicht mehr tut, können die Wölfe ihn absetzen.
Der Mensch kann sich also, so Hobbes, aus einem wölfischen, barbarischen Zustand durch einen Akt der Vernunft befreien, der von gleichsam göttlicher Freiheit ist. Das ist »der Mensch als Gott für den Menschen«.
Gemeint ist hier nicht der willkürlich, strafsüchtig, launenhaft agierende Gott des Alten Testaments. Sondern: Ein Gott für den Menschen wird der Mensch, indem er einen Rechtszustand einrichtet. (Einen Rechtszustand, also keinen rigorosen Imperativ.) Das bedeutet auch: Das »Göttliche« des Menschen für den Menschen besteht in der Institutionalisierung von Recht und Gesetzen.
Zwischen den Staaten:
Zwischen den Staaten sah Hobbes keine Chance für einen rationalen Gesellschaftsvertrag. Dort sah er stets die Gefahr eines wölfischen Kriegs aller gegen alle. Die Möglichkeit einer Art Welt-Ordnungsmacht, eines Welt-Leviathans war 1651 nicht gegeben. Auf supranationaler Ebene bleibt der Mensch ein Wolf für den Menschen. (s. Kissinger 2016: 43)
Ist Hobbes heute wirklich noch von Bedeutung?
Ja. Hobbes’ Aktualität besteht darin, dass er dem heutigen Trend entgegengesetzt ist, sehr viel edlere und umfassendere, aber auch weniger realitätstüchtige Gesellschaftsverträge zu entwerfen. Heute entwirft man gern Idealgesellschaften, in denen sich die Gutmenschen dieser Welt zu einer durch und durch altruistischen Welt zusammentun. (s. z. B. Hardt und Negri 2018; Piketty 2020) Das ist zwar schöner als Hobbes’ Vorstellung, dass der Mensch als Wolf für den Menschen nur aus einer Notsituation heraus zur Rationalität eines Gesellschaftsvertrags greift. Aber es ist unrealistisch, wenn heute der Glaube gepflegt wird, dass die Welt vor allem von edlen Schafen bevölkert sei. (Abgesehen von den schwarzen Schafen, die man mit Moralkeulen und Therapien in Schach halten möchte oder mit Maulkörben und Verboten.) Die edlen Schafe sind ziemlich dumm, wenn sie glauben, alle Schafe könnten kostenlos das Gras des Nachbarn fressen. Und wenn manche dieser Schafe behaupten, man müsse und könne überall eine »Einbeziehung des Anderen« leisten, also ungeheuer sensibel durch die Welt gehen – dann ist das mehr als unrealistisch. Was ist, wenn »der Andere« ein Täuscher und Betrüger, also ein Wolf im Schafspelz ist? Und wenn »das Andere« der Täuschung und dem Betrug dient? (s. von Matt 2008)
Wölfe sind bekanntlich keine Vegetarier.
Die Begrenztheit des göttlichen wie des wölfischen Menschen
Hobbes ist bis heute aktuell, weil sein Gesellschaftsvertrags-Modell Vernunft nahelegt, das aristotelische Maßhalten – also das Wissen, dass es, wenn man an Wirtschaft, Politik und Gesellschaft Forderungen stellt, auch Grenzen gibt. Folgende Grenzen:
»Der Mensch als Gott für den Menschen« muss sich dessen bewusst sein, dass es die Freiheit der Allmächtigkeit immer nur imaginär und das immer nur für Gott (bzw. den höchsten der Götter) gibt. Für die realen Menschen gibt es keine Allmacht. (Wenn es stimmt, dass die Verschiebung der Erdachse für das Schmelzen der Gletscher verantwortlich ist, werden selbst deutsche Jugendliche es nicht schaffen, die Erdachse wieder zurück zu schieben.)
»Der Mensch als Wolf für den Menschen« muss sich bewusst sein, dass auch Wölfe den von ihnen eingerichteten rationalen Gesellschaftsvertrag pflegen müssen. Wird er nicht gepflegt, kann jederzeit der Krieg aller gegen alle wieder ausbrechen: heute im weltweiten »Raubtierkapitalismus« der Monopole und Kartelle; oder im Rahmen der illegalen Migration; oder im Rahmen eines Weltkriegs.
Mit einem Vertrag der Wölfe ist es nicht getan.
Die Grenzen des Menschen als Gott ebenso wie die des Menschen als Wolf für den Menschen: Eins war an Hobbes zu kritisieren: Ein rationaler Gesellschaftsvertrag erfordert mehr als autoritäre Herrscher oder ein herrschendes Gremium, also mehr als den Leviathan. Nach der zweiten englischen Revolution (1689/1690); nach dem Sieg des englischen Parlaments und der Einsetzung des kooperationswilligen Königs William III – also ca. 40 Jahre nach Hobbes – machte John Locke klar, dass zum rationalen Gesellschaftsvertrag der Parlamentarismus gehört, (s. Locke 1689/1690) Später fügte Montesquieu die unabhängige Gerichtsbarkeit hinzu. (s. Montesquieu 1748)
In England waren allerdings im 18. Jahrhundert das Parlament, die Justiz und die Regierungsämter Institutionen, in die sich der Adel und die Großbürger einkauften. Erst 1776, in der amerikanischen Revolution und 1789 in der französischen, erhielt der rationale Gesellschaftsvertrag etwas mehr innenpolitische Realität. Und was den supranationalen Bereich betrifft, realisierte sich der rationale Gesellschaftsvertrag im Ansatz erst ca. zweihundert Jahre danach im Rahmen der UNO.
Fazit:
Die Beschränktheit des Gott-Menschen wie des Wolfs-Menschen erfordern Bürgerrechte, rationale Debatten, Verhandlungsstrategien, gemeinsame Verträge aller und damit gemeinsame, angemessene und auch von Politikerinnen und Politikern, Richterinnen und Richtern angemessen zu praktizierende Rechtszustände.
Rechtszustände! Also kein Rüberschieben von Staatsgeldern, Quoten, Privilegien.
IN DEN DEMOKRATIEN: DIE QUINTESSENZ VON FREIHEIT. ZWISCHEN VERSCHIEDENEN SYSTEMEN: DIE QUINTESSENZ VON FRIEDLICHER KOEXISTENZ
Die Quintessenz des rationalen Gesellschaftsvertrags – wie von Rationalität überhaupt – hat zwei Seiten.
Einerseits gehört zur Quintessenz des rationalen Gesellschaftsvertrags die Demokratie im Inneren jener Staaten, die Demokratien sind. Hier ist in allen demokratischen Institutionen, von der Legislative zur Exekutive, zur Judikative bis zur Medien-Öffentlichkeit das, was Hobbes’ Gesellschaftsvertrag ausmacht: Rationalität. rationales Denken und Handeln.
Andererseits gibt es für den Weltfrieden noch eine andere Möglichkeit als den supranationalen Leviathan. Vorbild konnte bereits 1648 auch der Westfälische Frieden sein, Vorbild für eine friedliche Koexistenz der unterschiedlichsten politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Systeme. Vorbild können bis heute auch die Beziehungen zwischen den USA und China sein, die Präsident Nixon und Außenminister Kissinger einst einleiteten, mit Mao Zedong auf chinesischer Seite. (s. Kissinger 2012): Kooperation dort, wo es möglich ist und ansonsten Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten.
»FÜR ALLE!« DER RATIONALE GESELLSCHAFTSVERTRAG AUF SUPRANATIONALER EBENE
»So setzt sich in der Herrschaft das Moment der Rationalität als ein von ihr auch verschiedenes durch. Die Gegenständlichkeit des Mittels, die es universal verfügbar macht, seine ›Objektivität‹ für alle, impliziert bereits die Kritik von Herrschaft, als deren Mittel Denken erwuchs.«
Horkheimer und Adorno: Dialektik der Aufklärung (1944: 51)
Wieso der Westfälische Frieden von 1648 noch heute das Vorbild sein muss
Hobbes hatte 1642 über bürgerliche Freiheiten (»Vom Menschen, vom Bürger«) geschrieben. 1649 war der Höhepunkt der ersten englischen Revolution und die Hinrichtung des Königs Charles I. 1651 erschien der Leviathan. Hobbes war so mutig, als Ordnungsmodell gegen das Chaos den rationalen Gesellschaftsvertrag mitsamt einem König zu empfehlen. mit dem Thema »Mensch als Gott, Mensch als Wolf«. Das war zwei Jahre nach der ersten englischen Revolution. Drei Jahre vorher, 1648, hatte der »Westfälische Frieden« den dreissigjährigen Krieg beendet.
Die Friedensverträge von Münster und Osnabrück begründeten in Europa den rationalen Gesellschaftsvertrag auf supranationaler Ebene. Sie begründeten das, was man heute »friedliche Koexistenz« nennt. Mit ihnen wurde die wechselseitige Anerkennung der Souveränität von Nationalstaaten der unterschiedlichsten Art beschlossen: Spanien und Frankreich waren absolutistische, katholische Königreiche. Schweden war eine protestantische Monarchie, und die Niederlande hatten zwar einen »Erbstatthalter« als König, aber auch eine mächtige parlamentarisch agierende »Kaufmannsbourgeoisie«. Im Westfälischen Frieden wurden die Niederlande als erster bürgerlicher Staat in Europa anerkannt. Als Erbstatthalter regierte in den Niederlanden Wilhelm von Oranien rg. (1674–1702), der zugleich im parlamentarisch regierten England als König William III regierte (rg. 1689–1702;).
Souveräne Staaten und Respektierung der Souveränität aller Vertragsstaaten; das bedeutete auch: keine Einmischung in die innere Struktur der Anderen, so unterschiedlich jene in ihren politischen Systemen auch sein mögen. Sondern friedliche Koexistenz. Und wechselseitigen Handel und sonstige wechselseitige Beziehungen dort – und nur dort –, wo das von beiden erwünscht ist.
Allerdings stellte der Westfälische Frieden zwar eine neue internationale Rechtsgrundlage dar, aber es fehlte damals die supranationale Ordnungsmacht, der Welt-König. Auch ein Welt-Gremium, das die Kontrolle hätte übernehmen können, gab es nicht.
Das gab es erst dreihundert Jahre später mit der UNO als Welt-Gremium, selbst wenn sie bis heute nicht die Macht eines Welt-Leviathans besitzt.
Die UNO als rationaler Wächter der Menschenrechte
Was sind die Menschenrechte? Inwiefern führen sie zu einklagbaren Ansprüchen? Inwiefern sind sie bloß emphatische Ideale?
In der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 und der französischen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 waren die Menschenrechte keine rechtsverbindliche Sache, sondern eine Aufzählung von Freiheitsrechten der Bürger. (An die Bürgerinnen dachte man damals nicht. s. von Braun 2001) Auch die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte durch die UNO von 1948 – in ihrer Generalversammlung in Paris – waren Empfehlungen. Immerhin wurde in den Empfehlungen die Gleichheit aller Menschen in ihrer Würde erstmals ausgesprochen. Im deutschen Grundgesetz wurde das übernommen: »Die Würde des Menschen ist unantastbar.« Aber erst als der Europarat 1950 die Europäische Kommission für Menschenrechte beschloss (der Vertrag trat 1953 in Kraft) und danach den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einrichtete, begann die Arbeit daran, einen Teil der zuvor erklärten Menschenrechte rechtsverbindlich zu machen.
Die UNO, United Nations Organization, gegründet 1945 mit Sitz in New York und Genf und heute auch mit Niederlassungen in Paris, Wien, Nairobi, Bonn etc. hat die Aufgabe, für den Frieden in der Welt zu sorgen. Die UNO kann aus dem Militär der UNO-Mitgliedstaaten Friedenstruppen zusammenstellen, aber sie hat kein eigenes Militär. Das bedeutet, dass Vieles, was die UNO-Vollversammlung beschließt, lediglich einen moralischen Charakter hat. Aber der Sicherheitsrat der UNO kann auch völkerrechtlich verbindliche Entscheidungen treffen. Die UNO kümmert sich in eigenen Organisationen um die friedliche Nutzung von Atomenergie und die Eindämmung von deren militärischer Nutzung (IAEO, Sitz in Wien); um den Schutz von Kindern (UNICEF); um Kultur und die Bewahrung des »Kulturerbes der Menschheit« (UNESCO); um internationale Arbeits- und Sozialnormen, die soziale Gestaltung der Globalisierung (IAO); um die Ernährungsprobleme in der Welt (FAO); um die Flüchtlingshilfe (UNHCR); um die Umwelt (UNEP) – und nicht zuletzt um die Menschenrechte (OHCHR, Office of the High Commissioner for Human Rights).
Erst 1966 wurde mit zwei von der UNO-Generalversammlung beschlossenen Pakten eine gewisse Rechtsverbindlichkeit von Teilen der Menschenrechte weltweit (bei den Unterzeichner-Staaten der Pakte) institutionalisiert: mit dem Pakt über politische und bürgerliche Rechte (auch »Zivilpakt« genannt). Zugleich wurde ein weiterer Pakt beschlossen: der Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (auch »Sozialpakt« genannt). Beide traten erst 1977 in Kraft, nachdem sie von der notwendigen Anzahl von Staaten ratifiziert worden waren.
Was bedeutet es, dass »Teile der Menschrechte« rechtsverbindlich gemacht wurden? Welche Teile? Welche nicht?
Der UNO-Pakt über politische und bürgerliche Rechte von 1966/1977 (»Zivilpakt«):
Er enthält unter Anderem das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit; den Schutz vor Folter; das Recht auf Freiheit, Eigentum und Sicherheit der Person; die Unverletzlichkeit der Wohnung, des Briefgeheimnisses etc.; Meinungsfreiheit; die Gedanken- Gewissens- und Religionsfreiheit; Reise- und Versammlungsfreiheit; Informationsfreiheit; Berufsfreiheit und auch Rechte bei Gerichtsverfahren. Diese Rechte sind in den Unterzeichner-Staaten gerichtlich einklagbar.
Der UNO-Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte von 1966/1977 (»Sozialpakt«):
Er bezieht sich auf weitere Menschenrechte: das Recht auf Selbstbestimmung; die Gleichberechtigung von Mann und Frau; das Recht auf Arbeit und angemessene Entlohnung; auf die Gründung von Gewerkschaften; auf soziale Sicherheit; das Recht auf den Schutz der Familie, der Schwangeren, der Mütter und Kinder; das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard; auf ein Höchstmaß von Gesundheit; das Recht auf Schulbildung und auf Teilhabe am kulturellen Leben. Auch dieser Pakt ist für die Unterzeichnerstaaten rechtsverbindlich.
Nur: Die UNO selbst kann die Einhaltung beider Pakte nur überwachen. Zuständig hierfür ist das OHCHR, das Hohe Kommissariat für Menschenrechte der UNO in Genf. Es kann Beobachter in die Vertragsstaaten entsenden. Die Staaten müssen periodisch über die Menschenrechtssituation in ihrem Staat berichten. (Das OHCHR nimmt auch Berichte von NGOs an.) Aber durchsetzen kann die UNO all diese Rechte nicht.
2005 beschloss die UNO-Generalversammlung rechtsverbindlich, dass die Staaten eine »Responsibility to protect« gegenüber ihren Staatsangehörigen haben. Das bedeutet nicht, dass der Staat Krankenhäuser bauen muss oder Bewässerungssysteme oder Dämme gegen regelmäßige katastrophische Überflutungen. Es bedeutet lediglich die Pflicht, den Schutz der Souveränität und den Schutz vor fremden staatlichen Angriffen auf das Leben ihrer Staatsangehörigen zu gewährleisten.
Welt-Gerichtsbarkeit: Internationaler Gerichtshof; die Menschenrechts-Gerichte
Zur Durchsetzung supranationalen Rechts bzw. der Menschenrechte wurden auch mehrere Gerichte institutionalisiert:
Im Rahmen der UNO: der Internationale Gerichtshof in Den Haag:
Er wurde 1945 im Rahmen der Charta der UNO gegründet und ist deren »Hauptrechtsprechungsorgan«. An ihn können sich nur Staaten wenden, die UNO-Mitglieder sind oder das Statut des Internationalen Gerichtshofs ratifiziert haben. Seine Entscheidungen können nur über den UNO-Sicherheitsrat durchgesetzt werden. Verhandelt wurden z. B. die Besetzung Namibias durch Südafrika; die Atomwaffentests Frankreichs im Mururoa-Atoll; Schürfrechte und Fischereirechte in der Nordsee; Entschädigungsleistungen Deutschlands für NS-Verbrechen etc.
Ad-hoc-Gerichte (»Kriegsverbrechertribunale«) der UNO in Den Haag:
Das ist das Internationale Strafgericht für das damalige Jugoslawien und das Internationale Strafgericht für Ruanda. Diese von der UNO eingerichteten Strafgerichte sind nur für die jeweiligen Konflikte zuständig. Sie wurden vom UNO-Sicherheitsrat eingerichtet.
Außerhalb der UNO: der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag:
Er wurde 1998 auf der Grundlage eines multilateralen, völkerrechtlich verbindlichen Vertrags gegründet, des Römischen Statuts. Das Gericht ist für Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit und für Kriegsverbrechen zuständig. Der Internationale Strafgerichtshof ist den nationalen Gerichtsbarkeiten untergeordnet, er kann also eine Straftat nur verfolgen, wenn eine nationale Strafverfolgung nicht möglich ist. Er begann seine Arbeit 2003. Verfahren wurden vor allem gegenüber afrikanischen Regierungen durchgeführt, initiiert entweder durch die Regierungen selbst oder durch den UNO-Sicherheitsrat oder durch eigene Initiative des Gerichts.
Das Römische Statut für den Internationalen Strafgerichtshof wurde von allen Staaten der EU unterzeichnet. Nicht beigetreten sind die USA, China, Indien, Russland, die Türkei und Israel. (Nichtbeitritt kann hierbei auch bedeuten: Unterzeichnung ohne Ratifizierung; Beitritt und anschließender Wiederaustritt.) Angesichts von Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs über mögliche Kriegsverbrechen der USA in Afghanistan erließen die USA 2019 Sanktionen gegen die Richter und Staatsanwälte des Gerichts (Einreiseverbote, Visa-Entzug).
Im Rahmen des Europarats: der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg:
1950 beschloss der Europarat in Straßburg, die Europäische Kommission für Menschenrechte einzurichten. Sie nahm 1953 ihre Arbeit auf. Auf dieser Grundlage wurde 1959 der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte initiiert, der 1998 zur dauerhaften Institution wurde. 1998 wurde die Europäische Kommission für Menschenrechte aufgelöst, weil sie mit der dauerhaften Institutionalisierung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte überflüssig wurde. Bei diesem Gerichthof können seit 1998 auch Einzelpersonen Klage erheben, wenn in einem Unterzeichnerstaat ein die Einzelperson betreffendes Recht aus der Europäischen Menschenrechtskonvention verletzt wurde. 2004 ging es zum Beispiel um die Klage von Prinzessin Caroline von Hannover (Schwester des Fürsten Albert von Monaco). Deutsche Gerichte hatten die Veröffentlichung von heimlichen Aufnahmen der Kinder der Prinzessin als zulässig eingestuft. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte urteilte, dass dadurch das Recht der Klägerin auf Achtung des Privatlebens verletzt worden sei.
Auch abgelehnte Asylbewerber können vor diesem Gerichtshof klagen.
Die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte sind in den Mitgliedstaaten des Europarats rechtsverbindlich, müssen also von den Staaten durchgesetzt werden.
»FÜR MICH!« IN DEMOKRATIEN IST EIGENTUM EIN MENSCHENRECHT
»Der kluge Mann der Gegenwart sagt: ›Was hat denn die Nachwelt für mich getan? Nichts! Gut, dass nämliche tu ich für sie.‹« In Nestroys Posse »Judith und Holofernes« (1849: 101): Gottlieb Heb, Neffe des armen Buchbinders Pappinger.
Individualität, Ichstärke und Eigentum
»Mündige Bürger«, »mündige Bürgerinnen« gibt es nur, wenn es ökonomische, politische, gesellschaftliche Infrastrukturen gibt, in deren Rahmen es jedem und jeder Einzelnen ermöglicht und garantiert wird, ein Individuum zu werden. Zu einem Individuum gehört Unabhängigkeit. Unabhängigkeit entwickelt man nur, wenn man eigene Interessen entwickelt, d. h. ein Eigeninteresse daran, dass alles Ökonomische, Politische, Gesellschaftliche einem selbst zu nützen hat. Erst ein Individuum, das an sich selbst denkt, kann eine unabhängige Identität entwickeln. Das kann man als »Egoismus« brandmarken, aber ohne einen »gesunden« Egoismus gibt es auch keine Ichstärke und Identität.
Selbst in den persönlichen Beziehungen geht es um das »Für mich!«. Nur ein Individuum, das fragt: »Was habe ich davon«, kann überhaupt eine Partnerschaft praktizieren, in der man sich nicht übervorteilt. Die Leute wissen das. (Selbst wenn sie dennoch Beziehungen eingehen, in denen sie übervorteilt werden.)
Zu demokratiefähigen Bürgern und Bürgerinnen gehört auch materielles, soziales, geistiges Eigentum. In der französischen Erklärung der Menschenrechte von 1789 ist Eigentum ein Menschenrecht. Im Grundgesetz wird es garantiert. (Art. 14 GG)
Überblick:
Zum materiellen Eigentum:
Materielles Eigentum ist unverzichtbar. Es ist die Voraussetzung für die Freiheit und Autonomie der Individuen. Der persönliche materielle Besitz sowieso. Dazu gehört, wo vorhanden, auch der persönliche Grund- und Wohnbesitz. In der Geschichte gehörte auch die Eigentumsbildung von Arbeitern und Angestellten mit zu den fortschrittlichsten Programmen, vom Konsumverein bis zur Arbeitnehmer-Aktie oder dem Häuslebesitz. Und so wie in manchen Bereichen staatliche oder kommunale Unternehmen notwendig sind (z. B. öffentliche Verkehrsmittel, Wasserwerke, Wohnungsbaugesellschaften), so ist die Freiheit des Eigentümers / der Eigentümerin in Wirtschaft und Gesellschaft unverzichtbar, unantastbar – im Rahmen des Grundgesetzes.
Zum geistigen Eigentum:
Institutionen, die es der Bevölkerung ermöglichen geistiges Eigentum, Ausbildung, Wissen, Bildung zu erwerben, dienen zweifellos der Allgemeinheit. Aber geistiges Eigentum ist ein Recht der Individuen. Es muss den Erfindern, den Autoren, den Regisseuren, den Schauspielern etc. unbedingt gewährleistet werden (Patentrechte, Copyright etc.). Auch der Schutz der persönlichen Sphäre ist ein unantastbares geistiges Eigentum der Bevölkerung. Ebenso Bürgerechte wie die Freiheit der Berufswahl, Meinungsfreiheit etc..
Zum sozialen Eigentum.
Das sind die politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Errungenschaften wie der Schutz vor Arbeitslosigkeit, Krankheit, Altersfolgen etc.. Sie sind ein Eigentum der von der Sozialgesetzgebung in einem Staat Betroffenen, also nicht der gesamten Menschheit.
Es gibt im Grundgesetz jedoch auch die Sozialverpflichtung des Eigentums:
»Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.« (Art 14 Abs. 2 GG)
Materielles Eigentum an Produktionsmitteln darf in der »Allgemeinheit«, d. h. in der Bevölkerung, keinen Schaden anrichten. Enteignungen im Interesse des Allgemeinwohls sind nach dem Grundgesetz möglich und auch üblich. Grundbesitzer, die den Bau einer Bahnlinie oder Autobahn verweigern, können enteignet werden. Natürlich müssen sie hierbei ausbezahlt werden.
Zum Eigentum gehören im Grundgesetz auch Formen des Allgemeineigentums. (s. Art. 15 GG) Während z. B. der Bahnbetrieb in Deutschland privatisiert, d. h. kommerzialisiert wurde (1993 beschlossen, 1999 realisiert), bleibt das Schienennetz im Besitz der Allgemeinheit, in diesem Fall des Staats. Aber auch Formen der Allgemeinwirtschaft sind möglich, sofern sie demokratisch kontrolliert sind. So ist zum Beispiel das öffentlich-rechtliche Prinzip – wie es in Deutschland bei den Radio- und Fernsehanstalten, ARD, ZDF (und als Rahmenstruktur auch für die kommerziellen Medienfirmen) der Fall ist – eine solche Form der Allgemeinwirtschaft. ARD und ZDF sind kein »Staatsfernsehen«, wie das oft behauptet wird, sondern sie befinden sich im Besitz und unter Kontrolle der »gesellschaftlich relevanten Gruppen«. Allerdings erhält seit einigen Jahren in ARD, ZDF und Deutschlandradio der grün-ökologistische Glaube eine privilegierte Möglichkeit der Selbstdarstellung, was den dort geltenden Regeln der ausgewogenen Berichterstattung widerspricht.
Inzwischen wurde, worauf der Rechtswissenschaftler Andreas Fisahn hinweist, die im Grundgesetz festgelegte Sozialbindung des Eigentums durch die europäischen Verträge abgeschwächt. Die Grundrechte-Charta der EU verlangt von der Wirtschafts- und Finanzpolitik der EU eine »offene Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb«. (Art. 119, 120, 127 AEUV; s. Fisahn 2019: 43) – Wobei »freier Wettbewerb« im Rahmen der EU-Diktion faktisch immer heißt: Freiheit der großen supranationalen Konzerne, also »Freiheit der Oligopolisten«.
Allerdings gibt es kein Menschenrecht auf persönliches Lebensglück
Klar ist, dass das hier gemeinte »Für mich!« ein Recht der Subjekte benennt, das als Recht nur im Rahmen der Gesetze praktiziert werden kann. In das Recht kann nur der Gesetzgeber, das Parlament, eingreifen, nicht aber Leute, die glauben, sie dürften die Gesetze verletzen, weil sie gutmenschliche Glaubensvorstellungen oder Benimmregeln haben: Kein Einzelner, keine Schiffskapitänin, keine Politikerin, keine Schülerbewegung, auch kein Präsident oder Präsidium eines Kirchenrats hat das Recht, die Gesetze nach eigenem Gutdünken zu übertreten. Der rationale, demokratische Gesellschaftsvertrag kann keine Privilegien für Einzelne garantieren und auch keine Sonderrechte für spezielle Bevölkerungsgruppen über die Bürgerrechte und Bürgerinnenrechte hinaus.
Außerdem kann das Recht Unmögliches nicht verlangen. In der realen, empirischen Welt gibt es kein Menschenrecht auf ein problemfreies Leben; und auch kein Menschenrecht auf illegale Einreisen überall auf der Welt; auch nicht darauf, sich überall in der Welt auf Kosten des sozialen Eigentums der jeweiligen Bevölkerung niederzulassen. Es gibt auch kein Menschenrecht auf niedrige Mieten für Wohnungen mitten im Stadtzentrum. Auch kein Menschenrecht darauf, unter Hinweise auf seinen Glauben die Gesetze eines demokratischen Staats zu missachten. Für die Propagierung des Ideals einer »Welt ohne Grenzen« mag der Papst die Kompetenz haben, aber nicht der demokratische Rechtsstaat. Eine Überforderung der Menschen im Namen des Rechts darf es nicht geben.
In die amerikanische Unabhängigkeitserklärung von 1776 hatte Thomas Jefferson das Recht auf ein Streben nach Glück als Freiheitsideal geschrieben:
»Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, daß alle Menschen gleich erschaffen worden [sic!], daß sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt worden, worunter sind Leben, Freyheit und das Bestreben nach Glückseligkeit.« (Präambel, Pennsylvanischer Staatsbote. [ ] hinzugefügt)
»Glückseligkeit« – das war nicht unbedingt so pathetisch zu verstehen, wie man das heute verstehen möchte: als Streben nach Selbstverwirklichung und nach Freiheit von Leiden. Denn Jefferson knüpfte an das im 16. Jahrhundert von Calvin entwickelte Naturrecht an, das – anders als die katholische und lutherische Auffassung von Naturrecht – den Menschen auch die Freiheit des Widerstands gegen despotische Willkür zugestand und vor allem auch die Freiheit, Handel und ungeniert auch Zinsgeschäfte zu betreiben. Auch um diese Marktfreiheiten ging es bei der »Glückseligkeit« in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776. In der Verfassung der USA von 1787 ist die Präambel nüchterner:
»Wir, das Volk der Vereinigten Staaten, von der Absicht geleitet, unseren Bund zu vervollkommnen, die Gerechtigkeit zu verwirklichen, die Ruhe im Inneren zu sichern, für die Landesverteidigung zu sorgen, das allgemeine Wohl zu fördern und das Glück der Freiheit uns selbst und unseren Nachkommen zu bewahren, setzen und begründen diese Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika,«
Hier ist »Glück« nur noch allgemein das »Glück der Freiheit«.
Also: Die Freiheit, nach Glück zu streben, hat schon damals nicht bedeutet, dass ein Gesetzgeber oder eine Regierung jedem Menschen sein persönliches Glück garantieren solle. Ohne eigene Ressourcen; ohne Arbeit und Leistung und eigene Kosten; ohne die Erarbeitung eigener Lebenserfahrung und Selbstverantwortung – und ohne günstige Zufälle im persönlichen Schicksal (in dem sich Tragik und Glück oft vermischen) – ist persönliches Glück nur selten möglich.
»FÜR UNS!« DAS SOZIALE EIGENTUM EINER BEVÖLKERUNG GEHÖRT NICHT DER GANZEN WELT
Wer das Eigentum als Menschenrecht bekämpft, wird auch dem »Für uns!« keine Chance geben. Denn das »uns« betrifft immer das Eigentum der Bevölkerung (des »Volks«) eines Staats.
Sozialleistungen gehören den Staatsbürgern und nur denen, die eingezahlt haben
Das »Für uns!« ist eine heikle Angelegenheit, denn das könnte als »völkische« oder sogar nationalistische Abgrenzung vom Rest der Welt missverstanden werden. Allerdings ist mit dem »Wir« nicht immer ein »Volk« gemeint. Oft, wenn ein Autor eines mit Politik befassten Buchs die Formulierung »Wir müssen …« gebraucht, meint er mit dem »Wir« die politische Elite, mit der er sich identifiziert. »Wir« – das sind dann die Großen, Mächtigen dieser Welt – und deren Berater bzw. jene Politologen oder Wirtschaftswissenschaftler, die davon träumen, Berater der Mächtigen dieser Welt zu werden. Es gibt Andere, die meinen statt einer Elite mit dem »Wir« und »uns« tatsächlich die ganze Menschheit. Anhänger der Neurophysiologie (»Hirnforschung«) sprechen sogar von »unserem Gehirn« und meinen damit die Gehirne aller Menschen auf der gesamten Welt. Und wenn Finanzfachleute von »unserem Gehirn« sprechen, kommen sie meistens zu dem Ergebnis, dass die Gehirne dieser Menschheit zu Herdenverhalten neigen. So schreibt zum Beispiel Max Otte:
»Es sind verschiedene Mechanismen unseres Gehirns, die uns immer wieder Fehler machen lassen; das (vor)schnelle, instinktgetriebene und intuitive Denken, die selektive Wahrnehmung, das Phänomen der kognitiven Dissonanz und das Gruppendenken. Diese Mechanismen waren im Verlauf unserer Evolution lebenswichtig – und sie sind es oft immer noch –, aber sie verleiten uns in der modernen, komplexen und technisierten Welt auch dazu Fehler zu machen.« (2019: 15, ( ) im Original)
Ich halte »uns« jedoch nicht für »instinktgebunden«, und die »Massenpsychologie« überhaupt für Scharlatanierie. (s. hierzu Nye 1975) Ich möchte auch das »Für uns!« nicht beim Neandertaler und beim homo sapiens ansetzen. Das »Für uns!«, das ich meine, setzt die Grenzen, die das Recht setzt. Faktisch wird ein sachliches »Für uns!« durch zwei Rechtsformen konstituiert: durch die Bürgerrechte und durch die Sozialrechte.
Die Bürgerrechte:
Das sind: demokratisches Wahlrecht; Pressefreiheit, Meinungsfreiheit; Religionsfreiheit (die offensive Akte oder den politischen Missbrauch ausschließt); eine unabhängige Justiz; das Recht auf den staatlichen Schutz der allgemeinen Ordnung. Das sind die Freiheiten der Zivilgesellschaft. Diese Bürgerrechte sind Menschenrechte. Sie sind universal, betreffen also alle, und sie werden von den Unterzeichnerstaaten der entsprechenden UNO-Übereinkommen formal akzeptiert. Insofern sind sie ein »Für alle!«. Bürgerrechte sind auch Rechte des Einzelnen, denn sie wahren dessen Würde und Selbstbestimmung. Insofern sind sie ein »Für mich!«. Und zum »Für uns!« werden die Bürgerrechte für die Staatsbürger dadurch, dass ihre Rechtswirksamkeit primär durch die Verfassungen der Staaten garantiert wird. (Und auch durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.)
Die »Grundrechte-Charta« der EU:
Für die Bürger und Bürgerinnen der EU gibt es ein weiteres »Für uns!«: die Grundrechtecharta der EU, die durch den Vertrag von Lissabon (VvL) von 2009 für die Bürgerinnen und Bürger der EU (außer in Polen) Gültigkeit erlangt hat. (s. VvL Art 6, 1–3; s. auch Fischer 2010: 137 f.. EU-Bürger ist jeder Inhaber eines Passes eines Mitgliedstaats der EU.) Es geht dabei um die Würde des Menschen, Freiheit, Gleichheit, Solidarität, Bürgerrechte und justizielle Rechte. Die Charta der EU sichert auch die Sozialrechte, deren Realisierung in Deutschland dem Gesetzgeber, dem Bundestag vorbehalten ist: »würdige Arbeitsbedingungen«, kostenlose Arbeitsvermittlung etc..
Entstanden war die Grundrechtecharta im Jahr 2000 bei den Entwürfen für einen europäischen Verfassungsvertrag. Jener sollte »unsere gemeinsamen Werte« betonen – und davon ablenken, dass die EU faktisch – auch in der Rechtsprechung des EuGH – ein Staaten-Verbund zwecks Organisation des EU-Binnenmarkts ist – und zwar zwecks dessen neoliberaler-marktradikaler Organisation. (Was bedeutet, dass die EU-Kommission die staatliche, kommunale oder öffentlich-rechtliche Organisation von Allgemeinwohl-Leistungen bekämpft.) Der europäische Verfassungsvertrag wurde 2004 von den Regierungschefs der EU in Rom mit viel Pomp unterzeichnet – und scheiterte danach, weil er in Referenden von den Bevölkerungen in Frankreich und den Niederlanden abgelehnt wurde. Die in diesem abgelehnten Verfassungsvertrag enthaltene Grundrechte-Charta wurde im Lissabon-Vertrag übernommen, der 2009 in Kraft trat. Als Unionsrecht steht die Grundrechtecharta über dem Grundgesetz – allerdings nur, wenn ein europäischer Bezug vorliegt.
Die »europäischen Grundfreiheiten« der EU:
Die Grundrechte der Charta darf man nicht mit den von der EU beschlossenen »Grundfreiheiten« verwechseln: Bei den »europäischen Grundfreiheiten« geht es nicht um Meinungsfreiheit, Wahlrecht etc. – das regelt die Charta –, sondern um die Warenverkehrs-, Dienstleistungs-, Niederlassungsfreiheit und Arbeitnehmerfreizügigkeit und um die Kapitalverkehrsfreiheit. Während die Grundrechte der Charta Menschenrechte und Bürgerrechte sind, stellen die »Grundfreiheiten« ein anderes, ein rein wirtschaftliches »Für uns!« dar. Dieses »Grundfreiheiten-Uns« besteht aus Unternehmen, die ihre Produktionen in die Niedriglohnstaaten der EU verlegen; aus Managern, die Arbeitnehmer aus den EU-Niedriglohnstaaten ins Land holen und ihnen die im Herkunftsland bestehenden Niedriglöhne auch im EU-Gastland bezahlen. Das »Grundfreiheiten-Uns« besteht auch aus supranationalen Unternehmen, die ihre europäischen Gewinne nicht in Europa versteuern; aus Banken, die ihr Geld nicht den Unternehmen und Investoren im eigenen Land leihen, sondern in Immobilien in Berlin und London investieren.
Die Sozialrechte:
In Deutschland werden die Sozialleistungen, auch manche Allgemeinwohl-Leistungen, nicht durch das Grundgesetz garantiert, sondern durch vom Bundestag erlassene Gesetze. Das Grundgesetz enthält zwar das Sozialstaatsprinzip (s. Art. 20 Abs.1 u. Art. 26 Abs 1 Satz 1 GG), aber es überlässt dessen Ausführung dem Gesetzgeber, also dem Bundestag. Udo Steiner, Rechtswissenschaftler und ehemaliger Richter am Bundesverfassungsgericht, kommentiert das so: