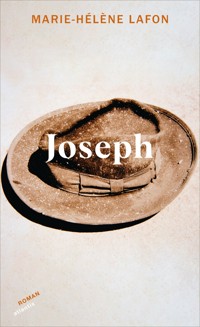Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rotpunktverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Edition Blau
- Sprache: Deutsch
Die Familie birgt ein Geheimnis, das Geheimnis um Andrés Vater, das der Sohn in dem Moment aufzudecken beginnt, da er selbst Vater wird. André ist der Sohn von Gabrielle und Paul. Die beiden sind sich 1919 im Krankenzimmer des Gymnasiums von Aurillac begegnet, Gabrielle als Krankenschwester, Paul als sechzehn Jahre jüngerer Internatsschüler. Gabrielle strebt aus der provinziellen Enge fort und folgt Paul nach Paris, obwohl sie weiß, dass die Beziehung nicht andauern kann. Als sie schwanger wird, erfährt Paul nichts davon. André wächst behütet in der Familie von Gabrielles Schwester Hélène und ihrem Mann Léon mit ihren fröhlichen Töchtern auf – und doch bleibt die Vaterstelle leer. Der Roman ist kunstvoll aufgebaut. Zwölf Kapitel, jedes mit einem Datum überschrieben, verschränken sich zu einer Familiengeschichte über drei Generationen und hundert Jahre, 1908 bis 2008. In jedem wird eine Begebenheit ausgebreitet und durch vorgreifende Gedanken, Erinnerungen in den Zusammenhang gestellt. Lafons Erzählung ist von einer tiefen Zärtlichkeit für ihre Figuren getragen. Man ist mittendrin in ihrer Welt zwischen dem hoch gelegenen Dorf im Cantal, der Provinzstadt im Lot und dem fernen Paris, spürt der Veränderung der Lebensverhältnisse nach.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Familie birgt ein Geheimnis, das Geheimnis um Andrés Vater, das der Sohn in dem Moment aufzudecken beginnt, da er selbst Vater wird. André ist der Sohn von Gabrielle und Paul. Die beiden sind sich 1919 im Krankenzimmer des Gymnasiums von Aurillac begegnet, Gabrielle als Krankenschwester, Paul als sechzehn Jahre jüngerer Internatsschüler. Gabrielle strebt aus der provinziellen Enge fort und folgt Paul nach Paris, obwohl sie weiß, dass die Beziehung nicht andauern kann. Als sie schwanger wird, erfährt Paul nichts davon. André wächst behütet in der Familie von Gabrielles Schwester Hélène und deren Mann Léon mit seinen fröhlichen Cousinen auf – und doch bleibt die Vaterstelle leer.
Der Roman ist kunstvoll aufgebaut. Zwölf Kapitel, jedes mit einem Datum überschrieben, verschränken sich zu einer Familiengeschichte über drei Generationen und hundert Jahre, 1908 bis 2008. Lafons Erzählung ist von einer tiefen Zärtlichkeit für ihre Figuren getragen. Man ist mittendrin in ihrer Welt zwischen dem hoch gelegenen Dorf im Cantal, der Provinzstadt im Lot und dem fernen Paris, spürt der Veränderung der Lebensverhältnisse nach.
Marie-Hélène Lafon
Geschichte des Sohnes
Roman
Aus dem Französischen von Andrea Spingler
Der Rotpunktverlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021 bis 2024 unterstützt.
Die Originalausgabe ist 2020 unter dem Titel Histoire du fils bei Buchet/Chastel erschienen.
© 2020 Buchet/Chastel, Libella, Paris
© 2022 Rotpunktverlag, Zürich für die deutschsprachige Ausgabe
www.rotpunktverlag.ch
Umschlagfoto: Guido Paradisi und frantic | Alamy Stock Foto
Korrektorat: Lydia Zeller
Umschlag: Patrizia Grab
eISBN 978-3-85869-949-7
1. Auflage 2022
für Jacquesfür Bernadette, in memoriam
Die Sprache ist unser Boden, unser Fleisch.
Ich stelle mir die Baustelle immer als eine Grube, eine Öffnung im Boden vor und das Vorankommen des Textes, seinen Fortschritt wie einen Gang durchs Gebirge.
Valère Novarina,Gespräch über L’Animal imaginaire, 2019
Inhalt
Donnerstag, 25. April 1908
Donnerstag, 23. Januar 1919
Samstag, 19. August 1950
Freitag, 17. August 1934
Mittwoch, 20. Juni 1923
Dienstag, 5. März 1935
Mittwoch, 20. Januar 1960
Samstag, 21. April 1962
Sonntag, 28. Oktober 1945
Donnerstag, 8. November 1984
Montag, 19. August 1974
Freitag, 28. April 2008
Über die Autorin und die Übersetzerin
Donnerstag, 25. April 1908
Armands nackte Füße gleiten über das Parkett; er will Paul nicht wecken, der noch schläft und sein ekliges kleines Schmatzgeräusch macht wie ein Welpe beim Saugen. Er wird ein wenig warten, aber nicht zu lange, Paul soll nicht aufwachen, er würde das Wiedersehensfest verderben, Paul verdirbt alles. Paul und er sind am selben Tag geboren, am 2. August 1903; er weiß von seiner Mutter und von seiner Tante, dass es in den beiden Familien vor ihnen nie Zwillinge gegeben hatte. Er wäre lieber nicht Zwilling, oder mit Georges, ohne Paul. Er versteht, dass das unmöglich ist, weil die Dinge sind wie sie sind, Tante Marguerite sagt das oft; er dreht und wendet diesen etwas seltsamen Satz, der glatt ist und sich ihm entzieht, hinter den Zähnen, einen Moment denkt er angestrengt an die grauen Sätze von Tante Marguerite und an ihren Geruch, kalte Asche und Dauerwurst. Er denkt viel über die Gerüche und Farben von Leuten nach, von Dingen, Zimmern oder Momenten, und als Antoinette mit ihnen in Chanterelle lebte, hat er sie mit dem, was sie seine Verrücktheiten nannte, zum Lachen gebracht, und sie lachte und lachte, sie hatte Tränen in den Augenwinkeln vor lauter Lachen; jetzt kann er seine Verrücktheiten niemand mehr sagen. Georges riecht nach der Pflaumenmarmelade im Sommer, wenn die Tante sie lange im Kupferkessel kochen lässt, genau nach dieser Marmelade riecht er und nicht nach der, die man an Winternachmittagen aufs Brot schmiert; sogar der Vater isst davon und macht der Tante Komplimente, die nicht darauf antwortet und ihn anschaut, als sähe sie ihn zum ersten Mal. Amélie riecht nach dem Fluss im Frühjahr, dem vom geschmolzenen Schnee angeschwollenen Fluss. Paul riecht nach Wind und nach der kalten Klinge der Messer, die in der Küche sind und die sie nicht anrühren dürfen. Bei seiner Mutter ist er unschlüssig, und es ändert sich dauernd, nach dem Schnee, der abends am Waldrand blau wird, nach heißem Kaffee, manchmal riecht sie auch rot. Der Vater vielleicht nach Gemüsesuppe, aber es fällt ihm nicht so recht ein, er stockt, etwas erstarrt in seinem Innern, und er will es lieber dabei bewenden lassen. Die Gerüche sind ein Spiel, und mit dem Vater kann man nicht spielen. Georges’ kleines Zimmer zwischen dem der Eltern und ihrem riecht nach den weißglühenden Bügeleisen, die seine Mutter oder Amélie über das Leinenzeug gleiten lassen, wobei sie den Arm anwinkeln und den Ellbogen abspreizen, den rechten Arm und Ellbogen seine Mutter, den linken Amélie, die dennoch die geschicktere ist. Das große Bad am Samstagabend mit den warmen, weichen Handtüchern und der Mutter und der Tante, die sich über ihn beugen, über sie beide, das große Bad riecht rosa, Antoinette und Amélie kümmern sich nicht um dieses Samstagsbad. Die Tante sagt, jedes Wort einzeln betonend, Gleich und Gleich gesellt sich gern, oder weggegangen, Platz vergangen, oder wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, oder wer Wind sät, wird Sturm ernten, oder der Apfel fällt nicht weit vom Baum. Er kann all die Sprüche der Tante auswendig, vor allem die, die er nicht versteht, und sagt sie manchmal still vor sich hin, Wort für Wort, um einzuschlafen oder um sich zu beruhigen, um sich abzukühlen, wie jetzt, da er spürt, dass er mit einem Satz die sechs Treppenstufen hinunterspringen und sich in der Küche wie eine Schwalbe auf Antoinettes Schulter setzen möchte. Die Tante sagt auch, eine Schwalbe macht noch keinen Frühling. Um sich in Geduld zu üben, bis die Uhr im Esszimmer halb schlägt, denkt er an die Erdbeeren, an die, die Antoinette für ihn in Embort gepflückt haben wird, die ersten, und an die aus dem Garten der Tante. Er weiß, dass seine Mutter, seine Tante und Amélie in der Küche sind und sich mit der Wäsche zu schaffen machen, es fängt heute an und wird zwei ganze Tage dauern. Antoinette kommt auch, für die schweren Arbeiten kehrt sie zurück, bestimmt ist sie schon da, sie hat ihm die ersten Erdbeeren versprochen, und Antoinette hält ihre Versprechen immer. Sie lebt nicht mehr in Chanterelle, sondern in Embort, er hat sich den Namen gemerkt, in einer anderen, viel lieblicheren Gegend, wo große Kirschbäume wachsen, sie erzählt es und zeigt mit beiden Armen, wie dick die Kirschbäume in den Obstwiesen dieser neuen Gegend werden, wo sie mit ihrem Mann wohnt. Er hat sehr geweint, als sie mit diesem Mann, der kraushaarig ist, wegging, auch wenn seine Mutter und Tante Marguerite ihm erklärten, es sei normal, dass junge Mädchen wie Antoinette, wenn sie einen Mann finden, die Kinder, um die sie sich in den Häusern der anderen kümmern, verlassen und ihrem Mann folgen, um mit ihm in einem eigenen Haus zu leben, wo sie selber Kinder bekommen. Tante Marguerite hat den Kopf gesenkt, als sie diese Worte sagte, und er verstand, dass er nicht weiterfragen sollte. Er weiß, dass Tante Marguerite weder Mann noch Haus noch Kinder hat, und er spürt, wie ihr die Traurigkeit durch die Haut dringt und ihr einen besonderen Geruch verleiht, den seine Mutter, Antoinette oder Amélie nicht haben. Es ist ein graues und kaltes Parfum, das ihn beklommen macht; er könnte weinen, aber er weint nicht, man soll es nicht, man würde ausgelacht. Er tritt aus dem Zimmer, das Fenster am Ende des Flurs ist voller Licht, wie das große Kirchenfenster bei schönem Wetter; auf dieser Seite geht die Sonne auf, und die Läden dieses Fensters werden nie geschlossen, auch nicht im Winter. Er ist allein auf dem Flur, alle sind unten in der Küche, und sein Vater ist auf dem Weg ins Rathaus, am Donnerstagmorgen geht sein Vater sehr früh ins Rathaus. Er war noch im Bett, als er ihn die Tür zuschlagen und den Platz überqueren hörte; nur vom Hören und mit geschlossenen Augen, weil er mit geschlossenen Augen besser hören kann, erkennt er jeden an seinem Schritt und an der Art, etwas zu machen, seine Mutter, seine Tante, seinen Vater, Paul, Georges, Amélie und sogar andere Personen wie Solange oder Antonin, die zum Helfen kommen und nicht bei ihnen wohnen; er erkennt auch jeden Hund im Dorf an seinem Gebell, das ist ein Spiel und ein Geheimnis, Paul soll es nicht wissen. Armand geht weiter im warmen Licht, er spürt es auf sich, auf seinen Füßen, auf seinen Händen, seinem Gesicht, seinem Haar, er schließt die Augen. Später, bald, wenn er groß genug ist, wird er Chorknabe, seine Mutter und seine Tante wollen es, sein Vater kann ihn nicht hindern, das hat er Antoinette zu Amélie sagen hören, auch wenn sie das Thema wechselten, als er die Küche betrat. Antoinette und Amélie fürchten den Vater, alle fürchten ihn, sogar Paul, die Wutanfälle des Vaters sind wie Gewitter und Donner, das Haus bebt, die Erde bebt, es ist Nacht mitten am Tag; wenn es aufhört, wenn der Vater geht, beginnen alle wieder zu atmen. Bis dahin kann man sich innerlich das Gebet aufsagen, das die Mutter abends für Paul und ihn spricht, Georges versteht es nicht, er ist noch zu klein. Beim letzten Wutanfall hat Armand es versucht, aber es ging nicht, er weiß warum, das Gebet beginnt mit Vater unser, und die Wörter bleiben in der Kehle stecken, sie kommen nicht durch. Man müsste mit Antoinette darüber reden können, heute oder morgen; danach bricht sie auf, sobald die Wäsche fertig ist, und er weiß nicht, wann sie wiederkommt. Antoinette hat Ideen, Lösungen für alles, sie kennt Zaubertricks, er mag ihre Arme, ihr Haar, ihren Hals, er mag es, an schönen Nachmittagen rasch mit ihr in die leere Kirche zu treten, nur um in den Pfützen von gelbem und rotem Licht, das durch das große Buntglasfenster fällt, eine Kniebeuge und das Kreuzzeichen zu machen. Sie setzen sich auch eine Minute in den Beichtstuhl, jeder auf seiner Seite, sie rechts, er links, das Holz ist glänzend und glatt, der Beichtstuhl riecht nach Wachs, Honig, frischer Butter. Er mag die Kirche, er wird Chorknabe sein, er mag Antoinette.
Er hört ihre Stimme, die aus der Küche heraufdringt, vermischt mit der seiner Mutter, die Tante und Amélie sagen nichts. Er steht auf der ersten Treppenstufe, er wartet, er weiß, dass seine Mutter und seine Tante schon lange wach sind und auf dem großen Küchenherd in zwei sehr hohen, nur für die Wäsche benutzten Töpfen das Wasser heiß werden lassen; die Töpfe sind sonst im unteren Regal der Waschküche verwahrt, und Georges und er spielen gern mit dem höheren, der so groß ist, dass Georges ganz hineinschlüpfen kann wie in ein hartes Futteral, er verschwindet darin und wippt von vorn nach hinten oder von rechts nach links, er ahmt ein Huhn nach, das gelegt hat, der Topf scheint gluckend zu tanzen, und sie lachen und können nicht mehr aufhören. Sie tun es heimlich, wenn die Erwachsenen sich nicht um sie kümmern, sie würden ausgeschimpft, weil man die Gerätschaften nicht kaputt machen darf. Paul findet, das ist ein Spiel für Kleine, und macht sich über sie lustig, verrät sie aber nicht. Armand steigt zwei Stufen hinunter und setzt sich auf die dritte, von der aus er sehen kann, ohne gesehen zu werden, was in der Küche passiert. Antoinette ist da; sie geht hin und her, die Arme voll Wäsche, ihre lockigen Haare sind rot, Antoinette ist rothaarig, kein Rotschopf, er mag das Wort nicht, das sein Vater manchmal benutzt. Antoinette ist rot wie der Fuchs, den seine Mutter und er letzten Winter gesehen haben, als sie an einem Schneeabend über die große Wiese oben gingen. Seine Mutter drückte seine Hand, die sie in der ihren hielt, sie blieben stehen, der Fuchs auch, gebannt, alle drei; dann verschluckte der Wald das Tier, nur noch seine kaum sichtbaren Spuren auf dem blauen, harten Schnee waren übrig. Antoinette ist ein Wunder, wie der Fuchs. Sein Vater tötet die Füchse, sein Vater ist Jäger; er wird später Chorknabe sein und er wird nicht jagen, er will keine Tiere töten, weder die magischen Füchse noch die samtigen Hasen noch die springenden Rehe noch die Vögel, keine Vögel, bloß nicht die Vögel. Alles geht durcheinander in seinem Kopf, die Vögel, Antoinette die Füchsin, das Kirchenfenster, die Erdbeeren, die frische Butter des Beichtstuhls, das Geheimnis des großen Kochtopfs. Er wehrt sich nicht, es ist zu viel auf einmal, seine nackten Füße schlagen geräuschlos den Takt seiner Freude auf die vierte Stufe, er möchte fliegen. Er erinnert sich gern an den letzten Sommer, als er noch nicht wusste, dass Antoinette wegziehen würde, abends gingen sie, sie beide, los, sie gossen den Salat, vor allem den Salat, und andere Gemüse, die ihn nicht so sehr interessierten, aber er trug gern die kleinen Kannen, die weiße und die blaue, er folgte Antoinette, er roch sie im Geruch der nassen Erde, er hatte Flügel, er rannte vom Brunnen ans andere Ende des Gartens, ohne irgendetwas zu beschädigen, um Wasser zu holen, noch mehr Wasser. Der Garten war ein grünes und goldenes Reich, der Garten war die Welt, und das Licht hörte nicht auf. Danach, bevor sie wieder hineingingen, sahen sie noch nach den Erdbeeren, sie hockten einander gegenüber, zu beiden Seiten des Beets, wühlten sacht im frischen Spitzenbesatz der Blätter und spürten unter ihren Fingern die Rundung der Erdbeeren, drei oder vier, nicht mehr, um die Tante nicht zu erzürnen. Bald kommt wieder ein Sommer, aber Antoinette wird nicht mehr da sein. Die Uhr schlägt halb acht, auch ihn hält es nicht mehr, er steht, seine Füße sind nackt auf den oberen Stufen der Treppe. Antoinette dreht ihm den Rücken zu, sie steht am Herd, sie hat ihn noch nicht gesehen, aber er weiß, dass sie ihn erwartet, er berührt nicht mehr den Boden, er springt, er läuft, er stürzt sich in die Beine seiner Antoinette in dem Moment, als sie sich umdreht; sie hat den hohen, kochend heißen Topf vom Herd genommen, sie trägt ihn mit ausgestreckten Armen, an den Griffen, und es endet in einem gellenden Schrei, der Paul aufweckt.
Donnerstag, 23. Januar 1919
Man saß im Arbeitssaal. Er rieb unter dem Pult seine Füße aneinander; er hatte immer kalte Füße, auch wenn seine Mutter ihm graue oder schwarze Söckchen aus feiner Wolle in den Koffer legte, die sie im Winter da oben in Chanterelle für ihn strickte. Morgens im Schlafsaal zog er sie unauffällig unter die Strümpfe, sie schmiegten sich an und waren weich auf der Haut. Man sollte im Gymnasium nicht wissen, dass Paul Lachalme sich vor kalten Füßen fürchtete und von Mutter gestrickte Söckchen trug. Er hatte seinen Stolz. Sie waren eine Handvoll, vier oder fünf, die mit ihm, in seinem Kielwasser, das ganze vergangene Jahr unaufhörlich erklärt, beteuert, verkündet hatten, wie dringend sie dabei sein, endlich sechzehn werden wollten, um sich zu verpflichten, es zumindest zu versuchen, und loszuziehen, die dumpfe Schmach des Hinterlandes zu verlassen, wo die Frauen, die Kinder, die Alten, die Krüppel, die Schwächlinge und die Drückeberger abwarteten und mit ihrem Bauch den ruhigen Alltag vor sich herschoben, während die Männer anderswo lebten und starben, über sich selbst erhaben. Paul war zufrieden mit seinem Satz und seinen Floskeln; er hatte eine Vorliebe dafür, manche sagten, eine Begabung, und gebrauchte sie gern im Lauf der hitzigen Diskussionen unter Internen über die entscheidende Frage dieses Krieges, der kein Ende nahm. Die losziehen, sich Vätern, Onkeln, Brüdern, Cousins, Freunden anschließen oder sie ersetzen oder rächen wollten, beeindruckten die anderen; man wagte kaum zu sagen oder auch nur zu denken, dass man Angst hatte oder dass dieser seit vier Jahren im Schlamm steckende Krieg keinen rechten Sinn mehr hatte oder dass man nicht wusste, wie man einer Mutter, einer Schwester, die bereits der Schwärze und den Tränen verfallen waren, auch noch das, dieses Losziehen, antun könnte. Der Waffenstillstand hatte kurzen Prozess gemacht und die Ausflüchte und Prahlereien abgewürgt. Zwei Monate später dehnte sich der endlose Januar ins eisige Grau der Wochen, die bis zu den fernen Osterferien herumzubringen waren, und Paul Lachalme hatte beim abendlichen Lernen kalte Füße. Man war in seinen Kindheitsstatus zurückgeworfen, man würde kein Held, man wäre nicht auf dem Feld der Ehre gefallen, es war für alles zu spät; man war abhängig, man wurde wieder ohnmächtig, man hatte nie aufgehört, es zu sein, man ertrug und schlug sich mit alldem herum, den Wochen, den kalten Füßen, dem ersten der Bucolica und anderen Schulstrafen. Sub tegmine fagi