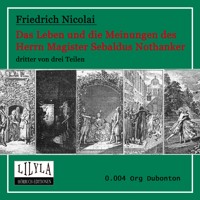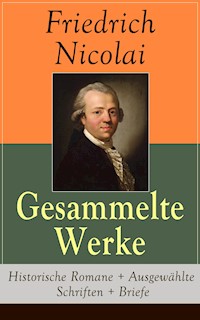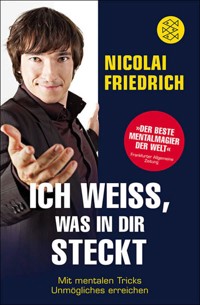Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In Friedrich Nicolais Werk 'Geschichte eines dicken Mannes' wird die Geschichte eines Mannes erzählt, der mit seiner Größe und Statur zu kämpfen hat. Nicolai erzählt die Geschichte mit einem klaren und direkten Stil, der den Leser sofort einfängt. Das Buch, das im 18. Jahrhundert verfasst wurde, reflektiert die sozialen und politischen Spannungen der Zeit und bietet gleichzeitig eine tiefgründige Charakterstudie. Nicolais Werk kann als früher Vorläufer des realistischen Romans angesehen werden, da er die alltäglichen Erfahrungen und Gefühle seines Protagonisten auf einfühlsame Weise darstellt. Friedrich Nicolai, selbst ein bekannter deutscher Schriftsteller und Verleger, schrieb 'Geschichte eines dicken Mannes' möglicherweise als Versuch, die gesellschaftlichen Normen und Schönheitsideale seiner Zeit herauszufordern. Seine detaillierten Beschreibungen und psychologischen Analysen machen das Buch zu einem fesselnden Leseerlebnis. Nicolais Interesse an der menschlichen Psyche und seinen tiefsinnigen Charakterstudien prägen dieses Werk. Dieses Buch empfiehlt sich für Leser, die an literarischen Werken des 18. Jahrhunderts mit starken Charakterbeschreibungen und einer präzisen Schreibweise interessiert sind. 'Geschichte eines dicken Mannes' bietet nicht nur einen Einblick in die sozialen und politischen Verhältnisse der damaligen Zeit, sondern auch eine zeitlose Auseinandersetzung mit den Themen Selbstakzeptanz und gesellschaftlicher Druck.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Geschichte eines dicken Mannes
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Man beurteilt immer das Unbekannte nach dem Bekannten. Dies ist sogar eine Regel der Gelehrten; und so wette ich, der gelehrte Leser wird bei Erblickung des Titels sogleich alle dicken Leute alter und neuerer Zeiten durch sein Gedächtnis laufen lassen, um unsern dicken Mann damit zu vergleichen. Ich wette aber auch, es wird dem gelehrten Leser ergehen wie gelehrten Leuten sehr oft. Sie schließen und folgern, aus der ihnen beiwohnenden gelehrten Weisheit, über Menschen und menschliche Angelegenheiten so streng, so kritisch, so weise, so bündig, so unwidersprechlich, daß jedermann von der Richtigkeit ihrer Sätze notwendig überzeugt sein muß; es wäre denn, daß er sie etwa nicht verstände, worüber sie immer zu klagen pflegen. Gleichwohl ereignet es sich nicht selten, daß kein einziger ihrer Schlüsse und Folgerungen trifft und paßt, sobald diese gelehrten Männer heraussteigen aus ihren Studierstuben, Gymnasien, Lyzeen, Universitäten, Akademien der Wissenschaften und der freien Künste und wie sonst die gelehrten Treibhäuser heißen, in welchen vermittels vielen gelehrten Düngers und nicht weniger gelehrten Dampfes alles menschliche Wissen und Verstehen viel früher zur Reife gebracht wird als bei den unwissenden, elenden Menschenkindern, die ihren unsterblichen Geist weder durch Belesenheit noch durch Spekulation düngen und deren beklagenswürdiges Schicksal bloß ist, zu wirken und zu handeln.
So viel sich die gelehrten Freunde des Verfassers erinnern, gibt es vorzüglich – ungerechnet drei bekannte dicke Könige und dicke Prälaten ohne Zahl – nur noch sieben recht berühmte kurze und dicke Leute: Einen im Altertume und sechs in neuern Zeiten. Wofern nun der gelehrte Leser etwa meinen sollte, unser dicker Mann gleiche einem von den zehnen oder von den sieben oder auch nur irgend einem andern dicken Manne, der ihm sonst einfallen könnte: so ist abermal zehn gegen eins zu wetten, der gelehrte Leser wird sich irren.
Überhaupt, günstiger, gelehrter oder nicht gelehrter Leser! liebst Du das Erhabene, bist Du etwa gewohnt, nur die Leben zu lesen von Königen, Prinzen, Prälaten, Feldherren, Heiligen, Wundertätern, Professoren, die sich durch sterbliche Systeme unsterblich machen, und sonst von andern weltberühmten Leuten – mager oder dick von Gestalt –, so wollen wir Dich hier dienstfreundlich ersuchen, dies Buch zuzuschlagen und nicht weiter fortzufahren. Wir weisen Dich hier gleich dahin, wo Du Deine Befriedigung finden wirst: zu den neuern deutschen Schriftstellern, welche sich auf das Erhabene legen, im eigentlichen Verstände legen, um es mit der Schwere ihres Geistes zusammenzudrücken. Wir gestehen Dir ungefragt, hier ist kein vornehmer oder hochberühmter Mann zu beschreiben. Wagst Du es, unsrer Warnung ungeachtet, weiterzulesen: so tue Verzicht aufs Erhabene und Große. Du wirst nur in die Familie eines gemeinen Handwerksmannes eingeführt; und unser Held selbst war so klein und so dick, daß ihn sogar der berühmte Doktor Knüppeln, welcher Friedrich den Großen so klein beschrieb, nicht noch kleiner hätte machen, noch der berühmte Magister Geisler der Jüngere, welcher unbedeutende Geschichten so dick aufblasen kann, noch dicker hätte aufblasen können.
Ganz besonders wirst Du gebeten, günstiger Leser, unsern dicken Mann mit keinem Könige, der etwa könnte kurz oder dick gewesen sein, in Gedanken zusammenzustellen. Wir reden gar nicht von Königen. Dies überlassen wir dem weltberühmten Professor Aloysius Hoffmann, der, als seine früh verblichene Wiener Zeitschrift noch lebte, gegen alle adeligen und bürgerlichen Aufklärer die Rechte der Könige so mutig verteidigte, da sie sonst, wie er selbst sehr deutlich zu verstehen gab, leicht in Nichts hätten zerfallen können, wären sie nicht emporgehalten worden von ihm und seinen würdigen Mitstreitern, dem Ritter Johann Georg von Zimmermann, dem Paten Professor Anton Hofstätter und andern, die sich den philosophischen Volksverführern, die jetzt gräßlich herumhausen, so tapfer widersetzten.
Also hier weiter kein Wort, weder von Karl dem Dicken, Könige von Deutschland und Frankreich, der seiner Frau zumutete, nach zehnjähriger Ehe ihre fortdaurende Jungfrauschaft durch Berührung eines glühenden Eisens zu beweisen, noch von Ludwig dem Dicken, Könige von halb Frankreich, der, um sicherer in den Himmel zu kommen, auf einem von Asche gestreueten Kreuze starb, noch von Heinrich dem Achten, dem kurzen und dicken Könige von England, der drei Käthen, zwei Annen und eine Hanne heiratete, noch von allen andern kurzen und dicken Königen in der Welt: selbst wenn im Königreiche Yvetot oder im Königreich Sylva noch irgend ein kurzer und dicker König menschlichen oder tierischen Geschlechts vorhanden gewesen sein sollte. Unser dicker Mann ist nicht einem davon ähnlich.
Auch bitten wir Euch, sagt kein Wort weiter von Professoren und Rittern, welche ungebeten die Könige mit ihren Gänsekielen verteidigen wollen. Begegnet Euch aber auf Eurer Reise durch die Welt ein Ritter, der für seinen König mit dem Schwerte ficht, so wie Ritter Möllendorf oder Ritter Kalkreuth oder andre biedre Ritter der Art, dem mögt Ihr die Hand bieten; wir bieten sie ihm auch.
Die merkwürdigen sieben dicken Männer, mit welchen man unsern Helden etwa möchte vergleichen wollen, wären: Thersites im Altertume und in neuern Zeiten Sancho Pansa, Falstaff, der Kanonikus Gil Perez, Oheim des berühmten Gil Blas de Santillana, der dicke Mann auf Otaheiti, der so vornehm war, daß er sich mit gehöriger Gravität täglich von seinen Weibern das Essen in den Mund stopfen ließ, und zwei dicke kurze Personen im Tristram Shandy, nämlich Doktor Slop, der Geburtshelfer, und der kleine Trommelschläger mit säbelförmigen Beinen, der am Tore zu Straßburg auf der Wache war, als ein Fremder hereinritt, kommend vom Vorgebirge der Nasen, mit der größten Nase, von welcher Welt und Nachwelt keinen Begriff haben würden, wenn der berühmte Hafen Slawkenbergius nicht Sorge getragen hätte, sie ganz genau zu beschreiben.
Diesem Trommelschläger gleicht unser Held nun auf gar keine Weise; denn er hat keinesweges säbelförmige, sondern gesunde ganz gerade Beine, mit netten Waden, wohlgeformt gleich den Waden des Apoll von Belvedere. Weder wurstförmige Waden, welche zufolge der Bemerkung des Physiognomisten Johannes Baptista Porta eine Eigenschaft der hagedornschen Schnarcher voller Schulgeschwätze sind, die jedem Naemanns Krätze gönnen, der von ihrem Systeme abweicht, noch schlotterige, gleich den Waden weiland Johann Kaspar Kubachs, des Gebethelden, der mit seinem Gebete nie Wunder getan hat.
Dem Doktor Slop, mögt Ihr ihn Euch auch denken wie Ihr wollt, ist unser Held gleichfalls nicht im mindesten ähnlich. Seht den Doktor nur an, es sei wie ihn Hogarthwie ihn Hogarth schlafen läßt, oder wie ihn Chodowiecki vom Pferde wirft – S. die Titelkupfer des 1sten Teils der deutschen Übersetzung des Tristram Shandy und die Chodowieckischen Kupferstiche dazu (Anm. Nicolais). schlafen läßt, oder wie ihn Chodowiecki vom Pferde wirft; und Ihr müßt gleich merken, Anselm Redlich müsse ein ganz anderes Kerlchen sein. Ihr werdet weiter unten finden, er ist rundlich, niedlich, witzig, gelehrt, galant, dem Frauenzimmer ergeben und nebenher zuweilen ein wenig ein Hasenfuß, unbeschadet seiner Sittsamkeit, Gelehrsamkeit und besonders seiner Klugheit, auf die er wohl, wie auch weiter unter erhellen wird, selbst einigen Wert setzen mag. Ein solches Männchen schläft ganz anders und fällt ganz anders vom Pferde als eine so plumpe Masse wie Doktor Slop.
Daß unser Anselm dem dicken Manne auf Otaheiti so wenig gleicht als dem Manne im Monde, kann der günstige Leser leicht einsehen, weil er eben ist belehrt worden, Anselm sei nicht vornehm; und weiter unten, wenn der günstige Leser geduldig genug ist, bis dahin zu lesen, wird belehrt werden, Anselm, so viel er auch dem Wohlwollen des schönen Geschlechts zu danken hat, müsse viel zu galant sein, um dem Frauenzimmer Mühe mit sich zu machen.
Mit dem Kanonikus Gil Perez, der nur drei und einen halben Fuß hoch war und dessen Kopf zwischen den Achseln steckte, ist auch kein Vergleich anzustellen. Anselm ist von gehöriger Leibesgröße und trägt seinen Kopf erhaben, ist auch nicht unwissend wie der ehrwürdige Gil Perez, sondern gelehrt und klug, beides im Übermaße, wie aus der folgenden Geschichte vermutlich sich noch weiter ergeben wird.
Dem Verfasser dieser wahren Geschichte würde es wohl behagen, wenn Anselm Redlich dem Sancho Pansa gleichen möchte; denn so würde er sehr unterhaltend sein, indem der gute Sancho immer gleich die Blicke der Leser erheitert, sobald er auftritt. Sonst aber muß man hier der Wahrheit zur Steuer anzeigen, daß unser Held ebenso wenig von Sancho Pansa hat als von zwei in der Geschichte des Don Quixote vorkommenden, hier beiläufig anzuführenden dicken Wettläufern, deren einer elf Viertel-Zentner, der andere aber fünf Viertel-Zentner wog und über deren Wettlauf der weise Sancho ein so weises Urteil fällte. Wiegt einer unter den deutschen Schriftstellern so viel: der trete hervor, um sich gegen diese wägen zu lassen, wenn er will. Wir sind wohl zufrieden, daß er auch sogar seine Werke mit auf die Waage lege.
Seit Falstaffs Zeiten ist man fast der Meinung geworden, dicke Leute wären aufs höchste witzig und weiter nichts. Dies ist aber eine höchst irrige Meinung, wenn man auch Zachariä, den Dichter, zum Beweise anführen wollte; denn dicke Leute können auch gelehrt sein. Davon soll Euch ein Beweis sein zwei Männer berühmt durch Genealogie und Geogonie: der Hofrat Krebel, der gelehrte Verfasser eines genealogischen Handbuchs, noch genauer als seine europäischen Reisen, die er sitzend auf seinem Lehnstuhle so oft wiederholte; und der Oberkonsistorialrat Silberschlag, Verfasser eines gelehrten Systems der Geogonie, welches so fest stehet wie die von ihm gebauten Wassergebäude. Insbesondre soll es Euch das Beispiel unsers Anselms selbst beweisen. In Absicht auf Gelehrsamkeit ist er den beiden genannten wohlbeleibten Gelehrten allenfalls einigermaßen ähnlich, sonst gleicht er weder diesen noch andern deutschen Schriftstellern und Übersetzern, von denen einige nicht weniger witzig und gelehrt als dick sind.
Wie könnte nun nach allem dem, was wir schon beiläufig von unserm Helden gesagt haben, ein so feiner und, obgleich runder, doch gerader Mann wie Anselm, in irgend einem Stücke mit dem Thersites verglichen werden, der, wie jeder Leser Homers weiß, schielte, hinkte, bucklicht, spitzköpfig und ein Kahlkopf war? Der günstige Leser soll aber wenigstens bei dieser Gelegenheit erfahren, daß unser Anselm einen runden erhabenen Scheitel und schöne kastanienbraune Haare hat; und hätte er ja irgend einmal zu schielen geschienen, so könnte es nur gewesen sein, als er ein Frauenzimmer verliebt ansah. Daß unser Held aber von der schönsten Hälfte des menschlichen Geschlechts die Augen nicht abzuwenden pflegte, kann nebst vielen andern Dingen der geneigte Leser erfahren, wenn er nur weiter lesen will.
Dies wären nun die antiken und modernen dicken Leute alle, deren Existenz den belesenen Freunden des Verfassers jetzt beigefallen ist. Denn Foote's Major Sturgeon, dessen Tapferkeit nach dem Gewicht zu berechnen war, ist nicht allgemein genug bekannt; und Selim der Glückliche, dessen Geschichte der Verfasser des Siegfried von Lindenberg aus dem Guzuratischen verdeutschte, war nur, als er geboren ward, ein dickes Bübchen, aber nachher ward er ein schlanker Bursche, wie der Leser selbst erkennen kann, wenn er die Vorstellung seiner Figur in ganzer Leibeslänge ansehen will, welche der gedachten Geschichte einigemal beigefügt ist.
Unser Held hingegen blieb dick bis in sein männliches Alter, und so wird er auch gleich auf dem Titel dieser wahren Geschichte nach dieser Eigenschaft benannt. Er hätte auch können der kluge Mann heißen; denn es fehlt ihm nicht an Klugheit. Man will aber überhaupt bemerkt haben, daß die körperlichen Eigenschaften der Magerkeit und Dicke permanenter zu sein pflegen als die geistige Eigenschaft der Klugheit. Ob jemand beständig so klug geblieben sei, als er sich gleich in seinen Jünglingsjahren zeigte, kann man erst am Ende seines Lebens wissen; besonders, ob unser Held ebenso unverändert klug als dick gewesen, kann nur am Ende dieser Geschichte recht deutlich werden; und wir trauen uns jetzt noch nicht, etwas Gewisses darüber im voraus zu sagen. Aber daß er als Kind, als Jüngling und als Mann beständig dick geblieben, zeigt sein dreifaches, von einem berühmten Künstler nach dem Leben gezeichnetes Bildnis, das wir dieser Einleitung, nebst den Bildnissen der sieben vorher benannten dicken Männer, als ein beweisendes Dokument, wie ungleich er jedem war, haben beifügen lassen.
Das Ende des menschlichen Lebens an sich ist der Tod; aber das Ende jeder Geschichte von der Art der gegenwärtigen ist bekanntlich eine Heirat. Ob nun, zufolge des Titels, sich diese Geschichte etwa gar dreimal endige, ja ob überhaupt die auf dem Titel angegebene Anzahl der Heiraten richtig sei, kann der Verfasser dieser Einleitung noch nicht ganz gewiß sagen, und der geneigte Leser oder Leserin kann es nicht gewiß wissen, bis sie diese wahre Geschichte ganz werden zu Ende gelesen haben, worum wir ihn und sie hiermit pflichtschuldigst bitten. Aber selbst alsdann versprechen wir nicht, er oder sie möchte ganz gewiß erfahren, ob die auf dem Titel versprochne Anzahl der Körbe richtig sei. Es ist der Ungewißheit so viel unter dem Monde wie des Leidens. Obgleich der Verfasser alle Bücher, die von der deutschen Sprache handeln, sorgfältig nachgeschlagen und viele Gelehrte – dicke und magere – befragt hat: so war doch nicht völlig gewiß zu erfahren, ob es ein Korb zu benennen sei, wenn eine Mannsperson die Hand einer Frau ausschlägt. Wofern nicht die deutsche Deputation der königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin etwas hierüber entscheiden sollte, möchten wir schwerlich hierin zur Gewißheit kommen. Denn auch die berühmte deutsche Gesellschaft in Mannheim, deren Entscheidungen Deutschland von Osten bis Westen sich so gehorsam unterwirft, hat in die vielen Bänden ihrer Schriften, die, wenn auch nicht an andern Eigenschaften, dennoch an Dicke und Klugheit, unserm Helden wohl am nächsten möchten zu vergleichen sein, hierüber noch nichts festgesetzt.
Sonst wagen wir noch, jede unserer günstigen Leserinnen zu bitten, sie wolle auf unsern Helden nicht etwa schon im voraus einen Unwillen werfen in der Meinung, er möchte die Hand eines Frauenzimmers verschmähet haben. Noch wissen wir dies nicht gewiß. Sollte er aber ja auch dieser Tat schuldig befunden werden: so bitten wir unsre schönen Leserinnen, ihn nicht ungehört zu verdammen; denn wir vermuten fast, er werde etwas zu seiner Verteidigung anzuführen haben.
Erster Abschnitt. Von der Familie und den nächsten Vorfahren Anselms
In des heiligen Römischen Reichs Stadt Aachen, die sich den königlichen Stuhl nennet, ungeachtet seit Jahrhunderten in der Stadt und dem ganzen Reiche von Aachen eben kein König sich zu setzen Gelegenheit gehabt hat, wohnte ungefähr in der Mitte dieses achtzehnten Jahrhunderts Meister Anton Redlich, ein Tuchmacher, nebst seiner Frau Sabine. Er war fleißig und sparsam, sie war bieder, sparsam und ordentlich; so vermehrte sich seine Arbeit, weil jeder Kaufmann Meister Antons Tuch besser gearbeitet fand als andrer Meister.
Nun ist aber ein weises Gesetz in Aachen: ein Tuchmachermeister solle mehr nicht als auf vier Stühlen arbeiten und mehr nicht als vier Gesellen halten; ein Gesetz, welches ausdrücklich gemacht scheint, um die vielen Bettler, womit alle Straßen dieser Stadt so reichlich gesegnet sind, nicht zum Spinnen und Kämmen der Wolle kommen zu lassen. Ferner bestehet in Aachen ein andres Gesetz, welches den Protestanten nicht verstattet, ein eigenes Haus, noch weniger das Bürgerrecht zu haben. Eine solche Verordnung würde der philosophische Gesetzgeber Dohm nicht gegeben haben, der aber auch seine für die Stadt Aachen entworfene Konstitution im Jahre 1790 nicht einführen konnte; sie ist hingegen ein wesentlicher Teil der katholischen Konstitution, welche der militärische Gesetzgeber Spinola im Jahre 1641 mit gutem Erfolge in Aachen wirklich einführte. Dergleichen Verbote sind auf den frommen Grundsatz gestellt: Nötige sie hereinzukommen. Es ist aber ein Beweis, wie sehr der Verstand der Protestanten, verlassen vom unfehlbaren Richter, verkehrt worden ist, daß sie solche Verbote gewöhnlich so verstehen, als wäre ihr Sinn: Nötige sie hinwegzugehen. Meister Anton und Frau Sabine hatten das Unglück, nicht zur alleinseligmachenden Kirche zu gehören, und waren beständig mißvergnügt, daß immer für mehr als vier Stühle Arbeit da war und sie nur vier Stühle halten durften, daß sie ein eigenes Haus nötig hatten und es nicht zu besitzen berechtigt waren und daß sie zum Gottesdienste eine Stunde Wegs nach dem holländischen Dorfe Vaals gehen mußten. Daraus entstand endlich ganz natürlich der Gedanke, sich neben ihrer Kirche zu setzen. Meister Anton zog also nach Vaals, mit Frau Sabine und mit Leonoren, seiner unverheirateten Schwester. Er kaufte dort ein Häuschen, hatte mit keiner Zunft Streit, ließ auf so viel Stühlen arbeiten, als er wollte, legte eine eigene Tuchschererei und Färberei an, welches ihm in Aachen auch nicht erlaubt gewesen wäre, und hatte nur zwanzig Schritte bis zur Kirche zu gehen. Zu leugnen war es nicht, daß er anjetzt von den großen Reliquien der Reichsstadt Aachen, dem Rocke der Jungfrau Maria und den Windeln des Christkindes, nicht mehr wie ehedem nur zwanzig Schritte entfernt wohnte. Auch ist ausgemacht, wenn er die Fronleichnamsprozession und in derselben den kolossalischen vermummten Mann, welcher zur Erbauung der rechtgläubigen Bürger und Bürgerinnen Aachens Karl den Großen als einen Heiligen vorstellt, ferner anzusehen gemeint gewesen wäre, so hätte er eine Stunde Weges darnach gehen müssen. Aber Meister Anton war ein so verstockter Protestant, daß er auf alle diese Dinge eben so wenig zu achten schien, als die Reichsstadt Aachen darauf, daß in ihr eine Familie weniger wohnte und auf vier Stühlen weniger gewebt ward.
Meister Anton hatte einen Bruder, namens Georg, der von Jugend auf Trieb hatte, fremde Länder zu sehen. Dieser arbeitete daher eine Zeitlang als Geselle in Holland, wo er mit den Herrnhutern in Zeist bekannt und ihrer Gemeinde einverleibt wurde. Die Ältesten sendeten ihn mit einer Empfehlung an die Brüder nach London. Daselbst arbeitete er bei verschiedenen ansehnlichen Tuchmachern in Southwark und lernte manche in seiner Vaterstadt unbekannten Vorteile. Es ging alles gut, bis daß die Ältesten das damals noch geltende Los des Heilands über ihn warfen. Dasselbe wies ihm eine Gattin an, welche, vermutlich nur zufälligerweise, nach dem Sinne der Ältesten, aber gar nicht nach dem Sinne Georgs war. Er bezeigte sich mit dem Los des Heilandes unzufrieden und fiel in die Gemeindezucht. Allein, er hatte so viel eigenen Willen, daß er sich dem Heilande und den durch ihn losenden Ältesten nicht ganz ergeben wollte, verließ daher die Gemeinde und zugleich England. Er kam nach Vaals, kurz nachdem sein Bruder sich daselbst gesetzt hatte. Er wäre sonst wohl nach seiner Vaterstadt Aachen gezogen. Denn das Los in London hatte ihm alle Lust zum Heiraten benommen; daher war er als ein einzelner Mann gar nicht willens, seine Manufaktur über vier Stühle zu treiben. Aber nun blieb er lieber, wo seine Kirche und sein Bruder war, wurde in Vaals Meister; und so hatte Aachen noch einen Einwohner weniger.
Es fügte sich, daß Meister Georgs Zurückkunft seinem Bruder auf mannigfaltige Art nützlich ward. Außer dem stillen Vergnügen brüderlicher Gesellschaft, welches das häusliche Glück dieser kleinen Familie vermehrte, gereichten Meister Georgs Kenntnisse von der engländischen Art zu weben und von der Verbesserung des feinen Gespinstes, welche er seinem Bruder ohne Vorbehalt mitteilte, der Manufaktur des letzteren zu nicht geringem Vorteile. Meister Georg besaß ebenfalls den anhaltenden Fleiß und die Genügsamkeit seines Bruders, nebst der den Herrnhutern gewöhnlichen heitern Frömmigkeit und Gleichmütigkeit, ihre Gemeindezucht abgerechnet, die freilich, so wie alle Kirchendisziplinen, mehr der Gemeinde als den einzelnen Gliedern nutzt. Er besaß noch dazu die Weltkenntnis, welche durch Reisen erworben wird, und die Menschenkenntnis, die derjenige nach und nach erlangen muß, welcher jahrelang unter den Herrnhutern gewesen ist und sowohl die Ältesten und die Vorsteher als die Glieder dieser Gemeinde in der Stille beobachtet hat. Dies mögen wohl nicht alle Brüder tun können oder tun wollen. Auch soll ein alter Herrnhuter gesagt haben, wer auf solche Weise beobachte, werde mit der Zeit entweder ein Ältester werden oder die Gemeinde verlassen.
Diese Welt- und Menschenkenntnis Meister Georgs gereichte nach und nach der ganzen Familie zum Nutzen. Meister Anton war fleißiger im Arbeiten als im Sprechen. Wenn er daher mit seiner Sabine abends oder sonntags zusammensaß, dies oder jenes zu überlegen, so redete sie mehrenteils allein. War aber Meister Georg dabei, so redete er gewöhnlich, und Frau Sabine antwortete zuweilen. Meister Georg war das Orakel der Familie: manchmal redete er auch, wie sonst die Orakel, ganz allein, gewöhnlich aber doch deutlicher und nützlicher als diese.
Meister Antons Manufaktur bekam nach einiger Zeit durch einen Zufall eine große Verbesserung und der Wohlstand seines Hauses dadurch noch einen größeren Zuwachs. Als er in Aachen wohnte, war sein nächster Nachbar ein Doktor der Arzneigelahrtheit, der aber nicht praktizierte, sondern, wie es schien, von seinen Einkünften ganz stille lebte. Wir sagen, wie es schien; denn wirklich zehrte er nicht nur seine Einkünfte, sondern auch sein Kapital auf, und seine anscheinende stille Ruhe war eigentlich unordentliche Tätigkeit. Denn Doktor Anselm Ettmann war unablässig bemühet, den gebenedeiten Stein der Weisen zu finden, und suchte in Tiegeln und Kohlen so lange nach Gold, bis er weder Silber noch Kupfer besaß, um Tiegel und Kohlen zu kaufen. Doktor Ettmann besaß in der Tat soviel chemische Kenntnisse, daß aller dunkler Unsinn alchemistischer Schriften seinen Beobachtungsgeist nicht ganz hatten ersticken können. Dabei war er, seine Torheit ausgenommen, der beste Mann, weshalb auch Meister Anton, der von dieser Torheit kaum etwas wußte, beständig gute Nachbarschaft mit ihm gehalten hatte. Er kam endlich immer mehr herunter. Zum Kummer über seine fehlgeschlagenen Hoffnungen und zum Mangel an allem Nötigen kam noch eine tödliche Krankheit. Meister Anton, der, um Wohltaten zu erzeigen, nicht wartete, bis sie gefordert wurden, unterstützte seinen gewesenen Nachbar, als er bei seiner oftmaligen Anwesenheit in Aachen dessen betrübten Zustand vernahm, sogleich mit Arzneimitteln und Pflege, die sein Leben retteten; und da kurz darauf von den Gläubigern des Doktors dessen Wohnung ganz ausgeräumt und die sämtlichen Habe verkauft ward, nahm ihn Meister Anton in sein eigenes Haus zu Vaals auf. Doktor Ettmann war der Tätigkeit gewohnt, er wendete daher seine chemischen Kenntnisse zum Besten seines Wohltäters an, indem er ihm Anleitung zu großen Verbesserungen seiner Tuchfärberei gab. Es wurden ganz neue Farben erfunden, andere erhöhet und dauerhafter gemacht. Diese und die von Meister Georg mitgeteilten Vorteile, verbunden mit Meister Antons anhaltendem Fleiße und Eifer, gaben seiner Manufaktur die sichtlichsten Vorzüge. Die Anzahl der Stühle und des Absatzes nahm in wenig Jahren ungemein schnell zu, und Meister Anton ward dadurch binnen kurzer Zeit aus einem armen Aachener Tuchmacher ein reicher Manufakturist in Vaals.
Durch die Dankbarkeit des Doktors war der Wohlstand Meister Antons fest gegründet worden, aber dieser gab jenem an Dankbarkeit nichts nach. Er legte ihm ein beträchtliches Gehalt bei, kaufte ihm ein Haus und gab ihm seine Schwester Leonore zur Ehe.
So reich nun Meister Anton geworden war, so blieb doch die ganz einfache Einrichtung seiner Familie und ihre vorherige Frugalität unverändert. Es ward keine Schüssel mehr auf den Tisch gesetzt als im ersten Jahre der angefangenen Haushaltung; keine Veränderung in der Kleidung war zu merken, kein neumodisches Hausgerät ward eingeführt. Alle Tage der Woche wurden mit ununterbrochener Beschäftigung zugebracht; die Abendstunden und die verträglichen Sonntagsgesellschaften der Brüder und
Zweiter Abschnitt. Geburten und Todesfälle
Mit dem Anfange des siebenjährigen Krieges, dieser wegen Glorie und Elend in Deutschland unvergeßlichen Periode, fing die schnelle Vergrößerung von Meister Antons Manufaktur und Reichtum an; und eben damals gebar Frau Sabine ihren ersten und einzigen Sohn. Meister Anton nannte ihn Anselm nach dem Doktor, seinem Schwager, gegen den er immer dankbar blieb, obgleich er ihn belohnt hatte.
Anselmino war, von seiner Geburt an, ein frisches, fettes, rundes, kurzes Kind, d'un aimable embonpoint, und ward, wie weiter unten erhellen wird, ein rundes kurzes Kerlchen, fröhlich und munter, schwatzhaft, leichtsinnig und lustig. Wie es nun zuging, daß Anselmino so fett ward, obgleich von magern Eltern entsprossen, so feurig und fröhlich, als jene ernsthaft und gesetzt, und so redselig und unbedachtsam, als sie beide das Gegenteil waren: das gehört zu den transzendentalen Dingen, worüber die Philosophen von jeher hundert Fragen aufwarfen; z. B. ob das Ding, welches du siehest, dem Dinge an sich selbst gleicht oder nicht? Ob es außer dem positiven Nichts noch ein negatives Nichts gibt; ob ein positives Unding oder ein Unnichts zweierlei sind; ob das Nichts bewegbar oder unbeweglich sei, und dergleichen gelehrte Fragen mehr. Die neueste Philosophie lehrt uns, niemand unter dem Monde könne von solchen Dingen etwas wissen oder begreifen; obgleich freilich eben diese Philosophie noch immer einiges Jucken zu haben scheint, das meiste davon zu erklären, indem sie immerfort versichert, es ließe sich gar nichts davon wissen. Wir wollen also versuchen, noch bescheidener zu sein als die so bescheidenen neuesten Philosophen, und über die obige wichtige Frage von fett und mager, lustig und still, gar nichts sagen. Könnt Ihr Euch aber ja bei unserer Bescheidenheit nicht beruhigen, so ergreift das Mittel, Euch an Herrn Doktor Grohmann zu wenden. Dieser weiß ganz genau, wie es hergehet mit der Zeugung der Söhne und der Töchter, daß sie so oder so geraten, und wie es geschieht, daß die Temperamente knochenreich oder koleurischknochenreich oder koleurisch – So nennt D. Grohmann eins von seinen neuerfundenen Temperamenten. S. Magazin zur Seelenkunde, Xten Bandes 2tes Stück, S. 26 (Anm. Nicolais). werden. Dr. Grohmann wohnt in Wittenberg. Seht aber zu, daß Ihr auf den rechten Doktor treffet; denn trefft Ihr auf einen andern Wittenbergischen Gelehrten, der Euch auslacht, so ists wenigstens unsere Schuld nicht.
Anselmino war die Freude seiner Eltern und seines Oheims Georg, der den Jungen von Kindesbeinen an liebte, als wäre es sein eigener Sohn. Wenn alle drei nebst Frau Leonoren in den langen Winterabenden des Jahres 1756 nach vollbrachter Arbeit einträchtig beisammen saßen, so ging Anselmino aus Hand in Hand, und alle freuten sich, daß er so gesund und so rund war. Diese Freude nahm zu, als er nach einem Jahr herumzulaufen anfing und so rund als gesund blieb. So wuchs das Kerlchen fort, immer mehr im Umfange als in der Höhe, und blieb so fünf Jahre lang und länger. Da hätte beinahe schon seine künftige Bestimmung unter beiden Eltern und unter Bruder Georg den ersten Zwist veranlaßt. Die Eltern besprachen sich oft darüber, ihr einziger Sohn müsse kein gemeiner Mann bleiben wie sie. Beide waren sogleich eins, er solle studieren; und so ward Anselmino schon den Musen geweihet, ehe er noch buchstabieren konnte. Wir sagen buchstabieren; denn weil damals die heilsamen neuern Lesemethoden noch nicht erfunden worden, war das gute Kind unglücklich genug, wirklich erst buchstabieren zu müssen, ehe es lesen lernte. Wer weiß, welche von den widrigen ihm zugestoßenen Begebenheiten und wie mancher von seinen Irrtümern, welche wir weiter unten erzählen werden, in dieser verkehrten Lehrmethode ihren Ursprung haben mag! Wer weiß, um wie viel unsere glücklichere philosophisch zum Lesen angeführte Jugend künftig konsequenter denken und folglich moralischer handeln wird, als wir weniger glücklichen Väter und unsere ältesten Söhne!
So sehr nun aber beide Eltern darin übereinstimmten, daß ihr Sohn studieren sollte, so sehr uneins waren sie über den gelehrten Stand, welchen sie für ihn zu wählen hätten. Die Mutter wollte ihn, wie leicht zu erraten, der Gottesgelahrtheit gewidmet wissen; denn welche größere Freude kann eine Mutter wohl haben, als ihren Sohn predigen zu hören! Der Vater war aber nicht so sehr aufs Geistliche gesteuert. Er stellte sich dieses Leben, wo es ihm so wohl ging, viel lebhafter vor als das künftige, über welches ihm noch so manches dunkel blieb. Er hielt daher einen Arzt für einen nicht zu verachtenden Mann. Dabei wußte er, so frugal er auch selbst lebte, sehr wohl, was in der Welt mit Geld auszurichten ist. Daß die Arzneikunde Geld bringe, sah er an einigen Ärzten in Aachen, welche in der Stadt viel gebraucht und oft auch nach benachbarten Landgütern und fürstlichen Höfen geholt wurden, ob es ihm gleich schien, dieselben wären im Heilen schwerer Krankheiten nicht ganz so glücklich, als er im Färben echter Tücher. Er beschloß also, sein Sohn sollte ein Arzt werden, und sah schon in Gedanken, wie derselbe in eigener Kutsche auf den Straßen von Aachen herumrollte und im fürstlichen Zuge von Sachsen über Land geholt wurde.
Ganz andrer Meinung war Oheim Georg. Derselbe hatte vermutlich bei den Herrnhutern, wo bekanntlich gar kein Unterschied der Stände gilt, die Begriffe von Gleichheit aller Menschen eingesogen, welche machten, daß er, beinahe wie jetzt die unhosigen und langhosigen Franzosen, jeden höhern Stand als etwas Unnatürliches ansah. Er meinte, die Familie sollte ja aus ihrem Kreise sich nicht emporheben, und der Junge dürfe daher nichts als ein Tuchmacher werden wie sein Oheim und sein Vater. Er stellte letzterm vor, was sich auch hören ließ, es werde natürlicher sein, diesen Sohn so zu erziehen, daß die schöne Manufaktur durch ihn im Flore erhalten bleibe, wodurch auch der künftige Wohlstand des jungen Menschen sicherer werde gegründet werden als durch ungewisse Hoffnungen und Aussichten. Aber diese Vorstellungen halfen wenig bei den Eltern, denen eben jene weitaussehenden Hoffnungen sehr viel Vergnügen machten. Es hätte dieser Zwist leicht zum Nachteile des häuslichen und brüderlichen Friedens ausschlagen können. Denn, so ein schlichter und verträglicher Mann auch Meister Anton war, so hatte er doch seinen kitzlichen ambitiösen Fleck und Frau Sabine ebenfalls. Dazu kam, daß, wie oben bemerkt worden, Oheim Georg gewohnt war, in der Familie am lautesten zu reden, und es fiel ihm auf, daß jetzt zum ersten Male das Gegenteil geschah.
Die übeln Folgen wurden indes durch ein Wort von Frau Leonoren glücklich gehindert. Sie bemerkte in der größten Hitze des Streits: Es sei unnötig, über das Schicksal des Knaben jetzt zu streiten, man könne ja lieber geduldig abwarten, wie es etwa mit ihm und seinen Fähigkeiten werden möchte. Dabei küßte sie den dicken Jungen und gab ihn auch dem Vater in die Arme. Die beiden Männer wunderten sich, wie ihnen ein so natürlicher Gedanke nicht selbst eingefallen wäre, und gaben einander treuherzig die Hände, obgleich jeder insgeheim wünschte, daß sein Plan zum vermeinten Glücke des Knaben ausgeführt werden möchte.
Die gute Frau Leonore hatte im Ehestande wenig Gelegenheit gehabt, Erfahrungen von Glücke zu machen, aber desto mehr Gelegenheit zur Prüfung ihrer Geduld. Kaum sah sich ihr Mann, der Doktor, wieder in guten Umständen, so fing er aufs neue an, alle Zeit, welche er nicht zu den Versuchen für die Färberei der Manufaktur brauchte, aufs Laborieren zu wenden. Er kam bald wieder in Schulden und sein ganzes Hauswesen in Unordnung. Unter diesen Umständen war Frau Leonore zum ersten Male guter Hoffnung. Sie gebar einige Monate darauf eine Tochter. Der Doktor ließ das Mädchen Sophia taufen, seine Ehrerbietung gegen die geheime himmlische Weisheit anzuzeigen, welche von seinem Schwager, seiner Meinung nach, verkannt ward. Er starb aber kurz darauf als ein Märtyrer dieser geheimen Weisheit. Soeben glaubte er, endlich die jungfräuliche Erde gefunden zu haben, in welcher er den Merkur figieren wollte. Plötzlich aber sprang das philosophische Gefäß, und er ward in Rauch und Flammen erstickt. Seine Frau, schon durch so manche Leiden geschwächt, fiel über den Schreck in eine heftige Krankheit und starb bald nach ihm.
Meister Anton sah wohl ein, daß die Begierde, Gold zu machen, eine unheilbare Krankheit ist. Er beweinte seine Schwester, bezahlte seines Schwagers Schulden und nahm die kleine Tochter in sein Haus, wo er sie als sein eigenes Kind erzog.
Dritter Abschnitt. Sophiens und Anselms Kinderjahre
Anselmino Redlich wuchs indes heran und war, da er elf Jahre alt geworden, ein kleines, rundes, frisches Kerlchen, über das sich alle Nachbarn freuten. Er hatte einen offenen Kopf, war immer fröhlich und guter Dinge und lernte in der Schule Sprüche und Vokabeln mit gleicher Leichtigkeit auswendig. Denn es hatte sich in Vaals ein ältlicher Kandidat der Theologie eingefunden, welcher nach manchen Wanderungen sich daselbst als Schulmeister setzte, um den deutsch-holländischen Kindern zu ihrem Fortkommen in dieser Welt die lateinische Sprache, und zu ihrem Wohle in der künftigen Welt den ganzen Inhalt von Braunii Doctrina Foederum s. Systema Theologiae didacticae beizubringen. Dieser Lehrer gewann unsern Anselm wegen seiner Fähigkeit, Worte auswendig zu behalten, so lieb, daß er mehr als einmal prophezeite, der Knabe werde ein großer Gelehrter werden, welches Frau Sabine im Stillen vor sich selbst auslegte, ein trefflicher Prediger.
Anselmino hatte zwei in die Augen fallende Eigenschaften, von welchen der Schreiber dieses nicht gewiß weiß, ob sie, an einem Knaben bemerkt, voraussagen müssen, er werde ein Licht der Kirche werden. Anselmino liebte von Jugend an jedes hübsche Mädchen; und Anselmino meinte, sehr klug zu sein. Was die letzte Eigenschaft betrifft, so war sie freilich selten in seinen Handlungen zu erkennen; denn ob er gleich sehr klug zu sprechen pflegte, so handelte er doch sehr oft unklug. Dies ging indes damals noch auf Rechnung seiner Knabenjahre; und auf eben diese Rechnung ging denn, mit gleicher Nachsicht, sein Gaffen nach jedem hübschen Mädchen. Wer wird auch einem muntern Knaben darum gram sein, wenn ihm die schönen Mädchen gefallen, und wenn er ihnen gefallen will? Die Mädchen nicht, die Mütter nicht; und ich denke, auch der liebe Gott nicht, der auf die Zuneigung beider Geschlechter zueinander, recht angewendet, die Erhaltung des menschlichen Geschlechts und, was eben so viel wert ist, dessen häusliches Glück gegründet hat!
Die junge Sophie war von schlankem Wuchse und von griechischer Gesichtsbildung; ihre kastanienbraunen Locken kräuselten sich neben den Grübchen ihrer blühenden Wangen und fielen von ihren Schultern herab; ihre sittsamen hellblauen Augen lockten die Herzen an sich. Sie war freundlich, gefällig, munter, hatte eine Silberstimme und sang schon als ein Kind gern fröhliche Lieder. Ursachen genug, daß Anselmino an Sophien wie an einer beständigen Gespielin seiner Jugend hing. Er zog sie allen Mädchen vor, die er in Vaals und in Aachen gesehen hatte, so wie sie auch ihn allen andern Knaben. Die Alten im Hause, die sich selbst gegenseitig liebten, freuten sich der so merklichen herzlichen Zuneigung der Kinder, welche von allen Verwandten und Nachbarn die kleine Braut und der kleine Bräutigam genannt wurden.
Einst hatten sich beide beim Spielen im Dorfe an einem schönen Sommertage an das äußerste Ende desselben verlaufen. Da fanden sie auf dem grünen Rasen einen Knaben sitzen, der totenblaß und ganz abgezehrt war. Auf vieles Fragen erfuhren sie endlich von ihm, er sei von langer Krankheit abgemattet, habe seine Eltern verloren und keinen Menschen in der Welt, der sich seiner annähme. Das Mitleid der guten Kinder ward erregt. Sophiechen teilte mit dem Kranken ihr Vesperbrot und bat ihren Gespielen, bei seiner Mutter, deren Liebling er, wie sie wußte, war, um mehr Beihilfe für den armen Knaben anzuhalten. Anselmino stand nachdenkend, fühlte seine Selbständigkeit zum ersten Male, und seine Klugheit, auf die er sich jetzt wieder etwas zugute tat, blies ihm ein, was er selbst verrichten könne, darum dürfe er nicht bitten. Er teilte Sophiechen folgenden Plan mit: In den weitläufigen Gebäuden, aus welchen seiner Eltern Gehöfte bestand, war eine entlegene Kammer, die nicht gebraucht ward und zu der man unbemerkt kommen konnte. Er schlug vor, den kranken Knaben ganz insgeheim dahin zu führen. Da wollte er dann ihm etwas von seinen Betten bringen, und sie beide wollten ihr Frühstück und Mittagessen unbemerkt mit dem Kranken teilen, um demselben wieder Kräfte zu verschaffen. Seine kleine Freundin hatte hiewider manches einzuwenden, aber seine Beredsamkeit siegte. Sie führten den ermatteten Knaben fort und brachten ihn unbemerkt an Ort und Stelle. Anselmino schleppte ihm noch spät gegen Abend einen Teil seiner Betten und den größten Teil seines Abendessens zu und war froh, daß er ihn ein paar Tage lang mit allem, was aufzufinden war, reichlich speisen und tränken konnte.
Freilich machte diese so klug ausgesonnene Wohltätigkeit einige Unordnung in der Haushaltung. Niemand konnte begreifen, wo die Betten geblieben waren, und die Dienstboten kamen darüber in unverdienten Verdacht. Backwerk und Semmeln verschwanden, Teller, worauf Überbleibsel der Mahlzeiten dem Kranken waren gebracht waren, wurden vermißt, und Unschuldige wurden deshalb beschuldigt. Anselmino geriet darüber in einige Verlegenheit; allein der Triumph, sich über den Erfolg seines glücklichen wohlausgesonnenen Planes zu freuen, schien ihm doch so schön, daß er den Bitten der ängstlichen Sophie, welche die Sache entdeckt wissen wollte, nicht nachgab. Die häusliche Verwirrung hätte noch einige Zeit währen können, wenn nicht Philipp, der kranke Knabe, welcher merkte, daß, was mit ihm vorging, nicht in der Ordnung sei, sie geendigt hätte, indem er aus der Kammer hervorkroch und sich selbst zeigte. Er ward von den Hausgenossen, die ihn, seinem elenden Ansehen und schlechten Kleidung zufolge, gleich für schuldig erklärten, vor den Richterstuhl der Frau Sabine gebracht. Der arme Schelm fand hier eine sehr barmherzige Richterin. Ihr Sohn bekam zwar von den Eltern einen gelinden Verweis, aber seine Gutherzigkeit ward bestätigt und Philipp nun unter Autorität ins Haus aufgenommen, von dem Rest seiner Krankheit geheilt, gespeiset und bekleidet.
Anselmino tat sich insgeheim nicht wenig auf seinen klugen Plan zugute, zumal da dadurch die Liebe seiner Eltern gegen ihn nicht vermindert, Sophiechens Liebe hingegen, seiner Gutherzigkeit wegen, noch vermehrt ward. Sollte der geneigte Leser etwa meinen, Anselmino habe, wenngleich gutherzig, doch nicht so klug gehandelt, als er sich dünkte, und sollte daraus etwa – wie es denn geneigte Leser gibt, welche in Geschichten dieser Art gern weit voraussehen mögen – auf die künftige Beschaffenheit des Charakters unsere Helden etwas schließen wollen: so wird gebeten zu bedenken, daß Anselmino nur ein Knabe war und daß wir noch nicht wissen können, ob sich nicht vielleicht in der Folge dieser Geschichte die Klugheit unsers dicken Männchens, noch ehe er ein dicker Mann ward, in viel vorzüglicherm Glanze zeigen möchte.
Was Philipp betraf, so fand sich, daß er aus dem benachbarten Dorfe Vylen kam, wohin sich sein Vater, ein verarmter Kaufmann aus Mastricht, begeben hatte, um dort auf besser Glück zu warten. Er hatte eben den größten Teil seines Vermögens verwendet, um seinen ältesten Sohn, der als Schiffschirurgus zur See ging, einigermaßen zu equipieren. Er selbst war eine Art von Schreiber bei einem in Vylen wohnenden Herrn; und seine Frau spann für eine Manufaktur in Vaals, wozu auch Philipp schon war angehalten worden. Eine epidemische rote Ruhr grassierte im Dorfe und hatte beide Eltern in kurzem weggerafft; Philipp, den niemand weiter hegen wollte, hatte sich halb genesen nach Vaals geschleppt, um zu erfahren, ob er dort Arbeit bekommen könnte, sein Leben zu fristen.
Dieser von allen verlassene Waise fand an Meister Anton einen neuen Vater. Da er schon lesen und etwas schreiben konnte, so ward er in die Schule geschickt. Daselbst lernte er, wie Anselm und alle andern Kinder, so viel es sein konnte, Lateinisch und besonders die Theologie aus Braunii Systema Theologiae didacticae. Neben diesen wichtigen Dingen vervollkommnete er sich auch noch im Schönschreiben und Rechnen. Diese Kleinigkeiten haben schon hin und wieder einem armen Knaben durch die Welt geholfen, ob sie gleich gegen die unermeßlichen Schätze des Wissens, welche in der Dogmatik und lateinischen Phraseologie liegen, gar nicht in Vergleichung zu bringen sind.
Dabei ward Philipp außer der Schulzeit zu allerhand kleinen Diensten im Hause gebraucht, wobei er sich sehr anstellig zeigte. Auch ward er Anselminos Spielgesell, wozu er sich aus einer besondern Ursache sehr gut schickte. Wir haben schon bemerkt, daß unser Held von Jugend auf ziemlich redselig war und sich nicht wenig klug dünkte; Philipp hingegen war von Natur bescheiden und etwas tacitum. Hier zeigte er sich noch nachgiebiger und bescheidener; denn er fühlte, daß er ein armer Knabe sei, und er wußte schon, daß ein solcher ohne Schweigen und Nachgeben in der Welt nicht fortkommen könne, da selbst ein reicher Mann beides zu beobachten sehr nötig hat. Anselmino war aber auch ein gutherziger Junge, obgleich etwas eigenliebig, doch nicht stolz, und Philipp war sein guter Geselle. Ob nun zu dieser Zuneigung nicht etwas beigetragen habe, daß er an Philipp einen Spielgesellen hatte, dem er seine klugen Einfälle vorsagen konnte, der ihn anhörte und ihm recht gab, mag der sittenforschende Leser in des alten Buddeus Moraltheologie im Kapitel von der Falschheit der menschlichen Tugenden oder in den Werken anderer Gottesgelehrten nachschlagen, welche den Menschen, die edelste Kreatur Gottes, im Reiche der Natur fleißigst erniedrigen, um ihn im Reiche der Gnaden desto mehr zu erhöhen.
Vierter Abschnitt. Schulweisheit, Examen, Gespräch übers Latein
Anselmino war nach und nach beinahe vierzehn Jahre alt geworden und Sophiechen beinahe zehn Jahre. Sie gefielen sich wechselseitig täglich mehr und fingen an, ungeduldig zu werden, wenn sie nicht beständig beieinander sein konnten. Wie aber überhaupt die Ordnung der Dinge in der Welt gemeiniglich nicht so zu gehen pflegt, wie sie die Verliebten gerne haben möchten, so ereignete sich ein Umstand, an den sie gar nicht dachten und der doch Ursache war, sie auf eine ziemliche Zeit zu trennen.
Die lateinische Schule hatte nun an unserem Anselmino geformt, was durch sie zu formen war. Er hatte konstruiert, exponiert, analysiert, Phrases ausgezogen, lateinische Reden gehalten und lateinische Verse gemacht. Er hatte sogar etwas von den römischen Altertümern gelernt und wußte, wie die Konsuln und die Ädilen in Rom waren gewählt worden. Freilich wußte er nicht, wie die Generalstaaten gewählt werden, auch nicht, ob sie in Vaals etwas zu befehlen hätten. Denn, warum sollten in gelehrten Schulen Kinder mit der Verfassung des Vaterlandes bekannt gemacht werden, da diese zu wissen keine Gelehrsamkeit ist? Dagegen hatte Anselmino einen guten Begriff von den Sätzen der Dordrechtschen Synode; sogar, daß er schon mit katholischen Seminaristen aus dem Konvente der Stiftsherren des heiligen Grabes zu Schlenaken, die in der Vakanzzeit nach Vaals kamen, über die Religion disputiert und, weil sie älter und stärker waren, von ihnen Ohrfeigen bekommen hatte. Er war nun der Erste in der Schule, und der alte Kandidat erklärte, daß er ihn weiter nichts lehren könne, er möchte denn etwa mit dem Knaben, ehe dieser nach der Universität ginge, des Ruarus Andala Logik durchnehmen, wovon er sich selbst noch etwas erinnerte. Er schlug daher vor, unser dickes Männchen von gelehrten Leuten examinieren zu lassen, damit die Eltern sehen sollten, wie geschickt der Knabe sei. Es wurden also einige holländische Domine aus der Nachbarschaft zusammengebeten, und, nachdem sie gut zu Mittage gegessen hatten, ward Anselmino examiniert. Er exponierte, analysierte und perorierte ohne Anstoß, beantwortete im besten Schullateine alle Fragen aus Braunii Theologia didactica; und alle Examinatoren sagten einstimmig, nie habe noch ein Knabe von so zartem Alter so gelehrte Antworten gegeben; aber alle waren auch darin einstimmig, er sei noch allzu jung, um auf die Universität zu gehen.
Die kleine Sophie erschrak zwar vor dem vielen Lateine, weinte aber doch vor Freuden, daß ihr Anselm so gelobt wurde. Anselmino war bei der ganzen Sache ziemlich unbefangen und gleichgültig gewesen, weil man ihn lauter Dinge fragte, die er vermöge seines guten Gedächtnisses auswendig wußte. Nun aber fing ihm das Examen an, merkwürdig zu werden, da Sophiechen, unvermerkt ihm die Hand drückend, ihn mit dem freundlichsten Blicke lobte. Mutter Sabine ließ ein paar Tränen der Freude fallen, sah aber ganz ernsthaft aus; und Meister Anton, so wie auch Oheim Georg, sagten nicht ein Wort.
Als die Herren weggefahren und die Kinder in den Garten gesprungen waren, saßen die Alten eine Zeitlang stillschweigend und in Gedanken. Endlich sagte Meister Anton, den Kopf schüttelnd: »Ich hätte doch nicht gedacht, daß Anselm so sehr gelehrt wäre. Wie muß der arme Junge seinen Kopf haben anstrengen müssen, um das alles zu behalten!«
Oheim Georg fuhr heraus: »Du sagst, er ist gelehrt; und ich sage, er ist dumm.«
»Dumm?« riefen beide Eltern zugleich aus.
»Ja freilich! dumm! – denn der Junge weiß nichts, als was er auswendig gelernt hat. Er hat mir schon vorher zehn Fabeln von Gellert hergebetet, und er konnte auf mein Verlangen keine einzige nach seiner Art mit andern Worten erzählen. Nein, bei den Herrnhutern hab ich auch Schulen gesehen, da geht man aber nicht bloß auf Gedächtniswerk. Weißt du was, Bruder Anton! Leicht gelernt, ist bald vergessen! Wenn nun der Junge vergißt, was er jetzt auswendig weiß, so weiß er alsdann gar nichts. Das nenn ich dumm sein! Und ob ihm das, was er uns heute auf lateinisch vorgesagt hat, was helfen kann, wenn er groß wird, das versteh ich nicht. Aber ich habe nun einmal keinen Glauben ans Lateinische.«
Meister Anton schlug die Augen nieder und dachte bei sich: »Wenn er Doktor wird, wird er mit den Kranken nicht lateinisch reden.«
Mutter Sabine schwieg, aber dachte bei sich: »Lateinisch predigen wird er nicht!« Und dabei fiel ihr ein, daß sie alle vom Examen nichts verstanden hätten und daß es doch vom Kandidaten wäre angestellt worden, damit sie wissen sollten, was Anselm gelernt hätte.
Oheim Georg schwieg nicht, sondern fuhr in einem verdrießlichen Tone fort: »Und wenn der Junge gar nichts gelernt hat als das Latein, wozu wird ihm das helfen, wenn er einmal deine Manufaktur übernehmen soll? Denn am Ende wird es doch wohl am klügsten sein, ihn dazu zu erziehen, wenn du nicht willst, daß die Manufaktur untergehe, ohne daß deine Kinder etwas davon haben sollen.«
Meister Anton schwieg abermal, denn er fühlte wohl, daß der Bruder nicht Unrecht hatte; aber daß sein Sohn nicht Doktor werden solle, wollte ihm auch nicht eingehen. Er dachte also nur: »Schade, daß der Junge noch zu jung ist, um nach der Universität zu gehen, da er doch schon so viel schönes Latein weiß! Wo soll er bis dahin bleiben, da er jetzt in der Schule nichts mehr lernen kann?«
Es ist oft die Sorge der Eltern, nicht, wie ihre Kinder zu erziehen, sondern nur, wo sie zu lassen sind. Haben sie so ganz unrecht? Wenn man die Kinder nicht selbst erziehen kann, muß man sie ja jemand abzurichten geben!
Im Fortgange der Unterredung kamen sie alle überein, Anselm müsse außer dem Hause irgendwo untergebracht werden; denn Meister Georg sagte: »Bruder Anton, der Junge ist für dein Haus allzu gelehrt und wird dir mit seinem Lateine und mit allem dem Zeuge, das er im Kopfe hat, alle deine Arbeiter aufsässig machen!«
Man sieht, Meister Georg, obgleich nur ein gemeiner Tuchmacher, war scharfsichtig genug, schon vor mehr als zwanzig Jahren Sinn für den jetzt von so manchen Staatsleuten angenommenen Satz zu haben, daß zu viel Gelehrsamkeit und Aufklärung endlich zum Aufruhre führe. Wie würden auch gegenwärtig in Frankreich die vielen Greuel entstehen, wäre nicht, wie weltbekannt ist, Jourdan, der Kopfabschneider, ein vertrauter Schüler des garstigen Hans Jakob Rousseau gewesen und der schleichende Abt Sieyes nebst dem heftigen Robespierre die vornehmsten Mitglieder der Akademie der Wissenschaften zu Paris? Hätte Philipp Egalité, als Prinz und als Bürger gleich nichtswürdig, wohl mit so unverschämter Stirn für den Tod seines Königs und Vetters gestimmt, wenn er nicht ein so großer Freund und Beförderer der Aufklärung und der Philosophie gewesen wäre? Und würden die Unhosigen in Frankreich wohl so arg gegen Monarchen und monarchische Regierung toben, wenn sie nicht, vermöge ihrer großen Liebe zu den alten Sprachen, sich so innig mit dem Geiste der Griechen und Römer genährt hätten?
Fünfter Abschnitt. Ein neuangelegtes Philanthropin. Notwendige Ehrenrettung Herrn Rehbergs in Hannover, des Philosophen
Kurz vor der Zeit, als in Vaals das oben beschriebene Examen unsers Anselmino und die dadurch veranlaßte Unterredung vorfiel, war in ganz Deutschland die erste Periode einer weltbekannten pädagogischen Reform angegangen. Basedow hatte den Plan gemacht – oder, um bestimmter zu reden, eigentlich nicht einen Plan gemacht, sondern nur sich eingebildet – vermittels einer kleinen Erziehungsanstalt allenthalben die ganze Erziehungsart und, vermittels derselben, das gesamte Menschengeschlecht auf bessern Fuß zu setzen. Er verlangte dreißigtausend Taler, um diese allgemeine Umformung zu Stande zu bringen. Er ließ gedruckte Aufforderungen an dreihundert große und kleine Potentaten ergehen; und als von diesen doch die dreißigtausend Taler nicht einkamen, so tat er Notschüsse über Notschüsse, damit das Wohl des menschlichen Geschlechts gerettet werde. Seine Einbildungen und seine Notschüsse sind vergessen, sowie seine andern Schwachheiten und Seltsamkeiten; aber die späteste Nachwelt wird dankbar erkennen, daß er sein Elementarwerk zu Stande brachte und den Nutzen desselben nicht in Träumen, sondern praktisch zeigte. Dies ist ein Unternehmen, welches den heilsamsten Einfluß auf die Verbesserung der Erziehung hatte und welches die armen Kinder von dem unseligen Wörterkrame und von der zwecklosen harten Schuldisziplin zu erlösen anfing. Beides erweckte in den Köpfen der von seelenloser Schulpedanterei niedergedrückten Lehrer (auch derer, welche Basedows Methode tadelten) eine Menge wohltätiger Ideen zum Besten der Jugend; und beidem können Mißbräuche in der Anwendung so wenig den verdienten Ruhm entziehen, als irgendeiner andern kühn unternommenen, aber im Anfange unvollkommen ausgeführten Reformation.
Es gab aber damals Pädagogen, und gibt vielleicht noch jetzt dergleichen, welche weder Basedows Einsicht noch Mut besaßen. Ihnen wurden bloß durch ihre Habsucht die zu erwartenden dreißigtausend Taler und durch ihre Präsumtion die Lust, eine ganze Welt umzuformen, vorgespiegelt, und bloß dadurch bekamen sie Neigung und Beruf zur Erziehung. Ein solcher war der wohlehrwürdige Herr Erasmus Quincunx, ein reformierter Prediger im Herzogtume Jülich: ein schöner Geist und ein großer Liebhaber der Entenjagd, der öfter, wenn er seiner Gemeinde predigen oder ein Kind taufen sollte, im Walde oder im schilfichten Sumpfe aufgesucht werden mußte, wo er entweder den Reimen oder den wilden Enten nachstellte. Nun hielt die ehrwürdige Provinzialsynode des Herzogtums Jülich eben nichts von Predigern, welche Verse machen, und noch weniger von denen, welche wilde Enten schießen. Es erfolgten also Vermahnungen, welchen Pastor Erasmus Quincunx, der nicht sonderlich geneigt war, sich vermahnen zu lassen, dadurch auswich, daß er sein Amt schnell niederlegte; zumal da jene Reskripte gerade zwischen Johannis und Jakobi ankamen, der besten Zeit zur wilden Entenjagd mit Stecknetzen, welche er nicht mit Schreiben verderben mochte.
Er war mehr des freien Lebens als des Sitzens gewohnt und dachte als Jäger, irgendwo sein Unterkommen zu finden. Zu dem Behufe ging er nach Dessau, wo die Jagd bekanntlich in großem Flore steht. Er fand aber dort die wilde Entenjagd nicht nach seinem Sinne; dagegen lernte er Basedows Philanthropin kennen, dessen Ruf noch nicht bis in die Gegend zwischen der Maas und Roer gedrungen war. Da er überhaupt in Dessau als Jäger nicht, wie er glaubte, sein Fortkommen fand, entschloß er sich, lieber ein Lehrer der Jugend zu werden. Die Pädagogen und die, welche es werden wollten, wallfahrteten damals in großer Anzahl nach Dessau. Unter ihnen erschien auch der Expastor Erasmus Quincunx vor Basedow mit dem Begehren, bei der Anstalt Lehrer zu werden. Es ging dies schon deshalb nicht an, weil Basedow, wie bekannt, in seinem Philanthropine lateinisch reden ließ, wozu dieser Mann nicht eingerichtet war. Er ward daher abgewiesen, blieb aber noch einige Wochen in Dessau,