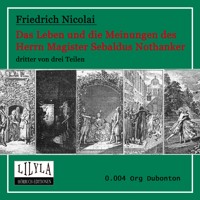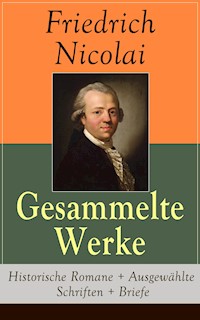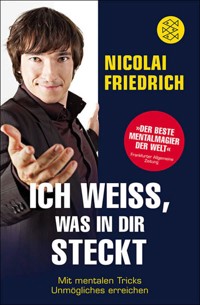Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Leben und Meinungen des Herrn Magisters Sebaldus Nothanker ist ein satirischer Roman von Friedrich Nicolai, der in 3 Bänden von 1773 bis 1776 veröffentlicht wurde und als ein wichtiges fiktionales Zeugnis der Aufklärung gilt. Der Titel ist entlehnt von Laurence Sternes äußerst erfolg- und einflussreichen Romanwerk The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman. Das Werk erzählt, wie schon der Titel angibt, das Leben des Sebaldus Nothanker, der im spätaufgeklärten Deutschland lebt. Es setzt, nach der im Vorwort gegebenen Erklärung, an einer eventuellen Nachzeichnung der Entwicklung des Nothanker uninteressiert zu sein, dort ein, wo, wie der Verfasser meint, viele Romane schon enden - mit der Vermählung des Protagonisten - um von hier ausgehend dessen weiteres Leben zu berichten. Der Stil, in dem dies dargeboten wird, ist im Sinne der Aufklärung betont nüchtern, beinahe karg. Selbst eine tiefer- oder weiterreichende Charakterisierung der Figuren wird vermieden. Im Inhalt erwacht aber dann die Emotionalität, mit der alle der Aufklärung feindlichen Tendenzen der Zeit aufgespürt werden, exemplarisch verwoben mit dem Leben der Hauptfigur, dessen Dienst als protestantischer Pfarrer an eben diesem Punkte scheitert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 621
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Leben und Meinungen des Herrn Sebaldus Nothanker
Friedrich Nicolai
Inhalt:
Friedrich Nicolai – Biografie und Bibliografie
Leben und Meinungen des Herrn Sebaldus Nothanker
Vorrede zur vierten Auflage
Vorrede zur ersten Ausgabe
Erstes Buch
Erster Abschnitt
Zweiter Abschnitt
Dritter Abschnitt
Vierter Abschnitt
Fünfter Abschnitt
Sechster Abschnitt
Siebenter Abschnitt
Zweites Buch
Erster Abschnitt
Zweiter Abschnitt
Dritter Abschnitt
Vierter Abschnitt
Drittes Buch
Erster Abschnitt
Zweiter Abschnitt
Dritter Abschnitt
Vierter Abschnitt
Fünfter Abschnitt
Sechster Abschnitt
Viertes Buch
Erster Abschnitt
Zweiter Abschnitt
Dritter Abschnitt
Vierter Abschnitt
Fünfter Abschnitt
Sechster Abschnitt
Siebenter Abschnitt
Achter Abschnitt
Neunter Abschnitt
Zehnter Abschnitt
Elfter Abschnitt
Zwölfter Abschnitt
Dreizehnter Abschnitt
Fünftes Buch
Erster Abschnitt
Zweiter Abschnitt
Dritter Abschnitt
Vierter Abschnitt
Fünfter Abschnitt
Sechster Abschnitt
Siebenter Abschnitt
Sechstes Buch
Erster Abschnitt
Zweiter Abschnitt
Dritter Abschnitt
Vierter Abschnitt
Fünfter Abschnitt
Sechster Abschnitt
Siebentes Buch
Erster Abschnitt
Zweiter Abschnitt
Dritter Abschnitt
Vierter Abschnitt
Fünfter Abschnitt
Sechster Abschnitt
Siebenter Abschnitt
Achtes Buch
Erster Abschnitt
Zweiter Abschnitt
Dritter Abschnitt
Vierter Abschnitt
Fünfter Abschnitt
Sechster Abschnitt
Siebenter Abschnitt
Neuntes Buch
Erster Abschnitt
Zweiter Abschnitt
Dritter Abschnitt
Vierter Abschnitt
Letzter Abschnitt
Leben und Meinungen des Herrn Sebaldus Nothanker, F. Nicolai
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849632632
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Friedrich Nicolai – Biografie und Bibliografie
Schriftsteller, geb. 18. März 1733 in Berlin, gest. daselbst 11. Jan. 1811, besuchte eine Zeitlang die Schule des Waisenhauses in Halle, dessen pietistische Richtung ihn zum Widerspruch herausforderte, lernte seit 1749 in Frankfurt a. O. als Buchhändler und suchte sich dabei durch ausgebreitete Lektüre, namentlich der englischen Schriftsteller, weiter fortzubilden. Nach seiner Rückkehr nach Berlin (1752) veröffentlichte er ohne Nennung seines Namens eine Schrift, in der er die törichten Angriffe der Gottschedianer gegen Milton zurückwies (1753), dann trat er mit den gleichfalls anonym erschienenen »Briefen über den itzigen Zustand der schönen Wissenschaften« (Berl. 1755; Neudruck von Ellinger, das. 1894) hervor, die sich sowohl gegen Gottsched als gegen die Schweizer Theoretiker wandten, für die Mustergültigkeit der englischen Literatur eintraten und strengere Handhabung der Kritik forderten. Sein Streben führte ihn mit Lessing und Moses Mendelssohn zu gemeinschaftlicher Tätigkeit zusammen, und bald schlossen sich andre an. Die Fortsetzung der mit Mendelssohn begonnenen »Bibliothek der schönen Wissenschaften und freien Künste«, in der N. seine beachtenswerte »Abhandlung vom Trauerspiel« veröffentlicht hatte (Leipz. 1757–58, 4 Bde.), ihrem Freunde Chr. Felix Weiße in Leipzig überlassend, begründeten beide im Verein mit Lessing die »Briefe, die neueste Literatur betreffend« (Berl. 1759–65, 24 Bde.). Hierauf brachte N. 1765 den Plan einer »Allgemeinen deutschen Bibliothek« zur Ausführung, die er anfangs mit Geschick und Erfolg redigierte, später aber mehr und mehr zum Organ der plattesten Aufklärung machte. Zensurschwierigkeiten, die unter dem Ministerium Wöllner entstanden, veranlassten N., seine Zeitschrift 1792 mit dem 107. Band eingehen zu lassen; doch erschien eine Fortsetzung u. d. T. »Neue allgemeine deutsche Bibliothek« von 1793–1800 (55 Bde.) in Kiel; erst von Bd. 56 an (1800) wurde sie wieder von N. herausgegeben und schloß 1805. Die Zeitschrift hatte einen sehr ausgedehnten Mitarbeiterkreis (vgl deren Verzeichnis von Partey, Berl. 1842). Von Nicolais eignen Schriften galt seine »Topographisch historische Beschreibung von Berlin und Potsdam« (Berl. 1769; 3. Aufl. 1786, 3 Bde.) für die damalige Zeit als ein Musterwerk; seine »Charakteristischen Anekdoten von Friedrich II.« (Berl. 1788–92, 6 Hefte) waren nicht völlig wertlos. Unter seinen Romanen waren »Leben und Meinungen des Magisters Sebaldus Nothanker« (Berl. 1773–76, 3 Bde.; 4. Aufl. 1799), eine Nachahmung Sternes, als realistische Wiedergabe beengter Lebenszustände und als satirische Tendenzschrift gegen die Herrschaft der Orthodoxie der bedeutendste. In der Satire »Freuden des jungen Werther« (1775) wandte er sich gegen Goethe in dem »Kleinen seinen Almanach« (2 Jahrgänge 1777–78; Neudruck, Berl. 1888) gegen die wiedererwachende Neigung zur Volkspoesie. Seinen literarischen Gegnern ist die »Geschichte eines dicken Mannes« (Berl. 1794, 2 Bde.), ein unsäglich seichtes, unerquickliches Buch, gewidmet. Heftigen Widerspruch zog ihm die breite und eine »Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz« (Berl. 1781; 3. Aufl. 1788–96, 12 Bde.) zu. Sein borniertes Ankämpfen gegen alle neuern Richtungen in der Literatur wurde der Anlass zu zahlreichen Angriffen gegen ihn, wie sie namentlich von Herder, von Goethe und Schiller in den »Xenien«, von Lavater, Fichte und den beiden Schlegel ausgingen. Die nüchterne Beschränktheit und polternde Rechthaberei des alternden Schriftstellers, der sich gern für den geistigen Erben Lessings ausgegeben hätte, führten schließlich dahin, dass man auch seine wirklichen Verdienste übersah und leugnete. Noch sind seine biographischen Schriften über Ewald v. Kleist (1760), Thomas Abbt (1767), Justus Möser (1797) u.a. zu erwähnen. Seinen Briefwechsel mit Herder veröffentlichte O. Hoffmann (Berl. 1887), R. M. Werner den Briefwechsel mit dem Wiener Staatsrat v. Gebler (das. 1888). Vgl. Göckingk, Nicolais Leben und literarischer Nachlass (Berl. 1820); Minor, Lessings Jugendfreunde (in Kürschners »Deutscher Nationalliteratur«, Bd. 72); Altenkrüger, F. Nicolais Jugendschriften (Berl. 1894); Schwinger, F. Nicolais Roman »Sebaldus Nothanker« (Weim. 1897).
Leben und Meinungen des Herrn Sebaldus Nothanker
Vorrede zur vierten Auflage
(1799)
Als dieses Buch vor sechsundzwanzig Jahren zuerst erschien, regierte in Deutschland ziemlich allgemein das Vorurteil: der geistliche Stand müsse, um sein Ansehen zu behaupten, sich notwendig von allen anderen Ständen durch eine ungesellige Gravität absondern. Diese orthodoxe, finstere Würde schien sogar vielen geistlichen Herren ein Teil der Würde der orthodoxen Religion selbst zu sein; und weil damals ein heiliger Schauder vor jeder Neuerung in der Lehre Frömmigkeit hieß, so schien es vielen eifrigen Theologen auch schon die gottloseste und verdammlichste Neuerung, daß in diesem Buche Personen geistlichen Standes, gleich anderen Menschen, geschildert waren, so wie sie sind. Besonders gaben sie es für Verachtung des geistlichen Standes aus, daß fast alle in dieser Geschichte vorkommenden Prediger und sogar die Hauptperson ganz gemeine Menschen wären. Wie arg deshalb über mich öffentlich hergefahren worden und wie weit die heimlichen Verunglimpfungen mancher orthodoxen Herren gingen, sollte man kaum glauben. Die Beschreibung davon würde ein so widriges als lächerliches Bild geistlicher Rachsucht geben, wenn es der Mühe lohnte, alle Züge derselben zusammenzustellen.
Von der anderen Seite ward ich auch von aufgeklärten Geistlichen der Unbilligkeit beschuldigt, weil im zweiten Bande der damals noch ganz neuen, verbesserten Theologie eben nicht viel Einfluß auf die Einwohner Berlins zugeschrieben war, da doch diese Herren glaubten, Berlin müsse vermöge derselben der Brennpunkt der höchsten Aufklärung sein. Als nach einigen Jahren ein neues Gesangbuch eingeführt werden sollte, zeigte sich, daß meine Schilderung eines großen Teils der Einwohner Berlins nur allzu getreu gewesen war.
In Berlin war damals schon vermöge der liberalen Denkungsart, welche Friedrich der Große durch sein Beispiel einführte und beschützte, von Philosophen und Theologen zur freien Entwickelung der Kräfte des menschlichen Geistes sehr viel geschehen. Dies ward allgemein anerkannt, nur konnte sich die Wirkung davon nicht so geschwind in alle Stände ausbreiten, als es manche lebhafte Einbildungskraft verlangte. Doch hätte sich damals auch wohl niemand vorstellen können, es würde eine Zeit kommen, da selbst in Berlin die Aufklärung in der Religion und die Anwendung der gesunden Vernunft auf die wichtigsten Angelegenheiten des menschlichen Lebens durch öffentliche Gewalt sollten gehindert werden wollen. Und doch kam diese Zeit, welche nun, gottlob, vorbei ist. Menschen, deren sinnlose Herrschsucht nur mit ihrer Unwissenheit zu vergleichen war, mißbrauchten die ihnen gegebene Macht auf eine Art, welche zeigt, wie schrecklich und wie zwecklos zugleich es ist, den weltlichen Arm zur Herrschaft über Meinungen anzuwenden. Sie entblödeten sich sogar nicht, die »Allgemeine deutsche Bibliothek«, ein Werk, zu welchem ich seit dreißig Jahren eine Anzahl verdienstvoller deutscher Gelehrten vereinigte, als ein Buch wider die Religion anzuklagen und ohne alle Untersuchung ein Verbot zu bewirken: ungeachtet ich einige zwanzig Jahre lang bei der Herausgabe und bei dem Abdruck beständig alles beobachtet hatte, was die Gesetze des Staats vorschreiben. Von Leuten, welche sich dieses erlaubten, durfte man alles Widrige erwarten, auch fehlte es nicht an Proben, daß sie sich gern mehr erlaubt hätten. Es ist hier nicht der Ort, auseinanderzusetzen, auf welche so niedrige als heimtückische Art man mich in beständige Verlegenheit zu setzen suchte. Sollte es einmal an einem andern Ort geschehen, so würden die Leser erstaunen.
Ich bin genötigt, dieses hier anzuführen, weil die Folgen des Einflusses gemißbrauchter öffentlicher Gewalt sich auch bis auf dieses Leben des ehrlichen Sebaldus Nothanker erstreckten. Die dritte Auflage war seit beinahe vier Jahren erschöpft und kein Exemplar zu haben. Es wäre schon damals eine neue Ausgabe nötig gewesen, aber selbst so wohlwollende als einsichtsvolle Männer rieten mir ernstlich davon ab: denn jene Menschen, welche sich schon soviel erlaubt hatten, würden ihre auffallende Ähnlichkeit mit dem verfolgenden Stauzius erkannt und entweder den Abdruck gehindert haben, oder sie hätten gleich wie bei der »Allgemeinen deutschen Bibliothek« gerufen, daß die Religion in Gefahr sei, und hätten, wie sie so oft taten, die symbolischen Bücher, denen sie selbst nicht einmal folgten, zum Vorwande ihrer Rache und Herrschsucht gebraucht.
Jetzt, da unter der Regierung Königs Friedrich Wilhelm III. Heuchelei und Aberglauben in die verdiente Verachtung zurückfallen und jeder freimütige Mann sein Haupt emporheben darf, erscheint diese neue Ausgabe im wesentlichen ungeändert. Nur ist in der Schreibart vieles verbessert, und es sind einige wenige Anmerkungen hinzugekommen, wodurch manche Anspielungen auf allerhand literarische Vorfälle der ehemaligen Zeit erklärt werden. Viele gelehrte Erfindungen und Merkwürdigkeiten bleiben gar kurze Zeit merkwürdig und verständlich, so ernsthaft und wichtig sie auch bei ihrer Entstehung von den gelehrten Herren behandelt werden; daher bedarf eine Schrift, welche davon redet, nach zwanzig Jahren mancher Erläuterung. Ob die Gemälde der Heuchelei, der Verfolgungssucht, der Futilität sowie der Gutherzigkeit, der Wahrheitsliebe und überhaupt der menschlichen Sitten und Leidenschaften, welche in diesem Buche vorkommen, noch jetzt ähnlich und ohne weitere Erklärung verständlich sein möchten, muß ich dem Leser zu beurteilen überlassen.
Die vorigen Ausgaben wurden von dem berühmten Herrn Daniel Chodowiecki mit sehr charakteristischen Kupferstichen geziert. Die gegenwärtige Ausgabe zierte der berühmte Herr Johann Wilhelm Meil mit Kupferstichen, in ihrer Art ebenso vorzüglich. So hat dieses Buch das Glück, daß zwei Künstler in Berlin, welche in charakteristischen kleinen Bildern jeder in seiner Art einzig sind, dasselbe durch ihre Kunst verschönerten.
Es ist in mehrere fremde Sprachen übersetzt. Die rühmlich bekannte Madame de la Fite1 im Haag lieferte in Gesellschaft des jetzigen Königlichen Geheimen Legationsrats Herrn Renfner (welcher damals im Haag als Königlicher Gesandtschaftssekretar stand) die vorzüglichsten Stellen aus dem ersten Bande in einer kleinen Schrift: »Lettres sur divers sujets«, par Me. d.l.F., à la Haye 1775, in Oktav. Eine vollständige französische Übersetzung, welcher eine Übersetzung des Gedichts »Wilhelmine« als des Grundes dieser Geschichte vorgesetzt ist, daher sie vier Bände ausmacht, soll von einem französischen Prediger Herrn Wyß (oder Weiß) in der Schweiz sein. Sie ist unter dem Titel »Londres« in Lausanne zweimal, im Jahre 1774 und 1777, in Kleinoktav gedruckt. Die holländische Übersetzung kam zu Amsterdam in drei Bänden in Großoktav heraus, wobei auch die Kupfer des Herrn D. Chodowiecki von C.F. Fritschius ziemlich gut nachgestochen sind. Der Übersetzer ist Herr van der Meersch, ein nunmehr verstorbener remonstrantischer Prediger in Amsterdam, der aber seinen Namen nicht nannte. Er hat einen launigen Vorbericht an den Nederlantschen Leezer vorgesetzt, worin er von der Schädlichkeit der Gottseligkeit handelt, »indem die Ketzer«, wie er versichert, »durch ihr gottseliges Leben oft ihren unrechtsinnigen Meinungen Eingang schaffen, wogegen die Rechtsinnigen, welche sich mit der Gottseligkeit nicht aufhalten mögen, darüber in übeln Ruf kommen«. Die dänische Übersetzung ist zu Kopenhagen in drei Bänden in den Jahren 1774 bis 1777 erschienen, die schwedische zu Stockholm im Jahre 1788. Die engländische Übersetzung erschien zu London in drei Bänden in Großduodez in den Jahren 1796 und 1798. Auf dem Titel nennet sich als Übersetzer ein mir ganz unbekannter Herr Thomas Dutton A.M. Aus einem auf den Titel gesetzten Motto aus Voltaires »Philosophe ignorant« und aus einigen Winken in der Zueignungsschrift an den bekannten Lord Landsdowne möchte man fast schließen, daß die Gravität einiger pfründebeladenen Geistlichen der hohen engländischen Kirche und die sanften Verfolgungen, welche die dortige Hierarchie bei aller Freiheit der Nation gegen die Dissenters sich erlaubt, Gelegenheit zu dieser Übersetzung gegeben haben, welche einen Mann verrät, der beider Sprachen sehr kundig ist.
Unter den mancherlei ernsthaften Schicksalen, welche dieses Buch gehabt hat, ist auch noch ein lächerliches zu bemerken. Zufällig erfuhr ich, daß es einem gewissen Herrn Erdwin Julius Koch, der sich einen Doktor der Philosophie und Prediger an der Marienkirche nennt, im zweiten, im Jahre 1798 herausgekommenen Teil seines Kompendiums der deutschen Literaturgeschichte gefallen hat, etwas zu sagen, das sowohl den Herrn Professor Eberhard in Halle als auch mich äußerst befremden muß. Es heißt nämlich Seite 281 daselbst von diesem Buche: »Auch verdienen hier die von glaubwürdigen Gewährsmännern herrührenden mündlichen Sagen, von welchen eine Herrn Professor J.A. Eberhard zu Halle zum alleinigen Verfasser und die andere denselben nur zum vorzüglichsten Teilnehmer macht, einer nähern Untersuchung unterworfen zu werden.« Der Ehrenmann hat diese Untersuchung nicht angestellt; es ist auch nicht recht abzusehen, wie sie angestellt werden könnte. Ebensogut wäre eine Untersuchung vorzuschlagen, ob nicht etwa sein Kompendium von einem Garkoch namens Erdwin Julius möchte sein zusammengetragen worden? Denn es könnte gar zu unwahrscheinlich scheinen, daß ein Doktor und Prediger, selbst wenn er zuweilen gedankenlos zu kompilieren gewohnt wäre, so wenig Beurteilungskraft und Menschensinn haben sollte, um durch eine läppische Erdichtung zwei lebende namhaft gemachte Schriftsteller zu beleidigen, wovon der eine seit sechsundzwanzig Jahren als der Verfasser eines Buchs allgemein bekannt ist und der andere weder Anteil daran hat noch haben will; und dies bloß auf die vorgegebene mündliche Sage namenloser Menschen, welche nicht glaubwürdige Gewährsmänner, sondern nur verächtliche Klätscher und Anekdotenmacher sein müssen.
Die dem dritten Bande angehängte »Nachricht« war in den vorigen Ausgaben dem zweiten Bande beigefügt. Weil ich nämlich den zweiten Band nicht geschwind genug auf den ersten folgen ließ, so geriet jemand darauf, einen unechten zweiten Teil herauszugeben. Auch kamen »Predigten des Herrn Magisters Sebaldus Nothanker« heraus, aber gar nicht im Sinne des Mannes, dessen Bild mir vorschwebte, als ich dies Buch schrieb. Hierdurch ward diese »Nachricht« veranlaßt, welche wegen der Einkleidung vielleicht jetzt noch einigen Wert hat.
Berlin, den 14. Jänner 1799
Fr. Nicolai
Vorrede zur ersten Ausgabe
Obgleich die leidigen Poeten, Komödien- und Romanenschreiber zu glauben pflegen, sie hätten das Leben ihres Helden weit genug beschrieben, wenn sie ihn bis zur Heirat bringen, so sind doch gründliche Gelehrte der Meinung, daß die Begebenheiten nach der Hochzeit oft viel merkwürdigere Dinge enthalten als die Liebesbegebenheiten vor derselben. Die Liebesbegebenheiten sind zwar für junge Herren und für junge Jungfern anmutiger zu lesen, aber gemeiniglich wird diese Anmut auf Kosten der Wahrheit verschafft; denn die verliebten Szenen werden nicht erzählt, so wie sie in der Welt vorgehen, sondern nach dem Bedürfnisse des Dichters, seine Geistesgaben zu zeigen und die Leidenschaften seiner Leser zu erregen. In dieser wahrhaftigen Lebensbeschreibung hingegen wollen wir nichts der Anmut oder des Wunderbaren wegen erdichten, sondern alles ganz einfältig melden, wie es vorgegangen ist. Dazu wird uns der Umstand nicht wenig beförderlich sein, daß wir das Leben unseres Dorfpastors erst nach seiner Heirat zu beschreiben anfangen dürfen, indem schon ein anderer Verfasser die Liebesbegebenheiten desselben vor der Heirat in dem bekannten prosaisch-komischen Gedichte »Wilhelmine« beschrieben hat.
Freilich ist dieser Verfasser ein Poet und daher nicht, wie es einem gründlichen Geschichtskundigen gebührt, beflissen gewesen, eine richtige Chronologie zu beobachten und seine Erzählungen von allen Erdichtungen rein zu erhalten. Es sind überdies manche Umstände sehr verdächtig; und er scheint nicht imstande zu sein, eine einzige seiner Erzählungen mit ungedruckten Urkunden zu belegen. Daß er gegen die Chronologie verstößt, ist offenbar, da er die Heirat des Sebaldus im Jahre 1762 und also, wie aus echten brieflichen Urkunden zu erweisen steht, mehr als zwanzig Jahre zu spät annimmt. Er ist hierin ebenso unachtsam wie sein Mitbruder, der nachlässige Virgil, in dessen »Äneide« die verpfuschte Chronologie von den gelehrtesten Kommentatoren mit vieler Mühe kaum hat in Ordnung gebracht werden können.
In der gegenwärtigen wahrhaften Lebensbeschreibung hat man die Zeitrechnung so genau beobachtet, daß man nicht allein das Jahr, sondern auch den Monat und den Tag angeben kann, wann eine jede Begebenheit vorgegangen ist; und an vollständigen diplomatischen Beweisen wird diese Geschichte keiner anderen nachzusetzen sein. Wir besitzen die Vokation des Sebaldus und seine Absetzungsakte, die Predigten des Doktor Stauzius, Säuglings sämtliche hieher gehörige Gedichte, ferner Wilhelminens, Sebaldus', Säuglings, Marianens, der Gräfin von ***, Rambolds und anderer Personen Briefwechsel mit ihren Siegeln und Unterschriften, ja selbst einige sonderbare tironianische Zeichen des Bauers, der den Sebaldus beherbergte, mit welchen unverwerflichen ungedruckten Urkunden wir jedes Wort, das wir gesagt, aufs glaubwürdigste belegen können.
Sie würden im Drucke nur etwa sieben bis acht Quartbände betragen. Demungeachtet können sie mit dieser Geschichte bloß aus einer Ursache nicht bekannt gemacht werden, wegen deren schon so manche treffliche Urkundensammlung ungedruckt geblieben ist: nämlich wegen des wenigen Geschmacks unsers Jahrhunderts an gründlichen Studien. Es wäre zwar der Vorschlag zu tun, daß irgendeine Gesellschaft der Wissenschaften einen kritischen Auszug daraus in einigen Bänden in Großoktav herausgäbe. Allein auch dazu ist wenig Hoffnung vorhanden, und so bleibt daher nichts übrig, als daß die wenigen Gelehrten, welche die diplomatischen Beweise zu untersuchen pflegen, dem Verfasser ebensogut auf sein Wort glauben müssen als die vielen leichtsinnigen Leser, welche die Urkunden doch nicht ansehen, wenn sie gleich den Geschichtsbüchern des breitern beigefügt sind.
Da wir übrigens eine wahre Geschichte abhandeln, so muß man in derselben weder den hohen Flug der Einbildungskraft suchen, den ein Gedicht haben müßte, noch einen so exzentrischen Plan, wie ihn neuere Kunstrichter, von Theorie und Einsicht erfüllt, den Romanen vorschreiben. Alle Begebenheiten sind in unserer Erzählung so unvorbereitet, so unwunderbar, als sie in der weiten Welt zu geschehen pflegen. Die Personen, welche auftreten, sind weder an Stande erhaben noch durch Gesinnungen ausgezeichnet, noch durch außerordentliche Glücksfälle von gewöhnlichen Menschen unterschieden. Sie sind ganz gemeine schlechte und gerechte Leute, sie strotzen nicht wie die Romanenhelden von hoher Imagination und schöner wortreicher Tugend, und die ihnen zustoßenden Begegnisse sind so, wie sie in dem ordentlichen Laufe der Welt täglich vorgehen. Sollte hierdurch unsere Geschichte etwas langweilig werden, so trösten wir uns damit, daß mehrere gründliche Werke deutscher Gelehrten das nämliche Schicksal hatten, als sie die unwidersprechlichsten Tatsachen in der besten Ordnung erzählten.
Hingegen könnte der Leser vielleicht durch die in dieser Geschichte bekanntgemachten Meinungen in etwas schadlos gehalten werden. Denn da fast jeder Mensch seine eigenen Meinungen für sich hat, so wäre es möglich, daß unter den hier vorgetragenen Meinungen etwas Neues und wenigstens insofern Interessantes vorhanden wäre. Der Titel verspricht zwar nur die Meinungen des Magisters Sebaldus, aber man könnte deshalb doch in diesem Werke vielleicht auch die Meinungen einiger andern Leute, ja wohl selbst einige Meinungen des Verfassers finden; obgleich, mehrerer Sicherheit halben, nicht gänzlich darauf zu rechnen sein dürfte, daß alle Meinungen, die er erzählt, auch die seinigen wären.
Man beliebe sich auch nicht zu wundern, wenn es sich etwa ergeben sollte, daß, alles wohl berechnet, in diesem Werke mehr Meinungen als Geschichte und Handlungen vorkämen. Der ehrliche Sebaldus kannte nicht die große Welt oder das Highlife der Engländer. Spekulation war die Welt, worin er lebte, und jede Meinung war ihm so wichtig als kaum manchem andern eine Handlung. Daher ist dieses Werk auch gar nicht für die große Welt, sondern – deutsch heraus zu reden – nur für Gelehrte geschrieben. Wir hoffen nicht von der halb unangekleideten Schönen am Nachttische gelesen zu werden, die, indem sie ihrer eigenen Grazie opfert, auf tant mieux pour elle einen schrägen Blick wirft; nicht von dem pirouettierenden Petit-maître beim Aufstehen oder Frisieren, auch nicht, wenn er en chenille mit ungepuderten Haaren von Toilette zu Toilette schwärmt; nicht von dem Hofmanne, der den Wink des Fürsten und des Ministers zu studieren versteht und alle Galatage an den Fingern herbeten kann; nicht von dem Spieler; nicht von der Buhlschwester; nicht von ...
Ist aber irgendwo ein hagerer Magister, der das ganze unermeßliche Gebäude der Wissenschaften aus einem Kapitel seines Kompendiums übersieht, ein feister Superintendent, der alle Falten der Dogmatik aufhebt, worin eine Ketzerei verborgen sein könnte, ein weiser Schulmann, der über Handel, Manufakturen und Luxus Programme geschrieben hat, ein Student mit der Kennermiene, der in seiner Dachstube die Kunst aus dem Grunde studiert, ein belesener Dorfpastor, der über die Regierungskunst gelehrte Ratschläge geben kann – so mögen sie hinzutreten und sich an dem Mahle weiden, welches hier ihrem Geiste aufgetischt wird.
Dies ist wenigstens die Gattung Leser, die wir uns gewiß versprechen; ob wir auch Leser anderer Art erhalten werden, ist ebenso ungewiß als das Schicksal überhaupt, welches dieses Werk und dessen Verfasser zu erwarten haben. Freilich ist zu vermuten, daß durch viele der hier vorgetragenen Meinungen Spaltungen in der Kirche erregt werden möchten und daß man darin Abweichungen von den allgemeinen symbolischen Büchern und von den besondern Formulis committendi einzelner Städte oder Länder entdecken könnte. Man wird vielleicht daraus schließen, daß der Verfasser das Staatsrecht nicht verstehe und daß er im Kirchenrecht gefährliche Neuerungen einzuführen zur Absicht habe; man wird sich vielleicht ins Ohr raunen, daß er verschiedene Gelehrsamkeit nicht für Gelehrsamkeit, verschiedene Gelehrten nicht für gelehrt und verschiedene berühmte Leute nicht für berühmt halte und so weiter.
Man könnte ihn sonach etwa zum Scheiterhaufen verbannen, in den Bann tun, in eine Festung schicken oder auch ein Buch wider ihn schreiben, ein Pasquill auf ihn machen oder ihm beweisen, daß er kein gutes Herz habe, sondern ein hämischer und boshafter Mensch sei.
Doch vielleicht könnte auch von allem diesem nichts geschehen. Vielleicht lieset niemand dieses Buch, niemand findet etwas Besonders darin, und es erregt vielleicht bloß die vorübergehende Aufmerksamkeit eines Gewürzkrämers, der schon bei sich überdenkt, welche dauerhafte Kaffeetüten aus dem haltbaren Papiere könnten gemacht werden.
Indes dürften sich auch wohl einige wenige Leser finden, die sich an dem Leben des Sebaldus, bloß weil er ein ehrlicher, aufrichtiger Mann ist, eine Viertelstunde ergötzen oder von seinen Meinungen Gelegenheit nehmen möchten, über gewisse Materien weiter nachzudenken; allein da offenbar dies bei weitem nur die kleinere Anzahl sein kann, so werden sie eben nicht in Anschlag gebracht werden können.
Erstes Buch
Erster Abschnitt
Die ersten Monate nach der Verheiratung pflegen sonst neuverehelichten Paaren die Zeit einer girrenden Zärtlichkeit zu sein, aber der Pastor Sebaldus und die schöne Wilhelmine waren zu Anfange ihrer Ehe in ihrem Betragen gegeneinander wenn nicht kalt, doch etwas verlegen. Die landmännische Treuherzigkeit des Mannes und die feine Hofmanier seiner jungen Frau machte einen Abstand zwischen ihnen, so daß der Pastor sich noch nicht recht dareinschicken konnte, mit ihr als mit seinesgleichen umzugehen; Wilhelminen war hingegen noch immer der wohlgeputzte Hof vor Augen, den sie verlassen hatte. Das Andenken an die prächtigen, von der Fürstin abgelegten Kleider, in denen sie sich oft der gaffenden Menge der Zofen und Kammerdiener gezeigt hatte, verleidete ihr ihren ländlichen, aber neugemachten Anzug. Es war ihr sogar, als ob ihr etwas fehlte, daß sie ferner nicht hohen Personen mit tiefer Verneigung aufzuwarten hatte, und das Glück, unabhängig zu sei, schien ihr Erniedrigung. Die ungekünstelten Schönheiten der Natur, womit sie auf dem Lande umgeben war, konnten sie noch nicht wegen des Flitterstaats der Kunst schadlos halten, den sie nun nicht mehr erblickte. Sie erinnerte sich mit Sehnsucht der glänzenden Szenen von Bällen, Konzerten und Schlittenfahrten, die sie oft – angesehen hatte, noch mehr des gnädigen Kopfneigens der Fürstin, durch das sie zuweilen unter der Menge gaffenden Hofgesindes war hervorgezogen worden. Sie tat bei jeder Gelegenheit kleine Reisen in die Stadt und unterließ nicht, ihre Aufwartung bei Hofe zu machen. Sie merkte aber gar bald, daß man sich am Hofe um die nicht bekümmert, die man nicht braucht, und daß ihre Stelle von andern eingenommen war. Dies kostete ihr zwar einige Tränen, war aber doch die erste Ursache, daß sie die gute Seite ihrer jetzigen Lage und die guten Gesinnungen ihres Sebaldus einzusehen anfing, welche zu bemerken sie bisher durch sein unmodisches Kleid und durch seine schiefgepuderte Perücke war verhindert worden. Sie erwiderte seine Liebkosungen mit freundlichen Blicken, er kam ihr mit Freundschaftsbezeugungen zuvor. Aus diesem Wechsel von Gefälligkeiten entstanden bei ihnen gegenseitige Empfindungen einer Glückseligkeit, die sie vorher noch gar nicht gefühlt hatten.
Von dieser Zeit an vergaß die schöne Wilhelmine völlig den Hof und ward ganz eine Landwirtin. Vorher hatte sie nur zu gehorchen gewußt, nun begann sie zu regieren. Es kostete ihr einige kleine Liebkosungen, so begann Sebaldus, der bisher als halber Wilder gelebt hatte, sich fleißiger den Bart zu putzen und nicht so viele Federn auf seinem schwarzen Rocke zu leiden. Durch gleiche Freundlichkeit erstreckte sie bald ihre Herrschaft auf ihre Nachbarinnen, die von ihr bisher durch ein gnädiges Hoflächeln verscheucht worden waren. Nun erwarb sie derselben Vertrauen, erteilte den Wohlhabenden guten Rat, den Armen Almosen und ward in kurzer Zeit im Kirchspiele ebenso beliebt, als ihr Mann schon vorher gewesen war.
Diese Liebe hatte sich Sebaldus durch die Sorgfalt, die er für seine Gemeinde trug, erworben. Er war in den Häusern seiner Bauern als ein Vater und als ein Ratgeber willkommen. Nie ließ er es dem Bekümmerten an Trost, nie dem Hungrigen an Labsal fehlen. Er war von allen häuslichen Vorfällen unterrichtet, nicht weil er in das Hausregiment der Laien einen Einfluß zu haben suchte, sondern weil er von ihnen selbst bei allen ihren Verlegenheiten um Rat, bei allen ihren Zwistigkeiten um Vermittelung ersucht ward. Er schalt in seinen Predigten nicht auf die Laster, aber wenn ein Laster in der Gemeinde verübt wurde, pflegte er, ohne desselben zu gedenken, die entgegengesetzte Tugend einzuschärfen. Daher richtete er seine Predigten auch mehr nach den Bedürfnissen seiner Gemeinde als nach der Folge der Evangelien ein. Er hat wohl eher über das Evangelium vom Zinsgroschen, von den Vorteilen eines mäßigen und nüchternen Lebens gepredigt, bloß weil sich kurz vorher ein paar Bauern in der Schenke betrunken hatten. Als er einst vergeblich versucht hatte, zwei Bauern, die in offenbarer Feindseligkeit lebten, zu vergleichen, und von dem einen hart mit Worten war angelassen worden, predigte er am Tage Sankt Stephani des Märtyrers von der ersten Pflicht wahrer Christen, ihren Nächsten zu lieben, und gedachte der empfangenen Scheltworte nicht, ob ihm gleich die Worte des Evangeliums: »Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind« die schönste Gelegenheit dazu gegeben hätten.
Zu beklagen war es freilich, daß dieser sonst gutmütige Mann und der beim Antritte seines Amtes auf die symbolischen Bücher geschworen hatte, im Herzen nichts weniger als orthodox war. Über das Athanasianische Glaubensbekenntnis hat er sich zwar niemals erklärt; nur weil er anstatt des Liedes: »Wir glauben all an einen Gott etc.«, welches sonst alle Sonntage in seiner Kirche war gesungen worden, oft ein geistliches Lied von Gellert singen ließ, war er bei einigen vielleicht allzu brünstig orthodoxen Landpredigern in der Nähe nicht in allzu gutem Geruche. Über die Lehre von der Genugtuung aber äußerte er bei Gelegenheit viele Zweifel. Er verschwendete (ohne Exegese, wovon er wenig hielt) viel philosophische Spitzfindigkeit, um dieser Lehre eine bessere Form zu geben, denn er war ein eifriger Anhänger der Crusiusschen Philosophie, welche unter allen anderen Philosophien am geschicktesten scheint, die Theologie philosophischer und die Philosophie theologischer zu machen. Am meisten aber ging er in der Lehre vom Tausendjährigen Reiche und von der Ewigkeit der Höllenstrafen von der Dogmatik ab. Er glaubte das erstere steif und fest, von der letztern hingegen hatte er sich nie überzeugen können. Er glaubte, im himmlischen Jerusalem würden alle Gottlosen fromm werden. Diese tröstliche Hoffnung hatte er aus einem fleißigen Studium der prophetischen Bücher der Schrift, besonders der Apokalypse geschöpft, welches Studium er schon seit langen Jahren mit unablässigem Eifer getrieben hatte. Er war auf eine sehr sonderbare Weise dazu gebracht worden, diese Bücher vorzüglich zu studieren. Schon in seinen jüngern Jahren war er durch sorgfältiges Nachdenken auf den Gedanken gekommen: der Willen Gottes, der unsere itzige und zukünftige Glückseligkeit bestimmt, wenn auch Gott für gut befunden habe, ihn besonders zu offenbaren, müsse dennoch auch notwendig durch Vernunft eingesehen werden können und mit der Vernunft übereinstimmen. Die einzige Offenbarung, die uns etwas ganz Unbekanntes entdecken könne, worauf die bloße Vernunft nie gefallen sein würde, glaubte er, sei die prophetische Offenbarung von zukünftigen Dingen. Nachdem er also bei sich über den Wert aller dogmatischen und moralischen Wahrheiten einig war, indem er keine dogmatische Wahrheiten für nötig und nützlich hielt, als die auf das Verhalten der Menschen einen Einfluß haben, und sich mehr angelegen sein ließ, alle moralischen Gesetze Gottes auszuüben, als sie zu zergliedern oder zu umschreiben, so hatte er sich ganz dem Studium der prophetischen Schriften gewidmet. Jeder Mensch hat sein Steckenpferd, und Sebaldus hatte die Apokalypse dazu erwählt, welches er auch, seine ganze Lebenszeit durch, vom Montage bis zum Freitage fleißig ritt. Nur der Sonnabend, wenn er sich zu seiner Predigt vorbereitete, und der Sonntag, wenn er sie hielt, war moralischen Betrachtungen gewidmet. Denn sosehr er auch die Prophezeiungen der Untersuchung eines scharfsinnigen Kopfes würdig hielt, sowenig, glaubte er, würden seine Bauern davon verstehen oder nützen können, und es war sein unwiderruflicher Willen, seinen Bauern nichts zu predigen, als was ihnen sowohl verständlich als nützlich wäre.
Er hatte daher mit einer Menge seiner wohlehrwürdigen Amtsbrüder eine gewisse Ähnlichkeit, ob er ihnen gleich sonst sehr unähnlich war. Viele Landpfarrer predigen sonntags mit lauter Stimme das Gesetz und wissen die Ungläubigen und Ketzer mit starken Ausrufungen und gelehrten Zitationen aus dem Grundtexte gar fein zusammenzutreiben. Ebendiese Männer aber sieht man die ganze Woche über als dickstämmige Pachter, wilde Pferdebändiger, drollichte Trinkgesellschafter oder vorsichtige Wucherer und möchte sie kaum für ebendieselben halten. Ebenso konnte jedermann alle Sonntage hören, daß der Vortrag des Pastors Sebaldus einfältig, herzrührend und allen Bauern verständlich war. Wer hätte sich da vorstellen sollen, dies sei der grundgelehrte Mann, der alle Kommentarien über die prophetischen Bücher durchstudiert hatte, der alle alte und neue Prophezeiungen nebst ihren Erfüllungen und Nichterfüllungen auf ein Haar wußte, der Vorbilder und Gegenbilder wie Schachtel und Deckel zusammenpassen konnte, dem keine Meinung der Mystiker und Gnostiker entgangen war, der Buchstabenziffern und Jahrwochen, prophetische Zeitzirkel und abgekürzte Abendmorgen, bildliche Geschichte und weissagende Träume nebst der ganzen Kabbala und dem Buche Raja Mehemna gänzlich innehatte? Wer hätte sich da vorstellen sollen, dieser ganz einfache Landprediger sei der Mann, der aus seinem Reichtume von gelehrtem Stoffe mit Hilfe der Crusiusschen Philosophie, die, feiner als die feinste Nadel zugespitzt, die einfachsten Begriffe zerteilen und sogar die beiden Seiten einer Monade voneinander spalten kann, eines der scharfsinnigsten Gewebe von Prophezeiungen aus der Apokalypse gezogen hatte, welchem Crusius' unumstößliche Hypomnemata der prophetischen Theologie, Bengels unwidersprechliche Auslegung der apokalyptischen Weissagungen, Don Isaak Abarbanels Majeneh Jeschuah und Michaelis' unwiderlegliche Erklärung der siebenzig Wochen weder an Richtigkeit und Wahrheit noch an Neuheit, Scharfsinn und sinnreicher Aufklärung der dunkelsten Bilder zu vergleichen waren?
So wie die meisten großen Begebenheiten aus sehr geringen Ursachen zu entspringen pflegen, so ging es auch derjenigen Hypothese über die Apokalypse, auf die sich Sebaldus am meisten zugute tat. Wilhelmine war, als sie vom Hofe kam, sehr französisch gesinnet: sie sprach und las gern französisch, sie ließ sich sogar merken, daß sie nichts eifriger wünschte, als einmal in ihrem Leben Paris zu sehen, und warf es ihrem Manne mehr als einmal vor, daß er gar nichts von französischer Artigkeit an sich hätte. Nun fügte es sich unglücklicherweise, daß der ehrliche Sebaldus schon vorher an allem, was französisch war, ein überaus großes Mißfallen hegte. Es war ihm von Jugend auf in der Schule ein herzlicher deutscher Haß gegen Frankreich eingeprägt und oft wiederholt worden, daß die Franzosen und die leidigen Türken Erb- und Erzfeinde Deutschlands wären, daß sie Kaiser und Reich beständig bekrieget und ganze Provinzen vom deutschen Reiche abgezwackt hätten. Da nun Frankreich außer dem vielen und öftern Unheile, das es auf deutschem Boden angerichtet hatte, sich auch sogar in des Sebaldus Hausangelegenheiten mengte (denn er ließ sich's nicht ausreden, daß bloß die Neigung zum Französischen Ursache sei, daß ihn Wilhelmine nicht so herzlich liebte, als er's wünschte), so verdoppelte sich sein Haß gegen alles, was französisch war. Weil er nun sonst kein Mittel sah, seinen Unwillen auszulassen, so wandte er sich mit Ernst zu seiner allgemeinen Zuflucht, der Apokalypse, und forschte nach, ob denn in diesem Magazine von Weissagungen nicht eine Weissagung wider die Franzosen enthalten sein sollte.
Es hat einer von den zweihundert schwäbischen tiefsinnigen Erklärern der Offenbarung Johannis es als einen sichtbaren Beweis der wirklichen göttlichen Inspiration dieses Buchs angegeben, daß man alles darin finde, was man mit aufrichtigem Herzen darin suche. Dies erfuhr auch Sebaldus. Denn da er die Apokalypse mit einem Seitenblicke auf Frankreich las, so schien ihm dies dunkle Buch ganz klarzuwerden, und er glaubte sich zuletzt überzeugt, daß ein großer Teil der apokalyptischen Bilder nichts als ein Kompendium der französischen Geschichte wäre, welches vor dem Hainault und Mezeray nur den einzigen Vorteil habe, daß es etwas über tausend Jahre eher geschrieben worden sei, als die Begebenheiten vorgingen. Er war fest versichert, daß die große Babylon im XVII. Kapitel weder die Stadt Rom noch die Freimaurerei, sondern die Stadt Paris andeute. Die Bedeutung der beiden Tiere im XIII. und XVII. Kapitel konnte er aus dem Propheten Daniel erläutern, den er deshalb ausdrücklich, nach der nürnbergischen Übersetzung, durchgelesen hatte. Die Entdeckung aber, worauf er sich am meisten einbildete, war, daß die Zahl des zweiten Tieres, 666 oder kxs, die Jesuiten bedeute, deren Verjagung aus Frankreich er wirklich einige Jahre eher wußte, als der Herzog von Choiseul daran gedacht hatte. Nebenher war er auch versichert, das Büchlein im X. Kapitel, das im Munde süß war wie Honig und hernach im Bauche grimmete, müsse offenbar auf die vielen schlüpfrigen, sittenverderbenden französischen Duodezbände gedeutet werden, die wir Deutschen mit so vieler Begierde lesen. Alle diese und mehrere neue Entdeckungen über die Apokalypse gediehen in kurzem zu einem großen Werke, woran unser Sebaldus unablässig arbeitete.
Freilich hatten diese gelehrten Bemühungen nicht ganz den Beifall der schönen Wilhelmine. Sie warf sich zwar nach ihrer gänzlichen Entfernung vom Hofe in die Literatur, so wie sich die vom Hofe verwiesenen französischen Damen in die Devotion werfen, aber diese Literatur war von derjenigen, die Sebaldus trieb, himmelweit unterschieden. Wilhelmine war eine schöne Geistin. Alle gute deutsche und französische Dichter hatte sie so fleißig gelesen, daß sie in der Konversation nicht selten Stellen daraus anzuführen pflegte. Im Urteile über den Wert der Romane war sie das Orakel der ganzen Gegend. Sie war aber auch in der ganzen Gegend die einzige, die alle unsre besten neuern Dichter ganz frisch von der Presse und die »Bremischen Beiträge«, die »Sammlung vermischter Schriften« und die »Briefe die neueste Literatur betreffend« stückweise kommen ließ. Von ihr erhielten sie die wenigen gnädigen Fräulein, die Landprediger und die Konrektoren in den benachbarten kleinen Städten, die noch in der dortigen Gegend unsere schönen Geister des Lesens würdigten.
In der Philosophie waren Sebaldus und seine Wilhelmine noch weit mehr voneinander unterschieden. Sosehr er ein eifriger Crusianer war, ebensosehr war sie aus allen Kräften der Wolffischen Philosophie ergeben, besonders aber wußte sie desselben »Kleine Logik« auswendig. Wenn eine von ihren Freundinnen sich den Geschmack bilden wollte, so pries sie derselben das zehnte Kapitel: »Wie man von Schriften urteilen soll« nebst dem elften an: »Wie man Bücher recht mit Nutzen lesen kann«. Der Crusiusschen Philosophie war sie von Herzen gram, welches auch kein Wunder war, weil sie sich niemals hatte überwinden können, eine einzige von den Schriften des hochwürdigen Mannes in die Hand zu nehmen. Sebaldus gab sich alle mögliche Mühe, sie dahin zu bringen, daß sie nur wenigstens »Wüstemanns Kompendium der Crusiusschen Philosophie« durchlesen möchte, welches er für eine nahrhafte Milch für unmündige Philosophen hielt. Umsonst! Sie legte es, nachdem sie sechs Seiten durchgelesen hatte, mit Verachtung aus der Hand und war und blieb eine Wolffianerin.
Es ist leicht zu begreifen, wie die Philosophie der schönen Wilhelmine zuweilen eine kleine Unordnung im Hauswesen habe verursachen können und wie möglich es gewesen, daß ein neuangekommenes Stück der »Literaturbriefe« der zureichende Grund sein konnte, daß der Reisbrei anbrennen mußte. Solche kleine häusliche Widerwärtigkeiten störten aber keineswegs die beiderseitige Zufriedenheit. Da Sebaldus gemeiniglich zu ebender Zeit über einem Gesichte aus der Apokalypse geschwitzt hatte, so schmeckte er entweder den Fehler der Speise nicht oder nahm ihn ganz gutherzig auf sich, weil er glaubte, er habe auf sich allzulange warten lassen. So gebiert das Bewußtsein eigener Schwachheiten Toleranz, und Toleranz gebiert Liebe.
Im Anfange freilich verursachten die sich gerade entgegengesetzten gelehrten Meinungen beider Eheleute unter ihnen manchen heftigen Zwist, sobald aber nur die beiderseitige Zuneigung stärker geworden war, konnten die verschiedenen Meinungen nicht mehr den Wachstum ihrer Liebe hindern. Auf die Philosophie, über die sie sich so oft ohne Erfolg gestritten hatten, ließen sie sich ferner gar nicht ein. Hingegen ließ sich Sebaldus zuweilen gefallen, von Wilhelminen ein Stück aus einem neuen deutschen Schriftsteller vorlesen zu hören (denn wider die französischen Schriften hatte er sich allzu deutlich erklärt, als daß sie sich derselben zu erwähnen getrauet hätte). Wilhelmine war auch zuweilen so gefällig, von ihrem Manne ein Stück seiner neuen Erklärung der Apokalypse, mit Parallelstellen aus Daniels Geschichte bestärkt, sich vorlesen zu lassen. Sie rief wohl zuweilen aus: »Sinnreich! Wirklich sehr sinnreich!« Mit diesem Beifalle war er vergnügt wie ein König. Er ließ ihn auch nicht unbelohnt. Er setzte sich ans Klavier und spielte ungebeten einige der Oden mit Melodien, von denen er wußte, daß sie seiner Frau am angenehmsten waren. Wilhelmine sang mit frohem Herzen dazu, und gewöhnlich war ein solcher Auftritt eine reiche Quelle guter Laune für diesen und einige folgende Tage.
Gegen das Ende der erstern neun Monate ihres Ehestandes ward er mit einem Sohne gesegnet, dessen sich der Hofmarschall aus alter Bekanntschaft besonders annahm. Er ließ ihn oft zu sich in die Stadt holen, beschenkte ihn und konnte lachen, daß ihm der Bauch schütterte, wenn der Junge, der von seiner ersten Jugend an versprach, einst ein durchtriebener Kopf zu werden, einen Umstehenden in die Wade zwickte oder sonst jemand einen kleinen Schabernack antat. Als der Knabe sechs Jahre alt war, so nahm er ihn ganz zu sich, so daß ihn seitdem seine Eltern nur selten zu sehen bekamen. Im vierzehnten Jahre war der Knabe so weit gekommen, daß er die mutwilligen Neckereien, die der Hofmarschall so oft in seiner ersten Kindheit an ihm bewundert hatte, auch an seinem Wohltäter selbst auszuüben anfing. Dieser mochte nun wohl dem Witze des Knaben Beifall geben, wenn er andere hohnneckte, aber nicht, wenn er sich auch an ihn, den Hofmarschall selbst, wagte, und dachte daher darauf, sich dessen zu entledigen. Er besann sich, daß er einen guten Freund hatte, der Kurator über eine etwa fünfundzwanzig Meilen entlegene Fürstenschule war, in derselben verschaffte er dem jungen Nothanker eine Freistelle. Als der Knabe in derselben sechs Jahre verharrt hatte und es nun Zeit schien, ihn auf Universitäten zu bringen, verschaffte er demselben durch gleiche Protektion zwei Stipendien auf einer berühmten Universität. Weil nun zwei Stipendien einträglicher waren als eins, so konnte der junge Nothanker auch seine Studien mit viel glücklicherm Erfolge fortsetzen, als sonst ein armer, einfacher Stipendiat hätte tun können. Er studierte daher nicht allein in den Kollegien, sondern auch in den Kaffeehäusern, bei den Jungemägden, in den Dorfschenken und also in der großen Welt der Universitäten. Er machte auch Verse und Satiren, wodurch er denn bald ein Mitglied der Deutschen Gesellschaft des Ortes ward. Von der Philosophie machte er Profession und setzte sich schon in seinen Studentenjahren vor, in derselben einst große Veränderungen vorzunehmen; in der ästhetischen Kritik aber war er so stark, daß er den Longin, Shakespeare und Homer immer beim dritten Worte zitierte. Diese Nachrichten erfreuten Wilhelminen ungemein, welche ihn als ihren würdigen Erben ansah, obgleich Sebaldus ein wenig darüber den Kopf schüttelte und die Hoffnung, die er sich seit zehen Jahren gemacht hatte, ihn einmal zum Adjunkt seiner Pfarre zu bekommen, beinahe aufzugeben anfing.
Etwa sechs Jahre nach der Geburt des Sohnes, als eben die Zuneigung zwischen Sebaldus und Wilhelminen zur wärmsten Zärtlichkeit gestiegen war, wurden sie mit einer Tochter erfreut. Mariane war von ihrer ersten Jugend an der Gegenstand der väterlichen und mütterlichen Zärtlichkeit. Besonders wendete Wilhelmine ihre ganze Sorgfalt auf die Erziehung dieser Tochter. Sie unterwies sie in allen weiblichen Arbeiten und in der französischen Sprache, ihr Vater war ihr Lehrer in der Geschichte und Erdbeschreibung, und beide vergaßen nichts, um den Geist und das Herz dieses geliebten Kindes zu bilden. Mariane hatte in ihrem sechzehnten Jahre die besten deutschen und französischen Schriftsteller gelesen. Nach Endigung ihrer häuslichen Arbeiten war ihr Abendgeschäft, wechselsweise ihrer Mutter vorzulesen oder auf dem Klaviere zu spielen, worin ihr Vater ihr erster Lehrmeister gewesen war und ihr eigener Fleiß sie zu mehrerer Vollkommenheit gebracht hatte. Eine sanfte Seele, ein mitleidiges Herz krönte ihre übrige gute Eigenschaften und gab ihnen in den Augen ihrer Eltern noch einen viel größern Wert.
Als diese älteste Tochter schon erwachsen war, wurde die Familie noch mit einer kleinen Tochter vermehrt, bei deren guter Erziehung Wilhelmine mit der jungen Mariane wetteiferte.
Zweiter Abschnitt
Die häusliche Zufriedenheit hatte auf solche Art viele Jahre ununterbrochen fortgedauret. Sebaldus verrichtete seine Amtsgeschäfte in der Kirche mit frohem Gemüte, ebenso wie Wilhelmine in der Küche und in der Milchkammer. Beide unterstützten willig ihre notleidenden und bekümmerten Nachbarn, und dann kehrten sie vergnügt zu ihrer eigenen Gesellschaft und zur Gesellschaft ihrer inniggeliebten Kinder zurück. Ein frohes Herz war die Würze jeder ländlichen Mahlzeit und verschönerte ihre ruhigen Spaziergänge. Das Einförmige in ihrer Lebensart und in ihrem Vergnügen gewann mehrere Veränderung, so wie ihre Kinder im Alter zunahmen. Eine richtige Anmerkung oder ein witziger Einfall, den Mariane hören ließ, ein neues musikalisches Stück, das sie zum erstenmal spielte, war der elterlichen Zärtlichkeit ein Fest, woran ihr Vergnügen tagelang Nahrung hatte. Der Tag, da Charlottchen zuerst das süße Wort Mutter lallte, der, da sie zuerst auf ihren kleinen Füßen drittehalb Schritte von dem Schoße der Mutter zum Vater forttaumelte, der, da sie ihm das erste von ihr genähte Säumchen vorzeigen konnte, oder der, da sie, durch ihre zärtliche Schwester gelehrt, beide Eltern durch Hersagung der Gellertschen Fabel vom Zeisig überraschte, waren in dieser kleinen Familie Galatage, deren Anmut, wider die Art der höfischen, auch noch, nachdem sie vorbei waren, genossen wurde.
So vollkommen das Glück dieser Familie war, so drohte es doch ein kleiner Zufall zu unterbrechen. Es erschien in den letzten Jahren des vergangenen Krieges eine Schrift, »Vom Tode für das Vaterland« betitelt. Diese kleine Schrift würde in das ruhige Fürstentum so leicht nicht eingedrungen sein, welches von neuen Schriften, sonderlich von solchen, die sich mit dem Tande der weltlichen Weisheit und mit dem Spielwerke der schönen Literatur beschäftigten, gar nicht beunruhigt wurde. Man hatte darin gewöhnlicherweise außer dem fürstlichen privilegierten Gesangbuche, welches jährlich in grobem und feinem Drucke aufgelegt ward, und einigen auswärtigen Kalendern als dem »Hinkenden Staatsboten« und dem »Nürnbergischen Land- und Hauskalender« und so weiter nichts als des Herrn von Bogatzky »Tägliches Hausbuch«, den kleinen Görgel in Lebensgröße, Schabalie, wandelnde Seele, Försters »Expedirten Prediger« in sechs Quartbänden, die Grundrisse von Predigten der Hamburgischen Herren Pastoren nebst der »Insel Felsenburg«, dem »Im Irrgarten der Liebe taumelnden Kavalier« und einigen Romanen des Dresdner Türmers, zum Beispiel: »Das Leben Peter Roberts«, »Das wunderbare Schicksal Antoni«, »Das Leben des Malers Michael«, und dergleichen Sachen mehr.
Wilhelmine aber, welche auf alle neue Bücher neugierig war, die in die schönen Wissenschaften, in die Sittenlehre, Geschichte und so weiter einschlugen, hatte, wie wir schon erwähnt haben, für sich selbst eine kleine auserlesene Bibliothek solcher Schriften, dergleichen in dem ganzen Fürstentume nicht anzutreffen war. Sie hatte dem Buchhändler in der fürstlichen Residenzstadt, ihrem Gevatter, den Auftrag gegeben, ihr alle merkwürdige neue Bücher dieser Art in ebendem Pakete zuzusenden, worin Sebaldus alle neue Schriften, die über die Apokalypse herauskamen, empfing. So nährte der ehrliche Hieronymus den Geist beider Eheleute mit Witz und mit Prophezeiungen.
Dieser Buchhändler hatte in seiner Jugend einige Schulstudien gehabt und dadurch vor verschiedenen seiner Handlungsgenossen den kleinen Vorzug erlangt, die Titel der Bücher, die er verkaufte, ganz zu verstehen. Er hatte in verschiedenen ansehnlichen Buchhandlungen in Holland, Frankreich und Italien als Handlungsdiener gestanden. Dabei hatte er nicht allein sein eigenes Gewerbe in einem weit größern Umfange eingesehen, sondern auch Städte und Sitten der Menschen kennenlernen. Daher kam es wohl, daß er zuweilen, vielleicht ohne es selbst zu wissen, ein vernünftigeres Urteil von verschiedenen Sachen fällte als sein Nachbar, der Superintendent, oder sein anderer Nachbar, der Rat in dem fürstlichen Expeditionskollegium, die beide, außer ihren auf einer benachbarten Akademie verbrachten Universitätsjahren, niemals ihre Vaterstadt verlassen hatten.
Hieronymus pflegte aber die Einsichten, die er besaß, eben nicht unablässig geltend zu machen, daher hatten sie ihm auch nicht Feinde zugezogen. Er war in der kleinen Residenzstadt, in der er sich gesetzt hatte, im Ansehen, ohne von jemand beneidet zu werden, denn er war gegen jedermann dienstfertig und hatte eine natürliche Abneigung, jemand ins Gesicht zu widersprechen oder erlangte Vorteile von irgendeiner Art zur Schau zu tragen. Bei diesen Grundsätzen und einer so glücklichen Temperamentstugend war er in seinem Städtchen wohlhabend geworden, ohne daß es eben bei seinen Nebenbürgern sonderliches Aufsehen verursacht hatte.
Gleichwohl waren durch seinen Fleiß ganz unvermerkt in dem Ländchen, wo er sich befand, zwei neue Handlungszweige eröffnet worden, an die vorher noch niemand gedacht hatte. Das kleine Fürstentum hatte einen fruchtbaren Boden und nicht wenig Viehzucht, es brachte alles hervor, was die Einwohner nähren konnte. Sie nährten sich auch und zehrten richtig dasjenige auf, was ihnen zuwuchs. Weil sie aber außer ihrem mäßig bestellten Ackerbaue gar keine einzige Art von Kunstfleiß trieben, so war freilich unter ihnen wenig Geld. Es reichte kaum zu, die Röcke und die Strümpfe zu bezahlen, die die Handwerker eines benachbarten Herzogtums aus der Wolle, die in diesem kleinen Fürstentume sehr wohlfeil verkauft ward, webten und alsdann in dasselbe wieder einführten. Es war also kein Wunder, daß bisher noch kein Buchhändler in diesem Ländchen hatte Bücher verkaufen können. Hieronymus war der erste, der sich unterstand, Bücher darin einzuführen. Er sah aber auch nicht so genau darauf, ob er eben bar Geld erhielt. Er verkaufte mehrmal zum Beispiel das »Juristische Oraculum« in sechzehn Foliobänden für einen fetten Ochsen, Leopolds »Landwirtschaftsbuch« für sechs Scheffel Roggen und Riegers »Herzpostill« oder Cardilucii »Kunst–, Natur- und Nahrungspostill« für ein paar Schock Eier; ja er gab noch wohl Mürdelii »Süße Geisteserquickungen« oder Meletaons »Tugendschul« in den Kauf.
Hierdurch machte er sich besonders bei den Predigern in den Städten, Flecken und Dörfern sehr beliebt, die gern etwas von ihren Zehenten oder von ihrem Naturaldeputate daranwagten, um sich Krausens »Evangelischen und epistolischen Predigerschatz«, Kleiners »Hirtenstimme«, Schlichthabers »Fünffache Dispositionen aller Evangelien« oder Weyhenmeyers »Epistolische Spruch- und Kernpostill« anzuschaffen und sich dadurch die schwere Last des Predigtamts, die sie so sehr drückte, zu erleichtern. Die Bürger folgten bald dem Exempel ihrer Seelenhirten und schafften sich von einem Teil des Ertrags ihrer Ernte und ihrer Kälber- und Hammelzucht einige erbauliche und nützliche Bücher an, zum Beispiel Hollazens »Gnadenordnung« und »Pilgerstraße«, das Gebetbuch »Die reine Wasserquelle«, den vom Engel Raphael begleiteten »Wandersmann«, Goezens »Betrachtungen über die Dinge«, die nach dem Jüngsten Gerichte vorgehen werden, »Hocuspocus oder Die neuvermehrten Taschenspielkünste«, Schnurrs »Kunst–, Haus-und Wunderbuch«, »Der getreuen Bellamira wohlbelohnte Liebesproben«, Heußens »Biblische Seelenweide« und dergleichen. Die fürstlichen Räte und Sekretarien aber kauften Bolzens »Amts- und Gerichts-Actuarium«, dessen »Anweisung zum Amthierungswerke«, besonders aber des deutlichen Schwesers oder Philoparchi »Wohlunterrichteten Beamten« und so weiter.
Hieronymus erhielt also als ein Laie einen Vorteil, der sonst nur der Geistlichkeit eigen war, nämlich er speisete den Geist seiner Mitbürger und eignete sich dafür ihre Glücksgüter zu. Er ließ die eingetauschten Ochsen, Hammel und Schweine in seine Ställe treiben und das eingetauschte Getreide auf seine Böden schütten. Beides war auf den Märkten des obengedachten Herzogtums für bares Geld zu verkaufen, weil daselbst die blühenden Manufakturen eine größere Bevölkerung, diese aber unvermerkt einen höhern Preis der Nahrungsmittel verursacht hatte. Man kannte unsern Mann daselbst nicht unter dem Namen des Buchhändlers Hieronymus, hingegen der Namen des Korn- oder Viehhändlers Hieronymus war bei den Müllern, Bäckern und Schlächtern daselbst um desto bekannter.
Seine Nachbarn hatten selbst Äcker und Wiesen, aber zufrieden, sich zu nähren, bauten sie wenig mehr, als gebraucht ward, und dachten nie daran, den kleinen Überfluß ihren Nachbarn weiter als etwa bis in die nächste Landstadt zuzuführen. Es währte jahrelang, bis durch die beladenen Wagen und durch die Herden Vieh, die sie so oft aus Hieronymus' Hause wegfahren und wegtreiben sahen, ihre Neugier rege gemacht ward.
Sie versuchten bald ebendiesen Weg, und da ihnen ihr Unternehmen gelang, fingen sie an, ihre Viehzucht zu vermehren und ihre Äcker fleißiger zu bauen. Sie nahmen dadurch selbst an gutem Wohlstande zu, und das ganze Ländchen kam in wenig Jahren in so gutes Aufnehmen, daß die Staatsklugen zu erörtern anfingen, warum das Land sich so schnell verbessert habe.
Eigentlich war freilich die Ursache davon der Fleiß des Hieronymus und das Beispiel, das er seinen Mitbürgern gegeben hatte. Es ist aber allen denen, die politische und Finanzvorfälle untersuchen, schon längst zur Regel geworden, nicht die kleinen Umstände anzuführen, welche gemeiniglich die wahren Ursachen der Begebenheiten zu sein pflegen, sondern große Umstände aufzusuchen, welche gemeiniglich nicht die wahren Ursachen sind. Daher ward in einer in das fürstliche Intelligenzblatt eingerückten Abhandlung die schnelle Zunahme des Wohlstandes der landesväterlichen Vorsorge des Fürsten zugeschrieben (der auf seinem Lustschlosse seine Zeit zwischen der Jagd und seiner Mätresse teilte) und nach derselben den klugen Anstalten seines Ersten Geheimen Rats (der in der fürstlichen Residenzstadt im Kabinette unermüdet arbeitete, alle Stellen im Lande mit seinen Verwandten und Kreaturen zu besetzen). Der Superintendent Doktor Stauzius hingegen, ein scharfer Gesetzprediger, nahm diese Abhandlung in der Einweihungspredigt der neuerbauten Sankt-Bartels-Kapelle ziemlich durch und versicherte, der zugenommene Wohlstand des Fürstentums sei bloß ein sichtbarer Segen des Höchsten wegen der frommen Aufführung der Einwohner.
Man muß nämlich wissen, daß in der fürstlichen Residenzstadt ein paar Jahre vorher fünf Straßen nebst einer kleinen verfallenen Kapelle abgebrannt waren. Die Einwohner trugen auf die nachdrückliche Ermahnung des Superintendenten zum Baue der Kapelle, welche viel vergrößert und verschönert aufgebauet werden sollte, so reichlich bei, daß sie freilich kein Geld übrigbehielten, zu einer Hauskollekte etwas herzugeben, die der Bürgermeister veranlasset hatte, um von deren Ertrage einige gemeine Feuerspritzen anzuschaffen, weil bloß aus Mangel derselben das Feuer so weit um sich gegriffen hatte. Noch weniger kehrten sie sich an die leichtsinnigen Reden des Bürgermeisters, der öffentlich sagte, daß man vor allen Dingen den abgebrannten Einwohnern beispringen müsse und daß es überhaupt unnötig sei, die Kapelle wieder zu bauen, da andere Kirchen genug in der Stadt wären, noch weniger, sie zu vergrößern, solange die Häuser der Einwohner, zu deren Gebrauche die Kapelle dienen sollte, noch in der Asche lägen. Diese mußten sich freilich, da sie nirgend unterkommen konnten und gar keine Hoffnung sahen, sich wieder aufzuhelfen, in wenig Wochen zu Kolonisten nach Rußland anwerben lassen und bekamen also die für sie neuerbaute Kapelle nicht zu sehen. Hingegen hatten sie doch den Trost, daß sie die gedruckte Einweihungspredigt des Doktor Stauzius nebst den beigefügten Carminibus des Stadtministeriums und aller Primaner des fürstlichen Lyzeums mit vieler Erbauung am Ufer der Wolga vorlesen hörten.
Sebaldus erhielt diese gedruckte Einweihungspredigt in ebendem Pakete, worin Wilhelmine die Schrift »Vom Tode fürs Vaterland« erhielt. Sie machte ihm aber nicht sonderliches Vergnügen. Doktor Stauzius hatte in derselben mehr als einmal denen, die Kirchen und Kapellen verachten und den Bau oder die Verschönerung derselben verhindern, mit der ewigen Verdammnis gedrohet. Sebaldus konnte aber an diese Lehre nie denken, ohne in eine Art von Bekümmernis zu geraten, die dem Mißvergnügen nahe war. Dagegen hatte der »Tod fürs Vaterland« auf Wilhelminen eine ganz entgegenstehende Wirkung, denn er setzte ihren ohnedies zum Romantischen geneigten Geist schnell in Feuer. Sie fühlte Entzückung über die Gedanken des Verfassers: daß auch der Untertan einer Monarchie nicht eine bloße Maschine sei, sondern seinen eigentümlichen Wert als Mensch habe, daß die Liebe fürs Vaterland einer Nation eine große und neue Denkungsart gebe, daß sie eine Nation als ein Muster für andere darstelle. Erhitzt von diesen Ideen, beschloß sie, in dem allgemeinen Kriege, der damals Deutschland verheerte, auch ein Beispiel ihrer Liebe fürs Vaterland zu geben. Da fiel ihr gleich auf der ersten Seite folgende Stelle aufs Herz: »Sollte wohl ein Diener der Religion sich entweihen, sollte er wohl dadurch sein Amt vernachlässigen, wenn er, nachdem er tausendmal gesagt hat: Tut Buße!, auch einmal riefe: Sterbet freudig fürs Vaterland?« Dieser Aufforderung Genüge zu tun, fand sie edel und groß und eilte, ihren Mann dazu aufzumuntern. Sie las ihm aus der Schrift, die ihr so sehr gefiel, die stärksten Stellen vor und beschloß mit den eben angeführten, an die Prediger gerichteten Worten. Hierauf nahm sie alles zusammen, um ihn zu bewegen, daß er den nächsten Sonntag seiner Gemeine predigen sollte: Sterbet freudig für das Vaterland!
Doch sie fand bei ihrem Mann einen stärkern Widerstand, als sie sich vorgestellt hatte. Sebaldus wußte ihrer feurigen Überredung hundert unerwartete kalte Gründe entgegenzusetzen; denn sein Geist geriet ohne Prophezeiung nicht leicht in Enthusiasmus, und durch Doktor Stauzius' Einweihungspredigt war er gar nicht erwärmt worden. Unter andern meinte er, ein Geistlicher, wenn er glaube, oft genug gerufen zu haben: Tut Buße!, könnte noch eine Menge Wahrheiten predigen, die ihn alle noch nützlicher dünkten als der Tod für das Vaterland. »Und«, setzte er hinzu, »wo ist in unserm unter Krieg und Verheerung seufzenden Deutschland jetzt wohl das Vaterland zu finden? Deutsche fechten gegen Deutsche. Das Kontingent unsers Fürsten ist bei dem einen Heere, und in unserm Ländchen wirbt man für das andere. Zu welcher Partei sollen wir uns schlagen? Wen sollen wir angreifen? Wen sollen wir verteidigen? Für wen sollen wir sterben?«
Aber Wilhelmine hatte nun einmal lebhaft den Gedanken gefaßt, es solle vom Tode fürs Vaterland gepredigt werden, und da ihr Mann durch allgemeine Gründe nicht zu bewegen war, nahm sie zu solchen ihre Zuflucht, die ihn näher angingen. »Wie«, sagte sie, »wird denn nicht in diesem Kriege wider die Franzosen gestritten? Die Deutschen sind echte Deutsche, die auf Türken und Franzosen losgehen! Sie haben mir, mein Lieber, oft von Weissagungen vom nahen Untergange Frankreichs vorgesagt, sollte in der Apokalypse keine Weissagung sein, die den itzigen Krieg angehet? Schlagen Sie doch nach. Wer weiß, ob in diesem Kriege nicht Deutsche das stolze Frankreich erobern sollen? Wenn es Ihnen nun vorbehalten wäre, durch Ihre Predigt zu diesem großen Werke den ersten Anlaß zu geben? Welcher Ruhm für Sie, wenn auch auf Sie und auf Ihre Predigt mit geweissagt wäre? Können Sie der Kraft so vieler Gründe wohl widerstehen? Ich dächte, Sie müßten dadurch determiniert werden!«
Der arme Sebaldus war nun bei allen seinen Schwächen angegriffen, denn Wilhelmine pflegte eben nicht die Apokalypse anzuführen, noch weniger pflegte sie der Franzosen mit widrigen Seitenblicken zu gedenken; und was den zureichenden und determinierenden Grund betraf, waren beide so schlechterdings entgegengesetzter Meinung, daß weder Sebaldus das Wort zureichend noch Wilhelmine das Wort determinierend jemals in den Mund zu nehmen pflegte. Es geschah also hier, was immer zu geschehen pflegt, nämlich daß die gefällige Freundlichkeit eines Frauenzimmers die besten Gründe einer Mannsperson unkräftig macht.
Sebaldus wählte für den nächsten Sonntag einen schicklichen Text aus der Apokalypse, und da dieses das, erstemal war, daß er einen aus diesem von ihm so geliebten Buche auf Kanzel brachte, so hielt er seine Predigt vom Tod fürs Vaterland in einem ihm sonst nicht gewöhnlichen enthusiastischen Feuer und nicht ohne Frucht. Denn beim Herausgehen aus der Kirche sah er auf dem Kirchhofe einen ziemlichen Auflauf und hörte jemand sehr laut reden. Als er näher hinzukam, vernahm er, daß ein im Dorfe liegender preußischer Unteroffizier, der mit in der Kirche gewesen war, zu seiner Predigt eine epanorthotische Nutzanwendung hinzutat, wodurch denn zehn junge, rasche Bauerkerle bewegt wurden, auf der Stelle Dienste zu nehmen.
Dem Sebaldus klopfte hiebei das Herz etwas ängstlich, aber Wilhelmine jubilierte über den glücklichen Erfolg ihres Vorschlags. Sie wendete auf dem Wege aus der Kirche nach Hause alles an, um ihrem Manne ebenso freudige Gesinnungen mitzuteilen. Es würde ihr vielleicht gelungen sein, wenn nicht zwei Briefe, die sie bei ihrer Ankunft zu Hause fanden, ihre Freude etwas niedergeschlagen hätten. Der eine war von einem Professor der Universität, wo ihr ältester Sohn studierte. Er meldete ihnen ohne Umschweife, daß ihr Sohn mit Hinterlassung vieler Schulden davongelaufen sei und daß niemand wisse, wohin. Beide Eltern fuhren bei dieser unvermuteten Nachricht zusammen und zitterten vor dem zweiten Brief, an dessen Aufschrift sie ihres Sohnes Hand erkannten. Der Sohn meldete darin, ohne von seinen Schulden etwas zu erwähnen, daß er es für einen guten Bürger für schimpflich halte, stillezusitzen, wenn das Vaterland in Not sei; daß die Römer und Griechen in ihrer Jugend Kriegsdienste getan hätten; daß er diesem glorreichen Exempel folgen wolle und daher zur Armee gegangen sei. Zugleich meldete er seinen Eltern, er habe vorderhand einen fremden Namen angenommen und wolle diesen so lange führen, bis er seinem wahren Namen Ehre mache. Sebaldus ward bei dieser Nachricht ganz blaß, und Wilhelmine fiel mit einem lauten Geschrei rücklings aufs Kanapee. Sie besann sich aber bald, daß jetzt Gelegenheit sei, spartanische Gesinnungen zu zeigen, und sagte nach einigen Minuten mit gebrochener Stimme und mit tränenden Augen: »Ich habe ihn dazu geboren!« Sie suchte, so schwer es ihr ward, ihre heldenmütigen Gesinnungen bei sich wieder hervorzuziehen. Bald stellte sie sich die großen Taten vor, die ihr Sohn verrichten würde; bald bedauerte sie nur, daß er seinen Namen verändert hatte, weil sie auf diese Art vor ihr unbemerkt geschehen könnten. Bald hoffte sie wieder, daß er, wenn er etwas Großes verrichtet hätte, gewiß seinen Namen kundtun werde. Doch konnten alle diese heroischen Gesinnungen, mit denen sie sich tröstete und die dem Sebaldus gar keinen Trost gaben, weder ihre mütterliche Zärtlichkeit noch des Sebaldus weise Betrachtungen unterdrücken, die sich den Rest des Tages über beständig dazwischenmischten. Und nun legten sie sich beiderseits in einer solchen Gemütsverfassung schlafen, daß, wenn sie vierundzwanzig Stunden vorher darin gewesen wären, Sebaldus sowenig würde gepredigt haben: Sterbet freudig für das Vaterland!, als Wilhelmine ihn dazu würde haben ermuntern wollen.