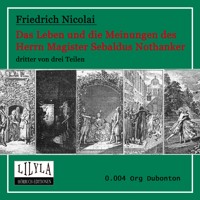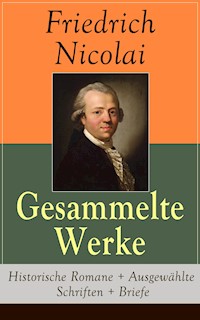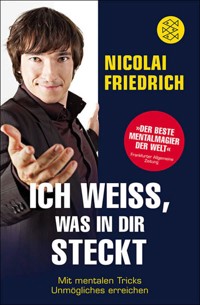Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
In dieser Reisebeschreibung erzählt der Schriftsteller und Regionalhistoriker Nicolai über seine Eindrücke während einer Reise im deutschen Süden im Jahr 1781.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Unter Bayern und Schwaben
Friedrich Nicolai
Inhalt:
Friedrich Nicolai – Biografie und Bibliografie
Unter Bayern und Schwaben
München
Die Reise von München über Nymphenburg nach Augsburg
Augsburg
Ulm
Stuttgart
Auf dem Weg nach Tübingen
Tübingen
Die Reise von Tübingen nach St. Blasien im Schwarzwald
Das Stift St. Blasien im Schwarzwald
Unter Bayern und Schwaben, F. Nicolai
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849632618
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Friedrich Nicolai – Biografie und Bibliografie
Schriftsteller, geb. 18. März 1733 in Berlin, gest. daselbst 11. Jan. 1811, besuchte eine Zeitlang die Schule des Waisenhauses in Halle, dessen pietistische Richtung ihn zum Widerspruch herausforderte, lernte seit 1749 in Frankfurt a. O. als Buchhändler und suchte sich dabei durch ausgebreitete Lektüre, namentlich der englischen Schriftsteller, weiter fortzubilden. Nach seiner Rückkehr nach Berlin (1752) veröffentlichte er ohne Nennung seines Namens eine Schrift, in der er die törichten Angriffe der Gottschedianer gegen Milton zurückwies (1753), dann trat er mit den gleichfalls anonym erschienenen »Briefen über den itzigen Zustand der schönen Wissenschaften« (Berl. 1755; Neudruck von Ellinger, das. 1894) hervor, die sich sowohl gegen Gottsched als gegen die Schweizer Theoretiker wandten, für die Mustergültigkeit der englischen Literatur eintraten und strengere Handhabung der Kritik forderten. Sein Streben führte ihn mit Lessing und Moses Mendelssohn zu gemeinschaftlicher Tätigkeit zusammen, und bald schlossen sich andre an. Die Fortsetzung der mit Mendelssohn begonnenen »Bibliothek der schönen Wissenschaften und freien Künste«, in der N. seine beachtenswerte »Abhandlung vom Trauerspiel« veröffentlicht hatte (Leipz. 1757–58, 4 Bde.), ihrem Freunde Chr. Felix Weiße in Leipzig überlassend, begründeten beide im Verein mit Lessing die »Briefe, die neueste Literatur betreffend« (Berl. 1759–65, 24 Bde.). Hierauf brachte N. 1765 den Plan einer »Allgemeinen deutschen Bibliothek« zur Ausführung, die er anfangs mit Geschick und Erfolg redigierte, später aber mehr und mehr zum Organ der plattesten Aufklärung machte. Zensurschwierigkeiten, die unter dem Ministerium Wöllner entstanden, veranlassten N., seine Zeitschrift 1792 mit dem 107. Band eingehen zu lassen; doch erschien eine Fortsetzung u. d. T. »Neue allgemeine deutsche Bibliothek« von 1793–1800 (55 Bde.) in Kiel; erst von Bd. 56 an (1800) wurde sie wieder von N. herausgegeben und schloß 1805. Die Zeitschrift hatte einen sehr ausgedehnten Mitarbeiterkreis (vgl deren Verzeichnis von Partey, Berl. 1842). Von Nicolais eignen Schriften galt seine »Topographisch historische Beschreibung von Berlin und Potsdam« (Berl. 1769; 3. Aufl. 1786, 3 Bde.) für die damalige Zeit als ein Musterwerk; seine »Charakteristischen Anekdoten von Friedrich II.« (Berl. 1788–92, 6 Hefte) waren nicht völlig wertlos. Unter seinen Romanen waren »Leben und Meinungen des Magisters Sebaldus Nothanker« (Berl. 1773–76, 3 Bde.; 4. Aufl. 1799), eine Nachahmung Sternes, als realistische Wiedergabe beengter Lebenszustände und als satirische Tendenzschrift gegen die Herrschaft der Orthodoxie der bedeutendste. In der Satire »Freuden des jungen Werther« (1775) wandte er sich gegen Goethe in dem »Kleinen seinen Almanach« (2 Jahrgänge 1777–78; Neudruck, Berl. 1888) gegen die wiedererwachende Neigung zur Volkspoesie. Seinen literarischen Gegnern ist die »Geschichte eines dicken Mannes« (Berl. 1794, 2 Bde.), ein unsäglich seichtes, unerquickliches Buch, gewidmet. Heftigen Widerspruch zog ihm die breite und eine »Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz« (Berl. 1781; 3. Aufl. 1788–96, 12 Bde.) zu. Sein borniertes Ankämpfen gegen alle neuern Richtungen in der Literatur wurde der Anlass zu zahlreichen Angriffen gegen ihn, wie sie namentlich von Herder, von Goethe und Schiller in den »Xenien«, von Lavater, Fichte und den beiden Schlegel ausgingen. Die nüchterne Beschränktheit und polternde Rechthaberei des alternden Schriftstellers, der sich gern für den geistigen Erben Lessings ausgegeben hätte, führten schließlich dahin, dass man auch seine wirklichen Verdienste übersah und leugnete. Noch sind seine biographischen Schriften über Ewald v. Kleist (1760), Thomas Abbt (1767), Justus Möser (1797) u.a. zu erwähnen. Seinen Briefwechsel mit Herder veröffentlichte O. Hoffmann (Berl. 1887), R. M. Werner den Briefwechsel mit dem Wiener Staatsrat v. Gebler (das. 1888). Vgl. Göckingk, Nicolais Leben und literarischer Nachlass (Berl. 1820); Minor, Lessings Jugendfreunde (in Kürschners »Deutscher Nationalliteratur«, Bd. 72); Altenkrüger, F. Nicolais Jugendschriften (Berl. 1894); Schwinger, F. Nicolais Roman »Sebaldus Nothanker« (Weim. 1897).
Unter Bayern und Schwaben
Meine Reise im deutschen Süden 1781
1. Kapitel
München
Die Stadt – Der Hofstaat und die Regierung – Industrie und mechanische Kunstfertigkeit – Gelehrsamkeit und die Schönen Künste – Aberglaube und Religion – Der Nationalcharakter der Bayern – Das Räuberunwesen in Bayern – Sitten und Gebräuche – Die Mundart der Bayern
München hat vor vielen Städten, selbst vor dem großen Wien, den Vorzug, daß es von ihm eine in neuerer Zeit erschienene, vollständige Beschreibung gibt, die einem Fremden als Leitfaden dienen kann. Man verdankt sie Herrn Prof. Westenrieder. Ich weiß sehr wohl, daß daran viel und zum Teil mit Recht Kritik geübt worden ist, aber im großen und ganzen gehört dieses Werk doch zu den wenigen wirklich nützlichen Städtebeschreibungen. Eine solche Aufgabe scheint nicht schwer zu sein, denn man hat ja alles, was man beschreiben will, vor Augen. So dachte ich auch, bis ich mich selbst an eine solche Beschreibung machte. Doch die Erfahrung hat mich inzwischen die Schwierigkeiten gelehrt, eine solche Menge von Gegenständen, wie sie sich in einer großen Stadt zeigen, unter dem rechten Gesichtspunkt zusammenzufassen, dabei das Bemerkenswerte auszuwählen und es kurz und doch klar zu beschreiben. Die erste Ausgabe meiner Beschreibung von Berlin war, obgleich ich größten Fleiß darauf verwendet hatte, noch sehr unvollkommen.
München ist eine Stadt von mittlerer Größe, und im allgemeinen sind die Gassen hier viel breiter als in Wien. Die Kaufingergasse, die Neuhausergasse, das Tal u. a. sind alle breit genug. Der Platz oder Markt, wo die Hauptwache ist, hat recht ansehnliche Häuser, unter denen sich Arkaden wölben. Auf diesem Platz steht ein vergoldetes Bildnis der Jungfrau Maria auf einer hohen marmornen Säule, um deren Basis man geharnischte Engel damit beschäftigt sieht, Ungeheuer zu zerhauen. Der Jesuitenpater Crammer erklärt dazu in seinem Werk »Das deutsche Rom«, wie er München nannte: »Die vier Tiere sind eine Natter, ein Basilisk, ein wilder Löwe und ein Drache. Diese vier Tiere symbolisieren die vier Übel eines Landes: ansteckende Luft und Krankheiten, Hungersnot, Krieg und die Ketzerei.«
Die Residenz oder das kurfürstliche Schloß ist ein ungeheuer großes Gebäude, ohne rechten Zusammenhang und mit einer schlechten Symmetrie, von dem 1750 noch dazu ein Teil abgebrannt und bisher nicht wieder aufgebaut worden ist. Man hat im Schloß aber immer noch genug Platz übrig, denn es ist so weitläufig, daß es acht Höfe einschließt. Es ist schwer, von der heterogenen Gestalt dieses Bauwerks eine klare Vorstellung zu vermitteln. Von außen ist die Residenz an vielen Stellen mit Marmor verkleidet. Die zweieinhalb Geschoß hohe Hauptfassade, unter dem Kurfürsten Maximilian I. erbaut, ist zwar nach damaligem Geschmack mit tischlerhaften Verzierungen überladen, und die beiden übereinanderstehenden dorischen und ionischen Säulenreihen sind etwas kurz, wie es bei Gebäuden der damaligen Zeit oft vorkommt, aber man kann doch nicht leugnen, daß diese Fassade etwas Wohlgereimtes und eine dem Auge sehr gefällige Harmonie der Teile aufweist. Die rechte Ausstrahlung eines landesherrlichen Schlosses hat sie aber doch nicht. Ich hätte das Gebäude eher für eine reiche Prälatur gehalten, zumal die Jungfrau Maria als Patronin von Bayern groß davor steht.
Das Innere des Schlosses ist sehr prächtig, was auch in vielen Büchern gelobt wird. Einem nachdenklichen Betrachter aber muß beim Anblick dieser vielen Kostbarkeiten die lange Reihe der Landesherren einfallen, welche teils wirklich Talent und Unternehmungsgeist hatten, wie z.B. Maximilian I. und Maximilian Emanuel, teils nur sehr viel guten Willen und Liebe zu ihrem Land. Und doch wurden sie alle von ihren Mätressen, ihren Ministern und – noch viel schlimmer – von ihren Beichtvätern irregeleitet und davon abgehalten, soviel für ihr Land zu tun, als sie selbst eigentlich tun wollten. Statt dessen weideten sie sich an eitlen Vergnügungen, stumpfen Andachtsübungen – die Gottesdienste heißen – und seelenlosem Prunk. Schon unter der Regierung des eher tapferen als glücklichen Kurfürsten Maximilian Emanuel hatte Bayern 1726 durch dessen unmäßige Neigung zur Pracht 30 Millionen Gulden Schulden. Zu ihrer Verzinsung konnten der Landschaft jährlich kaum ein Siebtel der fälligen Zinsen angewiesen werden. Gleichwohl dachte man weder an Sparsamkeit noch an Ordnung. Allein an den Bau und die Möblierung der Zimmer der Residenz wurden unmäßige Summen verschwendet. Kaiser Karl VII. hinterließ dem Land bei seinem Tode 42 Millionen Gulden als Schulden, die Hofschulden nicht mitgerechnet. Unter seinen Gemächern findet man unter anderem eines, das von 1723 bis 1729 fertiggestellt wurde und völlig mit rotem Samt, der überreich mit Goldfäden bestickt wurde, ausgeschlagen ist. Diese Einrichtung soll allein eineinhalb Millionen Gulden gekostet haben, und man sagt, die Stickereien wiegen für sich schon 24 Zentner. Trotz aller Pracht kommt einiges in diesem Schloß nicht so recht zur Wirkung. Ein berühmter Künstler aus Flandern, Peter de Witte, auch Candido genannt, hat für den größten, unter Maximilian errichteten Teil der Residenz sämtliche Entwürfe für die Ausschmückung gemacht.
Das Rathaus in München
Außer einem Springbrunnen – ebenfalls nach Plänen von Candido erbaut – im sogenannten Brunnenhof ist das Schönste an dieser Residenz eine herrliche Treppe aus rotem Marmor, deren Gewölbe auf vier mächtigen marmornen Säulen ruht. Sie liegt im Winkel eines öden, mit Gras bewachsenen Hofes, dem Kaiserhof, und von ihr gelangt man in den sogenannten Kaisersaal. Dieser größte Saal ist in seiner Anlage recht gut proportioniert, doch sah es darin etwas traurig aus. Die Wände waren mit alten, künstlerisch unbedeutenden Hautelissetapeten verkleidet, und die schönen großen Fenster waren zu meinem Erstaunen mit altmodischen Butzenscheiben verglast. Man hatte allerdings damit begonnen, größere Glasscheiben einzusetzen. Da hier auch Konzerte veranstaltet werden, so ist an einem Ende des Saales eine Erhöhung für das Orchester angebracht. Neben dem Kaisersaal befindet sich noch ein kleinerer, der seinen Namen von dem Deckengemälde hat, das man darin bewundern kann. Es stellt Apollon mit vier weißen Pferden dar, und so heißt der Saal der Schimmelsaal. Er ist, mit Florentiner Marmorplatten ausgelegt, eigentlich sehenswerter als der Kaisersaal. Über die Galerie, die im Grunde ein mit Bildern vollgehängter, geräumiger Korridor ist, gelangt man, wenn man sich nach links wendet, über eine Treppe in den Hofgarten. Nach rechts geht es zum sogenannten Hofgang. Auf diesem Weg kann die Hofgesellschaft, wenn es ihr sehr fromm zumute ist, in insgesamt sieben Kirchen oder auch, wenn sie sehr fröhlich gestimmt ist, ins Opern- und Komödienhaus gelangen. Unter den Räumen der Residenz, die man noch erwähnen muß, sind die Zimmer der Kaiserin Amalia. Hier, wo an Vergoldungen nicht gespart wurde, findet man sehr schöne Tapeten in herrlichen Farben aus der Münchner Hautelissemanufaktur; die Kartone dazu hat Christian Wink gemalt. In den Gemächern der Kaiserin findet man jede Menge herrlicher Spiegel und bemerkenswerte Miniaturgemälde. In einem Raum hängt ein Kronleuchter aus Elfenbein, dessen menschlichen Figurenschmuck Kurfürst Maximilian eigenhändig gedrechselt haben soll.
Außer der Hofkapelle, die recht hübsch eingerichtet ist und in der gewöhnlich der Hofgottesdienst gehalten wird, existiert noch eine weitere, 1607 erbaute Kapelle, in der viele, kostbar in Gold und mit Edelsteinen gefaßte, Reliquien aufbewahrt werden. Diese Kapelle wird sehr bewundert und die schöne Kapelle genannt. Besser wäre es, man hieße sie die kostbare, denn eigentlich schön ist sie nicht, obwohl sie mit Marmor und Jaspis ausgelegt ist. Alle Verzierungen sind als Kunstwerke schlecht oder phantasielos gearbeitet, gerade so, wie es sich für eine Reliquien-Rumpelkammer schickt. Man braucht schon viel Geduld, um das dumme Zeug, das einem bei Führungen über die Reliquien erzählt wird, ohne Lachen oder ein Zeichen des Widerwillens anzuhören.
Im Erdgeschoß des Schlosses befindet sich ein großer gewölbter und etwas feuchter Saal, das Antiquarium. An seinen Wänden sind auf Kragensteinen etwa 200 Brustbilder aus verschiedenen Epochen angebracht. Auf Tischen liegen Köpfe und andere Antiquitäten, jedoch gibt es keine außergewöhnlichen Stücke darunter. So schien mir ein Modell der Residenz, an dem man die unregelmäßige Gestalt des gesamten Gebäudekomplexes mit seinen acht Höfen recht gut überblicken kann, beinahe das Interessanteste zu sein. Am Modell wird auch deutlich, daß der 1750 abgebrannte sogenannte Neubau der schönste Teil der ganzen Residenz war.
Das Opernhaus hatte man für die 500 000 Gulden erbaut, die das Haus Bayern für den Verzicht auf Ansprüche an die Herzogtümer Mirandola und Guastalla bekommen hatte. Es ist nicht größer als ein gewöhnliches Schauspielhaus und hat vier, allerdings sehr prächtig ausgestattete, Logenreihen. Zu Karneval werden hier alljährlich italienische Opern aufgeführt, und bei Besuchen fremder Herrschaften spielen auch einmal deutsche Schauspieler.
Nicht weit vom Paradeplatz entfernt liegt die Wilhelminische Residenz, die viele auch die Herzog-Max-Burg nennen, und gleich daneben steht das Jesuitenkollegium, mit dessen Bau Herzog Wilhelm V., der Fromme, im sechzehnten Jahrhundert begann. Allgemein gilt dieses Gebäude als das prächtigste Jesuitenkollegium der Welt, so wie das in Prag das größte ist. Seit der Aufhebung des Ordens sind aber nur noch vier Landeskollegien in dem riesigen Gebäude untergebracht: die Oberlandesregierung, der Hofrat, der Geistliche Rat und die Schulkommission. Im Vordergebäude ist außerdem noch das Gymnasium und in einem hinteren Teil die Marianische Landakademie.
Das Kollegium wurde zusammen mit der dazugehörigen Hofkirche St. Michael von 1583 bis 1597 errichtet. Der Baumeister war ein Steinmetz namens Wolf Müller. Die Kirche ist 284 Fuß lang und 114 breit und hat ein schönes, hohes Tonnengewölbe, das majestätisch und edel wirkt. Es ruht auf korinthischen Wandpfeilern mit vergoldeten Kapitellen. Die Basis der Pfeiler besteht, wie auch der gesamte Kirchenboden, aus Marmor. Der ganze Kirchenraum ist in einfachem Weiß gehalten, weist wenig Vergoldung auf und ist durch keine Bilder geschmückt, mit Ausnahme der Altäre und zweier Beichtstühle. Auf halber Höhe stehen in Nischen auf marmornen Säulen die zwölf Apostel, von Krumpeter gestaltet. Die einfache Schlichtheit in der Anlage und der Verzierungen und die großen wohlproportionierten Massen des Gemäuers vereinigen sich zu einem angenehm überraschenden Gesamteindruck. Es findet sich in Deutschland schwerlich ein Gebäude aus dem sechzehnten Jahrhundert, das so erhaben und edel in seiner Anlage ist. Wolf Müller, dessen Namen bisher unverdientermaßen in Vergessenheit geriet, müßte wegen dieses Meisterstücks unter die ersten Baumeister Deutschlands gezählt werden.
Die Hofkirche Sankt Michael
Die Augustinerkirche und das Kloster sind vom Jesuitenkollegium nur durch die sogenannte Weite Gasse getrennt. Die Kirche ist gotisch und wirkt von innen sehr hoch und sehr hell, denn als sie vor wenigen Jahren verputzt wurde, hat man eine allzu helle Farbe genommen. Als wir die Kirche besichtigten, beteten gerade die Novizen, die aber schon recht große Kerle waren. Wie sehr wünschte ich mir eine Reißfeder, um die einander so ähnlichen Gesichter zeichnen zu können, um zugleich die Züge dieses dummen, fanatischen Anspannens, vereint mit der Ergebenheit in einen quietistisch blinden Gehorsam, festzuhalten, so wie sie sich in diesen schlappstarren und starrschlappen Novizengesichtern zeigten. Es gibt kaum eine Gelegenheit, die Menschheit mehr erniedrigt zu sehen, als bei der Betrachtung einer solchen Mönchsszene.
Die Augustinerkirche hat einen reichen Schatz an festlichen Ornaten, an Geräten für den Gottesdienst und an Reliquien. Obwohl ich gar keine Lust hatte, mir diesen Schatz zeigen zu lassen, so mußte ich doch, wider meinen Willen, den Zahn der heiligen Apollonia besichtigen, als ich am Hochaltar, vorne im Chor, das herrliche Altargemälde von Tintoretto bewundern wollte. Ich war aber nicht so sehr von dem Zahn gefesselt, als vielmehr von dem Gesicht des ehrlichen Laienbruders, der uns herumführte und uns mit einer gutherzigen Geschäftigkeit drängte, damit wir uns den Anblick eines ihm so wichtigen Heiligtums ja nicht entgehen ließen. Hätte er nicht ein nervöses Zucken der Augenlider gehabt, ich hätte mich an den Klosterbruder in Lessings »Nathan dem Weisen« erinnert gefühlt.
Mehr will ich von Kirchen und Klöstern in München nicht berichten, obwohl sich noch sehr viel hinzufügen ließe, denn Kirchen und Klöster beanspruchen mehr als ein Drittel der gesamten Grundfläche der Stadt. Die übrigen ansehnlichen Gebäude und Paläste sind nicht sehr zahlreich, und die schönsten von ihnen stehen in der Nähe der Residenz.
Die bürgerlichen Häuser sind zwar teils recht geräumig, doch sieht man nur selten wirklich schöne Fassaden. Gewöhnlich sind die Häuser zwei bis vier Geschosse hoch, und fast immer ist der Innenraum schlecht eingeteilt. Ich habe kaum einmal eine brauchbare und geschmackvolle Raumaufteilung gefunden. Die Möblierung ist durchweg sehr schlicht und viel einfacher, als man in einer Stadt vermuten würde, die zumindest bei Hofe und bei den Vornehmen sehr großen Luxus kennt.
Die Straßen sind, wie schon gesagt, ziemlich breit und einige auch leidlich gerade, obwohl München ebensowenig wie Wien planmäßig gebaut wurde. Jede Menge Kirchen, düstere Klöster mit langen, häßlichen Fassaden, hin und wieder ein Palast und sehr viele solide gebaute Bürgerhäuser beherrschen das Stadtbild. Die Straßen sind recht ordentlich gepflastert und werden rein gehalten, allerdings ist hier auch weniger Verkehr als in Wien. Wenn man von dort kommt und das beständige Schwirren auf den Gassen gewohnt ist, dann erscheint einem München fast tot. Die Straßen werden, allerdings nur im Winter, beleuchtet.
Ganz in der Nähe des Komödienhauses steht eine sehr praktische Einrichtung, der Wasserturm, denn mit dem Wasser, das auf eine Höhe von 55 Fuß hinaufgepumpt wird, speist man nicht nur die beiden Springbrunnen zu beiden Seiten der Mariensäule, sondern vom Turm führen auch unterirdische Kanäle in viele Gassen und von da direkt in zahlreiche Bürgerhäuser. So haben viele Häuser ihr eigenes Wasser. Außerdem sind die Kanäle bei Feuersbrünsten sehr nützlich, denn es ist sogleich Löschwasser zur Hand. Über die genaue Zahl der Gebäude in München gibt es unterschiedliche Meinungen, im allgemeinen spricht man aber von etwa 2000 Häusern.
Überaus groß, wie in vielen katholischen Ländern, ist die Zahl der Bettler. Man kann sie auf allen Straßen und vor allen Kirchentüren finden. Die Ursache der schändlichen Bettelei liegt keineswegs im Mangel an Armenanstalten, woran es gar nicht fehlt, sondern in der überflüssigen und unmäßigen öffentlichen Vergabe von Almosen. Wie in fast allen großen Städten leben nur sehr wenige Almosenempfänger gänzlich davon. Der weitaus größte Teil erhält die Almosen als eine Art Zuschuß zum eigentlichen Einkommen, teils wegen Kinderreichtums, teils wegen Krankheit. Hinzu kommt, daß die Almosenvergabe, wie in anderen katholischen Gegenden auch, als ein gutes und frommes Werk angesehen wird.
Die Barmherzigen Brüder machen wie an anderen Orten viel Aufhebens von ihren Spitälern, doch wird im Grunde der größte Teil des Geldes für unnütze Zeremonien und die Verpflegung der Mönche ausgegeben. Die bekannteste Almosenanstalt Münchens, der sogenannte Liebesbund oder die Liebesversammlung der schmerzhaften Mutter Gottes, von der im Kirchenboten, in den Ephemeriden der Menschheit und anderen Journalen viel zuviel Aufhebens gemacht wird, ist eine förmliche Bruderschaft, die vom Papst mit dem Ablaß versehen ist. Ihre Mitglieder versammeln sich, um Messen zu hören und Rosenkränze zu beten. Daher werden die Almosen dann auch oft an Betbrüder und anderes Gesindel vergeben, das dieser Gaben nicht würdig ist. Weitaus nützlicher, wenn auch lange nicht so bekannt wie der Liebesbund, ist die Mildtätige Gesellschaft in München. 1779 von dem geistlichen Rat Kollmann und dem Gastwirt Albert gegründet, war die Zahl der freiwilligen Mitglieder bis 1781 schon auf 203 angestiegen; unter ihnen gilt der Kurfürst ebenso wie ein Bauer. Diese Gesellschaft verlangt überhaupt keine Andachtsübungen und gibt an laufende Bettler grundsätzlich keine Gaben, denn ihren Hauptzweck sieht sie darin, verarmte Bürger oder sogenannte schamhafte Arme aufzusuchen, sie zu unterstützen und arme Kinder bei Handwerkern unterzubringen, damit sie etwas lernen können.
Zum Schluß will ich eine wohltätige Verordnung des jetzigen Kurfürsten nicht unerwähnt lassen, die bestimmt, daß alle unehelichen Kinder, die im Waisenhaus zum heiligen Geist erzogen werden, ein Legitimationspatent erhalten. Um diese Maßnahme hat sich der Staatsminister Graf Morawizky sehr verdient gemacht, und sein Unternehmen verdient Nachahmung in allen Ländern.
Man kann nicht behaupten, daß durch die große Anzahl von Beamten, die es hier gibt, Bayern besser verwaltet würde als andere Länder. Die öffentliche Meinung ist eher vom Gegenteil überzeugt: überall gebe es zahllose Mißbräuche, Aberglaube, Müßiggang und Völlerei seien im Volk weit verbreitet, und in gleichem Maße fehle es an Industrie und nützlichen Künsten. In vielen Schriften wird öffentlich behauptet, daß eine große Anzahl von Ländereien ungenutzt bliebe und daß Straßenraub und Diebstahl auch durch zahlreiche Hinrichtungen nicht verhindert werden könnten. Da ich dies nicht nur einmal hörte, muß es wohl wahr sein.
Dabei gibt man dem Regenten gar nicht die Schuld an diesen Mängeln, sondern vielmehr dem Einfluß von einigen Günstlingen und dem Klerus. Der bei seinen Untertanen allgemein beliebte Kurfürst Maximilian Joseph, dessen Namen auch heute noch mit Entzücken genannt wird, hat viel Gutes für sein Land erreicht. So hat ihm Bayern weitreichende Presse- und Zensurfreiheit, die Errichtung der Akademie der Wissenschaften in München, Verbesserungen im Schulwesen und weitere nützliche Einrichtungen zu verdanken. Der gutherzige Kurfürst sah leider nicht, wie sich einige seiner Günstlinge und Minister an seinen armen Untertanen bereicherten. So konnte sich die Wirtschaft, einer völlig unpraktischen Zollordnung wegen, kaum entwickeln. Auch die Gesetze waren unzulänglich und hart, und die Todesurteile nahmen so sehr überhand, daß 1774 in München fast jede Woche zwei bis drei Missetäter hingerichtet wurden. Der jetzige Kurfürst wird von seinen Untertanen fast ebenso geliebt wie sein Vorgänger. Sie sind überzeugt davon, daß er das Gute fördern will und das Böse verhindern möchte. Er kann aber mit seinen guten Absichten nicht durchdringen, so gern er das auch will, denn noch immer hat der Klerus einen zu großen Einfluß und verhindert jede weitere Aufklärung mit allen Mitteln. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele. So gibt man noch immer Personen, die von einem tollwütigen Hund gebissen worden sind, keine Arznei, sondern berührt sie mit dem St. Hubertusschlüssel. Noch im Jahre 1783 verbreitete man die Legende, ein Marienbild der St. Peterskirche in München habe die Augen bewegt. Es bleibt nur zu hoffen, daß unter diesem Regenten, der ja das Gute will, auch noch viel Gutes geschehe.
Handel und Gewerbe haben in München, wie in ganz Bayern, einen schweren Stand. Das kommt vor allem von den umständlichen Formalitäten und den unzweckmäßigen Gesetzen, mit denen der Unternehmungsgeist behindert wird. So kostet jede Gewerbeerlaubnis Geld, und den Handwerksmeistern will man vorschreiben, daß sie nicht mehr als einen oder zwei Lehrburschen ausbilden dürfen. Vergleicht man die Zahl der Betriebe, die nützliche Güter herstellen, mit der Anzahl der Betriebe, die Luxuswaren erzeugen, so ergibt sich auch hier ein bezeichnendes Bild. Es gibt in München z.B. mehr Goldschmiede als Tuchmacher und mehr Kaffeesieder und Kaffeehausbesitzer als Wollkämmer und Spinner. Als man dann begann, in Bayern Fabriken und Manufakturen einzuführen, fing man es ebenso verkehrt an. So gibt es zwar in München eine Manufaktur für Hautelissetapeten und eine, die Gold- und Silberwaren herstellt, aber man ist nicht in der Lage, so viel ganz gewöhnliches Tuch herzustellen, wie man benötigt.
Über die Entwicklungs- und Förderungsmöglichkeiten des Manufakturwesens bestehen hier die seltsamsten Vorurteile. So fragte mich einmal in München ein ansonsten verständiger Mann allen Ernstes: »Essen die Handwerker und Manufakturarbeiter in Berlin und Brandenburg eigentlich überhaupt warme Mahlzeiten?« Als ich die Frage bejahte und mich erstaunt nach dem Grund dafür erkundigte, versicherte man mir glaubwürdig, ein ehemals in Bayern bedeutender Mann habe einem Patrioten auf dessen frommen Wunsch nach mehr Industrie geantwortet: »Hier in Bayern ist es ganz unmöglich, an Manufakturen zu denken, lieber Mann. Es ist einfach sinnlos, denn unsere Arbeiter wollen einfach zwei warme Mahlzeiten am Tag und ihr Bier dazu trinken. In Sachsen, Schlesien und Brandenburg essen die Leute niemals warm und trinken nur Wasser, deshalb blühen dort die Manufakturen so auf.«
Es gibt in ganz München nur wenige wirklich erwähnenswerte Betriebe. Die Münchner Spielkarten z.B. sind im Ausland sehr bekannt. Besonders viele werden nach Polen ausgeführt. Auch ganz vorzügliche Malerpinsel, wohl die besten in ganz Deutschland, werden in München hergestellt. Es sind drei Schwestern, die dieses Geschäft betreiben.
Sehr viel bedeutender als die Industrie sind einige mechanische Künstler, die hier ansässig sind. Der bemerkenswerteste von ihnen ist ein gewisser Joseph Gallmayr. Als Bauernsohn hat er sich ohne jede fremde Anleitung zu einem geschickten Mechaniker ausgebildet. Er verdient Bewunderung, obgleich seine Phantasie der Anordnung und Ausführung seiner Werke oft sonderbare Züge verliehen hat. Schon als zehnjähriger Bauernjunge hat er eine funktionstüchtige Sonnenuhr gebaut. Später erlernte er zuerst das Schusterhandwerk, verlegte sich dann aber doch auf die Uhrmacherkunst. Dabei vereinigte er seine beiden Talente auf wundersame Weise: So hat er dem vorigen Kurfürsten ein Paar Schuhe gemacht, in die Repetieruhren eingebaut waren, wofür er dann zum kurfürstlichen Trabanten ernannt wurde. Unter seinen Werken sind 52 besonders hervorragende Kunstwerke der Feinmechanik. Dazu gehören ein als Türke gekleideter Flötenspieler, eine weibliche Figur, die Orgel spielt, und zwei Hündchen, die sich bewegen und Wasser lassen können. Um 1780 begann er das Modell für eine Maschine zu entwerfen, die mit Windrädern Wasser aus Sumpfgebieten abpumpen und so die Moräste trockenlegen sollte. Solche Mühlen sind in Holland und Holstein nichts Unbekanntes, ob aber seine Maschine in Bayern, wo sie sehr hilfreich und nützlich wäre, fertiggestellt und für brauchbar befunden wurde, das weiß ich nicht. Eines ist aber sicher: Das Talent dieses erfinderischen Mannes hat in München so wenig Aufsehen erregt, daß er, um überhaupt leben zu können – man kann es kaum glauben –, Kaffee ausschenken mußte!
Die Münchner Zeitung erscheint täglich, wird von einem Herrn Drouin verfaßt und vom Buchdrucker Bötter herausgebracht. Daneben erscheint montags, dienstags, donnerstags und freitags ein Blatt von etwa acht Seiten Umfang unter dem Titel Staats-, gelehrte und vermischte Nachrichten. Hierin erfährt man vor allem politische Neuigkeiten. Zweimal in der Woche, nämlich am Mittwoch und am Sonnabend, kommen die Münchener wöchentlichen Nachrichten heraus. Es handelt sich dabei um eine Art Intelligenzblatt mit Nachrichten, die die Stadt betreffen, wie die Ankunft wichtiger Persönlichkeiten, die Geburts- und die Totenlisten. Kennt man dieses Organ, dann versteht man auch folgendes Epigramm, das ich in einer Münchner Zeitung fand:
Faust nimmt die Zeitung her und spricht: ei, seht nur da! Schon wieder London, Haag, Paris, Amerika! Was Henker schert mich all der Bettel!
– Geduld, Herr Faust! das Mittwochsblatt, das nichts aus fremden Ländern hat, Bringt was für Sie – den Totenzettel!
Mit dem sehr viel bekannteren Münchner Intelligenzblatt zum Dienst der Stadt- und Landwirtschaft, des Nahrungsstandes und der Handlung, einer Wochenschrift von etwa einem Bogen Umfang, darf man das oben genannte Blatt allerdings nicht verwechseln. Das Münchner Intelligenzblatt wird von Hofkammerrat Kohlbrenner seit 1776 herausgebracht und enthält vor allem statistische Nachrichten aus Bayern, aber auch, und das ist bemerkenswert, Auszüge aus protestantischen Büchern.
Außerdem erscheinen monatlich die Bayerischen Beiträge zur schönen und nützlichen Literatur, die verschiedene für Bayern wichtige Beiträge enthalten. Sie wurden von 1779 bis 1782 von Herrn Westenrieder herausgegeben und 1783 durch Westenrieders Jahrbuch der Menschengeschichte ersetzt, wovon allerdings nur ein Band in zwei Teilen herausgekommen ist. Als weitere Publikation wären noch die Annalen der bayerischen Literatur von 1778 bis 1782 in drei Bänden zu erwähnen. Hierin werden nicht nur für den angegebenen Zeitraum Neuerscheinungen bayerischer Autoren besprochen, sondern auch allgemeinere wichtige literarische Nachrichten. Daneben gibt es noch den Pfalzbayerischen literarischen Almanach und den Pfalzbayerischen Hof- und Staatskalender, der immer noch jährlich erscheint.
Für den Vertrieb sorgen insgesamt drei Buchhandlungen, und gedruckt werden sämtliche Erscheinungen in drei Druckereien. Papier wird in Bayern eigentlich ziemlich viel gemacht, doch es ist meist grau und sehr dick. Es scheint, daß man in den dortigen Papiermühlen keinen Holländer hat oder ihn nicht recht zu gebrauchen weiß. Man klagt, wie an anderen Orten auch, vor allem über den Mangel an Lumpen, was sich aber in den nächsten zehn bis zwölf Jahren nicht ändern wird.
Ich wußte zwar, daß Bayern einige verdiente Gelehrte hat, wußte aber ebensogut, wieviel Macht dort die stumpfe Bigotterie und der Aberglaube noch haben. Als ich nun nach München kam, war ich auf eine sehr angenehme Weise überrascht, denn ich fand Aufklärung und Gedankenfreiheit sehr viel weiter verbreitet, als ich mir vorgestellt hatte. So ist es doch eine Untersuchung wert, herauszufinden, wer hier den Samen des Guten geweckt und den vormals so dürren Boden für seine Entfaltung vorbereitet hat. Ich glaube, Bayern hat dies vor allem dem berühmten Ickstadt zu verdanken, einem Manne von großen Talenten, der Weltmann und Gelehrter zugleich war. Bei einem Englandaufenthalt in seiner Jugendzeit hatte er die Liebe zu unbefangener und von religiösen Vorurteilen freier Denkart entdeckt. In Marburg erwarb er sich als ein Schüler Wolfs gründliche philosophische Kenntnisse, und Graf Stadion, ein Mann, dessen Verdienste noch nicht recht gewürdigt werden, brachte ihn endlich nach München. Hier war Ickstadt zunächst Lehrer und Erzieher des Kurprinzen und späteren Kurfürsten Maximilian Joseph. Er bemühte sich, dessen Geist, der durch die übliche Erziehung sehr eingeengt war, zu erweitern, und legte den Grundstein für die Achtung der Gelehrsamkeit und der freien Denkart und für die tolerante Gesinnung, die der Kurfürst während seiner Regierungszeit bewies. Ickstadt machte die bedeutendsten Werke protestantischer Autoren schon vor 40 Jahren in Bayern bekannt und gab seinen Studenten an der Universität Ingolstadt die Werke eines Leibniz, eines Wolf, Pufendorf, Grotius und anderer in die Hand. Überzeugt davon, daß die Lektüre nützlicher Werke den Geist am sichersten befreit, bewog er den Kurfürsten, eine sehr milde Zensur einzuführen. So konnten in Bayern zu einer Zeit, da sie in den übrigen katholischen Provinzen noch gänzlich unbekannt waren, fast alle protestantischen Bücher gelesen werden. Ein Grund, warum strenge Zensurmaßnahmen auch sonst nur schwer durchzuführen gewesen wären, liegt darin, daß protestantische Buchhändler aus Augsburg und Nürnberg seit langem die Münchner Messen besuchten und hier protestantische Bücher schon immer früher zu kaufen waren als z.B. in Wien.
Unter dieser Regierung wurde auch die Akademie der Wissenschaften zu München im Jahre 1759 gestiftet und zwar hauptsächlich aufgrund der Bemühungen des Geheimrates von Osterwald. Auch er hatte unter Wolf studiert, und so wurden Philosophie und Geschichte, die beiden sichersten Führerinnen des menschlichen Geistes, als Ziele der Bemühungen der Akademie festgesetzt; später kamen noch die schönen Wissenschaften hinzu, da sie ja ebenfalls den Geist beflügeln. Die Akademie hat auf dem Gebiet der bayerischen Geschichte sehr viele Entdeckungen gemacht und wichtige Erläuterungen dazu geliefert. Die Bände der historischen Abhandlungen geben deutliche Beweise dafür. Sie sind gesammelt in den Monumenta Boica und enthalten eine große Zahl an wichtigen Urkunden und sehr viele Abbildungen.
Die philosophische Klasse der Akademie bekam schon wenige Jahre nach ihrer Einrichtung Gelegenheit, einen für Bayern und für die Aufklärung in diesem Lande wichtigen Schritt zu tun: Don Ferdinand Sterzinger griff in einer viel beachteten Rede, die er 1766 vor der Akademie hielt, den Aberglauben und die Hexerei scharf an. Die Pfaffen, die sich die Einkünfte, die sie von ihren Zaubersegen und Exorzisationen hatten, nicht nehmen lassen wollten, machten einen gewaltigen Lärm. Doch unter dem Schutz der Akademie durften die Streiter gegen den Aberglauben viel freier schreiben, als ihnen sonst möglich gewesen wäre. Die Streitigkeiten um diese Rede bewirkten bei vielen ein gründliches Nachdenken über die Falschheit und Nichtigkeit abergläubischer Grillen.
Kurz vor meiner Ankunft in München hatte die Akademie beschlossen, auch fremden Gelehrten, die sich dort eine Zeitlang aufhielten, den Zutritt zu ihren Versammlungen zu gestatten. Ich war der erste, der diese Erlaubnis erhielt. Gleichzeitig widerfuhr mir die ganz unerwartete Ehre, daß ich in einer Sitzung als Ehrenmitglied in die Akademie aufgenommen wurde. Ich konnte, unvorbereitet, wie ich war, meine Dankbarkeit nur sehr schwach ausdrücken, aber ich empfinde es zutiefst als eine Ehre, Mitglied einer Gesellschaft so würdiger Gelehrter zu sein.
Die Akademie ist in einem ansehnlichen, großen, nicht völlig ausgebauten Haus untergebracht. Es steht in der Schwabinger Straße und gehörte früher einer Gräfin Fugger, einer Mätresse des Kurfürsten Karl Albert. So heißt das Gebäude auch heute noch Fuggerbau. Dort besichtigte ich das Naturalienkabinett der Akademie, ihre Sammlung physikalischer, optischer und anderer Instrumente und eine umfangreiche Sammlung mechanischer Modelle. Unter diesen blieb mir besonders ein Saal voller Arbeiten bayerischer Erfinder in Erinnerung.
Im gleichen Gebäude konnte ich damals noch die kurfürstliche Hofbibliothek besichtigen, die inzwischen in den Studentensaal des ehemaligen Jesuitenkollegiums gebracht wurde. Die eigentliche kurfürstliche Bibliothek soll ungefähr 80 000 Bände enthalten, die ihr einverleibte Jesuitenbibliothek, die damals noch gesondert stand, etwa 23 000 Bände. Sehr viele Bücher sind dadurch doppelt vorhanden, um so mehr vermißte ich neuere Werke. Dafür gibt es über 500 wertvolle Handschriften und Erstdrucke, die gleich hoch geschätzt werden wie die Handschriften. Unter anderem sah ich eine alte Ausgabe von Wolfram von Eschenbachs Gedichten von 1477 und den Gral in 41 Kapiteln, gleichfalls von 1477.
Eigentlich sollte die Hofbibliothek eine öffentliche Bibliothek werden, was aber bisher noch nicht geschehen ist, und so hat München keine einzige öffentliche Bibliothek.
Deutsche Schauspiele werden sonntags, dienstags und freitags im alten Opernhaus aufgeführt. Der Direktor, Herr Marchand, ist ein großer starker Mann, der sehr laut deklamiert, aber auf der Bühne eine gute Figur macht. Ich sah eine Aufführung des Adjutanten von Brömel, und mir fiel dabei auf, welche enormen Schwierigkeiten das deutsche Schauspiel allein dadurch hat, daß bei Stücken, die in Norddeutschland geschrieben wurden, und besonders bei Lustspielen, die sich auf lokale Sitten beziehen, die Schauspieler wie auch die Zuschauer viele Stellen gar nicht verstehen können. Umgekehrt wird dasselbe gelten.
Das deutsche Theater in München besteht noch nicht sehr lange und ist doch schon auf verschiedene Art berühmt geworden. So besaß es schon vor zehn Jahren eine Roeseul. In jüngerer Zeit sind verschiedene patriotische Schauspiele hier in München entstanden, die trotz ihrer etwas groben Anlage größte Aufmerksamkeit verdienen. So sind Agnes Bernauerin und Otto von Wittelsbach in ganz Deutschland berühmt, und man kann behaupten, daß die Schaubühne des benachbarten Wien seit beinahe 40 Jahren kein Stück geliefert hat, das sich nur annähernd mit diesen beiden Werken messen könnte. Der Stoff solcher patriotischen Dramen ist aus der bayerischen Geschichte genommen, und sie scheinen so recht für Bayern gemacht zu sein. Das Publikum liebt auch eher Stücke, in denen große Charaktere auftreten und strenge Sitten geschildert werden, als Wiener Piecen oder Übersetzungen französischer Theaterstücke. Desto mehr wunderte ich mich, als 1781, nach zwei Aufführungen des Otto von Witteisbach, alle vaterländischen Stücke verboten wurden. Diese Maßnahme scheint mir sehr widersprüchlich zu sein. Wäre es denn nicht sinnvoller, die Schriftsteller zu ermuntern, solche patriotischen Schauspiele zu verfassen? Der edle Geist der Freiheit würde der bayerischen Nation doch nur von Vorteil sein. Vermutlich war es aber gerade dieser Geist der Freiheit, der vielen Mächtigen nicht gefiel und dieses Verbot bewirkte. Wenn ich mich nicht irre, so war es gerade das Schauspiel Ludwig der Bayer, das man wegen der darin enthaltenen Gesinnung nicht aufführen lassen wollte. In diesem Stück weissagt ein Hellseher namens Abdenago dem Kaiser Ludwig folgendes:
Siehst brennen dort den Vatikan in lichterlohen Flammen? Der Gallier facht die Flamme an, zu fluchen deinem Namen. Die Klerisei spricht: Amen!
Wirst rufen zu Jehowa laut, Anbeten sein Gericht. Er wird verzeihen; – doch seine Braut, Die Kirch', verzeihet nicht Dem, der ihr widerspricht!
Welche große und wichtige Wahrheit, die vor, zu und nach Kaiser Ludwigs Zeiten die Geschichte aller Jahrhunderte bestätigte, liegt doch in den drei letzten Versen. Selbst wenn in diesem Schauspiel nur diese Zeilen den Mächtigen ein Dorn im Auge sein könnten, ist doch leicht einzusehen, daß in einem Land, in dem der Klerus so viel Macht hat, eine solche Wahrheit nicht fortgepflanzt werden kann und daß man, um Freimütigkeit zu unterdrücken, lieber alle vaterländischen Schauspiele verboten hat. Alle mönchischen Albernheiten dagegen sind erlaubt, wenn z.B. die Augustiner ihre Fastnachtsspiele oder die Kinder des Waisenhauses geistliche Singspiele wie Die vom Himmel gesegnete Liebe zwischen Isaak und Rebecca aufführen. Ist das nicht allerliebst? Ein wirklich beeindruckendes Erlebnis war für mich das Spiel des kurfürstlichen Orchesters. Die berühmte Mannheimer Kapelle ist ja bekanntlich jetzt in München, und ihr hoher, scharfer Ton, wie auch die unglaubliche Sicherheit in der Handhabung des Bogens, macht dieses Orchester in ganz Deutschland unverkennbar. Ich gestehe, obwohl ich vom Mannheimer Ensemble eine sehr hohe Meinung hatte, so übertraf doch das Spiel der kurfürstlichen Kapelle in München alle meine Erwartungen. Ich wußte bei den ersten 32 Takten des Allegros gar nicht, wie mir geschah.
Gleich beim Hofgarten wird eine eigene Galerie gebaut, in der einmal alle Gemälde aus München sowie die aus Nymphenburg und Schleisheim ausgestellt werden sollen. Die Sammlung wird dann also mehr als 800 Bilder enthalten, worunter einige ganz vorzügliche sind. Bei meinem Besuch lagen die meisten Bilder in einem großen Saal noch übereinandergestapelt, und viele Stücke wurden gerade gereinigt. So konnten wir wenig sehen, doch bemühte sich der Galerieinspektor, selbst ein begabter Künstler, in der liebenswürdigsten Weise, uns wenigstens einige der besten Stücke zu zeigen. Besondere Beachtung verdienen darunter die folgenden Werke:
Eine Maria mit dem toten Jesus im Arm soll von Raphael sein. Ich bin kein großer Kenner, doch nach dem zu urteilen, was ich von Raphael in Dresden und Wien gesehen habe, bezweifle ich, daß das Münchner Bild von ihm stammt. Da aber anscheinend jede Galerie ihren Raphael haben muß, so will ich nicht weiter widersprechen. Von wem auch immer dieses Bild gemalt worden sein mag, so ist es doch eines der vortrefflichsten Bilder. Der innige Schmerz in dem an die Wangen des Toten geschmiegten Gesicht der Maria ist unnachahmlich ausgedrückt, und auch die Farbgebung ist sehr naturgetreu. Der »Kindermord zu Bethlehem« von Rubens ist ein Stück mit sehr vielen Figuren und zeugt von großer Kunst, sowohl in der Komposition als auch im Detail. Dennoch mußte ich den Blick davon abwenden, und meines Erachtens sollte ein so gräßlicher Vorgang nicht gemalt werden. Das Schreckliche wie auch das Erhabene können sehr wohl zum Gegenstand der Künste werden, aber nicht das Ekelhafte und Gräßliche, denn Menschlichkeit und moralisches Gefühl sollten den Künstler bei seiner Arbeit leiten. Rubens hat in der Wahl seiner Themen sehr oft gefehlt, wenn er z.B. den dümmsten Mönchsaberglauben oder die abgeschmacktesten Jesuitenlegenden durch seine Kunst ehrwürdig darstellt. Stellt ein großer Künstler, so wie hier, gräßlichen und kalten Mord dar, ohne den Betrachter durch den Gegensatz menschlicher Empfindungen zu beruhigen, so schwindet leicht die Hochachtung für ihn. Doch Rubens' »Frau mit dem Kinde« versöhnte mich wieder mit dem Künstler. Dieses Bild ist so voll ruhiger Anmut, voll süßem Ausdruck häuslicher Glückseligkeit, was man bei Rubens seltener findet als erhabene oder erschreckende Inhalte. Besonders beeindruckt haben mich außerdem noch zwei sehr schöne große Gemälde von Domenichino und einige ganz ausgezeichnete Werke von van Dyck.
Der Katholizismus ist in München so tief verwurzelt wie in Wien, ja, ich meine sogar, noch tiefer, denn was in Wien an äußerlichen Mißbräuchen wenigstens abgestellt wurde, das ist in München noch voll im Schwange. Nur die Karfreitagsprozession ist ganz abgeschafft worden, und bei der Fronleichnamsprozession werden einige ganz tolle Dinge nicht mehr geduldet; so sah man am Karfreitag früher immer einen vermummten Herrgott und vermummte Juden, außerdem eine Menge Kerle, die sich geißelten und große Kreuze schleppten. Bei der Fronleichnamsprozession führte man sonst immer große papierne Figuren mit, Drachen z.B., die an die 40 Fuß hoch waren und deren langen Schwanz immer ein als Teufel verkleideter Bursche nachtragen mußte. Man sah aber auch noch andere Ungeheuer, die von Kerlen, die sich darunter versteckten, bewegt wurden und dabei allerhand lächerliche Figuren machten. Dazu kamen jede Menge Engel und Ritter, z.B. der Erzengel Michael in einem silbernen Harnisch und zu Pferde, begleitet von Pauken und Trompeten. Luther und Calvin verspottete man durch eine gehässige und lächerliche Darstellung. Auf einer langen Reihe von Tragegestellen waren ganze Legenden und anderes dummes Zeug dargestellt.
Bringt man in München abends das Venerabile zu einem Kranken, so wird aus den Fenstern aller am Weg liegenden Häuser aus Andacht ein Leuchter mit einer Kerze herausgehalten, solange das Venerabile in der Nähe ist. Dies ergibt eine possierliche, fortlaufende Beleuchtung. Wird jemand am Fastnachtsdienstag, wo in München wie in allen katholischen Ländern wacker getrunken und gegessen wird, nach Mitternacht noch im Wirtshaus angetroffen, so bringt man ihn auf die Wache, denn Schlag zwölf muß das liederliche Leben aufhören und die Andacht beginnen.
Am ersten Tag unseres Münchenaufenthaltes zog am Himmel ein bedrohliches Gewitter auf, und sofort wurde in jedem Haus ununterbrochen mit einem geweihten Lorettoglöckchen geläutet. Ich wußte nicht, was der viele Glockenklang bedeutete, und glaubte, in der Nähe führe man eine große Zahl beladener Esel vorbei. Da lachte man mich aus und erklärte mir, daß, soweit der Schall des Glöckchens reiche, der Blitz nicht einschlagen könne. Geschehe dies aber dennoch, so sei es nur ein Zeichen fehlendes Glaubens und Gottvertrauens der betroffenen Familie. Ich besitze die Münchnerische Andachtsordnung oder das Verzeichnis der Gottesdienste und Andachten, so wie sie in den Kirchen das ganze Jahr durch gehalten werden. Sie ist elf kleingedruckte Bogen stark, und man ist wirklich erstaunt, daß es kaum einen Tag im Jahr gibt, an dem nicht mit unnützen Andachten, Ablässen, Litaneien, Vespern und ähnlichem die Zeit vergeudet wird. Der Hof ist so devot, daß er in der Kapelle zu Loretto sogar auf eigene Kosten zwei Kapellane unterhält, wie ich aus dem Hof- und Staatskalender für 1785 ersehen kann.
Im Inneren von Sankt Michael
In Bayern und der Oberpfalz gibt es 28709 Kirchen und Kapellen, eine Zahl, die in gar keinem Verhältnis zur Anzahl der Ortschaften und der Bevölkerungszahl steht, denn nach Einzingers Abriß des heutigen Kurfürstentums Bayern gibt es im Lande – ohne die Pfalz – 35 Städte, 94 Flecken, 1478 Dörfer und 4720 Schlösser oder Adelssitze. Alle Einwohner aber ergeben sich in übertriebener Weise mechanisch ablaufenden Andachtsübungen. Bruderschaften, Prozessionen, Wallfahrten, Litaneien, Gnadenbilder, Amulette, Ignazbleche, Skapuliere, geweihte Kerzen und was der Fratzen mehr sind, werden von allen Ständen hoch geehrt. So konnte Crammer bei der Ankunft des Papstes Pius VI. zu Recht loben, daß in alle Teile Deutschlands Ketzereien sich eingeschlichen hätten, aber nie in das allzeit katholische Bayern. Das Land hat aber nicht nur allzeit den katholischen Glauben behalten, sondern, was viel schlimmer ist, allzeit jeden katholischen Aberglauben wuchern lassen.
Und doch fingen schon vor mehr als zwölf Jahren verschiedene Patrioten an, das Übel einzusehen, und wollten ihm auch abhelfen. So wurden wichtige Schritte zur Beseitigung des Aberglaubens unternommen, und angesichts der zahlreichen Hindernisse für ein solches Unternehmen sind ihre Bemühungen bewundernswert. So hat Bayern den Ruhm, daß hier unter allen katholischen Staaten in Deutschland die Aufklärung zuerst Fuß fassen konnte. Doch seit dem Papstbesuch ist die Förderung der Aufklärung eher rückläufig, und der Aberglaube nimmt wieder zu. Dafür kann ich ein Paradebeispiel nennen.
Im Januar 1784 verwundete ein tollwutverdächtiger Hund in den Straßen Münchens insgesamt 13 Personen. Die Geschädigten wurden alle aufs Rathaus befohlen, wo ihnen der Vizeoberjägermeister bekanntgab, daß sie nach St. Hubert im österreichischen Geldern gebracht würden, um dort durch die Wunderkraft des Heiligen, dessen Leichnam dort begraben liege, vor dem Ausbruch der Tollwut bewahrt zu werden. Schließlich ermahnte er sie noch, ein Vaterunser und ein Ave Maria zu Ehren des Heiligen zu beten. Man ließ die Leute tatsächlich ohne jede ärztliche Hilfe, ja, einem Garnisonsarzt, der schon angefangen hatte, einen verletzten Soldaten zu kurieren, wurde dies strengstens untersagt, da sich darin ein Mißtrauen in die göttliche Allmacht ausdrücke. Sämtliche von dem Hund verwundeten Personen mußten bei größter Kälte den weiten Weg antreten. Drei der Unglücklichen starben schon unterwegs, ob an den Folgen der Verletzung oder an einer anderen Krankheit, hat man nicht erfahren. Dabei war es nicht einmal sicher, ob der Hund, den man mit 250 anderen, ganz friedlichen Artgenossen sogleich erschossen hatte, wirklich tollwütig gewesen war. Das letztere ist schon allein deshalb sehr unwahrscheinlich, weil die gebissenen Personen trotz ihrer Verletzungen noch Kraft und Gesundheit genug hatten, um eine Reise von mehr als 100 Meilen durchzustehen. Die zehn, die lebend in St. Hubert anlangten, mußten sogleich beichten, das Abendmahl empfangen und durften außerdem neun Tage lang nur kaltes Schweinefleisch und geweihtes Wasser zu sich nehmen. Dann öffnete man ihnen ein wenig die Kopfhaut und tat eine Reliquie von der Stola des Heiligen hinein, die einwachsen sollte. Im April kamen sie schließlich nach München zurück und sollten fortan lebendige Zeugen für die Wunderkraft des heiligen Hubertus sein. Die ganze Geschichte klingt so unglaublich, daß man sie, wäre sie nicht in öffentlichen Zeitungen berichtet und von zuverlässigen Leuten bestätigt worden, für baren Unsinn halten müßte.
Ich glaube, kein einziges Land in Deutschland wird vom Klerus so sehr bevormundet wie Bayern, das noch nicht einmal einen einzigen bayerischen Bischof hat. Die Bischöfe von Salzburg, Freising, Regensburg, Eichstätt und Augsburg teilen sich die geistliche Gerichtsbarkeit in Bayern. Zu dieser ausländischen Macht gesellt sich noch eine sehr starke bayerische Geistlichkeit. Sie besitzt das Mark des Landes und hat zusammengenommen beinahe so viele Ausgaben wie der Landesherr. Der Fonds der sogenannten mildtätigen Stiftungen soll 60 Millionen Gulden betragen. So haben die Mönche und die Jesuiten, die keine Mönche sein wollen, aber noch viel schlimmer als diese sind, das Land unter sich aufgeteilt. Alles in allem stehen 180 Männer- und Frauenklöster auf bayerischem Boden, darunter sind 80 Prälaturen und ansehnliche Klöster. Was für prächtige und weitläufige Gebäude dies sind, und wie reich die Einkünfte der Prälaten, Äbte und Pröpste sein müssen, kann man leicht erahnen, wenn man nur einmal die Abbildungen der Klöster und Prälaturen betrachtet, die die Akademie der Wissenschaften zu München hat stechen lassen und jedem Bande ihrer Monumenta Boica vorangestellt hat. Kein regierender Fürst müßte sich schämen, darin zu wohnen.
Die Jesuiten haben, auch wenn sie offiziell als aufgehoben gelten, in allen katholischen Ländern nichts oder doch nur wenig verloren, am allerwenigsten in Bayern. Sie haben dort bei Hofe und auf dem Lande noch immer den allergrößten Einfluß, und im Grunde geschieht nichts, was sie nicht wollen.
Kommt man von Wien nach München, so fällt jedem, der auch nur ein klein wenig aufmerksam beobachtet, ein deutlicher Kontrast in sehr vielen Dingen auf. In anderen Bereichen gibt es hingegen auch recht viele Gemeinsamkeiten, schließlich beherrschten vor 900 Jahren die Bayern Österreich. Erst seit etwa 200 Jahren hat sich das Verhältnis umgekehrt, und Bayern wurde von dem beständig mächtiger werdenden Österreich immer abhängiger. Die beiden Nationen haben außerdem gemeinsame kulturelle Quellen, die gleiche Mundart und dieselbe Religion. Ungeachtet der unübersehbaren Gemeinsamkeiten bleibt der Gegensatz in einzelnen Bereichen immer deutlich erkennbar, oft schon auf den ersten Blick.
Kommt man z. B. aus dem Menschengedränge Wiens, so fällt sofort auf, daß in München alles sehr viel stiller zugeht. Auf den Gassen ist mehr Platz und in den Häusern kein solches Gedränge hin- und hergehender Besucher. In den Münchner Straßen ist recht wenig Verkehr, während einem in Wien das Rasseln der Räder gar nicht mehr aus den Ohren geht. Auch die Einwohner beider Städte unterscheiden sich allein schon in ihrem Äußeren. Der Bayer hat im ganzen kein so oberflächliches Wesen wie der Österreicher, ist nicht so aufgeregt in den Bewegungen und hat einen bedächtigeren Gang mit festem Tritt. Man begegnet in Bayern vielen Menschen von untersetzter Statur. Viele sind stark, breitschultrig und nur selten schlank. Im einfachen Volk entdeckte ich viele runde Köpfe und Bierwänste; aber in diesen dicken Körpern steckt Kraft. Das erkennt man sofort am Gang, der selten watschelnd oder schwankend ist, auch wenn der Körper unbeholfen wirkt. Selbst der gemeine Mann sieht jedem keck in die Augen. Doch sein Blick wäre viel angenehmer, hätte nicht die stumpfe Bigotterie, die seit 100 und mehr Jahren in Bayern herrscht, unauslöschlich einen gewissen stumpfen und gedankenlosen Zug über alle Gesichter verbreitet. Bei gebildeten und gut erzogenen Leuten ist dies zwar etwas gemildert, doch bleibt der Charakterzug unverkennbar. Die jungen Leute geringeren Standes sehen sehr gesund und kräftig aus, was besonders bei den Mädchen ins Auge fällt. Hier verknüpft sich eine innere Kraft mit Schönheit zu einem sehr angenehmen Gesamteindruck.
Heiligenbildnis für die Gebärende
Der Charakter der bayerischen Nation ist in verschiedenen Schriften mit guten und mit schlechten Zügen beschrieben worden. Selbst der Verfasser der Briefe eines Franzosen urteilt nicht eben vorteilhaft. Anselmus Rabiosus sagt sogar: Der Bayer ist falsch, grausam, abergläubisch und verwegen