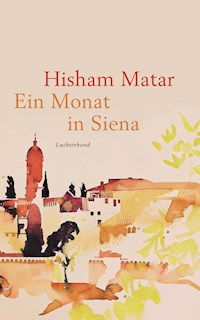2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein herausragender Roman über die Folgen von Willkür und Gewalt – mit autobiographischem Hintergrund.
Schlimmer als der Tod ist das spurlose Verschwinden eines geliebten Menschen. Hisham Matar, dessen Vater vor zwei Jahrzehnten von libyschen Sicherheitskräften entführt wurde, erzählt in seinem neuen Roman von der Verschleppung eines arabischen Dissidenten – und wie diese Entführung das Leben derjenigen, die zurückbleiben, für immer überschattet und verändert. »›Ich glaube nicht, dass mein Vater tot ist, aber ich glaube auch nicht, dass er noch lebt.‹ Diesen Satz aus dem Roman hat auch Hisham Matar selbst über sein Leben und seine Vater-Hoffnung einmal gesagt. Von dieser Unmöglichkeit handelt dieses großartige Buch .« (Volker Weidermann, FAS)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Seit dem Tod seiner Mutter lebt der zwölfjährige Nuri el-Alfi mit seinem Vater Kamal zurückgezogen in Kairo. Im Sommer verbringen die beiden einen Urlaub am Meer. Und hier entdeckt Nuri Mona, die junge Frau im gelben Badeanzug, die ihn vollkommen betört. Doch Mona verliebt sich in Nuris Vater, und als sie Kamal heiratet, beginnt für Nuri eine schwere Zeit. Oft wünscht er sich seinen Vater weit weg – er ahnt nicht, dass sein Wunsch auf eine Weise in Erfüllung gehen wird, die sein Leben für immer verändert. Denn nur zwei Jahre später wird Kamal Pascha el-Alfi, der von Ägypten aus gegen die eigene Regierung gearbeitet hat, von Unbekannten aus einer Genfer Wohnung verschleppt, und von da an wird Nuri kein Lebenszeichen mehr von ihm vernehmen …
HISHAM MATAR wurde 1970 in New York City geboren; seine Eltern stammen aus Libyen. Er wuchs in Tripolis und, nach der Emigration der Familie, in Kairo auf. Seit 1986 lebt Hisham Matar in London. Hisham Matars Debüt »Im Land der Männer«, das in 22 Sprachen übersetzt ist, wurde für die Shortlist des Man Booker Prize 2006 und des Guardian First Book Award nominiert. Hisham Matar wurde ausgezeichnet mit dem Royal Society of Literature Ondaatje Prize, dem Commonwealth Writers’ Prize, dem Premio Vallombrosa Gregor von Rezzori, dem Premio Internazionale Flaiano und dem Arab American Book Award.
Hisham Matar
Geschichte eines Verschwindens
Roman
Aus dem Englischen von Werner Löcher-Lawrence
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel
»Anatomy of a Disappearance« bei Viking, London.
btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, München
Copyright © der Originalausgabe 2011 Hisham Matar
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2011
Luchterhand Literaturverlag, München, in der
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Covergestaltung: semper smile München
Covermotiv: © plainpicture/whatapicture
CP · Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-31233-6V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Besuchen Sie auch unseren LiteraturBlog www.transatlantik.de
Für J. H. M.
Kapitel eins
Es gibt Zeiten, da lastet die Abwesenheit meines Vaters auf mir, als säße mir ein Kind auf der Brust. Dann wieder kann ich mich kaum an die Züge seines Gesichts erinnern und muss die Fotos hervorholen, die ich in einem alten Umschlag in der Schublade meines Nachttischs aufbewahre. Seit seinem plötzlichen, geheimnisvollen Verschwinden hat es nicht einen Tag gegeben, an dem ich nicht nach ihm gesucht hätte, selbst an den unwahrscheinlichsten Orten. Alles und jeder, die Existenz an sich, kann ihn heraufbeschwören, birgt Ähnlichkeiten. Vielleicht liegt hier die Wurzel des kurzen und fast schon archaischen Wortes »Elegie«.
Ich sehe ihn nicht im Spiegel, fühle aber, wie er leicht die Haltung verändert, als wände er sich in einem Hemd, das ihm nicht ganz passt. Mein Vater hatte immer schon etwas Geheimnisvolles, selbst als er noch da war. Ich kann mir fast vorstellen, wie es hätte sein können, ihm als Gleicher, als Freund zu begegnen, aber eben nur fast.
Mein Vater verschwand 1972, zu Beginn meiner Weihnachtsferien. Da war ich vierzehn. Mona und ich wohnten im Montreux Palace und frühstückten gerade, ich mit einem großen, leuchtenden Glas Orangensaft vor mir, sie mit ihrem dampfenden schwarzen Tee. Von der Terrasse aus sahen wir auf die stahlblaue Fläche des Genfer Sees hinaus, an dessen anderem Ende, hinter Bergen und Buchten, die bereits leere Stadt Genf lag. Ich beobachtete die Gleitschirmflieger über dem stillen See, und Mona blätterte durch La Tribune de Genève, als sie plötzlich die Hand an den Mund hob und zu zittern begann.
Minuten später saßen wir im Zug, redeten kaum und reichten die Zeitung hin und her.
Auf der Polizeiwache bekamen wir die wenigen persönlichen Gegenstände von ihm ausgehändigt, die auf dem Nachttisch gelegen hatten. Als ich den Plastikbeutel aufriss, roch ich neben dem Tabak und dem Feuerstein des Feuerzeugs auch ihn. Die Uhr, die mit im Beutel lag, trage ich heute noch an meinem Handgelenk, und wenn ich die Unterseite des Lederarmbands gegen meine Nasenlöcher drücke, kann ich immer noch einen Hauch von ihm ausmachen.
Ich frage mich, wie sich meine Geschichte entwickelt hätte, wären Monas Hände nicht so schön und ihre Fingerspitzen nicht so weich gewesen. Noch so viele Jahre später höre ich meinen kindlichen Protest: »Ich habe sie als Erster gesehen!«, den ich jedes Mal nur mühsam herunterschlucken konnte, wenn Vater eine seiner besitzergreifenden Gesten sehen ließ – wenn seine Finger in ihrem Haar versanken oder er mit der Geistesabwesenheit dessen, der sich mitten im Satz ans Ohrläppchen greift, seine Hand auf ihren Schenkel legte. Er hatte es sich angewöhnt, wie ein Westeuropäer in aller Öffentlichkeit Händchen mit ihr zu halten, sie zu küssen und zu umarmen. Aber mich täuschte er damit nicht: Wie ein schlechter Schauspieler war er sich unsicher. Wenn er merkte, dass ich ihn beobachtete, wandte er den Blick ab, und ich schwöre, ich konnte sehen, wie ihm Farbe in die Wangen stieg. Eine dunkle Zärtlichkeit überkommt mich, wenn ich daran denke, wie sehr er sich bemühte; auch heute noch sehne ich mich so sehr nach einem unkomplizierten Einverständnis mit ihm. Unserer Beziehung fehlte, was ich immer für möglich gehalten habe, wäre uns genug Zeit geblieben (und vielleicht hätte er auch sehen müssen, wie ich zum Mann und selbst zum Vater wurde): emotionale Offenheit und Leichtigkeit. Tatsächlich aber sehe ich ihn immer noch mit der Distanz, die bis zuletzt unser Miteinander bestimmte und jene stumme Kluft zwischen uns begründete.
Kapitel zwei
Wir lernten Mona im Magda Marina kennen, einem kleinen Hotel in Agami, gleich bei Alexandria. Obwohl es direkt am Strand lag, gingen wir nie im Meer baden, und ich wollte auch keine Sandburgen bauen. Wie fast alle übrigen Gäste begnügten wir uns mit den kleineren Freuden des geschützt liegenden Swimmingpools. Unsere in Betonquadern untergebrachten Zimmer schirmten uns von der Welt ab. Man hörte zwar, wie die Wellen, einem schnarchenden Wachhund gleich, träge auf den Strand schlugen, entdeckte aber nur selten ein schmales Stück Meerblau.
Vater war jetzt den zweiten Sommer mit mir hier, seit Mutter gestorben war.
Als sie noch lebte, waren wir nie an Orte wie diesen gekommen. Sie mochte die Hitze nicht. Ich habe sie nie in einem Badeanzug erlebt oder gesehen, dass sie sich der Sonne ergab, die Augen schloss und ihr das Gesicht zuwandte. Sobald der Kairoer Frühling nahte, machte sie sich an die Planung unserer Sommerfluchten. Einmal übersommerten wir hoch oben in den Schweizer Alpen, wo sich mein Körper angesichts der steilen Schluchten und Abgründe in der felsigen Erde unwillkürlich versteifte.
Ein anderes Mal brachte sie uns nach Nordland, oben in Nordnorwegen, wo sich die zerklüfteten Gipfel kahler schwarzer Berge hart im unbeweglichen Wasser spiegelten. Wir wohnten in einer Holzhütte, die ganz für sich am Wasser stand und in der braunroten Farbe verwitternden Laubs gestrichen war. Rings um das Dach führte eine Rinne, dick wie ein menschlicher Schenkel. Was immer dort oben vom Himmel fiel, fiel im Überfluss. Nirgends gab es Zeichen menschlichen Lebens. An manchen Nachmittagen verschwand Mutter, und ich verbarg vor Vater, dass ich mein Herz in den Ohren pochen spürte. Ich blieb in meinem Zimmer, bis ich ihre Schritte auf der Veranda und das Schlagen der Küchentür hörte. Einmal stand sie mit schwarzroten Händen da, ein dunkler, kreisförmiger Fleck breitete sich auf dem Vorderteil ihres weiten Pullovers aus. Mit glasklaren, großen, befriedigten Augen hielt sie mir eine Handvoll wilder Beeren entgegen. So reif und süß, wie sie schmeckten, wollten sie für mich nicht zur Landschaft passen.
Eines Abends zog sich dicker Nebel zusammen und verwischte das Züngeln und Seufzen des Nordlichts. Um solche Schrecken schätzen zu können, muss man erwachsen sein. Angstvolle Hitze trat in meine achtjährigen Gedanken, ich rollte mich im Bett ein, versuchte mein Weinen zu ersticken und hoffte auf einen der abendlichen Besuche meiner Mutter, hoffte, dass sie mir einen Kuss auf die Stirn gab und sich neben mich legte. Am Morgen kehrte die unbewegte Welt zurück: das unschuldige Wasser, die grimmigen Berge, der blasse, mit kleinen, neugeborenen Wolken gepunktete Himmel. Ich fand Mutter in der Küche, wo sie Milch warm machte, ein Glas Wasser neben sich auf der weißen Marmorplatte. Nicht Saft, Tee oder Kaffee, Wasser war ihr Morgengetränk. Sie nahm einen Schluck, und wie gewohnt auf Geräuschlosigkeit achtend, erstickte sie das Klacken das Glases auf dem Marmor mit der weichen Spitze des kleinen Fingers. Jedes plötzliche Geräusch irritierte sie, und sie vermochte die Arbeiten eines ganzen Tages in nahezu vollkommener Stille zu verrichten. Ich setzte mich an den Tisch, an dem wir drei uns zu den Mahlzeiten versammelten, wobei Mutter gelegentlich Blicke auf den vierten, leeren Platz warf, als versinnbildliche er ein Fehlen, etwas Verlorenes. Sie schenkte mir die heiße Milch ein. Ein Dampfschwaden wischte durch die Luft und verschwand hinter ihrem Hals.
»Warum machst du so ein langes Gesicht?«, fragte sie.
Sie führte mich auf die Veranda, die auf den See hinausging. Die Luft war so frisch, dass sie mir in die Kehle stach. Schweigend standen wir da. Ich dachte an das, was sie im Auto zu Vater gesagt hatte, als die kahlen Berge Nordlands in den Blick gekommen waren: »Hier hat Gott beschlossen, ein Bildhauer zu sein. Überall sonst hält er sich zurück.«
»Er hält sich zurück?«, hatte Vater fragend wiederholt. »Du redest über ihn, als wäre er ein Freund von dir.«
In jener Zeit glaubte mein Vater nicht an Gott. Mutters Erfahrungen des Göttlichen begegnete er nicht selten mit gereiztem Sarkasmus. Vielleicht hätte ich nicht überrascht sein sollen, als er nach Mutters Tod hin und wieder ein Gebet sprach. Sarkasmus verbirgt oft eine geheime Faszination.
War es die Romantik des Holzfeuers, die Geborgenheit schwerer Mäntel, die meine Mutter in den Norden und die unbevölkerten Gegenden Europas zog? Oder war es die makellose Ruhe, waren es die zwei Wochen, in denen sie mit den einzigen beiden Menschen, die ihr gehörten, zusammen sein konnte, zwei Wochen, die wir hauptsächlich drinnen verbrachten, geschützt und verschanzt? Heute denke ich an diese Urlaube, wohin sie uns auch führten, als Reisen in ein einziges Land, Mutters Land, und die Stille war Mutters Melancholie. Es gab Augenblicke, in denen ihr Unglück so elementar schien wie klares Wasser.
Nach ihrem Tod wurde bald offenbar, dass Vater in den zwei freien Wochen, die er sich im Sommer genehmigte, am liebsten immer schon von früh bis spät in der Sonne hätte liegen wollen. So wurde das Magda Marina der Ort, an dem wir diese vierzehn Tage verbrachten. Er schien jedoch nicht mehr zu wissen, wie er mit mir umgehen sollte. Mutters Tod hatte ihm alle Gelöstheit genommen, die er seinem einzigen Kind gegenüber je verspürt hatte. Wenn wir uns zum Essen setzten, las er entweder Zeitung oder starrte in die Ferne. Merkte er, dass ich ihn betrachtete, begann er unruhig herumzurutschen oder sah auf die Uhr. Gleich nach dem Essen steckte er sich eine Zigarette an und schnipste nach der Rechnung, ohne sich darum zu kümmern, ob ich schon so weit war.
»Bis später im Zimmer.«
Als Mutter noch lebte, hatte er sich nie so verhalten.
Gingen wir zu dritt in ein Restaurant, setzten sich die beiden mir gegenüber an den Tisch, und unterhielten wir uns, richtete Mutter ihre Beiträge fast immer an mich, ganz so, als wäre ich die Stirnwand eines Squash-Courts. Brachte ihn seine Unruhe dazu, den Entertainer zu geben, beobachtete sie auf ihre unauffällige Weise, wie ich auf seine gezwungene Fröhlichkeit reagierte oder auch auf sein ausgiebiges Schweigen, wenn er den eigenen Auftritt nicht länger ertrug. Ich spürte die Augen meiner Mutter auf mir, während ich verfolgte, wie Vater die anderen Gäste musterte oder aus dem Fenster starrte, hinaus auf eine unbedeutende Straße oder einen Platz, zweifellos tagträumend oder den nächsten Zug seiner geheimen Arbeit planend, von der ich ihn niemals reden hörte. In diesen Momenten hatte ich das Gefühl, als wäre er der Junge, der gezwungen war, sein Essen mit den Erwachsenen einzunehmen. Als wäre er der Sohn und ich der Vater.
Nach Mutters Tod begannen er und ich zwei Junggesellen zu gleichen, die sich aufgrund der äußeren Umstände, vielleicht auch einer Verpflichtung gehorchend, eine Wohnung teilten. Zwischendurch überkam ihn jedoch immer wieder diese zärtliche Zuneigung, impulsiv, zu den unwahrscheinlichsten Gelegenheiten, und er drückte sein Gesicht auf meinen Hals, gab mir schniefend einen Kuss und kitzelte mich mit seinem Schnauzbart. Dann lachten wir, als wäre alles in Ordnung.
Kapitel drei
Es stimmt, mir fiel Mona zuerst auf.
Sie saß auf den Keramikfliesen, die den rechteckigen Swimmingpool des Magda Marina einfassten, und betrachtete ihre Fußsohle. Die Fliesen trugen ein Muster, das die maschinelle Kopie eines Wandmosaiks der Alhambra war, wie ich Jahre später bei einer Reise nach Granada feststellte. Versonnen fuhr ich mit den Fingerspitzen darüber und gedachte jenes fernen Sommers 1971 in Agami, als ich zwölf gewesen war. Monas Haar war zu einem praktischen Pferdeschwanz gebunden, und sie trug einen unerhört hellgelben Badeanzug, der ihre Haut dunkler und sie selbst jünger erscheinen ließ. Einen Augenblick lang hielt ich sie für ein junges Mädchen. Einen Augenblick lang erinnerte mich der gelbe Stoffstreifen auf ihrem Rücken an das gelbe Krankenhausarmband, das meine Mutter ums Handgelenk getragen hatte. Schwachblau schimmernd spiegelte sich das Licht im Wasser und legte sich auf Monas Körper.
»Dieses Stück Haut ist arabisch, das dort von deiner englischen Mutter«, würde ich sie später necken.
Sie zog ihren Fuß an sich heran, beugte den Kopf vor, und ich sah, wie sich der Grat ihrer Wirbelsäule gegen den gelben Stoff drückte. Denke ich heute daran zurück, bin ich neidisch auf das Selbstvertrauen, mit dem ich mich ihr näherte. Als überquerte ich eine Straße, um einer auf dem Rücken liegenden Schildkröte zu helfen. Diese natürliche Selbstsicherheit hat mich längst verlassen. Während es Vater über die Jahre gelang, den Mantel seiner Befangenheit abzustreifen, wurde meiner umso schwerer.
Ich setzte mich im Schneidersitz vor sie hin und nahm, ohne um Erlaubnis zu fragen, ihren schmerzenden Fuß auf meinen Schoß. Nacheinander inspizierte ich jeden einzelnen Zeh. Sie wehrte sich nicht. Und dann fand ich ihn, in der weichen Unterseite eines der Zehen: den braunen Fleck eines Dorns, der sich im rosa Fleisch verlor.
»Letzte Woche«, erklärte ich ihr und drehte den Fuß etwas, um besser heranzukommen, »ist mir das Gleiche passiert. Das Ding hat mich den ganzen Tag über verrückt gemacht, bis ich es nicht mehr ausgehalten habe, und bevor ich ins Bett bin, habe ich ihn rausgeholt.«
Ich bekam den Dorn mit zwei Fingernägeln zu fassen. Sie zuckte zusammen, aber ich ließ ihren Fuß nicht los.
»Er war genau wie der hier«, sagte ich und hielt ihr den Dorn auf der Spitze meines Zeigefingers hin. Unsere Köpfe waren sich jetzt so nahe, dass ich eine Strähne ihres Haars auf der Stirn spürte.
»Danke«, sagte sie in etwas kantigem Arabisch.
Ich konnte sehen, dass sich ihre Schultern gelockert hatten.
»Wie heißt du?«
Es war ein englischer Akzent. Da war ich sicher.
Sie strich mir mit der Hand über die Wange, umfasste mein Kinn und sah mich an. Sie hatte unbeständige Augen, die gleichzeitig braun, grün und silbern schimmerten.
»Nuri«, antwortete ich und wich zurück. »Nuri el-Alfi.«
»Es freut mich, dich kennenzulernen, Nuri el-Alfi«, sagte sie und lächelte auf eine Art, die ich nicht verstand.
Ich ging zurück zu meinem Vater, der sich sonnte. Jetzt hatte er sich auf die Ellbogen gestützt, hielt mir die breite Brust entgegen.
»Wer ist das?«, wollte er wissen und sah zu Mona hinüber.
Ich überlegte, ob ich zurücklaufen und sie nach ihrem Namen fragen sollte, aber sie stand gerade auf, fuhr sich links und rechts mit zwei Fingern unter den Rand des Badeanzugs und zog sich den Stoff über den Po. Ganz schwach war das Muster der Keramikfliesen an einem ihrer Schenkel zu erkennen. Sie wandte sich uns zu, und ich fragte mich, ob sie mich oder Vater ansah oder vielleicht uns beide. Dann ging sie und setzte sich an einen Tisch, auf dem ein Glas Limonade stand. Vater legte sich wieder zurück, die Ellbogen vom Druck gerötet, und schloss die Augen. Die Lippen unter seinem perfekt gestutzten Schnauzbart verzogen sich zu einem eindeutigen Lächeln, wissend, ironisch, als genösse er die eigene Intelligenz, nachdem er ein Rätsel in der Hälfte der dafür zur Verfügung stehenden Zeit gelöst hatte. Sie blickte erneut zu uns herüber, steckte sich eine Zigarette an und tat so, als sähe sie anderswohin. Schließlich schloss sie die Augen vor der Sonne. Ich beobachtete sie ohne alle Zurückhaltung. Ich wollte sie tragen, wie man ein Kleidungsstück trug, mich hinter ihre Rippen schieben, ein Stein in ihrem Mund sein. Ich tat so, als spazierte ich rund um den Pool. Aus allen Winkeln wollte ich sie betrachten. Unversehens öffnete sie die Augen und sah mich an, ohne überrascht zu sein, unbeweglich. Sie trat an den Rand des Pools, steckte einen Fuß ins Wasser, dann den anderen und trippelte davon. Ich sah die nassen Fußspuren wegtrocknen. Das Glas Limonade stand immer noch da, geduldig und voll. Einer der schwitzenden Kellner mit schwarzer Fliege und Weste kam und holte es. Ich bedauerte, nicht schneller gewesen zu sein. Wie wundervoll wäre es gewesen, etwas zu trinken, das für sie gedacht war.
Als ich zurückkam, lag Vater auf dem Bauch, die hölzernen Latten des Liegestuhls hatten ein rotes Streifenmuster auf seinen Rücken gezeichnet.
Den Rest des Morgens tauchte sie nicht wieder auf, und als wir uns zum Mittagessen an unseren Tisch setzten, sah ich, dass auch Vater den Speisesaal absuchte. Immer wenn jemand hereinkam, blickte ich von meinem Teller auf, und Vater musterte mich, als wäre mein Gesicht ein Spiegel. Einmal wandte er den Kopf, um zu sehen, wer hereingekommen war, und ich hatte das Gefühl, ihn in die Irre geführt zu haben.
Nach dem Essen zogen sich die meisten Gäste in ihre Zimmer zurück, um der Sonne zu entgehen. Ein paar Europäer blieben draußen beim Pool liegen, ihre Haut hatte die Farbe von Orangenschalen. Hin und wieder fuhr eine Brise in die Seiten der Bücher und Zeitschriften auf dem Boden neben ihnen, aber ihre Körper lagen glänzend und reglos in der weißen Hitze.
Ich ging mit meinem Ball auf den gepflegten Rasen, der die Zimmer einfasste. Jede Einheit sah aus wie eine Schachtel und hatte eine gläserne Fassade aus verspiegelten Schiebetüren, damit niemand hineinsehen konnte. Die Klimaanlagen bliesen zischend heiße Luft nach draußen. Ich hatte das Gefühl, von den Gästen drinnen beobachtet zu werden, obwohl sie wahrscheinlich wie Vater hinter zugezogenen Vorhängen dösend auf ihren Betten lagen. Meist hielt er dabei seine knisternde Zeitung in der Hand, die Füße übereinandergeschlagen, den Kopf leicht zum Lampenschirm geneigt.
Die Tür eines der Zimmer stand etwa zwei Fingerbreit offen. Ich konnte laufendes Wasser hören, ein englisches Lied und dazu die Stimme einer Frau. Ich schob die Tür weit genug auf, um hineingehen zu können, wartete aber, bis sich meine Augen an das Schattenlicht gewöhnt hatten. Das Zimmer war genau wie unseres, mit der gleichen Bettwäsche, der gleichen Tapete und den gleichen Möbeln, allerdings gab es nur ein einziges Bett, das dafür so groß wie unsere beiden zusammen war. Die Badezimmertür war einen Spalt geöffnet, und an der Klinke hing der gelbe Badeanzug. Mir wurde bewusst, dass ich nach ihr gesucht hatte und darauf hoffte, sie ungestört vom Blick meines Vaters zu treffen. Ich verspürte eine fiebrige Erregung, in ihrem Zimmer zu sein, im privaten Reich dieser geheimnisvollen Frau, die allein zu reisen schien. Wer war sie? Wie kam es, dass sie unsere Sprache sprach? Nur sehr wenige Nicht-Araber sprachen Arabisch, und tatsächlich einen zu treffen war so aufregend, als entdeckte man einen Freund im Zuschauerraum eines riesigen Theaters, kurz bevor die Lichter ausgingen. Dazu kam die Art, wie sie sich bewegte und quer über den Pool zu mir herübergesehen hatte, ihre selbstsichere Gelassenheit, die darauf hindeutete, dass sie nicht einfach nur Urlaub machte und sich ausruhen wollte. Sie verfügte über die Anziehungskraft all derer, die wie mein Vater ihr Leben im Geheimen zu leben schienen.
Ich setzte mich an das Fußende des Bettes und legte den Ball neben mich. Vor dem Sessel stand ein Paar Schuhe. Einer davon lag auf der Seite, so dass man die cremefarbene, von ihrem Fuß geprägte lederne Innensohle sah. Auf dem Chiffonnier stand eine Parfümflasche neben einer Perlenkette und einer Haarbürste. Eine Hand auf der Türklinke und dem nassen Badeanzug, linste ich durch die schmale Öffnung. Ich sah ihren nackten, vom Duschvorhang vernebelten Körper, das Dreieck schwarzen Haars verschwommen und in Bewegung wie der dunkle Fleck, der einem vor Augen erscheint, wenn man direkt in die Sonne gesehen hat. Ich machte kein Geräusch und war sicher, dass sie mich nicht sehen konnte, dennoch sagte sie plötzlich: »Wer ist da?« Ohne darauf zu achten, wie viel Lärm ich machte, lief ich davon, lief aus ihrem Zimmer, so schnell ich konnte, und dachte erst an den Ball, als es zu spät war, noch einmal zurückzukehren und ihn zu holen.
Sobald Vater seinen Mittagsschlaf beendet hatte, erzählte ich ihm von meinem Ball.
»Er ist in eines der Zimmer gerollt, und ich fand es nicht richtig, hineinzugehen und ihn zu holen.«
»Und?«, sagte er, während er sich rasierte. Er rasierte sich immer abends, vor dem Essen, und nicht morgens wie die meisten Männer.
»Ich will nicht, dass irgendwer denkt, ich spioniere herum oder so was.«
»Aber ich weiß doch, dass du ein kleiner Spion bist«, sagte er und lächelte mich im Spiegel an.
Er legte die Klinge an den Hals und rasierte sich mit einer leichten Bewegung einen Streifen Schaum weg.
Abends sah ich sie in einem schwarzen Kleid an unserem Tisch im Speisesaal stehen und mit Vater sprechen. Eine Hand lag auf der Rückenlehne des Stuhls, der ihm gegenüberstand, meines Stuhls, und sie trug die Perlen um den Hals. Ihr gebürstetes Haar fiel schwer nach unten und wusste genau, wo es sich zurück nach oben zu biegen hatte, exakt auf Höhe der Kieferknochen. Als ich näher kam, fing ich den Duft ihres Parfüms auf.
»Da kommt Ihr kleiner Freund«, sagte Vater auf Englisch, als ich nahe genug war, ihn zu hören.
Sie hielt mir ihre Hand entgegen. Ich schüttelte sie, ohne ihr dabei in die Augen sehen zu können.
»Sag etwas, sei nicht so schüchtern«, sagte Vater in das peinliche Schweigen hinein. »Er geht auf die englische Schule«, erklärte er ihr.
Noch ein Stuhl wurde gebracht, ein weiteres Gedeck, und wir aßen zusammen. Was nachmittags geschehen war, erwähnte sie mit keinem Wort. Aber als Vater ans Telefon gerufen wurde, lächelte sie mir zu.
»Heute war eine Maus in meinem Zimmer. Eine sehr große Maus.«
Wieder hielt sie mein Kinn mit zartem Griff.
»Morgen kommst du deinen Ball holen.«
Sie trank etwas Wasser und tupfte sich mit der weißen Serviette auf die Mundwinkel.
»Dein Vater sagt, du bist zwölf. Ich hatte dich schon für älter gehalten.«
Sie sprach jetzt nicht mehr Arabisch, und so fehlte ihr die Verletzlichkeit, die mir am Pool aufgefallen war. Und weil es Vater gewesen war, der sich entschieden hatte, Englisch zu sprechen, als ich mich dem Tisch näherte, stand für mich er hinter dieser Veränderung.
Kapitel vier
Am nächsten Morgen ließ ich das Frühstück ausfallen. Ich ging am Hauptgebäude des Hotels vorbei, in dem das Restaurant war, und spazierte über den Rasen, der die Zimmer umgab. Das Meer war ruhig. Ganz leise konnte ich das Schwatzen und Lachen der Europäer hören, die beim Frühstück saßen. Ich stellte mir Vater vor, wie er dort drinnen allein Zeitung las, und fühlte mich schuldig. Doch die Schuld wandelte sich gleich in Eifersucht, weil ihm schon auf dem nächsten Bild, das ich mir ausmalte, Mona gegenübersaß.
Ich ließ mich auf die Erde sinken und lehnte den Rücken gegen die raue Rinde einer Dattelpalme. Der Schatten ihrer Krone umgab mich und bewegte sich im Wind. Ich hatte ihr Zimmer im Blick. Ob sie es verließ oder hineinging, ich würde sie sehen. Auf einmal musste ich weinen, und der Schmerz war neu und verwirrend. Ein Gärtner im blauen Overall bemerkte mich. Die breite Krempe seines Leinenhutes hob und senkte sich, als er zu mir gelaufen kam. Ich überlegte, ob ich aufstehen und davonrennen sollte, aber das Weinen wurde nur noch schlimmer. Er beugte sich vor. »Malisch, malisch«, sagte er und klopfte mir auf die Schulter. Nach dem Grund für meine Tränen fragte er nicht. Ich habe später oft an seinen freundlichen Trost denken müssen. Ich weiß noch, wie wir irgendwann lachten, allerdings nicht mehr, worüber. Heute noch sehe ich sein wettergegerbtes Gesicht vor mir, die schweren Augen, die unrasierten Wangen und die gelben Zähne, rieche den Geruch nasser Erde, kann mich aber nicht erinnern, was dieses ansteckende Lachen ausgelöst hatte.
Ich ging zum Meer, um mir mein Gesicht zu waschen. Zwei völlig angekleidete Frauen, wahrscheinlich Hotelpersonal, standen hüfttief im Wasser. Aufgeblähter schwarzer Stoff umgab sie und glitzerte bei jeder Bewegung. Ihre Unterhaltung wurde zu einem Flüstern, als sie mich sahen, kaum lauter als das sich kräuselnde Wasser um meine Füße. Ich wünschte, Naima wäre mit uns gekommen. Sie war schon vor meiner Geburt unser Hausmädchen gewesen. In diesem Moment hatte ich das Gefühl, dass sie mich besser kannte als irgendwer sonst auf dieser Welt.
Ein Mann in Shorts, auf dem Kopf eine Baseballkappe – im Rückblick denke ich, es war wahrscheinlich ein pensionierter Diplomat –, die braungebrannte Brust mit einem Rund grauen Haars besetzt, joggte entschlossen an der Wasserlinie entlang.
»Morning«, rief er mir auf Englisch zu, obwohl es doch fast Mittag und er wie ich Araber war.
Ich verspürte das Bedürfnis, hinter ihm herzulaufen, »Morning, morning, morning« zu rufen und lauter dumme Gesichter zu ziehen. Stattdessen leckte ich mir das Salz von den Lippen und wanderte zurück in den Garten des Magda Marina.
Obwohl ich keinen Schatten neben mir hatte auftauchen sehen und sie auch nicht hatte kommen hören, zuckte ich mit keiner Wimper, als sie plötzlich neben mir stand und sich bei mir unterhakte. Sie lächelte verschmitzt.
»Ich habe dich gesucht«, sagte sie, und ich spürte, wie sich der Kloß in meiner Kehle auflöste.
Sie ging voraus zu ihrem Zimmer. Ein Windstoß erfasste ihr Kleid, und einen Moment lang formte die leichte graue Baumwolle die Wölbung ihrer Wade nach, das kräftige Beben ihres Schenkels, die Rundung einer Pobacke.
»Warte hier«, sagte sie und ging hinein.
Ich sah mich im verspiegelten Glas, die Augen rot und verquollen.
Sie kam zurück und gab mir den Ball.
»Beim nächsten Mal klopfst du.«
Ich nickte und wandte mich zum Gehen.
»Nein, Dummkopf, komm schon her«, sagte sie lachend und schob die Tür weit auf.
Ich stand unsicher da, wusste nicht, was ich tun sollte. Sie deutete auf den Sessel. Ich setzte mich, atmete ihre Gerüche ein und musste an Mutters Kleiderschrank denken, wie es roch, wenn ich drinnen war und die Türen zuzog. Die Tür zu Monas Zimmer stand immer noch weit offen, und ich überlegte, ob ich sie bitten sollte, sie zu schließen. Aber es war ein heißer Tag.
Die Perlenkette lag in Form einer Acht auf dem Couchtisch. Ich stellte mir vor, wie sie jeden Abend nach dem Essen hier hereinkam, sich nicht in den Sessel, sondern auf die Lehne setzte und überlegte, was sie als Nächstes tun sollte.
»Möchtest du einen Saft?«, fragte sie und öffnete die Minibar, die genau wie die in unserem Zimmer war. »Guave?«
Sie stellte eine kleine Flasche vor mich hin, aber ich schraubte sie nicht auf, da ich es für unhöflich hielt.
Sie setzte sich ans Fußende des Bettes, wo ich tags zuvor gesessen und sie unter der Dusche singen gehört hatte. Auf dem Nachttisch stand ein kleiner Kassettenrecorder.
»Magst du Musik?«
Als ich nicht antwortete, drückte sie einen Knopf, und ein englisches Lied, schnell und dumm, erfüllte den Raum.
Sie streckte die Hände zu mir aus und zog mich hoch. Ich tat so, als sähe ich mich im Zimmer um. Sie schloss die Augen und hob die Arme über den Kopf. Bei jeder Bewegung erbebten ihre Brüste unter der grauen Baumwolle.
Ich verbrachte jede freie Minute mit Mona. Wenn ich sie verlassen musste, um zur Toilette zu gehen, raste mein Herz, bis ich wieder bei ihr war. Und abends im Bett hielten mich die Sehnsucht und die Erregung darüber wach, sie am nächsten Tag wiederzusehen. Wir schwammen im Meer, bauten Sandburgen und wunderten uns gemeinsam über die Gäste, die nicht weiter als bis zum Swimmingpool kamen. In ihrem Zimmer tanzten wir zu englischen Pop-Songs, die in meiner jungenhaften Vorstellung mit einem Mal versteckte Tiefen entwickelten. Ich hielt die Augen nicht länger gesenkt, sondern verlor mich mitunter völlig hemmungslos in der Betrachtung ihrer Anatomie. Einmal, als sie aufs Meer hinaussah, studierte ich eine Stelle an ihrem Hals, an der ihre Haut so zart war, dass man die smaragdenen Äderchen darunter ihr Netz weben sah. Ich küsste sie dort. Sie sah mich an. Eher vor Schreck als aus Schüchternheit schaute ich weg.
Sie erzählte mir von London, der Stadt, in der sie lebte, von ihrer Mutter und woran sie sich von ihrem toten Vater erinnerte. »Monir«, beim Vornamen nannte sie ihn, ohne eine Ergänzung, als wäre er ein Freund oder Liebhaber gewesen. Bei seinem Tod war Mona zehn. Da er in Alexandria geboren war, hatte Mona beschlossen, die Stadt endlich einmal zu besuchen. Wenn ich heute daran zurückdenke, begreife ich, dass es unter anderem dieser frühe Verlust gewesen sein muss, der Mona zu meinem Vater hinzog, einem Araber, der fünfzehn Jahre älter war als sie.
»Monir«, sagte ich, als stimmte ich ihr zu. »Er muss es gewesen sein, der deinen Namen ausgesucht hat.«
»Wahrscheinlich schon.«