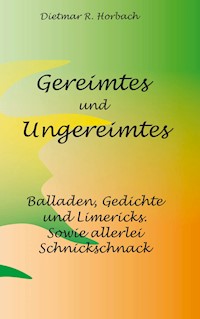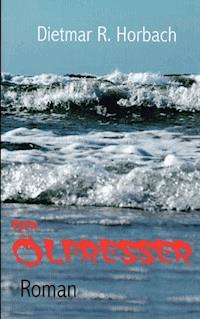Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Geschichten aussem Miljöh beinhalten Kurzgeschichten, die Menschlichkeit aufweisen. Mitgefühl, das wir in unseren Tagen in vielen Menschen vorfinden, bei anderen wiederum vergeblich suchen. Meine Kurzgeschichten sollen erheitern, aber auch nachdenklich stimmen. Sie sind aus dem Milieu des Lebens entstanden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1. Miljöh 1 – Ein Abenteuer kommt selten allein
2. Als Peter den Amadeus besiegte
3. Miljöh 2 – Wenn einer eine Reise macht
4. Die Geschichte mit der Maus
5. Miljöh 3 - Zivilcourage
6. Der Pferdekenner
7. Miljöh 4 - Die Straßenmusikanten
8. Jenny verliebt sich
9. Miljöh 5 - Tante Erna passt auf
10. Der seltsame Besucher
11. Miljöh 6 – Ollie kehrt zurück
12. Otto hatte es satt
13. Miljöh 7 – Der Engel von Tscheljabinsk
14. Tobias 5010
15. Miljöh 8 – Ferdi der Feigling
16. Der Weihnachtsmannassistent
17. Miljöh 9 – Wohin mit dem alten Huber
18. De Wihnachtsbraden
19. Miljöh 10 – Was wollen die denn hier?
20. Dat praktische Geschenk
Miljöh 1
1. Ein Abenteuer kommt selten allein.
Herbert Kowalsky, genannt Hebbert, war mal wieder arbeitslos. Gähnend und japsend wälzte er sich aus seinem Bett. Ein Blick auf den Wecker ließ ihn aufschrecken und vollends erwachen. „Wat, schon neune, ick werd' verrückt. Die machen ja schon dicht, bevor ick da bin.“
Er schlüpfte in seine Pantoffeln, und dann schlurfte er ins Bad.
Aus der Küche tönte Musik, und das Klappern von Geschirr war zu hören. Trude, Hebberts Frau, deckte gerade den Frühstückstisch. Sie stand immer um sieben auf, was Hebbert seit Jahr und Tag aufregte, da er ein notorischer Langschläfer war, der abends nicht ins Bett fand.
Trude kannte ihren alten Knutterkopf. Sie war ihm darüber nicht böse, doch manchmal gab sie ihm auch ordentlich Dampf, wenn er zum Beispiel nicht die Füße abtrat und den Schmutz in die Wohnung brachte. Ansonsten führten sie wohl ein friedliches Miteinander. Und Streit, ja den gab es doch überall mal, nicht wahr?
Hebbert kehrte schniefend aus dem Bad zurück und zog sich eilends an. Einen süßen Duft nach Tabac-Aftershave zog er dabei wie eine Fahne hinter sich her. Er wollte es unbedingt noch aufs Sozialamt schaffen. „Damit die Mücken auch surren“, sagte Hebbert immer. Ja, da war er sehr eifrig, wenn's ums Geld ging. Denn in seinem Alter mit 48 wurde man leicht gekündigt und bekam schwer wieder Arbeit.
Doch war es ihm bis heute nicht gelungen, eine neue Stelle zu bekommen. Na, und wenn nicht, ein bißchen Schwarzarbeit machte doch jeder, oder? Auf jeden Fall stellte Trude immer das Essen auf den Tisch, und die Miete konnten sie bisher auch immer zahlen.
Nach dem Frühstück, bei dem er wie immer die Anzeigen studierte und die Sonderangebote durchschnüffelte, machte er sich auf den Weg. An der Bushaltestelle war alles gerammelt voll. „Mann, müssen die hier alle heute unterwegs sein?“ brummte sich Hebbert in seinen Bart und wartete geduldig auf den 47er, der direkt vorm Sozi hielt. Einen Augenblick später kämpfte sich der Bus seinen Weg frei, vorbei an den vielen Autos und Menschen, die die Straßen bevölkerten.
Hebbert schob sich mit den anderen Fahrgästen hinein und entdeckte noch einen Sitzplatz. Doch bevor er sich erleichtert setzen konnte, wurde der Platz von einem jungen Mann eingenommen, der ihn noch frech angrinste, als wollte er sagen: „Gewonnen, Alter!“ Hebbert schluckte, blickte den Typen wütend an, der nun gelangweilt aus dem Fenster sah.
Der Bus fuhr ruckartig an. Hebbert konnte sich gerade noch festhalten, so dass er nicht gegen eine zierliche, ältere Dame geschubst wurde, die sonst auf dem Boden gelegen hätte. Hebbert wusste nicht, worüber er sich nun zuerst ärgern sollte. Über den „Rotzbengel“, der ihm den Sitzplatz wegschnappte, oder den „blöden Busfahrer“, der so unqualifiziert auf das Gaspedal getreten hatte. Er räusperte sich lautstark und schluckte den Ärger herunter. Jetzt trug er den richtigen Rochus
fürs Sozialamt in sich. Seiner Sachbearbeiterin, der „alten Ziege“, wollte er ohnehin schon immer die Meinung geigen. Das nötige Quantum an Wut hatte er nun gestapelt, und hielt es schön warm bis nachher.
Als Hebbert die Stufen zum Sozialamt emporstieg, stand dort schon wieder eine riesige Menschenschlange, die bis auf den Flur reichte. „Immer dasselbe“, grunzte er und wälzte sich durch die Menge bis zum Zimmer seiner Sachbearbeiterin. Er klopfte an. Dann öffnete er die Tür und trat ein. Frau Rosenberg warf ihm einen gleichgültigen Blick über ihre Brille zu, der nichts Gutes verhieß. Denn sie war, wie an jedem Montag, nicht gut drauf. „Morgen, Herr Kowalsky, ich schreibe Sie auf. Warten Sie bitte draußen.“ „Is in Ordnung“, knurrte Hebbert und begab sich zu der wartenden Schlange zurück. Da im Augenblick kein Sitzplatz zu ergattern war, lehnte er sich gegen die Wand. Sein Blick schweifte zu den Menschen, die hier auf ihre Abfertigung warteten. Einen Teil der Leute kannte er vom Sehen. Er blickte zum Teil in teilnahmslose, dösende Gesichter, die keine Hoffnung mehr in sich trugen. In den Augen blinkte kein Feuer mehr, Dinge zu verändern, um andere Perspektiven für das Leben zu schaffen. Die Menschen hier waren lange arbeitslos, hatten keinen Ausbildungsplatz erhalten und auch teilweise keine Lust zum Arbeiten.
Es war ja so einfach! Man ging zum Sozi und holte sich seine Stütze. Es reichte gerade zum Leben, aber große Sprünge konnte man damit als einzelner nicht machen. Da saß der Punker wieder in seinen schmutzigen, abgerissenen grauen Lederklamotten, die mehr Löcher aufwiesen als ein Schweizer Käse. Er stierte mit glasigen Augen vor sich hin. Wahrscheinlich hatte er erstmal wieder 'ne Dröhnung genommen, bevor er hierher kam. Seine fitzeligen Haare leuchteten rot und grün gefärbt und standen wie Stachel in alle Himmelsrichtungen.
Daneben saßen ein paar Türkenfrauen, die sich angeregt in ihrer Sprache unterhielten. Die Kinder, die sie bei sich hatten, quengelten schon lange herum, weil ihnen das Warten zu lange dauerte und sie vor lauter Langeweile nicht wussten, was sie anstellen sollten. Aber die Mütter störte das nicht bei ihrem Tratschen.
Eine alte Dame, die wegen Rundfunkgebührenbefreiung vorsprechen wollte, fragte alle Augenblicke, ob sie nicht bald dran wäre. Da erschien plötzlich Mehmet. Mehmet Gökan. Hebbert kannte ihn schon länger. Sie hatten sich hier mal kennengelernt und ein paar Worte gewechselt. Am Anfang ging er Hebbert auf'n Wecker. Aber so nach und nach, fand er ihn gar nicht so unsympathisch.
„Ah, merhaba Hebbert, was machte Geschäft?“ begrüßte ihn Mehmet und reichte ihm die Hand. „Mehmet, du alter Kümmeltürke, was macht die Familie? Hast du deine beiden Töchter schon verheiratet?“ Dabei grinste er, dass sein Gesicht einem aufgehenden Vollmond ziemlich nahe kam. Denn Hebbert wusste, dass die Töchter erst 12 und 10 Jahre alt waren. Mehmets ganzer Stolz war sein Sohn Ercan. Er war fünfzehn und besuchte die Realschule. Schien dort ziemlich gut zu sein. „Ercan wird mal deutsches Bürger“, prahlte Mehmet immer, um zu zeigen, wie gut er mit den Deutschen stand.
Da immer wieder Wartende aufgerufen wurden, waren bald zwei Plätze frei. Hebbert und Mehmet setzten sich und unterhielten sich über Gott und die Welt. Die Zeit verging, und plötzlich war Mehmet schon dran. Hebbert schaute auf die Uhr. Da kam seine Sachbearbeiterin aus dem Zimmer, schloss ab, und lief über den Flur in ein anderes Büro. Der Blick, den sie ihm dabei zuwarf, signalisierte, dass sie ihn zum Frühstück quer „fressen“ könnte. Hebbert freute sich schon auf das Gespräch und schoss sich innerlich darauf ein.
Mehmet war schnell wieder draußen. „Tschüß, Hebbert, seh'n wir uns heute Abend bei Schorsch?“ Hebbert schüttelte den Kopf. „Nee, ick glaub' nich, Mehmet. Will heute Fußball kucken. Anständig Borussia gegen FCK Stuttgart. Die Stuttgarter gewinnen doch ganz sicher, kannste glauben.“ Mehmet sagte Tschüß und ging.
„Herr Kowalsky, bitte“, tönte es durch den Lautsprecher. Hebbert stand auf und begab sich in die Amtsstube. Kaum hatte er Platz genommen, da legte Frau Rosenberg schon los: „Sagen Sie mal, Herr Kowalsky, haben Sie eigentlich den Wohngeldantrag schon abgegeben? Schon letzte Woche hab' ich Ihnen doch gesacht, dass der gestellt werden muß.“
Hebbert überlegte. „Au ja, Mensch, siehste“, antwortete er und fasste sich an seinen Kopf.
„Habbich doch total vergessen, Frau Rosenberg. Also womit man den Kopf nich immer voll hat. Da war ich beim Arbeitsamt und hab dat schon widder verpennt.“ Frau Rosenberg verdrehte die Augen und machte sich einen Aktenvermerk. Dann erledigte Hebbert seine Sachen. Da ihn die Sachbearbeiterin mit der Wohngeldsache erwischt hatte, konnte er nicht so auf den Putz hauen, wie er wollte, und so „backte er kleine Brötchen.“
Wieder draußen, atmete er kräftig durch. Jetzt könnte er sich 'ne Tasse Kaffee und ein Brötchen leisten. Schon war er auf dem Weg nach Karstadt, in die Kantine.
Genüsslich aß er dann eine Krakauer mit viel Senf. Die Tasse Kaffee trank er am liebsten schwarz und übersüß. Dabei beobachtete er die anderen Kunden. Hinten, an der rechten Seite, saß ein bekannter Stadtstreicher, der schmatzend seine Suppe löffelte. Da tauchte plötzlich in der Eingangstür zur Kantine ein weiterer „Saufbruder“ auf, der den anderen suchte. Mit lautem Gebrüll wollte er auf ihn zueilen. Doch nach drei Schritten verlor er das Gleichgewicht und stolperte betrunken zur Seite. Dabei rempelte er gegen zwei Stühle, die polternd zuerst gegeneinander und dann zu Boden fielen. Kollege „Saufbruder“ hatte sich gar nicht mehr unter Kontrolle und fiel über die Stühle. Dabei stieß er mit seinem Gesicht gegen einen Tisch. Ein Schmerzensschrei entrann sich seinem zahnlosen Mund, und er blieb dann still liegen.
Dieses Spektakel verursachte einen ziemlich großen Aufruhr beim Kantinenpersonal. Zwei Männer aus der Küche liefen zu dem Verunglückten hin und versuchten, ihn aufzuheben. Er blutete heftig aus Nase und Mund, da er sich bei dem Aufschlag, verletzt hatte. Schnell wurde die Gruppe von vielen Kunden umringt, die neugierig gafften. Einige gaben lauthals ihre Kommentare ab und sparten nicht mit Ratschlägen für die beiden Männer aus der Küche.
„Legt ihn erst einmal auf die Seite. Vielleicht hat er sich was gebrochen.“ „Holt die Polizei und den Krankenwagen.“ „Das hat der alte Penner nun davon. Soll er nich so viel saufen.“
Inzwischen hatten andere Bedienstete die Polizei und den Krankenwagen benachrichtigt, die schnell zur Stelle waren. Als die Sanitäter auftauchten, hatte der Verletzte schon wieder das Bewusstsein erlangt. Er stöhnte laut vor Schmerzen.
Der andere Stadtstreicher kümmerte sich derweil nicht um die Gruppe. Er nutzte die Gelegenheit und eilte von Tisch zu Tisch, um noch einige essbare Schätze einzusammeln. Am dritten Tisch nahm er sich eine dicke Bockwurst vom Teller und stippte sie in den Senf. Dann ging er weiter. Auf dem übernächsten Tisch stand noch ein Essen, das dampfte und von dem noch niemand gegessen hatte. Er blickte schnell nach allen Seiten, ob sich der Käufer in der Nähe befand. Als niemand zum Tisch kam, schnappte er sich das Tablett und marschierte eilends damit in eine andere Ecke, so dass er nicht mehr zu sehen war.
Hebbert, der das alles schmunzelnd beobachtete und sich dabei auch nicht aus der Ruhe bringen ließ, wartete ab, wie der Film weiter ablief. Da näherte sich auch schon der Kunde seinem Tisch. Es war ein elegant gekleideter Herr mit einem Aktenkoffer. Er stutzte, schaute auf den leeren Tisch, und wusste nicht, was los war. Dann blickte er zu den anderen Tischen hinüber.
Nirgends war sein Essen zu entdecken. Da kehrte er zum Tresen zurück und fragte die Bedienung, ob jemand den Tisch abgeräumt hätte. Diese verneinte und begleitete ihn zu seinem Tisch. „Also, ich weiß doch genau, dass ich mein Essen hier auf diesen Tisch gestellt habe!“ bekräftigte der Herr im mittleren Alter, mit etwas grauen Schläfen, seine Aussage von vorhin. „Aber dann müsste es ja hier oder auf einem Tisch in der Nähe stehen“, antwortete die Bedienung und drehte sich um die Achse, um alle Tische ringsherum noch einmal zu überprüfen. Doch kein Essen war zu sehen.
Hebbert grinste in sich hinein. Er dachte an den Stadtstreicher, der sich das Mahl gemütlich schmecken ließ. Aber er wollte ihn nicht verpfeifen. „Der andere hat sicher mehr Kleingeld, um sich ein neues Essen zu kaufen“, überlegte er und trank den restlichen Schluck Kaffee aus seiner Tasse. Dann erhob sich Hebbert und verließ die Kantine.
Er schlenderte noch ein wenig durch Karstadt und sah sich so einige Sachen an, die ihn interessierten. Beim Bücherstand blieb er stehen und schnüffelte sich ein wenig durch das moderne Antiquariat.
„Die Kunst, sein Leben selbst zu bestimmen. Was das für komische Buchtitel gibt.“ Hebbert begab sich anschließend in die Fotoabteilung. Dahin ging er gern, um sich die Neuigkeiten anzusehen. „Is ja doll, die ham' jetzt Digitalkameras so mit Computer und so. Aber det is nischt für mich, det is mir zu modern“, sprach er leise zu sich selbst.
Irgendwann hatte Hebbert das Gefühl, dass es jetzt genug war, seinen Wissensdurst zu stillen, und er machte sich auf den Weg zur Bushaltestelle.
Dort angekommen, wollte er sich auf die Bank setzen, was er auch machte. Dabei stieß sein Fuß gegen etwas Weiches. „Nanu“, dachte er und blickte nach unten. Da stand doch tatsächlich eine schwarze Tasche so herrenlos herum. Ein bisschen abgegriffen im Leder, aber sonst noch ganz in Ordnung. Hebbert bückte sich und hob die Tasche auf. Vorsichtig zog er den Reißverschluss auf. Als er in die Tasche sah, stieß er einen halblauten Schreckensruf aus. „O je, wat is dat denn?“
In seiner Hand hielt Hebbert Geld. Banknoten, viele Banknoten. Sie waren gebündelt. Ein Windstoß raschelte durch das Papier, und Hebbert blickte schnell nach links und rechts. Niemand war da. „Wer mag die Tasche wohl vergessen haben? Ein Geschäftsmann? Oder jemand, der sich seine Ersparnisse hat auszahlen lassen? Oder ein Gangster, der Geld waschen will?“ Viele Gedanken zogen Hebbert durch den Kopf, so dass er gar nicht klar denken konnte.
Er steckte das Geld in die Tasche zurück. „Na, erst mal mit nach Hause nehmen. Denn werd' ick die Sache mit Trude besprechen. Die weiß immer, wat man da tun soll.“
Da kam auch schon der Bus. Hebbert klemmte sich die Tasche unter den Arm und bestieg den Bus. Vorsichtig beäugte er die Leute im Bus, als ob alle sehen müßten, dass er eine Tasche voller Geld bei sich trug. Doch kaum einer beachtete ihn. Eine ältere Dame grüßte bei seinem Blick, und zwei kleine Mädchen fingen an zu
kichern. Hebbert setzte sich nah beim Ausgang hin, und der Bus fuhr los.
„Das wird aber auch Zeit, dass du kommst“, empfing ihn Trude nicht gerade freundlich. Als sie ihn ansah, hatte er so ein Leuchten in seinen Augen. „Wat haste denn? Du kuckst so komisch.“ Hebbert grinste und zog sie mit ins Wohnzimmer. Trude war neugierig geworden und schaute ihn fragend an. Hebbert stellte die Tasche auf den feinen Stubentisch, der noch mit gehäkelten Deckchen verziert war, und öffnete sie. Ein Griff in die Tasche, und Hebbert zog drei, vier Geldbündel aus der Tasche. Trude schrie auf und riss die Hand an ihren Kopf:
„Mein Gott, Hebbert, was ist das denn? Wo haste denn det viele Geld her?“
Hebbert grinste sie an und sagte: „Die Tasche hab' ich an der Bushaltestelle gefunden.“
„Aber det Geld könn' wir doch nich behalten“, antwortete Trude, und sie war enttäuscht darüber, denn sie hatte gehofft, dass ihr Hebbert im Lotto gewonnen hätte.
„Det weeß ja keener, dat wir det Geld haben“, brummelte Hebbert, der nun ein wenig über Trude verärgert war, weil sie ihn daran erinnerte, das Geld abzugeben. Er stopfte die Banknoten in die Tasche zurück. Sie setzten sich beide auf die Couch und waren in ihren Gedanken versunken.
Trude schaute ihren Hebbert nach einer Weile an. „Du, Hebbert“, sagte sie und machte seinen Hemdkragen ordentlich. „Du, Hebbert, ich glaub' nich, dat det gut is, wenn wir det Geld behalten.“ Hebbert war noch knurrig. Aber im Stillen gab er seiner Trude recht.
„Ja, Mutter, ick weeß“, war seine kurze Antwort. Trude stand auf und drückte ihrem Hebbert einen Schmatz auf die Stirne. „Ich mach' uns gleich mal'n Kaffee. Dann sieht die Welt schon wieder besser aus.“ Damit verschwand sie in der Küche.
Als Hebbert gut zwei Stunden später die Außentür zur Polizeidienststelle in seinem Viertel öffnete, hätte er sie bald vor seinen Kopf bekommen. Zwei Polizisten, die wahrscheinlich im Einsatz waren, stürmten an ihm vorbei, ohne von Hebbert Notiz zu nehmen. „Mann, die ham's aber eilig“, brubbelte er und schob sich in den Flur. An einer Tür stand Revier 21. Hebbert klopfte an und öffnete die Tür. Im Zimmer saßen zwei Polizeibeamte, die telefonierten. Hebbert trat an die Theke, die das Publikum vom eigentlichen Behördenraum mit seinen Schreibtischen und Schränken trennte, und wartete, bis sich einer der Beamten an ihn wandte.
„Was kann ich für Sie tun?“ wurde er von einem der Beamten gefragt. Hebbert schilderte die Situation aufs Neue und legte die Tasche auf den Tresen. Der Polizeibeamte bekam Stielaugen, als die Geldmenge aus der Tasche purzelte. Auch der zweite Beamte eilte herzu, als er die Geldscheine erblickte. „Und die Tasche haben Sie an der Bushaltestelle gefunden?“ Der erste Beamte war ein wenig skeptisch.
„Sag ich Ihnen doch. An der Bushaltestelle“, betonte Hebbert nochmals seine Aussage.
„Wurde schon eine Vermisstenmeldung oder Suchanzeige wegen der Tasche aufgegeben?“ wandte sich der erste an den zweiten Beamten. Dieser sah im Computer nach und schüttelte den Kopf. „Nein, absolut nichts.“
„Nun gut, dann woll'n wir mal die Sache aufnehmen.“ Der erste Beamte notierte Hebberts Namen und Anschrift. Dann stellte er ihm eine Quittung für die übergebene Tasche aus.
„Sie werden sicher von uns hören, wenn wir die Tasche dem rechtmäßigen Besitzer zugeführt haben“, verabschiedete er Hebbert, der nachdenklich die Wache verließ.
Die Wochen vergingen, und Hebbert dachte kaum noch an die Tasche. Da klingelte zu Hause das Telefon, und es klingelte nicht oft. „Hier Trude Kowalsky“, meldete sie sich. „Ja, hier spricht Wache 21, Polizeiobermeister Schnippenkötter am Apparat. Ihr Mann hatte vor einigen Wochen eine Tasche hier abgegeben.“
„Ich erinnere mich“, flötete Trude und hielt den Hörer ein wenig von ihrem Ohr weg, da der Polizeiobermeister eine sehr kräftige Stimme hatte.
„Ja, also! Der Besitzer hat sich gemeldet, und ich möchte Ihnen mal die Telefonnummer durchgeben.“ „Nen Augenblick, Herr Wachtmeister, ick will mir eben bloß einen Schreiber holen“, antwortete Trude und sauste los. Als sie wieder am Apparat war, notierte sie die Telefonnummer, die ihr durchgegeben wurde.
Ein paar Stunden später kam Hebbert nach Hause. Er war ein wenig angesäuselt, da er noch „Bei Schorsch“
war. Das war ihr Stammlokal, wo Hebbert und Mehmet und Günter Bohne und Wladimir Spalchow immer tagten und die „Tagespolitik“ machten. Dieses Mal hatten sie wieder die Grünen am Wickel mit ihrem Atomausstieg.
„Hallo, Trudchen, hicks, geht's dir gut?“ So stolperte Hebbert in die Stube, und seine Frau erkannte sofort, dass er angetrunken war. „Na, du hast ja schon wieder einen in der Krone“, konterte sie und warf ihm einen bösen Blick zu. „Aber Truudichen“, säuselte Hebbert und grinste in sich hinein. „Tlluudelchen, so schimpf doch man nich so. Ick hab' mir nur'n bisken angesäuselt, mehr nich.“
Trude zog es vor, Hebbert erst von dem Anruf zu erzählen, wenn er wieder bis Drei zählen konnte. So steuerte dieser auf die Couch zu, legte sich mit einem eleganten Satz auf den Diwan, und war im Nu eingeschlafen. Etwas später drang sein sonores Schnarchen bis in die Küche, in der sich Trude ihren Ärger abreagierte, indem sie die Töpfe blitzeblank scheuerte.
Stunden später saß Hebbert auf dem Sofa und gähnte lauthals. Seine Augen waren klein, und er stöhnte herum, da er Kopfschmerzen hatte. So einen richtigen Brummschädel. „O, aua, o weh“, kam es stöhnend von seinen Lippen. „Geschieht dir ganz recht, alter Trunkenbold“, wetterte Trude, die gerade die Sammeltassen, die sie mal wieder abgewaschen hatte, in den Wohnzimmerschrank stellte. Hebbert reagierte nicht darauf und jammerte leise vor sich hin. „Damit du mal auf andere Gedanken kommst. Der Besitzer der Tasche hat angerufen.“
„Welcher Besitzer, welche Tasche?“ Hebbert stierte Trude dabei an, wie ein Kalb, das zum Schlachthof geführt wurde. „Na, du versäufst nochmal deinen Verstand“, konterte sie und konnte sich nicht beruhigen. Hebbert überhörte ihre Spitze und fragte erneut nach. „Na, von der Tasche, die du letztens bei der Polizei abgegeben hast.“
Hebbert dachte einen Augenblick nach. Das verursachte einen stechenden Schmerz. „Aua“, jammerte er. Dann wurde es plötzlich hell in seinem Gehirn. „Ach ja, die Tasche mit dem Geld. Und was hat der gesacht?“ wollte er nun wissen.
„Hier ist die Telefonnummer. Du kannst ihn ja selber anrufen, wenn du wieder nüchtern bist.“
„Ich bin nüchtern“, brummte der liebe Ehemann und grapschte nach der Telefonnummer, die Trude ihm hinhielt. Dann begab er sich auf den Flur zum Telefon.
Langsam wählte er die Nummer. „Hier Neuhausen“, tönte es am anderen Ende.
„Ja, hier spricht Hebbert Kowalsky. Ich bin der Finder Ihrer Tasche, die Sie von der Polizei zurückbekommen haben“, brüllte Hebbert ein bisschen laut ins Telefon.
„Wie bitte?“ fragte man auf der anderen Seite. Hebbert wiederholte sich. Da klickte es bei Frau Neuhausen, die das Gefühl hatte, dass ihr Telefonpartner „nicht ganz alleine war.“
„Ach so, ja, dann werde ich es meinem Mann sagen. Bitte, sagen Sie doch mal Ihre Telefonnummer, damit er Sie zurückrufen kann.“
Hebbert knurrte etwas in sich hinein und gab brav die Nummer durch. Gut zwei Stunden später klingelte es an der Haustür. Trude öffnete, und Herr Neuhausen stellte sich vor. Trude bat ihn in die Stube. Hebbert, der einigermaßen wieder klar war, kam gerade vom stillen Örtchen und zog sich seine Strickjacke an, damit man sein fleckiges Hemd nicht so sah.
„Guten Tag, Herr Kowalsky, ich bin Herr Neuhausen und wollte mich für die ehrliche Abgabe meiner Tasche bei der Polizei bedanken.“
„Nix für ungut“, brummelte Hebbert und grinste ein wenig verlegen. Er hoffte auf einen anständigen Finderlohn. Nun kamen sie ins Gespräch, und Herr Neuhausen erzählte von seiner Firma, der es im Augenblick schlecht ging. Man hatte fast das Gefühl, als wollte er noch bei Hebbert Geld leihen. Nachdem sie noch ein oder zwei Tassen Kaffee getrunken hatten, den Trude schnell aufbrühte, wollte sich Herr Neuhausen verabschieden. Im Flur griff er in seine Tasche und drückte Hebbert einen Fünfzig-Mark-Schein in die Hand. „Für Ihre Unkosten“, sagte er, und schon war er aus der Tür verschwunden. Hebbert war so verdattert, dass er erst nach ein paar Sekunden zur Besinnung kam.
„Sag mal Trude, wieviel Finderlohn steht einem denn zu?“ „Ich weiß es nicht Hebbert, ruf doch mal die Polizei an.“
Das war ein guter Gedanke, den Hebbert sofort in die Tat umsetzte. „Polizeirevier 21, was kann ich für Sie tun?“ Hebbert meldete sich bei dem Beamten und fragte nach, wieviel Finderlohn man zu beanspruchen
hat. Die Antwort lautete fünf Prozent, ab einer bestimmten Summe. Und dann erfuhr Hebbert, dass es genau fünfhundertsechsundachtzigtausendunddreihundertfünfundneunzig D-Mark waren, die der Verlierer zurückerhalten hatte.
„Und fünf Prozent davon, sind -“, Hebbert stutzte, denn es kostete ihn ganz besondere Anstrengung, dieses festzustellen. Nach einigen Mühen hatte er es he-raus. „Donnerwetter, das sind ja - das waren ja neunundzwanzigtausenddreihundertneunzehn Mark und fünfundsiebzig Pfennje.“
Soviel Geld hatte Hebbert noch nie auf einem Haufen gesehen.
„Wat mach' ick denn nu?“ Hebbert kratzte sich unschlüssig seinen, mit einer ordentlichen Halbglatze versehenen Schädel. Nachdenklich zog er sich seine Jacke an und die Mütze auf und stapfte zur Tür. „Wo willst'n hin?“ fragte Trude, die gerade aus dem Bad kam.
„Ick will noch mal zur Polizei, mich erkundigen“, antworte er und zog dabei die Türe etwas auffallend ins Schloss, da sein Ärger über Herrn Neuhausen zu brodeln anfing.
Dort konnte man ihm nicht mehr Genaues über die Sache sagen. Der Beamte, der die Tasche an den Besitzer herausgegeben hatte, befand sich seit zwei Tagen in Urlaub und war verreist. Eine Quittung darüber ließ sich nicht auftreiben. „Aber mir wurde doch am Telefon gesacht, wieviel der Kerl zurückbekommen hat“, begehrte Hebbert auf, dem die Sache langsam mulmig vorkam. Doch auch davon wusste niemand auf dem Revier. Enttäuscht verließ er mürrisch die Polizeistation und schlenderte missmutig zur Bushaltestelle. Auf dem Weg dorthin kam er an dem Schreibwarengeschäft vorbei, in dem er immer seinen Lottoschein abgab. Da fiel ihm ein, dass der schon wieder fällig war. So betrat er den Laden.
„Na, Herr Kowalsky“, wurde er von der Lottofrau begrüßt, die ihn schon seit Jahren kannte. „Soll's mal wieder 'n Glückstreffer sein?“
„Wenn et det man wäre“, seufzte Hebbert und dachte an den verlorengegangenen Finderlohn.
„Vielleicht hab' ich ja doch mal Glück“, sprach er mehr zu sich selbst, als er den Schein abgab.
Wieder zu Hause, erklärte er Trude, dass da nichts zu machen sei wegen des Finderlohns. „Die Polente hat keinen Nachweis darüber“, brummte er, und seine Trude zuckte mit den Schultern. “Wer weiß, wozu et gut is, Hebbert. Aber et gibt doch noch mal 'ne ausgleichende Gerechtigkeit.
Wir gewinnen dafür heute im Lotto“, sagte sie entschieden und blickte ihren Mann mit fröhlichen Augen an. Der schüttelte seinen Kopf über so viel Naivität, aber er sagte nichts dazu.
Es war Samstagabend, und der Sprecher hatte gerade die Ziehung der Lottozahlen angekündigt. Die Kugeln drehten sich zu einer schönen, einschmeichelnden Musik. Hebbert war ganz Auge und Ohr, um die Zahlen aufzuschreiben. Nur Trude löste an ihrem Kreuzworträtsel von letzter Woche und dachte gar nicht mehr an
das, was sie vor zwei Tagen sagte. Da kam die erste Zahl. Fünf! „Fünf? Nee, hab' ick nich“, sagte Hebbert enttäuscht. Da, die nächste! Eine Elf. „Jo, die hab' ick. Na, een schon mal richtig.“ Zufrieden schrieb er die Zahl hin. Dann fiel wieder eine Kugel in das offene Rohr. Dreiundzwanzig! „Dat is nich möglich“, fuhr Hebbert hoch. „Die Dreiundzwanzig hab' ick och.“
Nun wurde auch Trude munter. Sie blickte von ihrem Kreuzworträtsel auf und sah auf den Fernseher. Dort wurde gerade die vierte Kugel auf den Weg in den Trichter gebracht. Zweiunddreißig! „Hurra“, stieß Hebbert einen Jubel aus. „Die hebb' ick och. Mensch, Mutter, drei Richtige bis jetzt.“ Trude wurde ganz aufgeregt. Ihre Hände wurden schwitzig, und sie wischte sich mit dem Taschentuch den Schweiß von der Stirn.
Da - eine 39. „Trude“, stöhnte Hebbert auf und wischte sich auch den Schweiß von der Stirn. „Wir haben vier Richtige. Dat is verdorrich een Glück.“
Die beiden saßen nun ganz aufgeregt vor dem Fernseher. Sie hörten nicht die schöne Musik, die die Lottoziehung begleitete. Und wieder ein Treffer! „Die Zweiundvierzig, Trude. Die Zweiundvierzig. Wir haben fünf Richtige.“ Trude und Hebbert lagen sich in den Armen, was schon seit Jahren nicht mehr vorgekommen war. Bei all dem Trubel hätten sie bald nicht die Zusatzzahl mitbekommen.
Doch das Fernsehen zeigte noch einmal alle gewählten Zahlen. Und die Zusatzzahl war die Neun. „Hurra, Trude, auch die Zusatzzahl haben wir. Ick werd' verrückt. Trude, wir haben fünf Richtige mit Zusatzzahl.“ „Na, wat is nu, Hebbert?“ jubelte Trude, und die Freudentränen liefen ihr die Wangen herunter. „Hab' ich dir det nich gesagt?“ „Ja, Trude, mein Goldschatz“, flötete Hebbert und gab ihr einen tüchtigen Schmatz. „Dat hast du gesagt. Ick werd' verrückt. Meine Trude hat det gesagt. Et gibt doch noch 'ne ausgleichende Gerechtigkeit.“
Ja, und die kam, die ausgleichende Gerechtigkeit. Hebbert und seine Trude waren auf einmal vermögend. Sie gewannen tatsächlich dreihundertfünfundachtzigtausendneunhundertelf Mark und zweiundfünfzig Pfennige im Lotto. Was sie damit machten, das ist eine andere Geschichte.
Als Peter den „Amadeus“ besiegte.
Kalle kam schlecht gelaunt nach Hause. Er warf seine Schultasche in die Ecke, und knallte die Türe hinter sich zu, die mit einem lauten Krach ins Schloß fiel, und pflanzte sich auf seinen Stuhl, der mit Blickrichtung Computer sein am meisten bewohntes Möbelstück war.
„Diese blöde Penne und diese hohlen Pauker! Es ist zum Kotzen damit.“ Mit diesen Worten war seine rechte Hand schon automatisch dabei, den Computer anzuschalten.
„Mal seh'n, was Schumann mir da wieder mitgegeben hat.“ Er griff in seine Jackentasche und fischte drei CDs heraus, die ihm sein Kumpel aus der Parallelklasse in der Pause gegeben hatte.
„Unbedingt geil, die Sache“, hatte er gesagt. Kalle sah sich die CDs an. Drei neue heiße Spiele - natürlich von Schumann's Partner gebrannt. Selbst kaufen konnte man sich ja die Dinger als Schüler nicht. Das bisschen Taschengeld reichte man gerade fürs Wochenende. Und Zeitungen austragen wie sein kleiner Bruder Peter? Nein, dafür war Kalle viel zu träge und hatte gar keinen Bock auf so was.
„Hexensabbat III, Schlacht gegen die Normannen und Jagt die Piraten IV. Mensch, sind das dolle Spiele“, Kalle bekam vor Aufregung ganz schweißnasse Hände, als er die erste CD in den Player schob.
„Mann, irrer Sound und was für 'ne Graphik; ich werd' nich wieder.“ Kalles Computerherz schlug höher und höher. Gekonnt, als erfahrener Computer-Gladiator, überwandt er recht schnell die ersten Hindernisse. Die Angriffe wurden abgewehrt, und sein Punktekonto sauste schnell in die Höhe. Gerade betrat er mit seiner Heldenfigur eine Höhle, in welcher er den Hüter des Elfenschatzes besiegen musste. Rechts hinter ihm tauchte plötzlich ein irres Monster auf, das mit gefährlichen Strahlen nach ihm schoss.
Kalles Held hob seinen Schild; und - und? Was war denn nun? Der Bildschirm begann, plötzlich in knalligem Rot zu leuchten, und nichts ging mehr. Kalle versuchte, seine Figur mit der Maus oder mit den Tasten, zu bewegen. Tot - keine Bewegung. Der Computer war abgestürzt.
Man kann sich die Schimpfkanonaden vorstellen, die Kalle von sich gab. Dann versuchte er einen Kaltstart. Nichts! Computer aus! Etwas warten! Computer an! Dieser fuhr hoch, und schon begann er sein Spielchen aufs Neue. Zwischendurch speicherte Kalle den augenblicklichen Spielstand sofort ab, da er wieder einen Absturz befürchtete. Und so kam es. Er stürzte wieder ab. Und wieder! Kalle tobte, er schimpfte, was das Zeug hielt. Sein kleiner Bruder Peter kam ins Zimmer, weil er das Geschrei hörte. „Was is'n los? Warum schreist du denn so?“ wollte er wissen.
„Ach, hau ab, lass mich in Ruhe“, bekam er zur Antwort. „Der PC ist abgestürzt, als ich die Spiele von Schumi ausprobierte.“ „Bei allen?“ wollte Peter wissen. Kalle nickte und machte den Computer aus. Er hatte die Nase gestrichen voll. Grimmig vor Wut, machte er seinen CD-Player an, und die neuste Scheibe der „Ox in the Darts“ dröhnte durch das Zimmer.
„Den mach ich morgen fertig“, maulte Kalle noch, als Peter, sich die Ohren zuhaltend, das Zimmer verließ.
Am nächsten Morgen, als Kalle endlich zur Schule war, schlüpfte Peter in dessen Zimmer. Er hatte sich am Morgen nicht wohlgefühlt, und Mama hatte gesagt, er solle sich heute ausruhen und im Bett bleiben. Nachdem sie Peter einen Kuss auf die Stirn gehaucht hatte, ging sie. Denn Mama musste noch etwas Geld verdienen, nachdem Papa einen anderen Job erhalten hatte und erst am Wochenende heimkam.
Für Peter war die Situation sehr günstig. Außer Kater Maunzi und ihm war niemand zu Hause. So schlich er sich in Kalles Zimmer, um die Sache mit dem Computer zu untersuchen. Eigentlich hatte ihm Kalle unter Androhung von Folterqualen und Todesstrafe verboten, den Computer anzuschalten. Aber es reizte Peter so sehr, da er sich auch brennend für Computerspiele interessierte. Natürlich hatte er seinen Gameboy. Aber der Computer von Kalle war ja viel interessanter. Er setzte sich auf den berühmten Stuhl vor den PC.
Dann suchte er zunächst die Spiele, die sein Bruder ausprobiert hatte. Sie lagen, etwas aus der Hülle gerutscht, auf Kalles ungemachtem Bett. Peter nahm sich eine davon und schaltete den Computer ein. Dann legte er die CD ein und wartete, bis er mit dem Spiel beginnen konnte.
Wie Kalle, begann er damit, sich eine Heidenfigur auszusuchen. „Wen nehm ich denn bloß?“ dachte er sich. Dann entschied er sich für Sigurd, einen blonden, bizepsträchtigen und durchtrainierten normannischen Krieger. Mit diesem ging er ins Spiel. Die ersten Trolle und anderen Geister wurden besiegt. Peter war begeistert von dem Spiel.
Nun musste Sigurd durch einen Wald zu einer Zauberin gehen. Als Sigurd dort ankam, hatte diese ihn schon erwartet. Peter klickte die möglichen Fragen an, die Sigurd an die Zauberin stellen sollte. „Wie erreiche ich das Schloss des Königs Haran?“
„Du brauchst einen Knappen“, lautete die Antwort. Peter suchte nach einer weiteren Frage. Aber er konnte keinen geeigneten Text finden.
Plötzlich erschien eine Frage auf dem Bildschirm. Peter schaute ganz erstaunt und erschrocken zugleich. „Wen soll ich als Knappen nehmen?“
„Nimm den, der dich erwählt hat“, lautete die Antwort der Zauberin.
Sigurd drehte sich um und sah nun in Richtung Zimmer. Peter konnte es nicht fassen. Da erschien schon wieder eine Schrift auf dem Monitor.
„Du da, komm 'rüber und hilf mir bei dem Kampf gegen das schreckliche Ungeheuer und die Mächte des Bösen.“
„Wer, ich?“ antwortete Peter und starrte auf den Bildschirm. Sigurd nickte und kam einige Schritte auf Peter zu. Er reichte ihm die Hand.
Plötzlich dachte Peter, dass er träume. Der Monitor wurde größer und größer, bis er so groß wie ein Tor war. Sigurd stand nun neben ihm und sprach ihn an. „Komm mit, ich brauche dich.“ „Aber, - schaffst du das nicht allein?“ antwortete Peter erstaunt.
„Nein, wir müssen besonders gegen den schrecklichen Amadeus kämpfen. Diesen Kampf kannst nur du allein führen.“
Bevor Peter noch etwas sagen konnte, hatte Sigurd ihn an seinem Arm gepackt, und schon befand er sich mit ihm in dem Wald, den er noch vor wenigen Minuten auf dem Monitor gesehen hatte. „Du benötigst erst eine Ausrüstung“, sagte der Normanne und deutete, ihm zu folgen. Sie gingen schweigend einen etwas ausgetretenen Waldpfad entlang. Etwas kam Peter sehr seltsam vor. Es war die eigentümliche Stille des Waldes. Kein Vogelgezwitscher war zu hören, kein Tier zu sehen. Es war absolute Stille. Nicht ein-mal die Bäume rauschten im Wind. Richtig gespenstisch fand Peter diesen Wald, und etwas Angst begann, in ihm hochzukriechen.
Dann wurde es plötzlich vor ihnen heller, und der Waldpfad endete auf einer Lichtung. Peters Blick fiel auf eine etwas hügelige Landschaft, wie er sie aus Videos kannte, die in England gespielt haben. Saftige grüne Wiesen, auf denen kleine gelbe Butterblumen wuchsen und einen kleinen Teppich bildeten, wurden von tiefbraunen Ackerflächen unterbrochen. Buschgruppen und stellenweise Waldflächen ergaben ein Landschaftsbild, das von einem herrlich blauen Himmel überspannt wurde, an dem kleine Schäfchenwolken langsam nach Norden zogen. In nicht allzu weiter Ferne sah Peter nun eine kleine Rauchfahne aufsteigen, die sich langsam nach oben kämpfte. Und dann konnte er auch kleine Hütten erkennen.
„Dort müssen wir hin. Da ist unsere Siedlung“, bemerkte Sigurd und nahm den Weg wieder auf. Peter folgte ihm geduldig, obwohl er schon etwas Müdigkeit verspürte. Nach einem strammen Marsch, der über eine Stunde dauerte und deshalb Peter manchen Schweißtropfen kostete, gelangten die beiden in die Nähe des Dorfes. Fröhliches Gelächter von Kindern und geschäftiges Treiben der Frauen drang zu ihnen herüber. Sigurd drehte sich zu Peter um, und lachend zeigte er in Richtung des Dorfes. Von dort hatte man sie bereits erspäht, und ein paar größere Kinder rannten ihnen entgegen.
„Sigurd, Sigurd!“ riefen sie lauthals und machten damit auch einige Männer aufmerksam, die in einer kleinen Gruppe vor einem größeren Haus beisammenstanden. Diese wandten sich nun ebenfalls interessiert den Ankömmlingen zu, die nun von den Kindern und einigen Frauen umringt wurden. Besonders Peter wurde mit neugierigen Blicken bestaunt und begutachtet.
Aus der Männergruppe löste sich ein stattlicher, älterer Mann. Sein wettergebräuntes Gesicht, das von seinem grauen Bart und den ebenso ergrauten Haaren eingerahmt war, wirkte würdevoll und ehrfurchtgebietend. Er trat auf Sigurd und Peter zu. Seine Falten glätteten sich, und ein freundliches Lachen machte der sonst ernst dreinschauenden Miene, Platz. „Sigurd, mein Sohn. Willkommen zu Hause“, begrüßte er zunächst diesen. Dann fiel sein Blick auf Peter, der ein wenig verschüchtert auf den großen Mann blickte. Dieser sah ihn nun an. „Ich sehe, du hast unseren Freund mitgebracht. Das ist gut.“
Er reichte Peter seine Hand, die dieser zögernd ergriff. „Sei auch du willkommen, Peter. Wir hoffen, dass du uns von dem elenden Leiden erlösen wirst, das unser Dorf getroffen hat, seitdem dieses Ungetüm hier in der Gegend sein Unwesen treibt.“ Dabei sah er in die Runde der Umstehenden, die seine Worte mit Nicken und murmelnden Worten zustimmend bestätigten.
Peter blickte ihn fragend an, und Sigurd gab seinem Vater und Häuptling des Dorfes zu verstehen, dass er Peter noch keine Einzelheiten mitgeteilt habe. Dieser nickte kurz und ging auf das große Haus zu, vor dem die Gruppe Männer vormals gestanden hatte. Er deutete mit einem kurzen Wink, dass Sigurd, Peter und die restlichen Männer ihm folgen sollten.
Die Männer setzten sich im Kreis auf den Boden. Peter saß zwischen Sigurd und dem Häuptling. Nach einer kurzen Zeit des Schweigens, ergriff der Häuptling das Wort: „Ihr Männer von Lamira. Wir haben uns im Rat der Ältesten versammelt, weil es große Probleme gibt. Probleme mit dem großen Geist, dem großen Ungeheuer, das unsere Frauen und Kinder tötet, unsere Felder verwüstet und unseren Lebensraum Stück für Stück vernichtet.“
Nun erfuhr Peter, dass seit fast zwei Monaten ein grässliches Wesen auftauchte, das in der Lage war, alles zu zerstören. Dabei vernichtete es die Landschaft umher und fraß sie einfach auf, sodass nichts mehr vorhanden war. Dadurch wurde der Lebensraum der Dorfbewohner immer enger und enger, und bald würde keiner mehr von ihnen existieren.
„Bisher gab es niemand, der ihn aufhalten konnte. Du bist allein unsere Hoffnung“, wandte sich der Häuptling an Peter.
„Wieso gerade ich?“ Fragend schaute er abwechselnd auf Sigurd und den Häuptling. „Er ist mit unseren Waffen nicht zu vernichten. Nur ihr da draußen habt das Wissen und die Möglichkeit, solche Wesen zur Strecke zu bringen.“
„Wir da draußen? Was meinst du damit?“ „Nun, ihr sitzt doch vor dem Computer und spielt mit uns. Nun bist du in unserer Welt. Ihr Menschen habt doch einen besonderen Namen für diese Wesen, die alles so zerstören.“
Peter überlegte einen Augenblick. Dann dämmerte es ihm. „Ah, du meinst einen Computer-Virus?“
„Ja, kann sein, ich kenne diesen Namen nicht“, antwortete Sigurd. „Wie heißt das? Computer-Virus?“ Peter nickte und musste dabei lächeln. Er erinnerte sich, dass sein Bruder etwas von einem Virus erzählt hatte, als er vorgestern die neuen Spiele mitbrachte. Und nun befand er sich in einem dieser Spiele. „Das ist ja unglaublich!“ sprach er zu sich selbst.
„Doch wie kann ich diesen Virus beseitigen? Ich muss mir Gedanken darüber machen.“ Der Häuptling beendete die Versammlung, und Peter folgte Sigurd in die Wohnhütte, wo dieser bereits von seiner Schwester und seinem jüngeren Bruder erwartet wurde. Die Geschwister begrüßten sich in herzlicher Umarmung. „Wie schön, dass du wieder da bist.“
Amuja blickte ihrem Bruder sorgenvoll in die Augen. „Du hast uns gefehlt, Sigurd. Das Ding war schon zweimal da und hätte beinahe meinen besten Freund Mijo getötet“, berichtete Taliv seinem Bruder. Jetzt erst bemerkten sie Peter, der die ganze Szene mit innerer Anteilnahme beobachtete.
„Wer ist das denn?“ wollte Taliv wissen, und auch Amuja schaute ihren Bruder fragend an. „Das ist Peter, der uns vor dem Ungeheuer retten wird“, gab Sigurd ein wenig pathetisch zur Antwort. „Du willst uns davon befreien?“ Taliv fing an zu lachen, als er sich den kleinen Peter genau ansah.
„Du brauchst gar nicht so blöde zu lachen“, rief Sigurd seinen Bruder zurecht. „Er hat die Kenntnis, die wir nicht haben. Und wir werden ihn unterstützen.“
„Ich entschuldige mich für meinen kleinen Bruder“, entgegnete nun Amuja und bat die drei in einen anderen Raum. „Hier könnt Ihr euch erst einmal stärken, bevor die großen Heldentaten die Geschichtsbücher füllen.“ Taliv, der zweimal eine Rüge von seinen Geschwistern einstecken musste, machte ein saures Gesicht, als er gegenüber Peter seinen Platz eingenommen hatte.
Doch Peter lächelte ihn an und meinte: „Wir müssen zusammenhalten, Taliv. Auch deine Hilfe wird benötigt.“ Dann streckte er ihm seine Hand entgegen. Dieser schaute ihn erst verkniffen an. Doch dann glitt ein Lächeln über sein Gesicht, und er ergriff Peters Hand. Eine neue Freundschaft war dadurch entstanden.
Am nächsten Morgen wusste Peter zunächst nicht, wo er sich befand. Er hörte Geräusche im Nebenraum, und es duftete lecker nach Essen. Er blinzelte noch verschlafen in die Welt und stellte fest, dass die Brüder ebenfalls schon auf waren. Da stand plötzlich Taliv im Zimmer.
„Peter, komm hoch, es ist Zeit zum Frühstücken. Sigurd hat schon die Pferde gesattelt. Wir machen uns nach dem Essen auf den Weg.“
„Wo wollen wir denn hin?“ „Wir erkunden die Gegend und wollen das Biest aufspüren.“
„Jetzt wird's langsam Ernst“, dachte Peter, und es wurde ihm ein wenig mulmig zumute. Er zog sich schnell an und erfrischte sich draußen am Brunnen, wie es die anderen auch taten.
Amuja hatte inzwischen ein schmackhaftes Frühstück zubereitet. Peter fühlte einen Bärenhunger und griff eifrig zu. Es gab Honig, ein festes, schmackhaftes Brot, ja sogar Schinken und gebratenes Fleisch, das wie Hähnchen schmeckte. Als Getränk gab es etwas Heißes, das sehr gut tat und wie Früchtetee schmeckte. Aber danach mobilisierte es sämtliche Körperteile, und Peter fühlte sich plötzlich so leicht und trotzdem so stark, als wenn er Bäume ausreißen könnte.
„Was ist das?“ fragte er und deutete auf das Getränk. „Ach das, ja, das ist etwas Besonderes. Wir trinken es nur, wenn von uns große Anstrengungen erforderlich sind, wie zum Beispiel vor einem Kampf. Es ist von der Gumpaya-Pflanze und stärkt sämtliche Muskeln, macht widerstandsfähig und läßt die Nerven auf Hochspannung steigen.“
Nach dem Essen verabschiedeten sie sich von Amuja und ritten los. Vorne weg Sigurd, dann Peter, gefolgt von Taliv. Ein paar Kinder folgten ihnen schreiend bis zum Dorfausgang, und von einem Feld winkten ihnen ein paar Frauen zu.
Schnell hatten sie das Dorf hinter sich gelassen. Der Weg endete bald und ging in eine satte Wiese über, auf der gelbe, rote und weiße Blumen blühten und den grünen Untergrund mit einem erfrischenden Muster bedeckten. Büsche mit roten Beeren lockten zum Verweilen und Pflücken ein, aber die drei hatten dafür keine Augen. Dunkler Tannenwald begleitete sie auf dem Weg und zog sich seitlich wie eine Linie, hinführend zu einem Gebirge, das sich immer drohender auftürmte, je weiter sie ihm entgegen ritten.
„Dahinten soll es sich aufhalten“, wies Sigurd nach vorne. Über ihnen flog eine Schar Vögel, die Peter nicht kannte. „Das sind Kibassen“, rief Taliv und zeigte nach oben. „Die schmecken sehr gut, wenn sie am Feuer gebraten werden.“ Peter nickte und merkte, wie das Gelände plötzlich etwas hügelig wurde. Sigurd brachte sein Pferd in eine ruhigere Gangart, und die anderen folgten ihm. Langsam ritten sie immer mehr bergan, und die Landschaft mit den Bäumen und Wiesen lag bald unter ihnen. Der Weg vor ihnen veränderte seine Gestalt bei jedem Schritt. Immer mehr Steine und Geröll lagen darauf und das erschwerte den Pferden die Möglichkeit, ohne Stolpern vorwärts zu kommen. So stiegen sie von den Pferden und beschlossen, die Pferde anzupflocken und zu Fuß weiterzugehen.
Kleines Kuschelgebüsch und Moos waren die einzigen Pflanzen, die ihnen nun begegneten. Der Berg zu ihrer Linken wuchs immer riesiger in die Höhe und verdeckte das Sonnenlicht, so dass sie sich auf der Schattenseite befanden. Da hier oben der Wind heftiger wehte, fröstelte Peter ein wenig. Den beiden anderen machte es nichts aus. Sie waren solche Temperaturunterschiede gewöhnt.
Plötzlich hörten sie ein fürchterliches Brüllen, das aus einer der Höhlen kommen musste, die vor ihnen im Gebirge lagen. Es hörte sich an wie das Brüllen eines Löwen. Dazwischen tönte es wie das Scharren von Hufen, das ein wilder Büffel oder Stier von sich geben würde.
Die drei sahen sich an, und Sigurd nahm seine Waffen fest in die Hand. „Na, dann los. Pirschen wir uns vorsichtig heran.“ Vorsichtig eilten sie in geduckter Haltung in Richtung des Gebrülls und nutzten jede, noch so kärgliche, Deckung aus. Das Geräusch wurde immer lauter und lauter. Plötzlich brach es wie mit einem Schwerthieb ab.
Sigurd und Taliv hatten sich hinter einem kleinen Felsen verborgen, während Peter nach einem anderen Schutz ausspähte. Er machte gerade ein paar schnelle Schritte in Richtung einer Bodenwelle, als gute 10 Meter vor ihm aus der Höhle ein grässliches Monster heraus trat und vorsichtig nach links und rechts äugte. Da sah es Peter und brüllte wieder laut auf, wie sie es vorher vernommen hatten. Peter war erschrocken stehengeblieben und starrte auf dieses schreckliche Wesen, das einen Körper wie ein riesiger Stier hatte. Doch vorne, wo eigentlich der Kopf hingehörte, befand sich ein menschlicher Rumpf mit menschlichen Armen, auf dem ein riesiger Löwenkopf mit einer mächtigen Mähne steckte.
Das Wesen, denn man konnte es nicht genau definieren, scharrte wild mit den Hufen. Dann galoppierte es auf Peter zu.
Sigurd ergriff seinen Bogen, legte schnell einen Pfeil auf und zielte in Richtung des Ungetüms. Doch was war plötzlich? Peter fühlte eine gewaltige Kraft in sich aufsteigen und gab Sigurd ein Zeichen, den Bogen zu senken. Ungläubig schauten er und sein Bruder auf das, was nun geschah.
Peter stand nun kerzengerade wie ein Gladiator aufrecht und streckte dem heranrasenden Ungetüm die rechte Hand entgegen. Ungefähr zwei Meter vor Peter stoppte es mit aller Kraft, dass die Hufe den Boden aufwirbelten, und brüllte Peter an.
Dieser blickte dem Monster ruhig in die Augen. Er hatte das Gefühl, dass er mit dem Wesen sprechen könne und begann, zu ihm zu reden. „Wie ist dein Name, und wo kommst du her?“ fragte er das sich beruhigende Sagenwesen.
Dieses blickte plötzlich sehr verwundert auf Peter und antwortete: „Du kennst meine Sprache, o Fremder. Das ist sehr verwunderlich, denn ich habe noch mit keinem, außer meinem Meister, gesprochen.“
Peter schwieg, denn er wusste darauf auch keine Antwort. „Nun, du fragtest mich nach meinem Namen. Ich bin Amadeus, und mein Meister hat mich gezeugt, um dieses Leben hier auszulöschen.“ Dabei ließ er wieder sein bedrohliches Brüllen hören.
Sigurd und Taliv waren starr vor Entsetzen. Sie beobachteten Peter, der ganz ruhig vor dem Monster stand und scheinbar mit ihm redete. Doch sie konnten kein Wort verstehen. Ohne auf ihre Deckung zu achten, kamen sie hinter dem Felsen hervor. Da erblickte sie das Ungetüm und ließ erneut sein Brüllen ertönen. Es stampfte mit den Hufen auf und wollte sich auf die beiden stürzen. Aber Peter erhob seinen Arm, und wie von einer magischen Wand gehalten, konnte das Tier nicht weiter.
Peter fühlte erneut in sich die große Kraft. Er wusste, dass Amadeus ein Computervirus war, der alle die Spiele vernichtete, die in den Computer seines Bruders installiert und gespielt wurden. „Ich mache dich darauf aufmerksam, dass du keine weiteren Spiele mehr zerstören darfst.“
„Aber ich muss! Das ist mein Auftrag, und mein Meister ist erst zufrieden, wenn ich alles zerstört habe“, war die Antwort von Amadeus.
„Wer ist dein Meister?“ fragte Peter, denn er wollte den Schöpfer dieses Virus erwischen.
„Das kann ich nicht sagen, ich kenne seinen Namen nicht! “ erwiderte sein Gegenüber.
Amadeus wollte die Unterredung beenden. „Ich fordere dich auf, den Weg freizugeben.“ Dabei stampfte er wütend mit den Hufen auf und versuchte, in Richtung Peter vorwärts zu drängen. Doch Peter dachte nicht daran, ihn mit seiner Zerstörung fortfahren zu lassen.
„Halt, es ist zu Ende, Amadeus!“ rief er dem grollenden Monster entgegen. „Du bist ja nur ein Virus, der keine Lebensberechtigung hat.“
„Das geht nicht, das kannst du mit mir nicht machen“, schnaubte dieser und versuchte, an der Seite vorbeizukommen. Es war nicht möglich, Amadeus kam an Peter nicht vorbei.
„Du hast die Dörfer und die Landschaft zerstört. Die Menschen hast du vernichtet, und du willst alle Spiele zerstören, die in den Computer geladen werden. Das kann ich nicht zulassen.“
„Was willst du denn dagegen tun, ha, ha?“ trotzte das Ungetüm auf, doch es fühlte, dass von dem kleinen Jungen eine unheimliche Bedrohung für ihn ausging.
Da erhob Peter seinen rechten Arm und hielt die Hand geöffnet hoch. Ihm kamen plötzlich Worte in den Sinn, die er laut aussprach: „Dubiosos Elementarum Logos Experimentarum Toros Eternitum Amadeus!“
Kaum hatte er diese Worte ausgesprochen, als ein mächtiger Lichtstrahl, aus seiner Hand kommend, das fürchterliche Wesen traf. Es brüllte auf und riss die Arme vor sein Löwenantlitz. Das Licht umhüllte Amadeus, und er schrumpfte in sich zusammen, als wenn er in einem Nebel verschwinden würde. Plötzlich war er gänzlich verschwunden, und der Spuk war zu Ende.
Peter senkte seinen Arm und drehte sich zu seinen Begleitern um, die nicht in der Lage waren, etwas zu sagen. Doch dann löste sich die Verkrampfung, die sie festgehalten hatte, und sie stürmten auf Peter zu.
„Hurra, du hast es geschafft, Peter. Das Ungeheuer ist tot. Es ist vernichtet.“ Peter blickte noch einmal zu der Stelle, wo Amadeus kurz vorher gestanden hatte. Er war selbst sprachlos über das, was geschehen war. Doch dann stieg eine große Freude in ihm auf. Er hatte es tatsächlich geschafft. Das Ungeheuer, der Virus, war vernichtet. Voller Freude sprangen die drei umher und umarmten sich.
„Nun lasst uns zurückkehren und die frohe Botschaft unseren Leuten überbringen“, mahnte sie Sigurd, „denn die Sonne geht bald unter“.
Sie machten sich auf und fanden die Pferde friedlich grasend vor. Sigurd und Taliv hatten es plötzlich sehr eilig und ritten voraus. Peter kam kaum hinterher.
„Sigurd, Taliv“, rief er ihnen nach, aber sie waren schon am Horizont verschwunden. „So eine Gemeinheit“, rief Peter, und er fühlte sich plötzlich hin und her geschüttelt.
„Hallo Peter, wach auf!“ Langsam drangen diese Worte an sein Ohr. Er blickte auf und sah in das Gesicht seiner Mutter. „Du hast im Traum gerufen“, sagte sie und wischte über seine Stirn, die schweißgebadet war. „Hast du einen Alptraum gehabt, mein Junge?“
Doch Peter schüttelte den Kopf. „Nein, ich habe den Amadeus vernichtet“, sagte Peter stolz. Aber er wusste nun, dass es ein Traum gewesen war, aber ein schöner Traum. Seine Mutter gab ihm etwas zu trinken und ließ ein wenig frische Luft ins Zimmer.
Eine halbe Stunde später kam Kalle aus der Schule. Er hatte seinen Kumpel Roman Schumann dabei. Kaum gab es eine Begrüßung, da waren die beiden schon in Kalles Zimmer verschwunden. Da die Tür nur angelehnt war, konnte Peter, der neugierig war, verstehen, was sie sagten. Doch es dauerte eine ganze Weile, bis ein Kommentar aus dem Zimmer kam.
„Was is'n Kalle, die Kiste geht doch“, maulte Roman und führte Sigurd gekonnt mit der Maus über den Monitor. Tatsächlich, sie waren schon längst über den Punkt gekommen, wo das Spiel immer abgestürzt war, und Roman konnte ungehindert die Titelhelden durch das Spiel führen. Kalle war sprachlos. „So ein Mist“, motzte er. „Bei mir ist das Ding immer abgestürzt. Das versteh' ich nicht.“
Peter war unbemerkt ins Zimmer gekommen. Er stand links neben Roman und starrte auf den Bildschirm. Da war ja Sigurd, und auch Taliv war zu sehen. Die drei verfolgten gespannt das Spiel. Auf einmal drehten sich Sigurd und Taliv um und sahen nun ins Zimmer zu den Jungen.
„Was machst du denn da?“ wollte Kalle wissen. „Na, nischt - siehste doch“, gab Schumi zur Antwort.
Da hoben Sigurd und Taliv ihren Arm und winkten ihnen zu. Auf dem Monitor erschien nun eine Schrift. „Hallo Peter, wir danken dir, alles Gute!“
Die Jungen starrten auf die Schrift. Kalle und Schumi sahen Peter mit großen Augen an.
„Verstehst du das, Kalle?“ fragte Schumi. Der zuckte sprachlos mit den Schultern.
Und Peter? Der lächelte in sich hinein und murmelte: „Es war also doch kein Traum!“ und verschwand überglücklich in sein Zimmer.
Miljöh 2
2. Wenn einer eine Reise macht!
Als Mehmet Gökan das Sozialamt verließ, begab er sich schnurstracks in das Türkencafé, das ihm und seinen Landsleuten zur zweiten Heimat geworden war. Hier waren sie unter sich. Es verlief sich kaum ein Deutscher in dieses Stammlokal, und wenn einer kam, dann hatte er türkische Freunde und kannte sich mit den Gepflogenheiten der türkischen Kultur aus.
Ja, Mehmet ging auch manchmal in Hebberts Stammkneipe „Bei Schorsch“. Dort hatten sie sich vor ungefähr zwei Jahren getroffen. Nach einigen belanglosen Gesprächen lernten sie sich näher kennen, und bald wurde daraus eine liebgewordene Gewohnheit, dass sie sich jeden zweiten Freitag dort zu ihrer Stammtischrunde trafen. Zu dieser Runde zählten auch Günter Pichlmayer, ein arbeitsloser, gestrandeter Alkoholiker mit dem Hang zum Philosophischen. Dann war Sergej Fedorow dabei, ein Russlanddeutscher, der erst vor gut einem Jahr aus Kasachstan übergesiedelt war. Neben Hebbert Kowalski gab es noch Fred Knippersbusch, der als selbständiger Schrotthändler manchmal seinen Frust ablud und sehr unzufrieden war. Diese zusammengewürfelte Gruppe, aus den verschiedensten Kulturkreisen, hatte sich in ihrem Milieu zusammengefunden und diskutierte in ihren Stammtischrunden über Gott und die Welt, über alles und nichts.
Es ging manches Mal heiß her, wenn sie ihre Kirchturmpolitik betrieben, wie es in ihrem Land und in der Welt geregelt werden sollte, damit die Menschen gut miteinander auskommen konnten. Ja, man sollte doch den einfachen Menschen öfter mal aufs Maul oder besser gesagt in das Herz schauen. Davon könnte mancher Politiker, der das normale Leben aus seiner hohen Warte nicht mehr kannte, noch etwas lernen.
Nun betrat Mehmet „sein Kahve“ und wurde von einigen Männern begrüßt: „Merhaba, Mehmet, nasilsin? (Guten Tag, Mehmet, wie geht es dir?)“
„Danke der Nachfrage, es geht gut“, antwortete Mehmet und setzte sich zu ihnen. Die Männer, die gemütlich ihren Mokka schlürften, unterhielten sich über Allah und die kleine Welt, in der sie lebten. Mehmet bestellte sich auch einen Kaffee. Da er noch heiß war, wartete er mit dem Trinken. Einige der Männer drehten bei der Unterhaltung ihre Tespih, ihre Gebetskette, zwischen den Fingern. Normalerweise wurden dabei die Koranverse gemurmelt; aber es diente auch dazu, eine gewisse Ablenkung zu haben.
„Was macht Ercan, dein Sohn?“ fragte ihn Ahmed, der einer der drei Besitzer des Türkencafés war. „Ja, Ercan macht sich gut in der Schule. Ich bin so froh darüber. Er hat auch keine Schwierigkeiten mit Almanca, mit deutsche Sprache, so wie ich.“ Dabei grinste Mehmet ihn an. Denn sie wussten alle hier, dass sie zwar gerne in Deutschland lebten, aber sie mochten auch ihre Kultur beibehalten. Nur die jungen Türkinnen und Türken, die hier geboren wurden, fühlten sich halb deutsch und halb türkisch. Es kam oft zu schwierigen Auseinandersetzungen in den Familien, besonders mit den Mädchen. Viele von ihnen konnten nicht verstehen, dass sie nach dem alten Glaubens- und Sittenkodex leben sollten, besonders was ihre Bekanntschaft zu deutschen Jungen anbelangte.
Nicht nur die Väter und Mütter hatten ein waches Auge auf die Töchter geworfen, sondern auch die Brüder wachten oft eifersüchtig darüber, dass ihre Schwestern keinen Kontakt mit deutschen Jungen pflegten. Sie wollten unter sich sein! Denn es war für einen türkischen Jungen auch nicht leicht, eine deutsche Freundin zu bekommen. Obwohl dieses jedoch öfter zu sehen war als umgekehrt.
Auch Mehmet erzog seine Töchter nach diesen islamischen Grundsätzen. Noch waren sie klein. Aber Ayse, die Älteste von ihnen, sah mit ihren zwölf Jahren auch schon den Jungen nach. Aber das tat sie heimlich, damit keiner etwas merkte. Nur Ercan, der große Bruder, hatte sie dabei einmal erwischt. Er gehörte jedoch nicht zu denjenigen, die ihre Schwestern gleich bedrohten oder auch manchmal schlugen. Nein, Ercan hatte ganz ruhig mit seiner Schwester gesprochen und versuchte, ihr klarzumachen, dass es besser wäre, noch nicht mit Jungen anzufangen. „Das schickt sich nicht“, hatte er ihr gesagt. Und Ayse hatte ihn mit gro-ßen Augen angesehen und geantwortet: „Und ihr Jungens dürft wohl alles, was?“ Doch Ercan hatte besonnen auf sie eingeredet. Da gab Ayse dann nach. Doch wie lange das vorhielt, wusste er nicht.
Nun zurück zu den Männern in ihrer Gesprächsrunde. Es war zu verständlich, dass sie ihre Probleme aus ihrer Sicht betrachteten. Gerade zeigte einer von ihnen auf einen Artikel des Hürriyet, einer türkischen Tageszeitung. Darin ließ sich der Redakteur über neue Ausschreitungen der rechten deutschen Szene aus.
Schon wieder hatten Punker einen Asylantragsteller aus Sri Lanka angegriffen und schwer verletzt. Das stieß bei den Anwesenden auf große Ablehnung, und die verschiedensten Meinungen, von gemäßigt bis radikal, prallten hart aufeinander.
„Diese Deutschen meinen, sie könnten machen, was sie wollen! “ „Man müsste diese Nazis in türkische Gefängnisse sperren, da würden sie was erleben und hätten nicht mehr so große Fresse wie jetzt.“