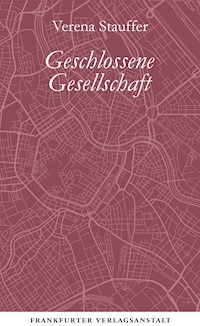
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Stauffer verwebt die Schilderung von Erlebtem und Imaginiertem geschickt – und findet damit eine poetische Sprache für die seltsamen Gefühlszustände während des Lockdowns.« Die Presse Nur scheinbar folgen die zwischen Realität und Traum oszillierenden Aufzeichnungen ihrer äußeren Chronologie, beginnend im November 2020 in Wien, sogleich nämlich emanzipiert sich der Text, führt zu einer tieferen Ebene in ein fantastisches Uhrwerk, dessen Zeiger stillstehen: Wir folgen der Erzählerin auf Spaziergänge im menschenleeren Prater und flanieren durch die nächtliche, gesperrte Stadt, genaue Beobachtungen wechseln sich ab mit kleinen scharfen Sequenzen und lyrischen Passagen. In welchem Paradies lebten wir – aus heutiger Perspektive betrachtet – und was wird im Sommer sein? »Verena Stauffer findet stimmungsvolle Worte für einen Ausnahmeszustand. Es ist ein Buch voller subtiler und stiller Schönheit, voller Wortpoesie und Wortklang; und außerdem äußerst abwechslungsreich.« Karoline Pilcz, Buchkultur »Die niederösterreichische Schriftstellerin hat ein realistisches Gerüst gebaut. Auf dem steht sie ab November 2020 und stellt fest, dass die Pandemie Fehler in der Gesellschaft offenbart. Dabei wechselt sie ins Surreale. Stauffers oft lyrischer Ton sorgt dafür, dass man nun den Schnee hören kann und die Engel über dem Wienfluss sieht. Trotz (wegen) der Fantasien wird unsere Zeit eingefangen, und man fürchtet, dass nachher keine neue Welt entsteht, sondern die alte zurückkehrt.« Peter Pisa, Kurier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 171
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
»Ich lebe in diesem Text, treibe von Zeile zu Zeile, spiele tote Frau. Nur hier in diesem Meer kann ich schwimmen, doch jetzt friert es von allen Seiten zu.«
Die zwischen Realität und Traum oszillierenden Aufzeichnungen Verena Stauffers beginnen im November 2020 in Wien, doch folgen sie nur scheinbar ihrer äußeren Chronologie. Immer mehr emanzipiert sich der Text, führt zu einer tieferen Ebene in ein fantastisches Uhrwerk, dessen Zeiger stillstehen: Wir begleiten die Erzählerin auf Spaziergänge durch den menschenleeren Prater und flanieren mit ihr durch die nächtliche, gesperrte Stadt, genaue Beobachtungen wechseln sich ab mit kleinen scharfen Sequenzen und lyrischen Passagen. In welchem Paradies lebten wir aus heutiger Perspektive betrachtet, und was wird im Sommer sein?
Witzig und frech, traurig und tröstend zugleich offenbart Verena Stauffer in ihren Aufzeichnungen ein Ich als Zentrum in einer Zeit, in der die Sehnsucht nach Berührung wächst. Ein Protokoll des »Wahnsinns, der jetzt all die Fehler in der gesamten Anlage der Gesellschaft offenbar macht« und ein Zeugnis, wie Poesie und Fantasie retten können.
Verena Stauffer
Geschlossene Gesellschaft
Inhalt
7. November 2020
14. November 2020
15. November 2020
16. November 2020
17. November 2020
18. November 2020
19. November 2020
20. November 2020
21. November 2020
22. November 2020
25. November 2020
26. November 2020
1. Dezember 2020
2. Dezember 2020
4. Dezember 2020
11. Dezember 2020
12. Dezember 2020
13. Dezember 2020
17. Dezember 2020
18. Dezember 2020
19. Dezember 2020
27. Dezember 2020
31. Dezember 2020
1. Januar 2021
2. Januar 2021
3. Januar 2021
5. Januar 2021
6. Januar 2021
9. Januar 2021
10. Januar 2021
11. Januar 2021
16. Januar 2021
17. Januar 2021
19. Januar 2021
20. Januar 2021
24. Januar 2021
29. Januar 2021
30. Januar 2021
31. Januar 2021
2. Februar 2021
3. Februar 2021
5. Februar 2021
6. Februar 2021
7. Februar 2021
8. Februar 2021
12. Februar 2021
13. Februar 2021
14. Februar 2021
15. Februar 2021
17. Februar 2021
19. Februar 2021
20. Februar 2021
21. Februar 2021
26. Februar 2021
27. Februar 2021
28. Februar 2021
7. November 2020
Gerade wohne ich in Wien-Ottakring, in der Wohnung eines Oberösterreichers namens F, der nach Kolumbien ausgewandert ist und eine dauerhafte Nachmieterin für seine hübsche, wie er selbst sagt, Maisonette sucht. Ich selbst bin nur übergangsweise hier, da ich ein für mich günstigeres Apartment gefunden habe, das ich bald beziehen werde.
F schickt mir oft Fotos von seinem Haus in Santa Marta, von seinem Garten voll verschlungener Brotnussbäume, Kokospalmen, Fettkräuter, Maiblumen und Sonnentau. Von Kapuzineraffen, Kreischeulen, apfelgrünen Vögeln und Kindern, die auf dem feuchten Erdboden auf Blättern kollern und mit schwarzen Augen in die Baumkronen blicken, ganz verträumt, ohne Scham und Sorge.
Obwohl wir uns nicht kennen, schreibt F mir immer wieder, wir fühlen uns ein wenig verbunden, vermutlich weil ich in seiner Wohnung lebe, die noch voll mit seinen Sachen ist. Er erzählt mir, dass er in Kolumbien eigentlich ein Hotel bauen wollte, nun wird es nur ein Kiosk, denn es sei beschwerlich, die Baumaterialien müssten mit Eseln einen Hügel hinauftransportiert werden, und ich komme nicht umhin, an Werner Herzogs Film Fitzcarraldo oder auch an Schlingensief mit seinem Operndorf in Afrika zu denken. Auch F ist Musiker und Regisseur.
Hier in Ottakring ist es ganz anders als bei dir, schreibe ich ihm, sei froh, dass du bist, wo du bist, und nicht hier, denn alle fünf Minuten heulen Sirenen der Polizei- oder Rettungswagen auf, sie rasen vorbei, ins nahegelegene Spital. In der Umgebung wurde ein radikal-islamistischer Verein aufgelöst, schreibe ich weiter, in dem sich der Terrorist vom 2. November und auch andere Terrorverdächtige regelmäßig aufgehalten hatten. An jenem Tag hörte das Heulen gar nicht auf. Im Wilhelminenspital verstarb ein Opfer des Anschlags. Zusätzlich werden viele Coronapatienten dahin gebracht, glaube ich. Nachts ist es aber recht still, und heute, Sonntag, auch.
Ich bin in Österreich, lebe in Wien, es ist Terror und es ist Lockdown light, während F in Kolumbien in eine Passionsfrucht beißt, das bittersüße Gelee lässt ihn seinen Mund verziehen, stelle ich mir vor, ehe er schelmisch grinst.
Die Wohnung hier in Ottakring hat bis auf eine große Terrassentür nur Dachfenster, und oft sitze ich und schaue in den Himmel. Kürzlich war so ein heller Vollmond, der meinen Körper im Bett strahlen ließ, so als wäre ich selbst der Mond und der eigentliche Mond eine weiße Sonne. Da war auch ein Satellit, der den Himmel entlang zog, doch dann blieb dieser mit einem Mal stehen, ich kam zu dem Schluss, dass es sich wohl um einen Stern handeln müsse. Wie wohl Mond und Sterne in Kolumbien aussehen? Ob Fs Haus da auch solche Dachfenster hat und er nachts in den Himmel starrt?
Neulich habe ich mit ihm videotelefoniert, weil er mir zeigen wollte, wie ich in seiner Wohnung den Wasserdruck der Therme erhöhen kann, was ich auch erfolgreich erledigte. Ich trug einen dicken, grau melierten Strickpullover, er saß mit nacktem Oberkörper auf seiner Terrasse in Sierra Nevada de Santa Marta. Er fragte mich, ob es denn in Wien schon sehr kalt sei, ich sagte, es sei nicht sehr kalt, aber frisch, er meinte dann, er vermisse den Schnee.
Gestern sagte ich ihm, dass ich wider Erwarten immer noch in seiner Wohnung sei, weil ich für meine neue Wohnung, in die ich schon bald langfristig übersiedeln werde, eine Matratze bestellt habe, diese aber nicht ankäme. Weder sei sie in die neue Wohnung geliefert worden, noch hat sie, obwohl ihre Retoursendung via Sendungsverfolgung nachzuweisen ist, nach Tagen wieder das Lager des Möbelhauses erreicht. Ich muss in einen Schildbürgerstreich verwickelt sein, sagte ich. Mittlerweile habe ich den Kauf der Matratze storniert und sie erneut bestellt, jedoch wurde das neue Modell bisher nicht der Post übergeben. Er fragte mich daraufhin, ob ich seine Frau und ihn nicht einmal in Kolumbien besuchen wolle, auch er habe hier schon viele Schildbürgerstreiche erlebt. Gerade sei er bei einer Familie der Arhuaco, einem indigenen Volk in Kolumbien – er schrieb »Indianer« –, zum Essen eingeladen und es sei völlig irre, inmitten des Regenwalds meine Sprachnachricht aus Wien zu hören.
14. November 2020
Rückblick: Moskau verließ ich nach Aufruf zur Heimkehr von Schallenberg im März. Mein liebstes Buch, ein großer Essayband von Montaigne, mein Feuerkleid und auch mein Fellmantel blieben zurück. Zurück ließ ich auch mein Rosenknospen-Ei, ein transluzid rotes und opak goldenes Fabergé-Ei, das auf meinem Moskauer Schreibtisch, neben Montaigne, auf schimmerndem Fuß thronte und glitzerte. Je mehr Zeit vergeht, desto stärker wird das Verlangen, zu diesen Dingen zurückzukehren.
Eingelebt hatte ich mich nach sechs Monaten in der russischen Metropole noch nicht. Moskau ist größer als New York, und ich mag nicht behaupten, die Stadt zu kennen. Aber fühle ich mich ihr verbunden, auch wenn sie zugleich meine Möglichkeiten, sie zu erfassen, übersteigt, es gibt Dinge dort, die ich auf Anhieb verstehe und andere, die ich nicht verstehen kann, wie das Gefühl, in China zu sein oder umgekehrt in einem futuristischen, dennoch abgewrackten Spaceland. Das Grau, die Rauheit und Brutalität, die mir entgegengebracht wurde, verdrängte ich, und irgendetwas in mir verband sich mit einer fehlgeleiteten Romantik, denn ich bin so dumm und idealisiere das einfache Leben für den Staat, die Gleichmütigkeit der Gesichter in der U-Bahn, deren Wagons eisern rattern, als führe man mit Hochgeschwindigkeit direkt in das Werk eines tiefliegenden Bergstollens. Jeden Abend schlief ich ein, und noch ehe ich erwachte, war die Stadt erwacht. In Berlin war das umgekehrt, und Wien liegt genau dazwischen.
Das knusprige Brot mit Korianderkruste, das süßsaure Beerenkompott als Limonade, die Syrniki, Piroschki und Wareniki, das alles waren Licht- und Anknüpfpunkte, die den Tisch mit Wärme füllten. Der Bauernmarkt im Außenbezirk bildete tausend Plateaus, nicht Moskau ist Russland, dachte ich, sondern dieser Ort als ein Wald aus gestapelten Pilzen, Honig in Waben, Nüssen, Beeren, fetten Fischen, weißem Fett und Fellen, Mandarinen und Bergen an Melonen, er stand für den Staat ein. Als orale Impfung verkaufte mir eine Bäuerin Honig gegen das Virus. Ich schleckte einen ganzen Topf aus und knabberte dabei getrocknetes Bärenfleisch. Ich aß Schokoladensalami und trank Schnaps aus Zapfen, und wenn er mir angeboten würde, dann ließe ich mir auch den russischen Impfstoff in die Venen jagen.
Nun schwebt Moskau mir nur mehr vor. Einzelschicksale versinken in dieser Stadt wie eine Prise Salz im Schnee und bleiben doch unvergessen, das macht die Gemeinschaft, die nicht gespalten ist. In der Uniformität liegt die Schönheit der Gerechtigkeit als Maske obenauf. Diese möchte ich tragen, so dumm bin ich.
Einmal hatte ich das Gefühl, in einer Schneekugel zu stehen, ich sah nicht mehr, wo oben und unten war, die Kristalle wirbelten in alle Richtungen. Ich stand mitten auf der Straße, konnte weder wegsehen noch weitergehen. Die Zeit verwirbelte mich, und plötzlich existierte ich nicht mehr, ich hatte mich aufgelöst, die Flocken und die Größe ihrer gemeinsamen Ausdehnung, die fremden Worte und die Weite des Lands hatten mich wie ein Stäubchen verschluckt. Deshalb ist es gut, vorerst wieder zurück zu sein. Nun lebe ich in Wien. Und ich lebe in Wien, wie ich nie zuvor in Wien gelebt habe. Das Nicht-ausreisen-Können hat mich in die Stadt eintauchen lassen, bis in die Donau.
15. November 2020
Meine Zeit in Fs Wohnung ist nun auch abgelaufen, ich schrieb auf, dass ich fortwolle, auch ohne Bett, mit oder ohne Matratze, ich wolle nun meine vier Wände beziehen, raus aus seiner Welt, seinen Utensilien, Sammelsurien, die seine Geschichte verdeutlichten und meine auf ein Neues verwischten. Doch was eignete sich als Ersatz, um mich soft zu betten? Wie sollte ich schlafen? Ich könnte Zeitungen entfalten, knittrige Magazine stapeln, doch das wäre zu knarzig, spießig wie auf Toilettenpapier. Zudem die Artikel, die ich lesen müsste, sobald ich zu Bett ginge, was mich eines jeden Schlafs berauben würde. Sollte ich das Möbelhaus Piringer kontaktieren? Mit einem Mal seufzte ich schwer, ließ mich in meinen Sessel sacken. So eine Matratze aus virtuellen Buchstabenblumen, so ein Datenbett, ich weiß nicht, dachte ich, ob das etwas taugt? Bestimmt wäre es auch völlig überteuert.
Da fiel mir etwas ein. Schnell lief ich zu einer Kaffeerösterei, fragte, ob ich Jutesäcke haben könne, die größten und festesten. Es gab sie nur mit Kaffee gefüllt, egal, ich trinke die Brühe ohnehin literweise, die Bohnen würde ich einfach in die Badewanne schütten. Da der Geruch des Kaffees für ein Bett zu stark war, musste ich einen anderen Füllstoff suchen.
Nun sitze ich in meiner neuen Wohnung, auf einem neuen Berliner Sessel aus Eichenholz, den ich mir online bestellt habe, ohne zu merken, dass er aus Berlin kam, denn eigentlich sieht er wie ein Wiener Sessel aus. Die Wohnung liegt in einem alten Haus, es könnte aus dem Mittelalter sein, man erahnt noch die Dunkelheit der Nöte. Kälte und Feuchtigkeit muss ich den dicken Wänden erst austreiben. Dem Gebäude sitzt die Pest in den Mauern und jetzt zieht eine neue Seuche ein, auch wenn die Bewohner noch versuchen, sie über zwei Tore hinweg hinauszusperren. Sperr zu, Flut, knurr, weg da, sperr weg, raus, aus, hau raus, ab! Es ist ein Montaigne-Haus, ich spüre mit einem Mal den Geist seiner Zeit und das in meinem Zimmer! Beseelt lehne ich mich zurück. Hier hat schon einmal jemand seine Fäden gesponnen, und jetzt spinne ich, ich ziehe sie aus mir heraus, ich spinne wild, webe.
16. November 2020
Heute war ich zweimal draußen. Für mich ist das viel. Zuerst holte ich den Jutesack aus der Rösterei, dann machte ich mich auf die Suche nach Füllstoff. Im Hof meines Innenhauses steht ein Baum, sein Laub hat er schon verloren, aber er trägt noch gelbe Butterballäpfel. Ich überlege, ob sie sich als Füllung eignen würden, doch die anderen Mieter beschwerten sich sicherlich, beraubte ich den Baum seines leuchtenden Schmucks.
In einer Straße ohne jede Grandezza sah ich einen Lieferanten aus einem Auto steigen, hinter seinem Rücken zog er einen Blumenstrauß hervor. Einen so großen habe ich selbst erst einmal erhalten, damals waren es weiße Lilien und ein Schächtelchen voller Samen. Plötzlich hatte sie Grandezza, die ganze Straße erfüllt vom Bouquet aus apfelroten Rosen, weißen Schwertlilien, hellgrünen Freesien und Schleierkraut.
Auf dieses Erlebnis hin holte ich mir in alter Tradition der bürgerlichen Wienerin einen kleinen Karton mit drei Brötchen von Trześniewski: Pfefferoni, Wilder Paprika und Karotte mit Gervais, dazu ein Glas Henkel trocken. Im Geheimen stieß ich mit der Blumenempfängerin an und ihre Freude schwappte auf mich über, ein Sprudeln.
Dennoch, sputen sollte ich mich, bald würde wieder eine Ausgangssperre verhängt und wie absurd, es erinnern mich diese Zustände dann mit einem Mal an Moskau, wo polizeiliche Macht und Überwachung ständig spürbar und erlebbar waren. Westlich vom Roten Platz ist eine Kreuzung, in meiner Erinnerung ist sie fünfmal so groß wie der Stephansplatz, von allen Himmelsrichtungen führen mehrspurige Straßen auf sie zu, eine geht nordöstlich in Richtung Kreml, Wächter und Schranken kann man erkennen. Als ich einmal zu Fuß von der Brücke zur Kreuzung kam, sprang die Ampel für meinen Übergang auf Rot, doch die Autos blieben stehen und nach ein paar Minuten Wartezeit in praller Sonne fiel mir auf, dass auch alle anderen Ampeln auf Rot gestellt waren.
Eine halbe Stunde war die Kreuzung gesperrt, alle warteten, niemand hupte, niemand schimpfte, Staus bildeten sich, denn Moskau ist eine Millionenstadt der Fahrzeuge. Nach gefühlt vierzig Minuten fuhr ein Konvoi schwarzer Limousinen vom Kreml her kommend auf mich zu, raste an mir vorbei über die Kreuzung hinweg, verschwand auf einer leergefegten Fahrbahn. Meine Ampel sprang Minuten später auf Grün. Mit einem mulmigen Gefühl des bedingungslosen Unterworfenseins durch eine allgegenwärtige, normalerweise unsichtbare Macht, wanderte ich eher wie maschinell gesteuert am Kreml vorbei, passierte das Ewige Feuer und gelangte durch den Ostzugang auf den Roten Platz, der wie eine Marslandschaft weitgehend leer war, bis auf ein paar Trauben chinesischer Reisegrüppchen, die auch Truppen hätten sein können, abgesandt zur Wahrung eines Scheins.
Nun aber, spute dich!, rufe ich mir selbst zu, denn vielleicht gelten die Ausgangssperren ja schon ab morgen, was dann? In meiner Vorstellung sehe ich mich bereits in dunklem Mäntelchen an Mauern entlanghangeln und versuchen, flüsternd von Tür zu Tür zu huschen, in die Sprechanlagen murmeln, fragen, ob jemand fälschlicherweise meine Matratze erhalten habe.
In diese Situation durfte ich mich erst gar nicht bringen, ich raffte mich auf, wagte mich nochmals hinaus, lief Richtung Naschmarkt, öffnete Mülltonnen. Klapp, plopp und klirr. Es sollte ja etwas sein, das niemand mehr brauchte. Etwas, das vielleicht gut verrottete und der Jutesack dadurch mit der Zeit weicher wurde. Ich dachte an Kastanien und Blätter, doch die Kastanien, die brauchten die Rehe, die nachts in Büscheln durch die Stadt raschelten, außerdem war es schon Spätherbst, es kollerten einem kaum mehr welche vor die Füße.
Ich öffnete eine Tonne nach der anderen, ehe ich erschrak, Hühnerkrallen, Schweinefüße und Hasenläufe streckten sich mir entgegen. Zuerst schlug ich den Deckel wieder zu, dann aber dachte ich: Fülle ist Fülle, besser als auf dem nackten Lattenrost zu schlafen. Ich füllte meinen Sack mit Tierläufen, die Tonne war groß, es wurde kaum weniger, ich konnte aus dem Vollen schöpfen. Weiter unten kamen die Köpfe, Felle und Häute, war mir nur recht. Ich hoffte, ungesehen zu bleiben. Schwer trug ich nach Hause, dort überzog ich den Jutesack mit zwei Leinentüchern und war fürs Erste beruhigt. Ich hatte ein Lager.
Jetzt konnte mir die Matratze des Möbelhauses gestohlen bleiben!
Über Nacht rann Blut aus meinem roten Samtbett, es sickerte in die Fugen des Parketts. Es war nicht mein Blut, das war das Gute.
Später stand ich auf und holte mir Kaffee aus der Badewanne.
17. November 2020
F schickt ein Video aus Kolumbien.
Palomina, eine weiße Eselin, ihr Leib in ein Geschirr aus Leinen gespannt, vier Holzbalken eingehängt, die sie durch einen Fluss hinter sich herzieht und weiter einen Weg bergauf, sie tariert Unebenheiten aus, stolpert über Steine, ihre Hufe versinken im Sand und im Hintergrund ruft F: »Mi amor! Mi amor Palomina!«
Ein weiteres Bild erreicht mich, die Eselin hinter einem Gatter, es ist Nacht, nur ihr Fell und viele kleine Wolken leuchten, ihre Augen zur Kamera gerichtet.
Dann ein Foto von F, im Vordergrund er selbst auf einer Erhöhung, auf der Erde kahles Geäst, im Hintergrund eine Kakaoplantage, Palmen. F trägt eine weite graue Baumwollhose, einen breiten Strohhut, eine Leinenlasche quer über den Oberkörper, sein Blick nicht frei von Sorge und Stolz, direkt in die Linse gerichtet, wobei er zu beiden Seiten von zwei Männern flankiert wird, vermutlich aus dem Stamm der Arhuaco, die Nachkommen der Taironas sind, wie auch das Volk der Kogui, Wiwa und Kankuamo.
Ich lege mein Handy zur Seite, lehne mich zurück. Nun beginnt das Sterben, denke ich, jeden Morgen wird es heißen, es sei dieser oder jener Mensch an den Folgen des tödlichen Virus umgekommen, so wie in Wolfgang Hilbigs Erzählung Alte Abdeckerei, in der im Radio der Eltern jeden Tag die Liste jener Bürger verlesen wird, die verschwunden waren, nur wurden sie offiziell nicht Verschwundene genannt, sondern Gesuchte, wobei allen klar war, dass niemand sie mehr suchen würde, sie auch nie mehr wiedergefunden würden. Es ist jedoch anzunehmen, dass es sich bei Hilbig um jene Bürger handelt, die aus der DDR geflüchtet waren oder aber um solche, die das Regime verschwinden ließ. Die österreichische Regierung steuerte das Land in den letzten zwei Monaten wie einen Zug ohne Bremsen ins Nichts, der eine Teil der Mitbürger schaufelte Kohle in den Ofen, auf dass es gut dampfte und der Zug nur schneller führe, während alle anderen still auf ihren Plätzen saßen und warteten, worauf? Auf eine Art Endstation in China? For proper disposal of excreta and other secretions, please dissolve 10 disinfectant tablets in the toilet before defecation. Let the excreta and disinfectant fully contact for ONE HOUR before flushing the toilet.
Die Toten der Pandemie werden dann Verschwundene sein, keine Gesuchten. Es werden auch keine Geflohenen, sondern eines gewaltsamen Todes Verstorbene sein. So eine Pandemie ist doch gewaltsam, es ist eine gewaltsame äußere Einwirkung, die für manche zum Tod führt, eine unbekannte Größe, gegen die es keine Formel gibt. Es ist ein Verschwinden, das ich aufhalten möchte, ich möchte es aufhalten, ich möchte es eindämmen und zugleich möchte ich nach draußen, in eine Bar und mit mir völlig fremden Menschen das Leben feiern.
Marina Zwetajewa schreibt, es gäbe die Liebe, sie sei in einem jeden, und dann ist ein jeder da noch selbst, das wären bereits zwei und zwei seien genug. Jeder, der noch zusätzlich dazukäme, zerstöre diese harmonische Zweisamkeit. Das ist ein poetischer Gedanke, eine krude Theorie, die Erfüllung in der Abwesenheit eines Anderen sieht, doch ich glaube, Erfüllung liegt eher dort, wo zwischen zwei sich haltenden Händen eine Wunde heilt, jahrelang gebildetes Eis der Hochgebirgswälder und Klüfte wie im warmen Westwind langsam schmilzt, in Quellen zerfließt und sprudelt.
Sibirisches Blau mit grauem Granit. Ein Blick in Bernsteinaugen. Farben, die ineinander versinken. Ein Dauern, ein Andauern, ein Hin- und Fort- und wieder Hinsehen. Sehen und nichts mehr sehen zugleich. Dann die Bar, wie sie zu Staub zerfiel. Die Theke, die Tische, die Gin-, Whiskey-, Absinth- und Rumflaschen in den Regalen, die Hocker, die Menschen, ihre Taschen, Mäntel, all das löste sich in ein Rieseln auf. Nur die beiden standen in Wolkendust, im Sehen. Dann das Lächeln des Himmels.
Das war die Nacht, in der die französische Bar zu Staub zerfiel.
18. November 2020
Lulos seien toll, schreibt F, aus dem gelblich-grün schleimigen, süß-sauren Gelee wird in Kolumbien Fruchtbutter gemacht. Er wolle diese nach Europa exportieren, man müsse sie nur mit Wasser oder Milch mixen, schon erhielte man einen Fruchtshake, es sei nur das Virus, das alle Handelsaktivitäten in Schach hielte. Auch sein Kakao sei bald reif. Die Bohnen werden in der Bodega einer Kooperation gesammelt und dann gemeinsam mit jenen der anderen Kakaobauern der Region verarbeitet.
Ein Bild von zwei apfelgrünen Papageien, sie sitzen auf einer Sessellehne, blicken in die Kamera. Der Sessel hat einen Holzrahmen, der mit einem Geflecht gefüllt ist, es kommt dem bekannten Wiener Geflecht ein wenig gleich, andererseits erinnert es mich eher an die Saiten eines alten Tennisschlägers, viel größere Abstände als beim Wiener Geflecht und dicke, runde Schnüre aus weißem Bast.
Der Bau seines Kiosks sei in der Zwischenzeit fortgeschritten, schreibt F weiter. Als Schriftstellerin, so meint er, könne man vor ihm »in der Kühle des Mangobaums« sitzen und schreiben. In den Pausen spränge man in den Fluss oder ins karibische Meer. An den weißen Stränden Korallenriffe, Kokospalmen und Riesenkakteen, dahinter die schneebedeckten Gipfel der Sierra Nevada.
Vor kurzem sehnte ich mich noch nach Kolumbien. Jetzt weiß ich, dass ich hierbleiben muss, um Sorge zu tragen, dass auch niemandem etwas passiert.





























