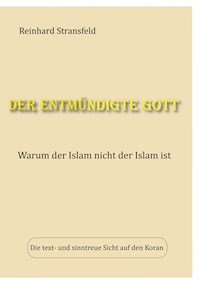Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im Krieg gegen alle, sah einst Thomas Hobbes das Individuum, bevor die Staatsbildung gelang. Dabei profitierten bereits frühesten Lebensformen von Gemeinschaften, die einzelnen Mitglieder wie in der evolutiven Fortentwicklung der Gattung. So wurde auch der erste Mensch in eine familiale Gemeinschaft hinein geboren. Dank Initiative, Flexibilität und wohl auch Aggressivität hat der Mensch sich an die Spitze der Evolution und der Nahrungsketten gesetzt. Er erwies sich als derart erfolgreich, dass ihm inzwischen droht, an den Grenzen der Ressourcen auszuzehren. Die Möglichkeit des Scheiterns an sich selbst ist allerdings in keiner Verfassung der Welt zeitig bedacht worden. Das Buch beschäftigt sich mit den Gründen, die in die prekäre Lage geführt haben. Diese sind so elementar und antriebsstark, dass sich die Frage aufdrängt: Hat der Mensch als Kulturwesen noch eine Überlebenschance? Sie wird allenfalls in Maßnahmen zu finden sein, die im Sinne des Prinzip Verantwortung von Hans Jonas gegenwärtige Schranken von Recht und Ethik in verstörender Weise durchbrechen müssen, um der Größe und Tücke der Probleme gerecht zu werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Im Krieg gegen alle“ sah einst Thomas Hobbes das Individuum, bevor die Staatsbildung gelang. Dabei profitierten bereits früheste Lebensformen von Gemeinschaften − die einzelnen Mitglieder wie die evolutive Fortentwicklung der Gattung. So wurde auch der erste Mensch in eine familiale Gemeinschaft hinein geboren. Dank Initiative, Flexibilität und wohl auch Aggressivität hat der Mensch sich an die Spitze der Evolution und der Nahrungsketten gesetzt. Er erwies sich als derart erfolgreich, dass ihm inzwischen droht, an den Grenzen der Ressourcen auszuzehren. Die Möglichkeit des Scheiterns an sich selbst ist allerdings in keiner Verfassung der Welt zeitig bedacht worden.
Das Buch beschäftigt sich mit den Gründen, die in die prekäre Lage geführt haben. Diese sind so elementar und antriebsstark, dass sich die Frage aufdrängt: Hat der Mensch als Kulturwesen noch eine Überlebenschance? Sie wird allenfalls in Maßnahmen zu finden sein, die im Sinne des „Prinzip Verantwortung“ von Hans Jonas gegenwärtige Schranken von Recht und Ethik in verstörender Weise durchbrechen müssen, um der Größe und Tücke der Probleme gerecht zu werden.
Inhalt
Vorbemerkung
Einführung
1 Wie alles begann
1.1 Frühe Formen der Gesellung
1.2 Biologische Gesellschaften
1.3 Grenzen des Lebens
2 Sozialbeziehungen des Menschen
2.1 Der Weg zur Zivilisation
2.2 Die Neolithische Revolution
2.3 Feudalgesellschaften
2.4 Neuzeit
2.5 Weg in die „Moderne“
2.6 Weitere Schritte
2.7 Gegenwart
3 (Un)vermeidbares und Versäumtes
3.0 Gemeinschaften – Gesellschaften – Weltgemeinschaft?
3.1 Demokratie
3.2 Familien
3.3 Komplexität
3.4 Psychopathen
3.5 Bevölkerung
3.6 Umwelt: Klima / Boden / Biomasse / Biodiversität
3.7 Die Rolle Gottes
4 Gegenwehr
4.1-3 Demokratieabbau / Familiendominanz / Überkomplexität
4.4 Psychopathenabwehr
4.5 Überbevölkerung
4.6 Umweltschutz
5 FAZIT
Literatur
Endnoten
Vorbemerkungen
„Gesellschaft“ ist ein facettenreiches Wort. Umgangssprachlich kennen wir die „feine Gesellschaft“ oder sagen, „er befindet sich in schlechter Gesellschaft“. Die „Reisegesellschaft“ steht für temporäre Gemeinsamkeit; die „Gesellschaft für Freiheitsrechte“ ist wie viele andere dauerhaft für ein gemeinsames Anliegen eingerichtet. Zudem existieren mit speziellem formalrechtlichem Status die „Aktiengesellschaft“ sowie die „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ zur Verfolgung wirtschaftlicher Interessen. Ferner gibt es wissenschaftliche Gesellschaften wie die Max-Planck-Gesellschaft.
Gemein ist allen Gesellschaften, ob temporär oder zeitlich unbegrenzt, der Zusammenschluss einer größeren Zahl von Individuen. Es mag, unbeabsichtigt, den Umständen geschuldet sein, wie etwa die Geburt in einer Dorfgemeinschaft. Oder zweckgerichtet, um mit höherer Erfolgschance als allein handelnd gemeinsame Ziele anzustreben. Letztlich befindet man sich auf der Ebene von Völkern bzw. Staaten.
In den Gesellschaftswissenschaften, speziell der Soziologie, findet die systematische Beschäftigung mit Gesellschaften und deren Strukturen, Ausprägungen und Ereignissen statt, im Einzelnen mit den zwischenmenschlichen Beziehungen und Interaktionen. Im frühen 19. Jahrhundert hatte der französische Mathematiker, Philosoph und Religionskritiker Auguste Comté der Soziologie ihren Namen gegeben; zunächst hatte er noch von einer „sozialen Physik“ gesprochen. Demgemäß war sein Weltbild mechanistisch – eine von Experten gelenkte deterministische Gesellschaft, in der menschliche Existenz „verwaltet“ wird. Mit dem Verdikt eines „mathematisierenden Materialismus“ belegt, blieb seine Geltung begrenzt.
Mit seinem Hauptwerk „Gemeinschaft und Gesellschaft“ begründete im Jahr 1887 Ferdinand Tönnies die Soziologie in Deutschland. Bereits im Titel bahnt sich eine differenziertere Sicht auf „Gesellschaft“ an. Unter Einbezug von Psychologie und Biologie entwickelt Tönnies die Dichotomie einer sich entgegenstehenden Begrifflichkeit. Tatsächlich ist „Gemeinschaft“ jedoch die ursprüngliche, überschaubare Form von Gesellung. Sie geht zunächst folgerichtig mit der Familienzugehörigkeit einher. In ihrem Zusammenhalt beruht sie wesentlich auch auf emotionalen Faktoren. Darin stellt „Vertrauen“ ein zentrales Element dar.
Im Zuge einer „historischen Phase der Individualisierung“, ergab sich nun, so Tönnies, dass der Einzelne sich der Anderen zunehmend auf instrumentelle Weise bedient. Sie seien ihm Mittel zu seinen eigenen individuellen Zwecken. Jeder für sich und „im Zustande der Spannung gegen alle“, charakterisiert er gesellschaftliche Verhältnisse. Anders als in der Gemeinschaft bilden nun Tauschverhältnisse den Kitt, der die Gesellschaft zusammenhalte.
Stellt Tönnies Gemeinschaft und Gesellschaft begrifflich gegeneinander, entfaltet Dieter Claessens einen Dualismus aus funktionalen Zusammenhängen. Der Unterschied sei eine Folge von Größe, lautet seine Kernthese. Mit der Differenzierung in „Das Konkrete und das Abstrakte“ hat er eine anthropologische Dynamik postuliert, die für das Verständnis und die Bildung von Ordnungen entscheidend sei.
Danach nehmen Menschen in überschaubaren Gruppen bis etwa 15 Mitglieder untereinander spontan und ohne Beachtung bzw. ohne das Erfordernis von Förmlichkeiten »primär motiviert« Kontakt auf.
Erfahrungen von Nähe und Vertraut sein sind Träger wechselseitige Bereitschaften, sich zu unterstützen, Nahrung zu teilen, in gefährlichen Situationen zu helfen u. ä. Die Begrenztheit primärmotivierter Kontakte kann jeder an sich selbst prüfen, wenn er seine (wirklich) guten Freunde aufzählt. Gewöhnlich sind zunächst Familienangehörige inbegriffen. Die ausgeprägten familialen Bindungen in islamischen Kulturen finden darin ein biosoziales Fundament.
Werden Gruppen größer, wird sukzessiv formale Organisation erforderlich: Regelwerke, Zwischenebenen, schließlich eine Hierarchie. In zunehmend komplexen Systemen wird Motivation vornehmlich durch äußere Faktoren gefördert: Entlohnung, Status, Ehrungen etc. Nunmehr ist Verhalten verstärkt »sekundär motiviert«.
Einen deutlich unterschiedenen Zugang zum Phänomen „Gesellschaft“ bietet der Begriff „Wertschöpfung“ – materielle Basis menschlicher Existenz, der Natur abgerungen. Lebten die Menschen als Jäger und Sammler noch in kleinen familialen Gruppen − also in Gemeinschaften − änderten sich die Verhältnisse. Mit dem Übergang zur Landwirtschaft (und Sesshaftigkeit) wuchs das Nahrungsangebot massiv und damit die Zahl der Menschen. Die „neolithische Revolution“ hatte in allen bevölkerungsreichen Agrarzivilisationen eine fundamentale Aufspaltung der Gesellschaft zur Folge:
„Der Ackerbau hat die Menschen in zwei einander fremde Hälften zerlegt – die Herrenschicht oben und die große Masse unter ihr. In manchen Gesellschaften schienen Masse und Herren nicht einmal zur selben Art zu gehören – die Götter hatten die einen aus Eisen, die anderen aus Gold geschaffen (Platon)“.1
In der marxistischen Lehre werden die sich daraus ableitenden Entwicklungen von der Sklavengesellschaft über die Feudalgesellschaft bis zur kapitalistischen Gesellschaft als „Klassengesellschaft“ verstanden.
Ein dichotomisches Konzept kann der Komplexität heutiger Gesellschaften letztlich nicht gerecht werden. So entwickelten sich spezielle Soziologien. Sogenannte Bindestrichsoziologien sind auf einzelne Objektbereiche des gesellschaftlichen Lebens konzentrieret: Bevölkerungs-, Betriebs-, Kultur-, Religions-, Stadt-, Techniksoziologie, um nur einige aus einer Liste von annähernd 80 Untergliederungen zu nennen. So gesehen, existieren zwei unterschiedliche Zugänge zu gesellschaftlichen Phänomenen: der eine mit normativem Duktus, also wertorientiert, der andere mit affirmativem Charakter, auf gegebene spezifische Funktionen und Verhältnisse fokussiert.
Im Hauptfeld der Soziologie werden Gesellschaften als sich entfaltende Entitäten wahrgenommen, gewöhnlich geprägt von zunehmender Größe und Komplexität. Mit der Diversifizierung ist die Notwendigkeit öffentlicher Diskurse gewachsen. Dies, um angesichts verschiedenartiger Anschauungen und Wertvorstellungen konsensfähig zu bleiben. Durch das hohe Maß an Arbeitsteilung haben zudem die wechselseitigen Abhängigkeiten zugenommen, damit der Bedarf an vertrauenswürdigen Informationen und Institutionen.
Frühere Klassifikationen etwa nach ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder ideologischer Ausrichtung mit innerhalb der Segmente wenig unterscheidbaren Subjekten wichen dynamischen Konzeptionen. Den Interaktionen zwischen individuellen und gesellschaftlichen Akteuren wird vermehrt Aufmerksamkeit gewidmet. Damit geht eine Öffnung für sozialpsychologische und psychologische Sichten einher. In der Rollentheorie rückt schließlich das Individuum ins Zentrum: „Hart im Geschäft, aber sonst eine Seele von Mensch“, formuliert Max Frisch im „Biedermann und die Brandstifter“ einen nachgerade allegorischen Zwiespalt, in den der Mensch als Subjekt aufgrund der Positionierung in unterschiedlichen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens gerät. Nicht zuletzt daraus mag der Wunsch nach einer Vereinfachung und Entflechtung der Lebensverhältnisse resultieren. Sprach Karl Marx von Entfremdung, ist es bei David Riesman die Einsamkeit in der Masse, die den Stand der Zivilisation spiegelt. Jedoch hat es jene zufriedene, sich selbst genügende Existenz jemals gegeben? Wie war es am Anfang – in der Morgenröte der Menschheit?
Wenn auch Fiktion, galt vormals zum Wesen des frühen Menschen im Naturzustand hier und da das Bild einer einsamen Kreatur, sich gegen feindliche Andere behauptend (Thomas Hobbes, 17.Jh.).2 Noch in 20. Jhd. wurde zuweilen die Vorstellung vom einsamen Individuum propagiert.3 Heute wird insbesondere im neoliberalen Gedankengut die Fiktion vom Einzelkämpfer gepflegt.
In Jahrzehnten haben die Gesellschaftswissenschaften ihr Spektrum stetig erweitert. Der evolutionären Tiefe menschlicher Existenz hat sie allerdings wenig Beachtung gewidmet. Bisher mangelt es ihr im Ganzen am Blick auf die biologische Fundierung des Menschen und seiner Gesellschaft. Gehen wir daher zurück – ganz weit zurück, bis zum Anfang der Dinge, geleitet von dem Gedanken, ein umfassendes, treffendes Bild zu erlangen.
Einführung
„Viele Hände machen rasch ein Ende“, lautet ein Sprichwort. Schlicht und wahr, liegt darin der unübertreffliche Nutzen von Gemeinschaft: Sie ist als Ganzes mehr wert als die Summe ihrer einzelnen Mitglieder. Ein triviales Beispiel: Ein Baumstamm soll auf einen Wagen geladen werden. Wenn, je nach Größe, ein Dutzend oder mehr Personen sich daran beteiligen, ist es zügig zu bewältigen. Dem Einzelnen wäre es auch bei größtem Kraft- und Zeitaufwand unmöglich. Wenn nun menschliche Intelligenz hinzutritt, scheint schlichtweg alles möglich zu sein. Als eine Erschwernis erweist sich bei wachsender Größe der Gruppe indes die Abstimmung des Handelns – dass alles wunschgemäß funktioniert und nicht ein großes Chaos entsteht. Dafür bedarf es Organisation, Regeln und Verfahrensweisen.
Über Jahrtausende sind gewaltige Regel- und Rechtswerke entstanden – schier unüberschaubar und angesichts häufig sich widersprechender Anforderungen niemals vollständig und für jedermann zufriedenstellend. Jedoch wurden Verfassungen geschaffen, die die Grundlagen und Werte einer Gesellschaft festhalten und gewissermaßen als Eichmaß für Detailregelungen gelten können. Mit den Grundrechten in den ersten 20 Artikeln des deutschen Grundgesetzes sind zudem Orientierungen auf hohem ethischen Niveau gestaltet worden.
Eine Vorstellung wurde jedoch in keiner Verfassung der Welt berücksichtigt – dass der Mensch sich selbst zugrunde richten könnte, indem er seine Lebensgrundlagen ruiniert. Den Wirtschaftswissenschaftler Kenneth E. Boulding veranlassten die Verhältnisse zu einer boshaften Anmerkung:
„Jeder, der glaubt, dass exponentielles Wachstum in einer endlichen Welt ewig andauern kann, ist entweder ein Verrückter oder ein Ökonom“.
Der Sarkasmus verdeckt eine beklemmende Wahrheit. Der unglaubliche Umfang und die damit einhergehende Spezifität des Wissens führt dazu, dass fast alle in fast allen Dingen Laien sind und infolgedessen nur Facetten des großen Ganzen verstehen. Da nun aber fast alles mit fast allem − in Echtzeit − zusammenhängt, zeigt sich mit steigender Zivilisationshöhe und Wirkmacht immer später und zunehmend zu spät, was angerichtet wurde.
Nun heißt es seit Oktober 1994 im Art. 20a des Grundgesetzes:
„Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.“
Nüchtern betrachtet, ist es jedoch ein Lippenbekenntnis geblieben, weil nichts, was in diesem Sinne geschieht, zureichend ist. Überdies ist Deutschland ein Staat unter 194 anderen Ländern. Das Bild vom Schwanz, der mit dem Hund wedelt, gleicht einem Euphemismus angesichts des weitgehenden Unvermögens eines einzelnen Landes, wirksam gegen globale Dynamiken anzugehen. Dieses Buch beschreibt, wie es − im Grunde unvermeidbar − dazu kam. Gibt es einen Ausweg? Im Prinzip ja – aber wäre der Mensch noch derselbe, wenn er ihn beschreiten würde? Eher scheint es so, als würden politische Gestalten wie Trump und Putin ein Niedergangszenario im Sinne Oswald Spenglers anstreben und dessen Werk nachträglich bestätigen.
Und so mag das zu Beginn zitierte Bonmot eine größere, endgültige Wahrheit in sich bergen, als ursprünglich gedacht.
1. Wie alles begann
„Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer.“ So eröffnet die abendländische Bibel. Der ursprüngliche Text in der jüdischen Tora lautet jedoch: „Und die Erde war unförmlich und vermischt“. Tatsächlich entspricht dieses Bild eher dem realen Geschehen in der Genese unseres Planeten. Es währte Dutzende Millionen Jahre, bis aus einem zunächst lockeren Elementengemisch dank zunehmender Schwerkraft ein fester, heißer Ball wurde, dessen Kruste stabil genug war, um Strukturen zu bilden. Und früher als man es bis vor kurzem vermutet hatte, entstand Leben auf der immer noch von heftigen inneren Dynamiken strapazierten Oberfläche. Inzwischen hatte nämlich das aus dem Weltall stetig eingefangene Wasser Ozeane gebildet. Darin vollzog sich wohl die früheste Lebensschöpfung.
Und wenn auch der heiße, flüssige Erdkern aus Eisen und Nickel immer wieder kraft seiner Bewegungen die Situation auf der Oberfläche destabilisierte, waren eben diese Verhältnisse der Entstehung des Lebens vorausgesetzt. Denn der unruhige Kern bildete ein Magnetfeld (heute Van-AllenGürtel genannt). Es schützt seitdem den Planeten vor einem Großteil der zerstörerischen Strahlung von Sonne und Kosmos. Anderenfalls wäre es kaum zur Bildung lebender Organismen gekommen.4
Was ist überhaupt Leben? Ist es Produkt einer gewöhnlichen Fortentwicklung toter Materie – überall im Universum? Oder ist es einem seltenen Aufeinandertreffen spezifischer Verhältnisse und Ereignisse entsprungen? Oder entstammt es einer „Saat“ aus dem Weltraum und entzieht sich damit zunächst einmal einer Bestimmung? Wir wissen es nicht und werden es womöglich niemals erfahren.
„Leben ist ein Zustand fernab des Gleichgewichts“, formulierte Erich Jantsch knapp und bündig. Es ist auf stetige Energiezufuhr angewiesen, um sich zu erhalten. Empathischer kann man von einem Wunder sprechen. Galt doch mehr als zwei Jahrtausende das Verständnis des Aristoteles, dass der Übergang von der Ruhe in Bewegung durch ein direkt einwirkendes Äußeres zustande kommt. Im Christentum verfestigte sich die Vorstellung, dass Gott zu Beginn seiner Schöpfung einen unermesslichen Anstoß gegeben hat, der alle Zeiten hindurch weitergegeben wird. Mit Isaac Newtons Erkenntnis der fernwirkenden Gravitation verlor die „Stoßtheorie“ aber in der Physik ihre Bedeutung.5
Leben ist jedoch eigenaktiv, stellt ein sich selbst organisierendes und antreibendes System dar. Es dient in alldem einem Zweck: Selbsterhalt. Das unterscheidet Organismen grundsätzlich von der in sich passiven anorganischen Materie. Allerdings ist der Unterschied nicht als absoluter Gegensatz zu verstehen, wie es zunächst erscheinen mag.
In den 1830er Jahren ritt der englische Ingenieur John Scott Russell eines Tages an einem der vielen Treidelkanäle entlang. Dabei bemerkte er eine Welle. Einige Meter breit und etwa einen halben Meter hoch, begleitete sie ihn kaum verändert über mehrere Kilometer und sogar über einen Abzweig des Kanals hinweg. Ungefähr zur gleichen Zeit beschrieb Michal Faraday erstmals wissenschaftlich das Phänomen der „stehenden Welle“.
Heute bezeichnet man solche Phänomene mit Ilya Prigogine als „dissipative Strukturen“. Es handelt sich um „selbstorganisierende, dynamische Strukturen fern dem thermodynamischen Gleichgewicht“.6 Für seine Arbeiten hat Prigogine 1977 den Nobelreis für Chemie erhalten. Es existieren also bereits in der sogenannten toten Materie Strukturen, die sich dank ständiger Energieaneignung über längere Zeit selbst erhalten. Handelt es sich also lediglich um einen graduellen Unterschied?
Mitnichten, denn für das Leben ist das Selbsterhaltungsprinzip über die Existenz der gegebenen Struktur ausgedehnt: Es pflanzt sich fort. Das heißt, dass es eine Information über den Aufbau seiner selbst und dessen Erstellung abgibt. Zwar schöpft es seine Bausteine aus demselben Korb wie die sonstige Materie – wird aber zu etwas drastisch Anderem.
Zum frühesten Leben gibt es mehrere Erzählungen. Eine beginnt in der Tiefsee in der Nähe von heißen Quellen oder Vulkanen. Diese unwirtlichen Umgebungen bildeten gleichwohl ein Milieu, in dem vermutlich frühesten Lebensformen – Archaebakterien – ihr Auskommen fanden. Die andere Erzählung handelt von Cyanobakterien. Deutlich früher als bis vor kurzem angenommen, fassten sie vor annähernd 4 Milliarden Jahren zunächst in den flachen Schelfgewässern Fuß. Dies im wörtlichen Sinn. Sie bildeten auf dem Grund des flachen Meeres größere Gebilde, Termitenhügeln ähnelnd, in denen sie mittels Photosynthese Lebensenergie gewannen. Gewiss spekulativ, kann dennoch die Annahme gewagt werden, dass das „Fußfassen“ überlebensdienlich war. Nur die lichtdurchfluteten Schelfgewässer boten Gewähr für eine kontinuierliche Photosynthese. Wären sie nicht am Boden verankert, hätten Strömungen sie wohlmöglich in tiefere Schichten mitgeführt, in denen sie nicht lebensfähig gewesen wären.
Schließlich gibt es eine Sicht, die grundsätzlich an die Entstehung des Lebens heranführt. Leben setzt die Bildung sehr großer Molekülketten voraus, lautet das Grundverständnis.7 Das sei aber im Meer nicht möglich, da Wasser wie eine Schere auf die Ketten wirkt, sie also wieder zerteilt. Erst hinter einer Schutzhülle seien die Voraussetzungen gegeben. Der Aufbau der Schutzhülle setzt jedoch sehr komplexe Moleküle voraus, die ohne Schutz aber nicht gebildet werden können… Danach dürfte es Leben eigentlich gar nicht geben.
Es sei eben nicht im Wasser entstanden, sondern auf dem Land – in tiefen Höhlen, die Schutz vor der intensiven Strahlung boten, lautet ein Erklärungsversuch. Und hat sich dann ins Meer begeben?8
Jedenfalls war es zur Existenz gelangt. Und so entfaltete sich über Jahrmillionen eine Lebenswelt von Bakterien. Durch die Ausgasungen von Vulkanen hatte sich bereits zuvor eine Atmosphäre gebildet; sie bestand vornehmlich aus Wasserstoff, Kohlendioxyd und wohl auch aus Stickstoff. Das änderte sich im Verlauf von zwei Milliarden Jahren entscheidend. Im Prozess der Photosynthese durch die Cyano-Bakterien wurde kontinuierlich Sauerstoff freigesetzt. Als ubiquitär verfügbarer Energieträger war dieses Gas für bewegliche Organismen höchst geeignet. Allerdings nicht für die damals vorhandenen. Für sie war Sauerstoff größtenteils giftig und so vollzog sich die „große Sauerstoffkatastrophe“. Das vorhandene Leben wurde fast vollständig ausgelöscht. Die wenigen anpassungsfähigen Exemplare bildeten die Grundlage für die gesamte heute existierende Lebenswelt.
Zunächst blieb das Wasser Hort des Lebens. Im Laufe der nächsten Jahrhundertmillionen vollzog aber ein weiterer Wandel. Stetig wurde die Atmosphäre mit Sauerstoff, Abfallprodukt der Photosynthese, angereichert. Die nunmehr erreichte Dichte führte zur Bildung einer Ozonschicht in der Stratosphäre. Damit war ein weiterer Filter geschaffen, vornehmlich wirksam gegen die gefährliche UV-B-Einstrahlung. Vor 700 Millionen Jahren wurde es daher dem Leben im Prinzip möglich, die Meere zu verlassen. Es währte jedoch annähernd 200 Millionen Jahre9, bis zunächst den Pflanzen der Schritt aufs Land gelang. 100 Millionen Jahre später folgten Amphibien, sowohl im Wasser wie auf dem Land existenzfähig. Daraus ist in weiteren 400 Millionen Jahren die Lebenswelt hervorgegangen, wie wir sie heute vorfinden.
Kurzgefasst: Das Zusammentreffen besonderer Bedingungen war der Entstehung von Leben auf der jungen Erde vorausgesetzt. Und es ist durchaus fraglich, ob derartige Bedingungen an anderen Orten des Universums gegeben waren oder sind – jedenfalls um Leben zu ermöglichen, wie wir es verstehen. Dieses Leben blickt auf eine Geschichte und Entwicklung im Lauf von fast vier Milliarden Jahren zurück und wurde mehrfach fast bis zur Auslöschung herausgefordert, so bereits aufgrund der „Großen Sauerstoffkatastrophe“. Erst spät, in den letzten 10 Prozent der bisherigen Erdgeschichte, gelang die Expansion auf das Land. Dann aber erreichte die Evolution eine Dynamik, die alles Vorangegangene übertraf.
Nicht zuletzt durch Diversifizierung ist es der Evolution gelungen, allen Gefährdungen eines Untergangs zu entgehen. Die Vielfalt der Genome ist eine Schatzkammer, in der − bisher − auf interschiedlichste Herausforderungen Antworten gefunden wurden. Deren Erhalt kommt daher hohe Dringlichkeit zu.
1.1 Frühe Formen der Gesellung
Von Beginn an hatte sich das Vorhandensein anderen Lebens als äußerst nützlich erwiesen. Gesellung ist nicht lediglich eine mögliche Form der Existenz. Sie war und ist vielmehr für den Erhalt und vor allem für die Fortentwicklung von Leben von essentieller Bedeutung. Einzelwesen im „Naturzustand“ verharrten in archaischen Verhältnissen. Dort sind sie u.a. noch heute an den Ausgängen von Vulkanen in der Tiefsee anzutreffen. Zusammenhalt − oder zumindest Koexistenz − aber erwies sich nachgerade als Treibstoff der Evolution.
Cyanobakterien waren nach der Teilung zuweilen miteinander im Sinne des Wortes verbunden. Das geschah jedoch ungewollt, war Umständen der Vermehrung geschuldet: Zellwände lösten sich nicht vollständig voneinander, so blieben sie aneinanderhaften. Daraus entstanden allmählich in den flachen Schelfgewässern Termitenhügeln ähnelnde Gebilde; das erwies sich als erfolgsträchtig. Einige Hundert Millionen Jahre später, vor etwa 3,2 Milliarden Jahren, trat zweckgerichtetes Verhalten in Erscheinung. Verbünde von Mikroorganismen bildeten Schleimschichten: Biofilme, die ihnen Schutz gewährten, vornehmlich gegen übermäßige Einstrahlung, die aber auch als Basis für Überfälle auf andere Lebewesen dienten.10
Vor etwa 2,5 Milliarden Jahren traten erstmals Wesen mit Isogamen (gleichartige Keimzellen) in Erscheinung.11 Damit war ein erster Schritt zur geschlechtlichen Fortpflanzung geleistet.12
Im weiteren Verlauf waren es diese Wesen − Eukaryoten (kernhaltige Organismen) ⌐, die echte Sexualität entwickelten: Austausch von DNA sowie Weitergabe an Nachkommen. Erst vor 700 Millionen Jahren brachte die Evolution dann Wesen hervor, die dank Neuronen Lust empfinden konnten. Diese Sexualität regte die gezielte Suche nach Partnern an. Es war der erste Schritt zur Gemeinsamkeit, die nicht durch pure Zweckmäßigkeit definiert war. Nunmehr basierte Gemeinschaftsbildung auf Nützlichkeit und auf Begehren, zunächst in Gestalt von Trieben. Allmählich wandelte sich das Sexualverhalten zu komplizierteren Fortpflanzungsprozeduren, was auch Brutfürsorge und Brutpflege einschloss. Darin scheinen Phänomene auf, die bis zur Jetztzeit wirken.
Die sexuelle Fortpflanzung hat der Evolution gewissermaßen Flügel verliehen. In der bisherigen linearen Fortpflanzung beruhten Veränderungen auf Mutationen. Mit der Kombination verschiedenen Erbgutes wurde nunmehr deutlich rascher eine höhere genetische Variabilität erreicht. Diversifikation diente wiederum einer verbesserten Anpassungsfähigkeit an verändernde Umweltbedingungen. Damit ging eine Beschleunigung der Evolution einher. Ohne diese „Innovation“ wäre die großartige Ausdifferenzierung der Lebensformen und -arten vermutlich nicht erfolgt.
Es gibt jedoch Sichten, die die überragende Position der Sexualität für die Evolution relativieren. Entscheidende evolutionäre Sprünge seien durch den Zusammenschluss schon vorhandener Lebewesen entstanden und nicht durch zufällige Mutationen, die einer genetische Durchmischung entsprungen wären, wird argumentiert.
Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass ein lebensfähiger Organismus in der Regel alles andere als autonom, sondern vielmehr auf Lebewesen angewiesen ist, die eine andere DNA aufweisen und anderen Reichen angehören13.
Mit dieser neuen Theorie zur Evolution und Vererbung wendete sich Lynn Margulis gegen die gängige Vorstellung von „genetisch-homogenen Lebewesen“ als ein Resultat des Darwinschen Stammbaumes der sich ausdifferenzierenden Arten. Alles was als höhere Organismen bezeichnet wird, werde eigentlich in eine Welt der Bakterien hineingeboren und von ihr durchzogen und umschlossen.
Diese Erkenntnis ist ein Grundstein der Beschäftigung mit Symbiose: Formen von Verbindungen, die nicht zu gemeinsamer Nachkommenschaft führen, sondern eher als erfolgreiche Allianz weitergegeben werden. Vererbung gehe über die bloße Weitergabe von Genmaterial hinaus und schließe Symbionten mit ein. So bilden Mitochondrien, einst Element eigenständiger Bakterien, seit mehr als 1,6 Milliarden Jahren das Kraftwerk damaliger Zellvorläufer und versorgen die Zellen mit Energie.
Tatsächlich birgt ein durchschnittlicher erwachsener Körper um 30 Billionen Zellen und ist gleichzeitig von mindestens ebenso so vielen Bakterien besiedelt. Diese sind allerdings deutlich kleiner und leichter als Körperzellen, sie machen etwa zwei kg an Masse aus. Bakterien finden sich auf unserer Haut, unseren Schleimhäuten sowie in unseren inneren Organen, dies mit zahlreichen Arten. So lassen sich allein auf der Zunge 9.000 Arten zählen.14
Leben kann ohne anderes Leben schwerlich existieren. Dies sowohl in der Abfolge von Generationen, wie zeitgleich in räumlich-materieller Nähe. Natürlich wäre es vorstellbar, dass das, was lebt, ewig existiert. Oder dass es Prozesse gäbe, in denen unaufhörlich Leben aus der vorhandenen nicht-lebendigen Substanz gezeugt wird. Das scheint jedoch, soweit heute bekannt, nicht der Fall zu sein.
Im Übrigen spricht Margulis bedachtsam von „höheren Organismen“. Die niedrigsten Formen, Viren und Bakterien, werden nicht in eine „Bakterienwolke“ hinein gezeugt, mutieren dennoch zu unserem Leidwesen fast von Generation zu Generation in zuweilen bedrohlicher Weise, gleichermaßen Bakterien. So ist Mutation die ursprünglichste Form der Veränderung; sie hat sich als äußerst wirkungsvoll erwiesen.
Und wie weit man den Bogen der Gesellung auch spannt – der sexuellen Fortpflanzung kommt im Erfolgsweg der Evolution als Motor der Ausdifferenzierung gewiss das Primat zu.15 Im Zyklus der Generationen werden bei jedem Paar die Karten neu gemischt – mit Bauelementen, die sich bereits als lebensgeeignet erwiesen haben. Dafür spricht die Tatsache, dass in den letzten 10 Prozent Existenzdauer der Erde (mit sexueller Vermehrung) eine vielfach höhere Diversität herbeigeführt wurde als in Jahrmilliarden zuvor. Dazu trug allerdings auch die Expansion des Lebens aufs Festland bei.
Kurzgefasst: Die Evolution hat sich zunächst in drei epochalen Entwicklungen vollzogen. Vor etwa 2,5 Milliarden Jahren wurden erstmals Einzeller zur geschlechtlichen Vermehrung fähig. Wenig später trat in Gestalt von Ketten oder Kolonien ein Mehrzellern ähnelndes funktionsteiliges Verhalten auf. In dieser Phase machte sich der durch die Photosynthese im Wasser angereicherte Sauerstoff bemerkbar. Der als „Sauerstoffkatastrophe“ bezeichnete gewaltige Umschwung der Biosphäre bahnte sich an. Zunehmend füllte sich auch die Atmosphäre mit Sauerstoff auf. Etwa vor 700 Millionen Jahren war eine Sättigung erreicht, die zur Bildung einer Ozonschicht in der Stratosphäre führte. Dadurch wurde die UVB-Strahlung gedämpft − eine entscheidende Voraussetzung für die dritte epochale Entwicklung: Das Leben konnte sich aus dem Wasser aufs Land ausdehnen.
Das entwicklungsfähige Leben auf der Erde trat vor annähernd 4 Milliarden Jahren von Beginn an gemeinschaftlich auf. Zunächst eher zufällig, aber in einem noch frühen Stadium bereits gezielt, um als System Vorteile wahrzunehmen, die für Einzelwesen nicht erreichbar waren. Sehr früh fanden zudem Bakterien und Einzeller für kooperatives Vorgehen zusammen. Dies, um in Biofilmen gemeinsam Schutz vor Strahlung zu suchen. Aber auch, um sich als Jagdgemeinschaft andere Bakterien einzuverleiben.
Die „große Sauerstoffkatastrophe“ bildete einen tiefen Einschnitt in die Lebenswelt. Für die zuvor entwickelte anärobe Natur und nur wenige Arten konnten sich anpassen. Andererseits wurden Lebewesen unabhängig von einer stationären Energieversorgung.
Mit der zweigeschlechtlichen Vermehrung wurde der Boden für eine beschleunigte Diversifizierung bereitet. Vor etwa 700 Millionen Jahren, vollzog sich dann eine weitere bedeutsame Entwicklung in der Zweigeschlechtlichkeit: Dank Neuronen konnte Lust empfunden werden. Über Zweckmäßigkeit hinaus wurde Gemeinschaftlichkeit nunmehr auch emotional gesucht. Möglicherweise erfuhren die bis dahin noch primitiven mehrzelligen Wesen dadurch eine umfängliche Entfaltung. Zudem wurden Symbiosen zwischen Mehrzellern und Bakterien nun selbstverständlich, andererseits wuchs das Potenzial für Parasitentum.
1.2 Biologische Gesellschaften
Leben braucht anderes Leben – nachgerade eine Plattitüde. Wie aufgezeigt, kann davon ausgegangen werden, dass bereits bei frühestem Leben, bei Cyanobakterien, Gemeinschaftsbildung existierte. Hier war der Nutzen wechselseitig gegeben. Hingegen wirkt ernüchternd, dass der überwiegende Nutzen, den Leben aus anderem Leben zieht, im Verzehr besteht. Und so stellt heutiges Leben die winzige Spitze einer unfassbaren Pyramide Jahrmilliarden währenden gewaltsamen Sterbens dar.
Auf der untersten Stufe der Nahrungsketten befinden sich einige Bakterien und Pflanzen. Sie sind autotroph, versorgen sich also mittels Umwandlung von unorganischer in organische Substanz.
Bereits eine Reihe von Bakterien sowie Einzeller ernähren sich von organischen Substanzen: Kohlehydrate, Fette, Proteine. Dafür verzehren sie vornehmlich Bakterien, aber auch Pilze und Algen. Darauf aufbauend, haben sich Nahrungsketten gebildet. So etwa im Meer: Die Basis eines großen Teils des Meereslebens bildet das autotrophe16 Phytoplankton: Kiesel- und Grünalgen sowie Cyanobakterien (Blaualgen). Sie werden vom Zooplankton, z.B. Krill, gefressen, dies wird wiederum vornehmlich von kleinen Fischen (aber auch von Walen) einverleibt. Es schließen sich größere Fische an, schließlich die großen Raubfische: Tunfische, Delphine, Haie, um nur einige zu nennen.
Vergleichbare Ketten haben sich auf dem Land hergestellt. Gewöhnlich bilden Pflanzen die autotrophe Basis. So stellt das Leben eine Pyramide mit vertikalen Stufen (Nahrungsketten) und horizontalen Ebenen dar, auf denen sich Gemeinschaftlichkeit in unterschiedlichen Erscheinungsformen herausgebildet hat.
In grober Klassifizierung unterscheidet man Aggregation und Verband. Eine Aggregation ist eine Ansammlung von Tieren einer oder mehreren Arten, die zufällig zusammenkommen, etwa an einer Tränke. Sie nehmen sich zur Kenntnis, aber kooperieren nicht. Es existiert keine soziale Bindung.
Unter einem Tierverband versteht man eine Gruppe von Tieren, die einander aufgesucht haben und mehr oder weniger stark zusammenwirken bzw. zusammenarbeiten. Die Gruppenmitglieder bleiben grundsätzlich zusammen.
Der Zusammenhalt verstärkt sich, wenn es sich um Familienverbände handelt. Die Mitglieder werden in den Verband hineingeboren und sind selbstverständlich Mitglieder. Die Altersstufung bringt es mit sich, dass Jungtiere mit einer bestimmten Reife gewöhnlich den Verband, etwa das Rudel, verlassen bzw. verlassen müssen.
Im Übrigen existieren Verbände in vielfältigen Konstellationen. So wirken Fisch- oder Vogelschwärme in ihren Bewegungen wie verschworene Gemeinschaften. Tatsächlich finden sie zusammen, um Gefährdungen zu reduzieren. So schützt die Zugehörigkeit zu einem Schwarm die Stare vor Angreifern aus der Luft. Greifvögel als natürliche Feinde des Stars haben es so schwer, einen einzelnen Vogel innerhalb des Schwarms zu fixieren. Entscheidend zur Abwehr von Beutegreifern ist die synchrone Bewegung der Vögel zur Schwarmmitte.
Es handelt sich um eine offene Gemeinschaft. Die Vögel können sich nach Belieben anschließen oder den Schwarm verlassen. Nicht zuletzt aufgrund der Größe herrscht Anonymität. Die einzelnen Tiere kennen einander nicht. Die (scheinbar) synchronen Bewegungen entspringen nicht gemeinsamem Üben, sind vielmehr genetisch angelegt.
Anders verhält es sich in Insektenstaaten: Bienen Wespen, Ameisen. Die Mitglieder kennen sich nicht als Individuen. Sie erkennen sich jedoch an bestimmten gemeinsamen Merkmalen (z. B. dem Gruppengeruch, sodass zwischen Fremden und Angehörigen der Gruppe unterschieden werden kann. Im Unterschied zum offenen anonymen Verband sind die Individuen der geschlossenen Gruppe nicht beliebig austauschbar. Fremde Artgenossen werden deshalb am Eingang eines Bienenstocks aggressiv abgewehrt. So ergeht es gegebenenfalls auch Flüchtlingen eines zerstörten Volkes. Treffen Ameisenstaaten aufeinander, kämpfen sie gewöhnlich bis zum Tod, auch gegen die eigene Art.
Wiederum anders stellen sich die Verhältnisse in einer Brutkolonie von Vögeln dar. Zwar gibt es kein feste Gruppenzugehörigkeit. Jedoch kennen zumindest einige Gruppenmitglieder einander persönlich. Schließlich existieren kleinere Verbände, etwa unter Elefanten. Deren Mitglieder kennen sich persönlich. Gruppenspezifische Erkennungsmerkmale können vorhanden sein, sind aber letztlich nicht notwendig (da sich alle Tiere individuell kennen). Nur bei individualisierten geschlossenen Verbänden ist zu beobachten, dass das Verschwinden eines Gruppenmitglieds das Verhalten der anderen Mitglieder ändert, z. B. indem nach einem vermissten Gruppenmitglied gesucht wird.
Die verschiedenen Verbandsformen haben sich in Jahrtausenden, eher in Jahrmillionen herausgebildet. Im Gang der Evolution hat es sicherlich in jeder Species unterschiedliche Ansätze zur Gruppenbildung gegeben. Was sich heute darbietet, sind Verhaltensweisen, die sich angesichts der Umweltbedingungen als erfolgreich gezeigt haben. Deren Mitglieder haben überlebt und sich vermehrt.
Quellen: https://www.mefa.jena.de/images/bioweb/tierverb/Tierverb_Hannes_Carlo.htmlhttp://www.biologie-lexikon.de/lexikon/tierverband.php
Allen geschlossenen Verbänden ist gemein, dass Vertrauen und Nähe ausschließlich Mitgliedern gewährt wird. Fremde Artgenossen, die in das Territorium eindringen, werden unnachsichtig zurückgewiesen.
Die afrikanischen Bonobos, Vettern der Schimpansen, sind für ihr friedliches Wesen bekannt. Innerhalb der Gruppe treten die Weibchen solidarisch den Männer entgegen und dominieren die Gemeinschaft. Kommen dennoch Konflikte auf, wird etwa das führende Weibchen den männlichen Flegeln Sex anbieten, damit sie ihr Mütchen kühlen können. Werden aber fremde Artgenossen angetroffen, werden sie selbst von weiblichen Tieren unter Umständen sogar getötet.
Die eigene Schar bildet bei fast allen Tieren einen Mikrokosmos; die Außenwelt wird als indifferent, gegebenenfalls als feindlich wahrgenommen.
Klassifikationen wie die soeben angeführten bieten einen raschen Überblick. Allerdings entzieht sich die Wirklichkeit einer einfachen Zuordnung. So wird etwa unterstellt, dass in kleinen geschlossenen Gruppen sich die Individuen kennen. Das ist jedoch keineswegs durchgängig der Fall.
Um Kriterien der Zugehörigkeit herauszufinden wurde mit Ratten ein Experiment durchgeführt. Einem Nest wurden einige Jungtiere entnommen. Sie wurden gründlich gesäubert, sodann im Stroh eines anderen Nestes gewälzt. Anschließend wurden sie in ihr Geburtsnest zurückgesetzt. Dort wurden sie umgehend zerbissen. Trotz eines überschaubaren Standes von Mitgliedern gab es also kein Erkennen anhand individueller Merkmale. Allein der Nestgeruch entscheidet, ob ein Individuum als Mitglied erkannt wird – oder eben nicht.
Ist die Zugehörigkeit gegeben, können Ratten allerdings altruistisch handeln. So wurde eine Ratte mit einem Zweig in der Schnauze beobachtet, dessen anderes Ende hintan eine zweite Ratte in der Schnauze hielt. Offenbar war dieses Tier blind und wurde vom Gefährten durch das Gelände geführt.
Heikel ist gewöhnlich die Geburtssituation: Hat die Ziegenmutter keine Gelegenheit, ihr Zicklein unmittelbar nach der Geburt zu lecken, wird es nach nur wenigen Minuten der Trennung als Fremdling behandelt.17 Darin scheint ein generisches Momentum auf, mit einem Entscheidungsraum je nach Gattung in einer Zeitspanne von einigen Sekunden bis wenigen Stunden.
Andererseits werden Fremde nicht zwangsläufig als Feinde behandelt. So beschrieb es Alfred Brehm eine Beobachtung beim Zusammentreffen von Ameisen verschiedener Bauten.
„Warenaustausch, auch Austausch einer von Nachbarstämmen herbeigeschleppten Leiche eines »Stammesangehörigen« gegen z. B. einen Wurm (wobei eine Art Verhandlung geführt wird), eine Art von Ackerbau und »Viehhaltung« und vieles andere mehr, was unseren Bedürfnissen nicht so sehr fern liegt, wurden früh festgestellt und unterdessen in genaueren Beobachtungen präzisiert.“18
Generell gilt, dass die staatenbildenden Insekten nicht lediglich mechanisch-funktionale Wesen sind. Dem eben zitierten Ausschnitt geht voran:
„Wie Brehm vor 100 Jahren feststellte, ist das Leben der Ameisen nach Plutarch der Spiegel aller Tugenden: der Freundschaft, Geselligkeit, Tapferkeit, Ausdauer, Enthaltsamkeit, Klugheit und Gerechtigkeit. Sieht man von der Vermenschlichungstendenz in solchen − politisch tendenziösen – Aufstellungen ab, so bleibt ein bewundernswert hohes Maß an Koordination bei diesen Lebewesen. Der, das Gesamt-(»Staats«-)Wesen sichernde, Informationsfluß fällt ebenso auf, wie die zwar mechanisch wirkende, aber nach unseren heutigen Erkenntnissen doch mit einigen (wenn auch nach unseren Maßstäben bescheidenen) Frei-heitsgraden ausgestattete Motivation/ Aktivität.“
Bienen wird sogar unterstellt, dass „die Biene weiß, wer sie ist“, […] sie hat eine innere Welt“, so der Bienenforscher Randolf Menzel.19 Dank einer gewissen Intelligenz20 könne sie den Erfordernissen entsprechend flexibel ihre Funktion wechseln. Mehr noch:
„Schon relativ weit unten im Stammbaum des Lebens teilte die Evolution die Tiere in zwei verschiedene, große Entwicklungslinien auf: Am Ende der einen steht heute der Mensch, am Ende der anderen die Biene“21.
Im Hinblick auf Intelligenz hat die Evolution unter den Wirbeltieren − Säugetiere, Vögel, Reptilien, Amphibien, Fische − jene auf einen hohen Stand geführt, die in individuellen, geschlossenen Verbänden leben. In diesen Formationen existieren klare Hierarchien. So steht etwa den Leittieren gewöhnlich der erste Zugriff auf Nahrung, speziell auf Beute, zu. Um die Positionen wird gerungen, sei es mittels Posen, sei es in Kämpfen. Oft jedoch werden die erworbenen Positionen vererbt. Die Nachkommen übernehmen den Habitus der Mutter, bzw. der Eltern und setzen sich in der Gruppe durch.
Der Vorteil der Hierarchiebildung ist darin zu sehen, dass damit fortwährenden Konflikten vorgebeugt wird. Denn die niederrangigen Tieren tragen gewöhnlich duldsam ihr Los. Kommt es dennoch zu Auseinandersetzungen, greift, etwa bei Affen, das ranghöchste Tier ein und befriedet den Konflikt. Dabei wird häufig das rangniedrigere Tier bevorzugt – dies, um ranghöhere Kontrahenten, die ggf. mit dem Ranghöchsten konkurrieren könnten, durch Misserfolg zu entmutigen.