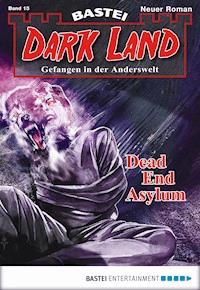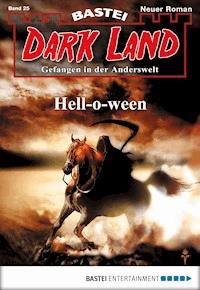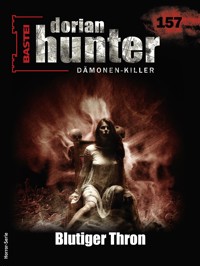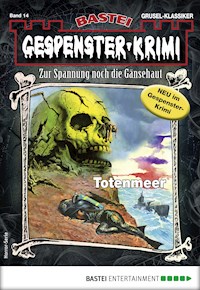
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Gespenster-Krimi
- Sprache: Deutsch
Totenmeer
von Logan Dee
Ich hatte wieder Gespenster gesehen. Die ganze Nacht. Den ganzen verfluchten Schlaf hindurch. Die Gespenster, das waren die Toten. Die toten Leiber meiner Kameraden. Sie schwebten an mir vorbei, Körper und Gesichter aufgedunsen, so, als hätten sie schon ein paar Tage im Salzwasser gelegen. Und doch waren sie erst seit wenigen Minuten tot. Mehr noch: Im Traum war sogar noch Leben in ihnen. Sie verzogen die Lippen zu einem verzerrten Grinsen, und ihre zu Krallen geformten Finger griffen nach mir. Wollten mich in jenen dunklen Schacht zerren, dem ich gerade erst entkommen war.
Ich schrie, und dann fiel mir auf, dass man unter Wasser doch nicht schreien konnte.
Das war der Zeitpunkt, an dem ich jedes Mal erwachte. In Schweiß gebadet, mit zitternden Gliedern. In solchen Momenten war ich heilfroh, dass ich noch lebte ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Totenmeer
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati/BLITZ-Verlag
Datenkonvertierung eBook: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-7325-7967-9
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Totenmeer
von Logan Dee
0. Windstille
Ich hatte wieder Gespenster gesehen. Die ganze Nacht. Den ganzen verfluchten Schlaf hindurch. Die Gespenster, das waren die Toten. Die toten Leiber meiner Kameraden. Sie schwebten an mir vorbei, Körper und Gesichter aufgedunsen, so, als hätten sie schon ein paar Tage im Salzwasser gelegen. Und doch waren sie erst seit wenigen Minuten tot. Mehr noch: Im Traum war sogar noch Leben in ihnen. Sie verzogen die Lippen zu einem schiefen Grinsen, und ihre zu Krallen geformten Finger griffen nach mir. Wollten mich in jenen dunklen Schacht zerren, dem ich gerade erst entkommen war.
Ich schrie, und dann fiel mir auf, dass man unter Wasser doch nicht schreien konnte.
Das war der Zeitpunkt, an dem ich jedes Mal erwachte. In Schweiß gebadet, mit zitternden Gliedern. In solchen Momenten war ich heilfroh, dass ich noch lebte …
Was mir zuerst auffiel, war die absolute Windstille.
Es war, als hielte die Welt den Atem an, bevor ich das NAMENLOS das erste Mal betrat.
Das Haus thronte direkt auf den Dünen. Es schien geradezu verwachsen mit ihnen, als sei es selbst ein Teil der Landschaft.
Direkt davor ging es fast senkrecht hinab – direkt in die schwarzen Wellen der Ostsee, die an diesem Stück Land kaum Gezeitenrückgang erkennen ließ.
Irgendwann würden die Wellen die Sanddünen so weit unterwässert haben, dass das Haus darüber einstürzen würde.
Doch noch war es nicht so weit. Und es schien, als trotze das NAMENLOS bereits seit Jahrhunderten seinem drohenden Schicksal.
»Das ist es«, sagte Frau Rotemund. Sie reichte mir den Schlüssel. »Aufschließen sollten Sie schon selbst. Is’ ja jetzt immerhin Ihr Haus.«
Ich hatte das Gefühl, dass sie mir den Schlüssel nur allzu gern überließ, als sei damit eine Last verbunden, die sie so schnell wie möglich los sein wollte.
Ich sah sie an und versuchte einmal mehr seit der vergangenen halben Stunde schlau aus ihr zu werden. Sie war zwischen vierzig und fünfzig, mit dünnen blonden, nach hinten gebundenen Haaren, schwarz geränderten Augen und einem schmalen roten Strich als Mund. Sie hatte mir sämtliche Unterlagen ausgehändigt und mir auch angeboten, weiter im Hause für Sauberkeit zu sorgen. Nicht nach Stundenlohn, sondern für einen festen Betrag.
»Meistens hilft mir meine Tochter. Zu zweit schaffen wir es viel schneller.«
Auch dabei hatte ich das Gefühl gehabt, dass sie froh war, wenn ihr die Arbeit schnell von der Hand ging. Nicht der Arbeit wegen, sondern weil sie dann wieder schnell aus dem Haus heraus war.
Ich nahm ihr Angebot an, obwohl ich glaubte, dass es nur aus einer Art von Pflichtgefühl erfolgt war.
»Warum mögen Sie das Haus eigentlich nicht?«, fragte ich sie geradeheraus, als ich den Schlüssel in Empfang nahm.
Sie sah mich mit einem Blick an, der Erstaunen und Ablehnung zugleich ausdrückte.
»Wie kommen Sie darauf, dass ich das Haus nicht mag?« Ihre Stirn verzog sich zu Falten. »Ich hätte sonst nicht für Ihren Vater gesorgt …«
Ja, das hatte sie wohl. Zuerst einmal die Woche, später jeden Tag. Nur was er für ein Mensch gewesen war, wie er geredet hatte, gelacht, was er gefühlt hatte, dass vermochte sie mir nicht zu sagen. Zugleich klang in ihrer Antwort eine stille Anklage: Ich habe für Ihren Vater gesorgt. Und Sie?
Gisela Rotemund übergab mir den Schlüssel. Er fühlte sich kalt an, obwohl er in ihrer Hand gelegen hatte. Ich hatte solch einen Schlüssel zuvor noch niemals gesehen, aber Gisela Rotemund hatte mir seine Funktionsweise erklärt: »Das ist ein Berliner Schlüssel – so hat ihn jedenfalls ihr Vater genannt, als ich ihn danach gefragt habe. Wir hier auf Fischland benutzen solche Schlüssel nicht.«
Das Besondere an diesem Schlüssel war, das er zwei Bärte aufwies – an jedem Ende einen. Man musste zunächst die Haustür aufschließen, den Schlüssel durch das Schloss schieben und erst nachdem man von innen wieder abgeschlossen hatte, konnte man den Schlüssel rausziehen.
»Das klingt kompliziert«, war mein erster Gedanke gewesen.
»Es ist kompliziert«, hatte Gisela Rotemund geantwortet. »Aber nur auf diese Weise konnte Ihr Vater sicher sein, wirklich von innen abgeschlossen und den Schlüssel abgezogen zu haben.«
»Hatte er etwa Angst davor, dass jemand hier einbrechen würde?«, wunderte ich mich.
Frau Rotemund zuckte mit den Schultern. »Wir sind hier ehrliche Leute. Hier bricht keiner ein. Wenn Sie mich fragen, dann hatte Ihr Vater etwas zu verbergen.«
»Gehen Sie da nicht etwas zu weit?« Ich fühlte mich herausgefordert, die Familienehre zu verteidigen.
»Hier bricht niemand ein«, wiederholte Frau Rotemund stur.
Ich nickte. »Das habe ich auch nicht andeuten wollen …« Ich hatte das Gefühl, mit jedem Satz, den ich sagte, die Missstimmung zwischen uns nur noch mehr zu vertiefen.
Es nieselte leicht. Ich überlegte, ob ich sie hereinbitten sollte. Ich hatte zwar nichts anzubieten, aber als versöhnliche Geste würde es sicherlich Wirkung zeigen. Bevor ich jedoch die Einladung aussprechen konnte, reagierte sie: »Also dann«, sagte sie und wandte sich um. »Ich geh dann mal.«
»Bis morgen!«, rief ich ihr hinterher. »Und noch einmal vielen Dank!«
Sie drehte sich noch einmal um, sah mich erstaunt an: »Vielen Dank? Wofür?«
Dann marschierte sie weiter, den schmalen Gartenpfad bis zum Gatter entlang, der zum Weg führte.
Erst als ich die Tür hinter mir und Ronja geschlossen hatte, wurde mir bewusst, auf was ich mich eingelassen hatte. Ich hatte einen Trennstrich zwischen mein bisheriges und zukünftiges Leben gezogen. Tatsächlich hatte ich nicht mehr als einen Koffer mit dem Notwendigsten dabei. Natürlich war mir bewusst, dass ich jederzeit wieder nach Hamburg zurückkehren konnte. Noch hatte ich meine Wohnung dort nicht aufgegeben. Und doch spürte ich, dass der erste Schritt hinein in dieses Haus eine neue Phase einläutete. Und das Schließen der Tür hatte etwas Endgültiges an sich.
Ronja rannte los und schnüffelte umher. Sie machte sich auf ihre Art das Haus zu eigen. Auch ich sog die Luft tief ein, um den Duft dieses uralten Gemäuers in mich aufzunehmen. Es roch nach Salz, wie das Meer, unterlegt mit einer leicht rauchigen Note wie bei einem guten Whisky. Und da war noch ein Geruch, ein leicht fischiger Odem wie von Algen oder Seetang.
Ich stellte meinen Koffer ab und stand eine Weile unschlüssig herum. Dann beschloss ich, es Ronja nachzumachen und das Haus einer ersten Inspektion zu unterziehen.
Zunächst nahm ich mir das Erdgeschoss vor. Von dem Korridor, in dem ich stand, führten drei Türen in die anderen Räume. Ich wählte die linke Tür und gelangte in einen Gastraum. Er war kleiner, als ich ihn mir vorgestellt hatte. Insgesamt mochten nicht mehr als zwei Dutzend Leute an den vier Tischen Platz finden. Die lange Theke nahm einen großen Teil des Raumes in Anspruch. Dahinter befand sich ein riesiges Arsenal mehr oder weniger hochprozentiger Getränke.
Der Geruch von abgestandenem Rauch und schalem Bier hing in der Luft, so als hätte mein Vater erst gestern noch hinter der Theke gestanden.
Seltsam, ich konnte ihn mir dennoch nicht als Wirt vorstellen. Was mochte ihn bewogen haben, hier, am Ende der Welt, eine Kneipe zu eröffnen? Verzweiflung? Geldnot? Letzteres konnte ich mir kaum denken, denn das Erbe, das ich ausgezahlt bekommen hatte, war zwar kein Vermögen, aber es hätte ihm den Ruhestand erleichtert. Auch hatte er über genügend Geld verfügt, um das NAMENLOS zu kaufen.
Der Gastraum war traditionsgerecht eingerichtet mit allerlei maritimen Erinnerungsstücken. Selbst das obligatorische Fischernetz fehlte nicht. Dennoch wirkte es an diesem Ort authentisch und ursprünglich. Es passte einfach hierher.
Die holzgetäfelten Wände waren über und über mit Gemälden und Fotografien bedeckt. Sie alle zeigten das Meer, die Wellen und Schiffe. Was das Besondere war: Die Rahmen hingen allesamt schief an den Wänden, so als wäre ein Orkan hier durchgefegt. Fast fühlte ich mich bemüßigt, damit anzufangen, sie gerade zu hängen, aber ich ignorierte den Impuls. Zu offensichtlich zeugte diese Form von Chaos von der Handschrift meines Vaters.
Ich blickte aus einem der Fenster. Es ging zu den Dünen hinaus, aber das Meer war deutlich zu sehen, wenn man den Kopf nach rechts drehte.
Der Gastraum wie auch die Theke waren L-förmig aufgebaut. Die eine Seite zeigte hinaus aufs Meer. Es war ein grandioser Ausblick, und ich konnte mir weitaus schlechtere Plätze vorstellen, als hier zu sitzen und mich zu betrinken. Fast glaubte ich, dass die hölzernen Dielen unter mir ein wenig schaukelten, als befände ich mich auf einem Schiff.
Ich hätte noch länger an diesem Ort verweilen und dem Auf und Ab der Wellen zusehen können, wenn ich nicht plötzlich ein Jaulen vernommen hätte. Ronja!
Im nächsten Moment hörte ich ihre trippelnden Laufschritte in der Etage über mir.
»Ich bin hier unten!«, rief ich überflüssigerweise.
Natürlich wusste sie, wo sie mich fand. Im nächsten Moment stürmte sie die Treppe hinunter und war bei mir. Spinnwebfäden und Staub verklebten ihre Schnauze. Sie drängte sich an mich, und ich tätschelte ihr leicht die Flanke.
»Wir werden es schon hier aushalten, wir zwei zusammen«, sagte ich. Dabei wurde mir bewusst, dass ich mehr und mehr zu ihr sprach, als wäre sie ein Mensch. Zumindest wenn wir unter uns waren.
Das machte wahrscheinlich die Einsiedelei.
Draußen fuhr jemand vor. Bremsen quietschten. Ronja begann, an meiner Seite wie verrückt zu bellen. Hätte ich sie nicht am Halsband gehalten, wäre sie davongestürmt.
Ich blickte aus dem Fenster und sah, wie sich eine massige Gestalt aus einem für sie viel zu kleinen Mercedes hievte. Der Mann war mindestens zwei Meter groß und unglaublich dick. Ich schätzte ihn auf über sechzig, aber vielleicht war er auch älter. Oder jünger? Seine Erscheinung erinnerte mich an Pavarotti. Er trug einen dunkelbraunen Pelzmantel, der ihm aufgrund seiner gedrungenen Statur bis zu den Waden reichte. Ich sah, wie er auf das Haus zu stampfte und glaubte fast, dass der Boden ein wenig vibrierte. Ronja knurrte inzwischen nur noch.
Eine zweite Person stieg aus. Im Verhältnis zu dem Mann wirkte sie winzig und zerbrechlich. Es war eine junge Frau in einem schwarzen Nadelstreifenkostüm. Der Rock war kurz, und unter dem Blazer schien sie nur einen BH zu tragen. Dennoch wirkte sie auf mich nicht feminin, sondern äußerst businessmäßig. Unter dem Arm trug sie eine dicke Aktentasche.
Ich befahl Ronja, endlich mit dem Geknurre aufzuhören, und begab mich zur Haustür. Es war offensichtlich, dass die beiden nicht gekommen waren, um die schöne Aussicht zu bewundern.
Noch bevor sie klingeln konnten, war ich an der Tür und hatte sie geöffnet.
Der Mann trug einen eher missmutigen Ausdruck zur Schau, doch als er mich erblickte, zeigte sich auf seinem Gesicht ein falsches Grinsen. Vielleicht war es auch nur geschäftstüchtig, jedenfalls machte es sein Gesicht noch breiter.
»Herr Sturm? Welch Freude, Sie zu treffen! Wir haben Sie schon tagelang erwartet. Ihr Rechtsanwalt …«
»… ist eine Plaudertasche«, ergänzte ich und gab einen innerlichen Seufzer von mir.
Dünnebacke hat mir Glaukamps Angebot unterbreitet und mir den Architekten beschrieben. So wie der Mann vor mir wirkte, konnte es sich nur um Glaukamp handeln. Ich hatte Dünnebacke gebeten, ihn mir vom Leibe zu halten.
Es hatte offensichtlich nicht lange gewirkt.
Während er mir seine riesige Pranke entgegenstreckte, fuhr ich fort: »Ich habe noch nicht mal die Koffer ausgepackt.«
»Macht nichts!«, entgegnete er. »Wenn Sie mein Angebot hören, lassen Sie die Koffer so, wie sie sind, und sind mir einfach unendlich dankbar.«
Er hatte eine derart einnehmende Art, dass ich nicht anders konnte, als einen Schritt zur Seite zu treten und ihn über die Schwelle zu lassen. Wahrscheinblich hätte er mich sonst plattgewalzt. Er sog die Luft ein wie ein misstrauischer Bär. »Faulholz«, dozierte er. »Schimmel!« Zwei, dreimaliges weiteres Schnuppern. »Kriegen Sie nie mehr raus! Das Haus fault Ihnen von innen weg. Da hilft nur eines!«
»Sie meinen Abriss?« Dünnebacke hatte mich gewarnt, aber dass Glaukamp derart schnell mit der Tür ins Haus fiel, hätte ich nicht gedacht.
Ich grinste ihn an.
»Sie glauben mir nicht?«
»Ich glaube, dass Sie darauf aus sind, das NAMENLOS zu kaufen. Und zwar wie der Teufel hinter den Seelen.«
»Ich mache keinen Hehl daraus!«, sagte er und guckte empört. »Ich habe noch nie lange um den heißen Brei herumgeredet. Auch Ihr Vater wusste, dass ich das NAMENLOS abreißen wollte. Und trotzdem hat das nichts mit dem Faulholz zu tun. Dieser Geruch … Sie müssen ihn doch wahrnehmen?«
Ich schüttelte den Kopf. »Mir wird schon nicht gleich das Dach über dem Kopf einstürzen.«
Glaukamp hatte mittlerweile des Schankraum erreicht. Er sah sich um, stürmte hierhin und dorthin und sog dabei immer wieder die Luft ein. Ich fand seinen Auftritt durchaus imposant.
Die Frau in seinem Schlepptau hatte ich völlig vergessen.
»Möchten Sie einen Kaffee?«, fragte ich.
»Nur ein Glas Wasser«, entgegnete sie reserviert. Ronja knurrte sie an. »Können Sie Ihre Bestie nicht von mir fernhalten?«
Ich lächelte. »Ich bin leider nicht unhöflich genug, Sie rauszuwerfen. Alle beide. Im Grunde haben Sie sich noch nicht einmal vorgestellt.
»Kleprekova, Gundula Kleprekova. Ich bin Herr Glaukamps rechte Hand.«
»Nett, Sie kennengelernt zu haben. »Das Glas Wasser bekommen Sie natürlich noch.«
Ich wandte mich um und ging zum Spülstein. Diese Kleprekova war eine eiskalte Braut. Gegen sie wirkte Glaukamp tatsächlich wie ein tapsiger Bär. Selbst Ronja ließ sich von ihm kraulen.
»Ihr Hund vertraut mir schon!«, rief er mir zu. »Und das sollten Sie auch, Herr Sturm.«
»Auch Wasser?«, rief ich zurück.
»Wir trinken hier Bier. Wenn Sie eins haben …«
Ich sah nach, fand einen Kasten unter der Spüle und servierte das Gewünschte. Glaukamp hatte sich mittlerweile neben seiner Angestellten in die Bank gezwängt.
»Jetzt lassen Sie uns Tacheles reden, Herr Sturm!«, fuhr er fort, nachdem er sich den Bierbart abgewischt hatte. »Ihren Vater hatte ich fast so weit, dass er mir das Gelände hier verkaufen wollte. Ja, ich habe vor, das NAMENLOS abzureißen. Stattdessen wird hier etwas völlig Neues entstehen.«
»Ein Hotel? Ein SPA?«
»Unsinn!« Seine riesige Faust wischte meinen Einwand zur Seite. »Ich bin Architekt, kein Geschäftsmann. Ich habe mich immer mehr als Künstler betrachtet, Herr Sturm. Aber auch das reicht nicht, wenn Sie ein guter Architekt sein wollen …«
»Herr Glaukamp ist der beste!«, ergänzte Gundula Kleprekova.
»Danke, meine Liebe! Nun ja, meine Passion seit jeher war die Verbindung von Kunst und Mathematik, die in der Architektur ihren Ausdruck findet.«
»Herr Glaukamps realisierte Entwürfe stehen in Brasilia, im argentinischen Urwald und auf den Osterinseln«, ergänzte seine rechte Hand mit echter Bewunderung. Offensichtlich musste man Glaukamp kennen. Ich hatte, bevor Dünnebacke mir von ihm erzählt hatte, niemals zuvor seinen Namen vernommen.
Glaukamp winkte geschmeichelt ab. »Überall dort, wo bestimmte magnetische Erdlinien aufeinandertreffen, ist die Architektur gefragt, diese zu bündeln und für ihre Zwecke zu nutzen. Es gibt Linien und Kurven, mein Lieber, die Ihnen über die Grenzen des Raumes hinweg den Weg in andere Raumsysteme leiten …«
War Glaukamp ein Irrer? Nein, dazu schien er mir viel zu erdverbunden, nicht nur aufgrund seiner massigen Gestalt. Ich ließ ihn noch eine Weile weiterreden. Er dozierte über Orte, von denen ich noch nie in meinem Leben gehört hatte. Schließlich brach er abrupt ab. »Überlegen Sie sich mein Angebot!«
»Aber Sie haben mir noch keins gemacht!«, sagte ich verblüfft.
»Ich zahle Ihnen jeden Preis – jeden vernünftigen Preis. Es geht mir nicht, wie ich Ihnen soeben erläutert habe, um Ihre Bruchbude, sondern um die Linien, die hier kreuzen. Aber ich sehe, Sie sind noch nicht bereit. Ich werde in den nächsten Tagen noch einmal wieder nach Ihnen schauen. Kommen Sie, Gundula!«
Und genauso plötzlich, wie sie über mich gekommen waren, verschwanden sie wieder. Ich sah das seltsame Paar in den Mercedes steigen und davonfahren.
Ich atmete auf. Endlich konnte ich mich weiter der Besichtigung des Hauses widmen.
✞
Ronja streunte erneut davon, während ich mich weiter umsah. Vom Gastraum führte eine schmale Tür neben der Theke direkt in eine winzige Küche. Ein Sammelsurium von Töpfen, Tiegeln, Pfannen und Geschirr starrte mir entgegen. Angebrochene Öl- und Essigflaschen vermittelten den Eindruck, dass hier vor Kurzem noch gekocht worden war. Ich glaubte sogar, den Geruch von Speck zu schnuppern. Ich öffnete den Kühlschrank. Auch er war gut gefüllt, vor allen Dingen mit Butterpackungen.
Sofort musste ich daran denken, dass ich auch als Kind überreichlich mit Butter versorgt worden war. Meiner Mutter schien es immer sehr wichtig gewesen zu sein, dass mindestens ein Päckchen Butter als Vorrat im Hause war. Es gab Butter aufs Brot (so dick, dass ich meistens die Hälfte heimlich wieder herunterstrich), in Butter überreichlich geschwenktes Gemüse, und es gab die Butter sogar löffelweise, wenn ich erkältet war.
Ich konzentrierte mich wieder auf die Gegenwart. Mein Vater war vor zwei Monaten gestorben, aber die in eine Vakuumverpackung gepresste Blutwurst trug das Verpackungsdatum von letzter Woche.
Ich musste an Frau Rotemund denken. Offensichtlich war sie gar nicht so spröde, wie ich gedacht hatte, und sie hatte die Vorräte für mich besorgt.
Ich würde sie bei ihrem nächsten Besuch danach fragen, damit ich ihr die Unkosten erstatten konnte.
Von der Küche aus führte eine weitere Tür wieder in jenen Korridor, von dem aus ich den Rundgang begonnen hatte. Viel mehr außer dem Gastraum, der Küche und diesem Korridor hatte das Erdgeschoss also nicht zu bieten. Obwohl das natürlich schon eine ganze Menge gewesen war. Nur was sollte ich mit einer Kneipe anfangen? Noch dazu mit einer, die am Ende der Welt lag?
Von oben vernahm ich scharrende Geräusche. Ronja war wahrscheinlich wieder hoch gelaufen. Eine steile, mit einem verschlissenen roten Teppich bedeckte Treppe führte hinauf. Die einzelnen Stufen knarrten unter meinen Schritten.
Oben angelangt, tastete ich nach dem Lichtschalter. Es war stockdunkel. Ich wurde leicht unruhig, als ich ihn nicht sofort fand. Der Drache der Angst, der tief in mir lauerte, war noch lange nicht besiegt. Ich zwang mich zur Ruhe, aber dennoch tauchten die Visionen der Vergangenheit vor meinen Augen auf. Ein Wirbel aus Schlick und Algen, kleinsten Leuchtkörperchen und Schmutzpartikelchen. Doch hinter dem Schleier hockte noch etwas Anderes, Unaussprechliches …
Es ist nichts, redete ich mir ein. Nur die Dunkelheit. Und dennoch spürte ich, dass die Furcht über die Logik siegte. Meine Handflächen wurden feucht, ich registrierte, wie sie an der rauen Tapete entlangrutschten.
Um die Panik zu verscheuchen, sah ich zurück zur Treppe. Von unten drang genug Helligkeit herauf, sodass sich das hölzerne Geländer deutlich abhob.