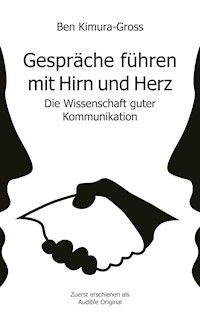
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Was macht Ihr Gehirn, während Sie sich unterhalten? Gespräche beeinflussen unser Sozialleben, den Erfolg im Beruf, die Familie. Wir tauschen uns aus, weisen an, bitten um Hilfe oder genießen Gemeinsinn und Humor. Aber in Gesprächen beschuldigen wir uns auch, greifen uns gegenseitig an und lösen damit Konflikte auf anderen Ebenen aus - besonders im Beruf und in der Politik haben Gespräche oft wirtschaftliche oder gar militärische Konsequenzen. Worauf basiert also "Dialogfähigkeit"? Wie schafft es Mandela `94, einen Bürgerkrieg abzuwenden, während Gaddafi von seinen Landsleuten in Stücke gerissen wird? Warum ist die eine Familie warmherzig, die andere von Streit zerklüftet? Woran scheitern Umweltaktivist*innen wie Thunberg? GESPRÄCHE FÜHREN MIT HIRN UND HERZ zeigt Ihnen die versteckten Mechanismen, die unsere Gespräche steuern: welche neurobiologischen Prozesse Kommunikation und Dialoge ermöglichen und woran sie scheitern. Forschungsergebnisse räumen mit Mythen auf, die Fortschritte in unserer Dialogfähigkeit behindern: Multitasking, Dualismus, Veränderungsresistenz im Alter. Sie erkennen ungeahnte Risiken: welch rares Gut Vernunft und freier Wille gehirnphysiologisch sind und warum sie manchmal einfach abgeschaltet werden. Denn viel öfter als wir annehmen sind unsere Aussagen in Gesprächen "Sprechreflexe" - automatisiert und unfreiwillig. Die gute Nachricht: Wir können negative Gesprächsreflexe umtrainieren. Wir können Vernunft und freien Willen stärken. Ihr Gehirn ist formbar, zeigt die Neuroplastizitätsforschung: Ganze Hirnregionen wachsen oder schrumpfen messbar, je nach Gebrauch. Wer verstehen will, warum ein Gespräch gut lief, während ein anderes scheiterte, und wer aktiv darauf Einfluss nehmen will, dem gibt "Gespräche führen mit Hirn und Herz" Wissen und Werkzeuge an die Hand.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Vom Hörbuch-Original zum Buch
TEIL 1: FOKUS
Dialog 1
Fokus: Der kleine Lichtkegel im großen Dunkel
Dialog 2
Neuro-Tricks: So schwenkt Ihr Gehirn den kleinen Lichtkegel auf Gespräche
Dialog 3
Zwiegespalten: Ihre Aufmerk-samkeit kämpft mit sich selbst
Dialog 4
Fokus-Machtkampf: Der Klügere gibt nach
Dialog 5
Ich bin dann mal weg: Ihr Geist auf Wanderschaft
Dialog 6
Bis 4 Uhr morgens: Begeisterung sprengt Grenzen
TEIL 2: AUTOMATISIERUNG
Dialog 7
Grenzgänger: Das Problem mit dem Bewusstsein
Dialog 8
Der 3A-Kurzschluss: Enttäuschung verabschiedet Bewusstsein
Dialog 9
ZPG-Reflexe: Automatisierungen greifen dem Bewusstsein ins Lenkrad
Dialog 10
SNS-PNS: Ihr Rückgrat spricht mit
Dialog 11
Konfliktparteien: Ihr Gehirn diskutiert mit sich selbst
Dialog 12
Hoffnungsschimmer: Wenn schon automatisiert, dann aber richtig!
TEIL 3: BEDEUTUNG
Dialog 13
Missverstanden: Kein Wort hat eine Bedeutung
Dialog 14
Gewalt oder Empathie: Wie wollen Sie Verständnis herbeiführen?
Dialog 15
Wahrheitsbaustelle: Wie Ihr Gehirn Ihre ganz persönliche Realität konstruiert
Dialog 16
Intersubjektivität: So kommen wir zu einem gemeinsamen Realitätsempfinden
Dialog 17
Kognitive Verzerrung: Wenn‘s kracht, weil ein Gehirn seine Fehlkonstruktion beharrlich verteidigt
Dialog 18
How We Connect: Verständnis, Vertrauen, Verbundenheit
Danksagung
Literaturangaben und Anmerkungen
Prolog
Gespräche und die Kunst, sie zu führen, beschäftigen uns seit Jahrtausenden. Seien es Sokrates und Meletus, Romeo und Julia oder Mandela und Viljoen – Gespräche sind der Kern von Kultur, Liebe, Politik. Gespräche sind geprägt vom Wunsch, sich mitzuteilen, sich auszutauschen, zu verstehen und verstanden zu werden. Doch in all den Jahrtausenden fehlte denen, die Gespräche analysierten, die die Kunst des Dialogs zu optimieren oder gar zu lehren suchten, etwas Fundamentales. Sie betrachteten Gespräche, ohne das Gehirn zu verstehen. Das machte viele Theorien zu Luftschlössern.
Unterdessen wissen wir: Unsere Gespräche finden nicht allein in den luftig-erhabenen Höhen des Geistes statt, sondern sind an körperliche Prozesse in unseren Gehirnen gebunden. Und diese körperlichen Prozesse – die Voraussetzung dafür, dass es überhaupt einen Sokrates, eine Julia, einen Mandela gibt – beeinflussen die Qualität unserer Gespräche massiv.
Seit einigen Jahren zeigen uns bildgebende Verfahren, welche Gehirnareale aktiviert sind, wenn wir miteinander sprechen, was sie dabei tun, und was sie dabei stört. Detaillierte Untersuchungen von Nervenzellen und Neurotransmittern zeigen, wie wir lernen, wie wir uns erinnern, und wie das Gehirn situationsbedingt ganz plötzlich seinen Gesamtzustand ändert – mal ist das förderlich für unsere Gespräche, mal nicht. Die Kognitionsforschung zeigt, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir Wahrgenommenes verarbeiten und wie die individuelle Einfärbung unserer Wahrnehmung unsere Gespräche beeinflusst. Neuroplastizitätsforschung macht uns Hoffnung, dass wir nie auslernen und dass wir auch neue Gesprächsfertigkeiten lernen können, egal in welchem Alter.
Ich lade Sie in diesem Buch dazu ein, mit mir die Vielfalt der lebendigen Baustoffe und neurobiologischen Prozesse zu bestaunen, die Ihre Gespräche so maßgeblich beeinflussen. Ich lade Sie ein, das Fundament zu betrachten, auf das Sie die geistigen Gebilde Ihrer Gespräche bauen. Und ich lade Sie zu Geschichten ein, die die Qualitäten dieses Fundaments veranschaulichen.
Hortensien
Andrea hat Hortensien gepflanzt. Im ersten Jahr sind die Blüten pastellig blau, im zweiten plötzlich rosa. Andrea ist enttäuscht – sie mag kein Rosa. Jetzt kann sie natürlich die Blüten untersuchen, aber da findet sie den Grund für den Farbunterschied nicht. Die Ursache liegt im Nährboden, der seit letztem Jahr saurer geworden ist und weniger aluminiumhaltig. Es sind die veränderten Bedingungen im „Fundament“, in dem Ihre Hortensie wächst, die die Blüten rosa färben.
So wie die Blüten einer Hortensie können Gespräche mal so, mal so ausfallen: mal rosa, mal blau – mal angenehm, mal konfliktgeladen. Und wenn wir verstehen wollen, warum das so ist, dann müssen wir auch hier die Bedingungen im Fundament untersuchen. Das Fundament – man könnte sagen der Nährboden – unserer Gespräche sind unsere Gehirne. Sie nähren unsere Gespräche, sie liefern die neurobiologischen Baustoffe, Energien und Prozesse, die Sprechen, Hören und Denken ermöglichen. Natürlich ist dieses Fundament unserer Gespräche unvergleichlich komplexer als der Einfluss von pH-Werten und Aluminiumgehalt im Boden auf die Blütenfarben von Hortensien. Und doch zeigt uns diese Metapher, wie begrenzt unsere bisherige Auseinandersetzung mit Gesprächen war: Jahrtausende lang schauten wir immer nur auf die Geistesblüten.
Erst seit kurzem ist es uns möglich, das Gehirn genau genug zu beobachten, um seinen Einfluss auf die Qualität unserer Gespräche zu verstehen. Es ist, als hätten wir erst gestern den Zusammenhang zwischen den pH-Werten, dem Aluminiumgehalt und den Blüten verstanden – doch wollen wir uns dann heute dieser Erkenntnis verschließen?
Selbstverständlich könnten wir auch weiterhin die Qualität unserer Gespräche dem Zufall überlassen. Aber wer will schon, dass der Zufall entscheidet, ob ein Gespräch mit dem Partner oder der Partnerin Vertrauen, Verständnis und Verbundenheit stärkt oder ob es in einen Konflikt entgleist? Wer will es dem Zufall überlassen, ob der Mit-arbeiter begreift, was man ihm gerade erklärt hat, ob die Kundin oder Patientin zufrieden ist, ob ein politischer Konflikt sachlich bleibt oder in Beschimpfungen ausartet?
Schauen wir uns also das Fundament an. Und wenn wir das tun, dann bemerken wir schnell: Es geht viel weniger darum, ob wir eine Aussage so oder anders formuliert, ob wir eine offene oder eine geschlossene Frage gestellt haben, und viel mehr um die Rahmenbedingungen, in die unsere Aussagen und Fragen eingebettet sind.
Rahmenbedingungen
Weder mit In 10 Schritten zum perfekten Verkaufsgespräch noch mit Die 21 schönsten Liebeserklärungen der Weltliteratur will und kann dieses Buch dienen. Es geht nicht um oberflächliche, rein kognitive Techniken, sondern Sie lernen Schritt für Schritt die Kunst, die Rahmenbedingungen, die Ihre Gespräche beeinflussen, besser zu gestalten.
Sie werden scheinbar Unlogisches lernen: Warum ein Gespräch vor dem Mittagessen andere Resultate bringt als eins danach; wie warme und kalte Getränke, der Klang einer Stimme oder selbst die Tageszeit Ihre Gespräche beeinflussen können. Sie werden lernen, warum Sie gewisse Gespräche nicht im Auto führen sollten und warum schlechte Rahmenbedingungen gut gemeinte Worte manchmal auf einem silbernen Tablett in die Gesprächshölle tragen. Denn genau darin liegt eine der großen Errungenschaften der modernen Hirnforschung: Dass sie scheinbar Unlogisches zu erklären vermag, indem sie bisher unsichtbare Zusammenhänge aufdeckt.
Sie werden lernen, dass ich, wenn ich von Rahmenbedingungen spreche, nicht nur externe Bedingungen meine, sondern auch interne: die physiologischen und energetischen Zustände in Ihrem Gehirn. Diese „von innen heraus“ wirkenden Kräfte – man könnte sagen, Ihre innere Haltung – üben eine enorme Macht aus darüber, ob in Ihren Gesprächen Vertrauen, gegenseitiges Verständnis und Gefühle der Verbundenheit gestärkt oder geschwächt werden.
Wer diese Rahmenbedingungen gut gestaltet, kann seine Gespräche tiefgreifend und entscheidend beeinflussen, denn sie wirken im Fundament, also auf einer Ebene, die mit rein kognitiven Gesprächswerkzeugen nicht erreichbar ist.
Das mindert nicht den enormen Mehrwehrt, den gute Fragetechniken, aktives Zuhören und ähnliche Werkzeuge Gesprächen bisher gebracht haben; sie werden allerdings auf eine solidere Basis gestellt.
Schauen wir uns also den Nährboden Ihrer Gespräche an. Und wer weiß, vielleicht werden Sie herausfinden, dass Ihre innere Haltung sowieso schon zu den Erkenntnissen passt, die Ihnen dieses Buch nahebringt. Umso besser.
Lernen und Bestätigung
In meinen Kommunikationskursen gibt es zwei Arten von Reaktionen auf das, was Sie in diesem Buch lernen werden. Manchmal lösen die neurobiologischen Erkenntnisse ein Veränderungsbedürfnis aus, manchmal aber auch einfach das Gefühl von Bestätigung: „Jetzt weiß ich, warum die Art, wie ich ein Gespräch angehe, immer so gut funktioniert!“
Auch Sie werden in diesem Buch einiges finden, das Sie bestätigt, und einiges, das in Ihnen den Wunsch hervorruft, Neues zu lernen, eine Übung auszuprobieren oder Ihre Haltung zu ändern. Ich wünsche Ihnen dabei viel Freude, denn jeder Schritt in Richtung Vertrauen, Verbundenheit und Verständnis ist ein Schritt weg von unnötigen Konflikten, Zwist und Uneinigkeit.
Zu lernen und auszuprobieren gibt es unendlich viel – und wie jeder, der für sein Thema brennt, fand auch ich es schwer, Grenzen zu setzen. Was passt in ein Buch, was ist zu viel? Daher gibt es an manchen Stellen Verweise auf Übungen, weiterführende Texte oder Videomaterial online – damit die Vielfalt der praktischen Anwendungen den Rahmen nicht sprengt. (Der dafür angelegte Link hirnundherzbonus.de führt Sie übrigens auf eine Unterseite meiner Webseite gespraechsfit.de – also keine Sorge: da sind sie richtig.)
Fokus, Automatisierung und Bedeutung
Dieses Buch besteht aus drei Teilen. Jeder Teil nimmt sich einen besonderen Aspekt der Rahmenbedingungen vor, die unsere Gespräche beeinflussen: Fokus, Automatisierungen und Bedeutung.
Im ersten Teil – Fokus – schauen wir uns an, wie viel Energie unsere Gehirne benötigen, um unsere Aufmerksamkeit auf Gespräche zu lenken, und warum manche Menschen geborene Zuhörer sind und andere nicht. Wir erforschen überraschende Zusammenhänge zwischen Aufmerksamkeitssteuerung und Missverständnissen, und Sie lernen, mehr aus Gesprächen mitzunehmen und sich genauer an sie zu erinnern.
Im zweiten Teil – Automatisierung – schauen wir die Vielzahl automatisierter Prozesse an, die unsere Gespräche ermöglichen und mitgestalten. Dieser Teil birgt Erkenntnisse darüber, warum wir manchmal Dinge sagen, die wir vielleicht gar nicht so meinten, die aber unsere Gespräche entgleisen lassen. Das zeigt: Manche dieser Automatismen sind zielführend, andere nicht. Daher lohnt es sich, einige umzutrainieren. Die Mittel dafür gibt Ihnen dieser Teil an die Hand.
Im dritten Teil – Bedeutung – lernen Sie, wie Ihr Gehirn Realität erkennt und verarbeitet und dass es dabei nicht spiegelt, sondern konstruiert. Wenn aber alles, was wir sehen, hören, spüren usw. subjektive Konstrukte sind, wie finden wir dann in Gesprächen zueinander? Wie entstehen eine gemeinsame Wahrnehmung und gemeinsame Gedanken? Wie gelangt Bedeutung aus Ihrem Kopf in den Kopf Ihres Gesprächspartners?
All das zeigt Ihnen Teil 3, und natürlich auch, welche Rahmenbedingungen das Teilen von Bedeutungen fördern und welche nicht. Dabei meine ich mit „Rahmenbedingungen“, wie gesagt, sowohl externe als auch gehirninterne Gegebenheiten, also Ihre innere Haltung im Gespräch.
Oder, um es mit Hortensien zu sagen: In diesem Buch lernen Sie, den Nährboden Ihrer Gespräche gut zu düngen, damit die Farbe der Blüten so ausfällt, wie Sie es sich wünschen. Denn erst, wenn Sie sich mit dem Nährboden beschäftigen, entscheiden wirklich Sie – und nicht der Zufall – über die Qualität Ihrer Gespräche. Doch mit der Theorie ist es nicht getan, daher stelle ich Ihnen zwei Wegbegleiter an die Seite.
Mia und Fred
Zwei Protagonisten und ihre Bekannte begleiten uns durch dieses Buch, dessen Kapitel jeweils durch Dialoge eingeleitet werden, damit wir etwas Praktisches, etwas Greifbares an der Hand haben, nicht nur Theorien.
Überhaupt geht es in diesem Buch sehr stark um den praktischen Mehrwert dessen, was Sie lernen. Manchmal muss ich etwas ausholen, denn Ihr Gehirn ist wunderbar komplex, und diese Komplexität lässt sich nur selten in drei Sätzen darstellen. Doch am Ende steht immer das Ziel, in Gesprächen Vertrauen, Verbundenheit und gegenseitiges Verständnis zu stärken.
Abenteuer
Es geht also nicht um die manipulativen Tricks eines Verkaufsgesprächs, es geht nicht darum, wie Sie mit visionär klingender Propaganda die Leistung Ihrer Mitarbeiter ankurbeln oder sich mit rhetorischer Kraft in einer Diskussion durchsetzen.
In diesem Buch geht es darum, mit unnötigen Missverständnissen aufzuräumen, damit Sie die Menschen, die Ihnen viel bedeuten, besser verstehen und sich angenehmer mit ihnen unterhalten können. Es geht darum, wie wir in Gesprächen Vertrauen aufbauen, und ein kleines Bisschen geht es auch ums Staunen über die Vielfalt der geistigen Universen, die sich in jedem von uns verstecken, wenn wir nur bereit sind, uns auf das Abenteuer wunderbar tiefgreifender Gespräche einzulassen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude und einige Überraschungen mit Gespräche führen mit Hirn und Herz.
Vom Hörbuch-Original zum Buch
Gespräche führen mit Hirn und Herz wurde im Dezember 2020 als Hörbuch veröffentlicht – also vor der Buch-Version. Das ist etwas ungewöhnlich. (Meist werden Bücher zu Hörbüchern, nicht umgekehrt.)
Der Reiz einer Hörbuch-Fassung war, dass der Verlag, Audible, sich bereit erklärte, die Dialoge, die jedem Kapitel vorangestellt sind, als Hörspiele aufzunehmen, also mit mehreren Schauspielern, einem Erzähler, passenden Geräuschkulissen usw.
Ich habe mich entschieden, diese 18 Dialoge auch im Buch in ihrer Originalfassung zu belassen, also lesen sie sich genau wie das, was sie sind: Hörspiel-Skripte.
Gespräche zu verschriftlichen ist immer ein unvollständiger Prozess. Jeder, der mal ein Drehbuch oder Theaterskript in der Hand gehabt hat, weiß, wie vielseitig so ein Text interpretiert werden kann.
Gespräche führen ist eben mehr als nur „Worte sprechen“. In echten Gesprächen bestimmen Stimmqualität, Sprechtempo, Lautstärke, Mimik, Gestik und Körpersprache die Bedeutungen der gesprochenen Worte mit – wie, dazu kommen wir noch.
Ich bin jedenfalls sehr gespannt, wie diese Hörspiel-Skripte auf Sie als Leser*in wirken. Falls Sie Lust haben, mir ein Feedback zu schicken, können Sie mich gerne über meine Webseite gespraechsfit.de kontaktieren. Ich höre gerne von Leser*innen und melde mich auf jeden Fall zurück!
Wer auch die Hörspiel-Fassungen der Dialoge hören will, findet sie im Audible-Programm.
Und jetzt … wünsche ich Ihnen gute Unterhaltung!
TEIL 1: FOKUS
Warum es unseren Gehirnen so verdammt schwerfällt, wirklich gute Gespräche zu führen
Dialog 1
[Zuggeräusche im Großraumabteil. Ansage im Hintergrund: „Wir heißen alle in Ingolstadt Zugestiegenen willkommen im ICE 800 München-Berlin und wünschen Ihnen eine angenehme Reise. “ Geräusche von Menschen, die ihre Rollkoffer durch den Gang ziehen, anecken, sich entschuldigen usw. Fred sitzt einem älteren Herrn gegenüber. Er lacht überrascht auf. Der ältere Herr lacht mit.]
Fred:
… und da lag dann der Umschlag, und Ihr Chef war – einfach weg!?
Älterer Herr:
Joh, wie a Oachkatzerl. Oaf Nimmerwiedersehn. So lief des damals.
Fred:
Das ist ja …
Älterer Herr:
Iss scho, mei, g’wiss 45 Jahr is des her.
Mia:
Entschuldigen Sie, ich glaube, Sie sitzen auf meinem Platz.
Älterer Herr:
Na denn [seufzt beim Aufstehen], Herr Bellin, `s war mia a Vergnüg‘n.
Mia:
Nein, nicht Sie. …
Sie
, Herr, ähm, Bellini?
Fred:
Das haben wir gleich. [Geräusche, wie er sich ebenfalls bewegt und aufsteht.]
Mia:
Warum stehen Sie denn jetzt
beide
auf?
Fred:
Warum nicht?
Mia:
Sie …
Älterer Herr:
Mei, mei! [räuspert sich] Fräulein, des war schoa i, oaf Ihr‘m Platz.
Mia:
Nein.
Älterer Herr:
Doch, doch. Bis i diesen jungen Herrn um den G‘fallen bat, mit mir zu tauschen. I fahr halt so ungern rückwärts.
Mia:
Ach so, dann … Dann müssen Sie jetzt …
Älterer Herr:
… stehen? Ja, ober i steig eh in Nürnberg aus. Des geht scho. [zu Fred] A schöne Weiterfahrt, Herr Bellin.
Fred:
Herr Regensburg.
[Geräusche. Herr Regensburg geht. Fred und Mia setzen sich.]
Fred:
Ich hoffe, Sie fahren nicht so ungern rückwärts wie Herr Regensburg.
Mia:
Ich hoffe, Herr Regensburg findet einen Platz.
Fred:
Er steigt gleich aus. Hat er …
Mia:
Ach so ja, stimmt, hat er gesagt. Dann isses ja … Tut mir leid, übrigens. Sie hatten wohl ein sehr ange-nehmes Gespräch.
[Geräusche: Mia packt ihren Laptop aus und klappt ihn auf – das Gerät gibt einen Start-Ton von sich.]
Fred:
Schon okay. Wir waren gerade am Ende seiner Geschichte angelangt. [Pause] Bis wohin fahren Sie?
[Geräusche: Mia tippt ein Passwort ein – der Laptop meldet sich mit: „Ihre Virenabwehr wurde aktualisiert.“]
Mia:
Ähm – durch, bis Berlin, und Sie?
[Geräusch: Mias Handy klingelt.]
Mia:
Sorry … [dann, mit freundlich-professioneller Telefon-stimme:] Ja, Herr Brilldorst, danke, dass Sie zurück-rufen.
[Mia steht auf, Ihre Stimme entfernt sich.]
Mia:
Wir haben uns Ihre Anforderungen noch mal angeschaut und sind zu dem Schluss gekommen, dass sich die Kombination der …
[FADE OUT]
Fokus: Der kleine Lichtkegel im großen Dunkel
Ab und zu hören wir Gespräche wie dieses im Zug und schmunzeln ein wenig. Es betrifft uns ja nicht direkt. Wenn wir selbst daran teilhaben, können solche Gespräche natürlich auch nervig sein. Und obwohl wir nur ahnen können, wie gereizt Mia genau während der Sitzwechselorgie ist, oder ob es Fred stört, dass Mia plötzlich an ihr Handy geht – eins ist klar: Bis jetzt ist zwischen Fred und Mia noch kein wirklich gutes Gespräch entstanden.
Die Situation gibt es einfach nicht her, dass sie sich gegenseitig konzentriert zuhören. Manchmal ist das o.k., aber manchmal kommt es im Leben sehr wohl darauf an, genau zuzuhören. Und je mehr unser Alltag durch kurze, schnelllebige und etwas wirre Gespräche geprägt ist, desto schwerer fällt es uns, im richtigen Moment umzuschalten auf eine andere Art, Gespräche zu führen.
Denn für die wirklich bedeutsamen Gespräche in unserem Leben brauchen wir eine andere Art von Aufmerksamkeit. Eine fokussierte, ununterbrochene Aufmerksamkeit. Doch was ist eigentlich Aufmerksamkeit?
In seinem 1890 erschienenen Standardwerk The Principles of Psychology (Die Prinzipien der Psychologie) beschrieb William James Aufmerksamkeit als „ein Ausblenden einiger Dinge, um mit anderen effektiv umgehen zu können“.1 Aufmerksamkeit ist also das, was unser bewusstes Wahrnehmen fokussiert. In einem guten Gespräch z.B. hoffentlich auf die Worte unseres Gegenübers und dann auf unsere eigenen. Diese Aufmerksamkeitssteuerung im Gespräch funktioniert bei unterschiedlichen Menschen verschieden gut.
Bestimmt kennen Sie auch jemanden, den Sie als besonders guten Zuhörer beschreiben würden. Und auch mindestens eine Person, deren Talent, zuzuhören, schwach ausgeprägt ist, was Sie ab und zu frustriert.
Früher waren Gespräche mit mir sicher auch frustrierend, mal für Freunde, mal für mich selbst, denn ich beherrschte die Kunst des guten Zuhörens nicht. Und manchmal war ich Jahre später überrascht, wie detailliert sich ein Freund oder eine Freundin an Gespräche erinnerte, die ich schon längst vergessen hatte. Heutzutage weiß ich: Die Gehirne mancher Menschen lenken ihre Aufmerksamkeit anders auf die Worte ihrer Gesprächspartner als meins. Sie sind von Grund auf anders gepolt. Und wenn ich auch ein guter Zuhörer werden wollte, dann musste ich etwas ändern – und so begann mein Interesse an Aufmerksamkeitssteuerung.
Doch bevor wir uns den Merkmalen und Spielarten dieser Steuerung zuwenden können, müssen wir eine grundsätzlichere Frage klären: Wie viel bewusste Aufmerksamkeit kann das Gehirn überhaupt herstellen? Ist sie endlos, oder gibt es da so etwas wie eine begrenzte Bandbreite? Können wir multitasken, also unsere Aufmerksamkeit mehrgleisig steuern, oder sollten wir das lieber lassen?
Diese Fragen beantworte ich in meinen Kommunikationskursen am liebsten mit einer Geschichte. Auf den ersten Blick eine einfache Parabel von einem Lichtkegel in der Dunkelheit, doch Vorsicht! Die Dunkelheit steht für etwas anderes, als man vielleicht auf Anhieb denken würde.
Der kleine Lichtkegel im großen Dunkel
Mitternacht. Ein entlegener Bauernhof in der Bretagne, zur Herberge umfunktioniert. Eine dichte Wolkendecke hat gefühlt alle Himmelskörper wegradiert, alle Lichtquellen gelöscht. Man sieht die Hand vor den Augen nicht. Vier Dreizehnjährige schleichen sich nach draußen: ein spontaner, geheimer Nachtspaziergang. Die Lehrerin, die die Klassenfahrt begleitet, weiß von nichts. Und so schleichen wir uns ins Dunkel.
Doch plötzlich greifen unsichtbare Büsche greifen nach unseren Beinen, und den schmalen Pfad kann man nicht sehen, nur mit den Füßen ertasten. Für Stadtkinder wie mich eine ungewohnte Erfahrung. Was soll das? In Berlin gibt es diese Art tiefschwarzer Dunkelheit nicht. Es ist so stockduster, dass meine Arme ungefähr ab den Ellenbogen verschwinden, wenn ich sie ausstrecke.
Was die anderen nicht wissen: Ich habe – unserer Absprache zuwider – eine Taschenlampe dabei. Es ist ein kleines, schwächelndes Ding, ein Schlüsselanhänger. Vielleicht besser als gar nichts, denke ich jetzt, hole sie aus der Hosentasche und schalte sie an. Doch die große, scheinbar unendliche Dunkelheit zeigt sich unbeeindruckt. Der Lichtkegel reicht nicht weit und macht nur sehr Weniges erkennbar.
Und natürlich fauchen mich die drei anderen sofort an, ich solle doch die blöde Lampe ausknipsen, das mache mich jetzt auch nicht gerade zur Leuchte!
Genau so verhält es sich mit unserer Kapazität für bewusstes Wahrnehmen und für Aufmerksamkeit. Sie ist begrenzt – ein kleiner Lichtkegel im großen Dunkel. Und sie ist nicht immer gegeben. Sie schaltet sich ein, sie schaltet sich aus.
400 Milliarden Bits pro Sekunde – so viele Daten schicken Ihre Sinne in Ihr Gehirn
In den 90ern versuchten Neurologen, die durchschnittliche Datenmenge, die pro Sekunde in ein menschliches Gehirn gelangt, in Bits zu definieren. Warum Bits? Zum einen ist es eine bereits existierende Maßeinheit – warum eine neue erfinden, wenn es schon eine gibt? Außerdem waren in den 90er Jahren Computer-Gehirn-Analogien noch sehr beliebt – selbst unter Wissenschaftlern. Also schienen Bits naheliegend.
Die besten Schätzungen für das Datenvolumen, das potenziell über die Sinne in das Gehirn gelangt, liegen bei 400 Milliarden Bits pro Sekunde.2 Warum potenziell? Weil diese Zahl variiert, z. B. je nachdem, ob Ihre Augen geöffnet oder geschlossen sind. Sie bezieht sich auf ein potenzielles Maximum.
Ganz wichtig dabei ist, dass wir nicht von Daten sprechen, die schon irgendeine Bedeutung haben. Wenn Sie einem Bekannten Ihre Kontaktdaten als VCF-Datei per SMS schicken, ist der größte Teil der Kommunikationskette allen Beteiligten unbekannt.
Sie können schließlich nicht sehen, wie die Daten Ihr Handy per Funknetz verlassen, an welchen Mast sie sich wenden, wie sie weitergeleitet werden und wie das Handy Ihres Bekannten Tausende von Nullen und Einsen aus der Luft greift, um als Anhang zur eingehenden SMS eine VCF-Datei herzustellen.
Und genauso ähneln die Daten, die unsere Augen, Ohren, Nasen usw. aufnehmen, nicht etwa der bedeutungsvollen VCF-Datei am Ende der Kette, sondern eher den Nullen und Einsen, die aus der Luft gegriffen werden. 400 Milliarden Nullen und Einsen pro Sekunde, die an sich und ohne Interpretation noch keinen Sinn ergeben.
Ein Lichtstrahl, der durch einen Fotorezeptor in Ihrer Netzhaut in das neurologische Äquivalent eines Farbpunktes umgewandelt wird, hat keine Bedeutung. Selbst Millionen von Punkten haben keine Bedeutung; diese entsteht erst in einem späteren Stadium der Wahrnehmung. Die nächste Frage ist also: Welchem Anteil dieser 400 Milliarden Bits pro Sekunde kann das Gehirn bewusst Bedeutung beimessen? Allen? Der Hälfte? Zehn Prozent?
Wie viele Daten kann Ihr Bewusstsein zu „Bedeutungen“ verarbeiten?
Das Bewusstsein ist eines der größten Mysterien der Menschheit – trotz rasantem Fortschritt gibt es noch keine allgemein gültige wissenschaftliche Definition dieses Begriffs. Die Tatsache, dass unser Bewusstsein ein rätselhaftes, subjektives Phänomen ist, erschwert seine Quantifizierung – aber wenn wir beschreiben wollen, wie viele Daten bewusst verarbeitet werden können, müssen wir schon Mengenangaben machen.
Glücklicherweise tappen wir dabei nicht ganz im Dunkeln. So ist zum Beispiel gut erforscht, in welchen Teilen des Gehirns keine bewussten Prozesse stattfinden; die können wir somit ausschließen.
Bekannt ist auch, welche Gehirnareale bei bewussten Gedanken oder Handlungen besonders aktiv werden. Es gibt sogar sehr detaillierte Studien dazu, welche Arten von Neuronen beim Bewusstmachen von Sinneswahrnehmungen aktiv werden.
Anhand dieses Wissens können Forscher grob hochrechnen, wie viel Gehirn-Power für unser Bewusstsein überhaupt zur Verfügung steht, und das ist enorm aufschlussreich. Geschätzt wird, dass das Gehirn etwa 60 bis 2000 Bits pro Sekunde bewusst verarbeiten kann.345
Und wir werden gleich sehen, dass es eigentlich keinen großen Unterschied macht, ob es nun 60 oder 2000 sind. Denn selbst, wenn wir von der optimistischsten Schätzung – 2000 Bits pro Sekunde – ausgehen, ist das nur ein Mikro-Bruchstück der Daten, die pro Sekunde auf uns einströmen: 400 Milliarden Bits.
Und das ist Ihr Fokusproblem: Über Ihre Sinne strömt ein wahrhaftiger Daten-Tsunami auf Ihr Gehirn ein und überschwemmt die kleine Insel „Bewusstseinsprozesse“ gnadenlos. Jede Sekunde Ihres Lebenswäre Ihr armes Bewusstsein also völlig überfordert mit dem Volumen an Daten, das Ihre Sinne liefern – wären da nicht Mechanismen, die auswählen, was bewusst gemacht wird und was nicht.
Doch wie erkennen wir das Wesentliche? Wie weiß Ihr Gehirn, was wichtig ist, und was nicht? Z.B. in einem Gespräch? Anders gesagt: Wohin schwenken Sie im großen, endlosen Dunkel den kleinen, schwachen Lichtstrahl Ihres Bewusstseins?
Und wo wir gerade wieder bei unserer dunklen Nachtgeschichte sind – ist es Ihnen aufgefallen? Es ist klar, wofür der Lichtstrahl steht. Doch wofür steht die Dunkelheit? Das ist weniger selbstverständlich.
Wenn ich diese Geschichte in Kommunikationskursen erzähle, frage ich das die Teilnehmer. Und es ist immer dasselbe. Die Geschichte verführt zu der Interpretation, die dunkle Nacht sei das Unbekannte, das Unsichtbare . Also all das, was unsere Sinne nicht erfassen können.
Doch mit Blick auf die Forschung ergibt sich eine andere, etwas merkwürdige Interpretation: Die riesige Dunkelheit ist das 400 Milliarden Bits umfassende Datenvolumen, das Ihre Sinne Ihrem Gehirn schicken. Und der Lichtstrahl der kleinen Schlüsselanhänger-Taschenlampe ist die 2000 Bits-pro-Sekunde-Kapazität, mit der Ihr Bewusstsein das Dunkel behelfsmäßig zu erhellen versucht.
Die grenzenlose Nacht steht für all das, was unsere Sinne sehr wohl erfassen, unser Bewusstsein aber nicht!
In einem wichtigen Punkt unterscheidet sich die Realität unsere Bewusstseinskapazität allerdings von den Umständen in der Geschichte: Ihr Bewusstsein kann nicht kehrtmachen und in eine hell beleuchtete Herberge zurückgehen, denn die Herberge gibt es nicht.
Wir, Homo sapiens , die Wissenden, sind wir vielleicht doch unwissender, als wir gerne annehmen? Warum hat die Evolution unsere Gehirne nicht mit mehr Bewusstseinskapazitäten ausgestattet? Wie bewältigen wir überhaupt den Alltag, mit diesem kleinen Fünkchen Bewusstsein?
Fragen über Fragen. Ich würde sagen, als Erstes wenden wir uns der Kapazitätsgrenze unseres Bewusstseins zu. Und dabei hilft uns eine Olympiasiegerin im Hochsprung.
Yelena Slesarenko, der Mond und Belastbarkeitsgrenzen
7. März 2004: Wir befinden uns in Budapest, bei den 10. Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften. Eine weitgehend unbekannte Athletin, die 22-jährige Yelena Slesarenko, setzt zum Hochsprung an, aber sie hat die Latte zu hoch legen lassen, auf 2,04 m. Niemand erwartet, dass sie den Sprung schafft – doch dann bleibt die Latte liegen, und sie segelt in hohem Bogen drüber.
Das Publikum ist begeistert, und von einem Augenblick zum anderen wird Slesarenko als aufsteigender Stern des Hochsprungs gefeiert, denn sie hat allen Erwartungen entgegen einen Sprung absolviert, der dem aktuellen olympischen Rekord verdammt nahe kommt. Ihr fehlt nur noch ein Zentimeter.
Wenige Monate später tritt sie bei der Olympiade in Athen an. Am 28. August springt Slesarenko 1,96 m im ersten Versuch und 1,99 m im zweiten. Ihre Technik ist makellos; sie wirkt schwerelos. Aber die Konkurrenz ist stark. Sowohl die Ukrainerin Vita Styopina als auch die Favoritin, die südafrikanische Hestrie Cloete, nehmen 2,02 m im ersten Sprung. Doch Slesarenko bleibt selbstsicher, cool und schafft 2,04 m im dritten Versuch. Ihre Konkurrentinnen scheitern. Und obwohl ihr die Goldmedaille nicht mehr zu nehmen ist, legt Slesarenko noch einmal auf: Sie schafft 2,06 m und stellt damit einen neuen olympischen Rekord auf – die Welt der Leichtathletik erbebt.
Doch da ist noch der Weltrekord von 1987. Damals, als Slesarenko gerade mal fünf Jahre alt war, sprang die unbezwingbare Stefka Kostadinova in Rom 2,09 m. Diesen Rekord gilt es jetzt zu brechen. Vom Hochgefühl ihrer erfolgreichen Sprünge getrieben, lässt Slesarenko die Latte auf 2,10 m legen. Und scheitert.67
Die Olympischen Spiele treiben Athleten an, ihre Grenzen zu testen. Dabei gibt es Disziplinen, in denen ständig neue Rekorde aufgestellt werden, und solche, wo wir scheinbar die Belastbarkeitsgrenzen des menschlichen Körpers erreicht haben. So wurde beispielsweise der Stabhochsprungrekord der Damen seit 1988 über 50 Mal gebrochen. 1988 stand der Rekord bei 3,72 m. Heutzutage springt frau regelmäßig über 5 m.8 Die Erklärung dafür finden wir aber nicht in der sagenhaften Veränderungen der Skelettmuskulatur, sondern in neuen Stabmaterialien. Hochsprung ohne Stab andererseits ist eine jener Disziplinen, die sich einer solch kontinuierlichen, schrittweisen Verbesserung verweigern.
Im Moment sind die Weltrekorde für Männer und Frauen im Hochsprung seit über einem Vierteljahrhundert unverändert. Es wirkt fast so, als gäbe es eine natürliche Grenze von 2,09 m für Frauen und 2,45 m für Männer.
Doch was hat Hochsprung mit unseren Gesprächen zu tun? Das:
Die Funktionsfähigkeit des menschlichen Körpers wird durch physiologische Grenzen eingeschränkt und diese Grenzen sind unveränderbar.
Das gilt für Ihr Gehirn genauso wie für Yelena Slesarenkos Beine. Wir können hier und da ein wenig optimieren, aber kein Mensch wird je wie ein schwarzer Panther aus dem Stand über fünf Meter in die Luft springen – jedenfalls nicht mit den Beinen, mit denen wir geboren wurden.
In Athen mag Yelena Slesarenko in ihrem Herzen den Wunsch gehabt haben, bis zum Mond zu springen. In der Poesie des Herzens geht so was. In der Realität sind das knapp 400.000 km, aber selbst bei 2,10m signalisierte Yelenas Körper: „2,06 m ist die Grenze, Schatz.“ Und das war's. Fantasie und Realität – die Kluft ist zu groß, um sie zu überbrücken.
Lassen Sie uns mal schauen, wie groß diese Kluft ist. Wer gern etwas rechnet, hat schon erkannt: Die 400.000 km zum Mond sind 400 Milliarden Millimeter, ein Zwei-Meter-Hochsprung sind 2000. Und damit wären wir bei der Veranschaulichung des Verhältnisses, das auch in unseren Gehirnen existiert: 400 Milliarden Bits Input versus 2000 Bits Bewusstseinskapazität.
Und weiter geht’s: Wenn wir jetzt 2000 durch 400 Milliarden teilen, kommen wir auf 1 Bit aus 200 Millionen – so wenige Sinnesdaten erreichen Ihr Bewusstsein.
Wenn Sie sich an nur eine Tatsache aus diesem Kapitel erinnern, dann bitte an die folgende:
Für jedes Bit, das Ihr Bewusstsein erreicht, erreichen 199.999.999 Bits Ihr Bewusstsein nicht!
Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und sich dann vor den Spiegel stellen, sich ernsthaft anschauen und laut sagen: „Ich lebe mein Leben bewusst.“ Und dabei nicht lachen.
Übrigens muss ich Sie vertrösten: Warum das wenige Bewusstsein, mit dem wir durchs Leben gehen, dennoch kein Grund zum Verzweifeln ist, dazu kommen wir im zweiten Kapitel. Jetzt wenden wir uns erst mal einem großen Philosophen zu, der neben sehr interessanten Dingen auch manchen Unsinn erzählt hat.
Philosophische Einsicht oder völliger Unfug?
Geistige Kapazitätsgrenzen mit den körperlichen Grenzen einer Hochspringerin zu vergleichen – ist das nicht etwas weit hergeholt? Sie glauben doch nicht wirklich, dass es Ihrem Gehirn so geht wie Yelena. Oder? Denn der Geist ist doch etwas Abstraktes. Bewusstsein ist doch mehr als das Rumgefunke einiger Neuronen. Ja, gewiss – und doch sind geistige Prozesse direkt abhängig von der physiologischen Realität des Gehirns. Dass dies unseren Glaubenssätzen und Werten so stark widerspricht, hat mit einem jahrhundertealten kulturellen Missgeschick zu tun: Wir können anscheinend nicht ablassen von philosophischem Gedankengut, das dem Geist eine Art Unabhängigkeit zuschreibt. Zum Beispiel vom kartesianischen Körper-Geist-Dualismus.
Im 17. Jahrhundert zerbrach sich ein Philosoph namens Descartes den Kopf darüber, wie wir sicher sein können, dass wir wirklich existieren, und kam zu der Schlussfolgerung: „Ich denke, also bin ich. “ Ob das Denken den einzigen oder deutlichsten Nachweis für unsere Existenz erbringt, ist eine spannende Frage; durch Descartes‘ Aussage wird es jedenfalls auf ein Podest gehoben. Kein Wunder also, dass er auch annahm, der Geist laufe auf einem anderen Substrat als der Körper; Körper und Geist seien zwei vollkommen verschiedene Essenzen.
Aber wie teilt der Geist dann dem Körper mit, was er tun soll? Na klar: über die Zirbeldrüse, eine kleine Drüse im Mittelhirn, die zeitabhängige Körperrhythmen beeinflusst, zum Beispiel den Schlaf-Wach-Rhythmus. Doch leider war Descartes‘ Erklärung schon angesichts des damaligen Stands der Wissenschaft unsinnig. Heutzutage können wir nur darüber lächeln. Kein Wunder, dass der renommierte Stanford-Neurologe Robert Sapolsky den kartesianischen Körper-Geist-Dualismus „völligen Unfug“9 nennt. Sapolsky kommt in seinen Vorlesungen lässig, lustig und bisweilen etwas kaltschnäuzig daher. Aber er weiß, wovon er spricht. Er erklärt ohne Umschweife und ist für seine direkte Art bekannt.
Aber noch mal zurück zu Descartes und seinem Dualismus: Warum wurde dieser so lange als große Erkenntnis hochgehalten? Als Fundament unseres Selbstverständnisses? Dafür gibt es 3 Erklärungsmodelle:
#1: Selbst heutzutage ist es noch verdammt schwierig, den Geist zu erklären. Trotz bildgebender Verfahren und modernster Forschung. Der Geist bleibt ein Mysterium. Das macht ihn zu etwas grundlegend anderem als einem Muskel, den wir sehr wohl mit großer Genauigkeit auseinanderlegen und in seiner Funktionsweise erläutern können. Da bietet sich das Konzept eines anders geartetes, etwas geheimnisvoll anmutenden Substrats für den Geist geradezu an. Das hilft uns heutzutage genauso aus der wissenschaftlichen Hilflosigkeit wie vor mehr als 350 Jahren.
#2: Eine weitere große Kraft, die unsere Kultur über Jahrtausende geformt hat, ist die Religion. Und die sagt unter anderem: „Der Geist ist willig, doch das Fleisch ist schwach.“ Descartes hat also den Körper-Geist-Dualismus keineswegs erfunden, sondern unsere Kultur trennt – schon seit Jahrtausenden – den Geist vom Körper.
#3: Haben Sie Ihren Geist schon mal in den Händen gehalten? Natürlich nicht. Unsere eigene, ganz individuelle Erfahrung unseres Geistes ist auf keine Art und Weise materiell nachvollziehbar. Wir können ihn nicht anfassen. Wir können ihn nicht riechen. Unsere körperlichen Sinne können den Geist nicht erfassen. Es ist also nachvollziehbar, warum wir über Jahrhunderte darauf bestanden haben, der Geist sei etwas Abstraktes, etwas Nicht-Körperliches. Eine mystische Essenz. Und es ist auch nachvollziehbar, dass wir das subjektiv weiterhin so empfinden.
Doch auch wenn die Wissenschaft das Phänomen Denken und den Geist nicht endgültig erklären kann, können spezifische Prozesse definiert werden, die Denken unterstützen und ohne die es kein Denken gibt. Die Verwobenheit von hirnphysiologischen Prozessen und Denken steht also im direkten Widerspruch zu Descartes‘ Körper-Geist-Dualismus, und für die Qualität unserer Gespräche ist es nicht zielführend, sich diesen Erkenntnissen zu verschließen. Schauen wir uns also noch mal genau an, was uns die Hirnforschung über die Kapazitätsgrenzen zu sagen hat, mit denen das Gehirn beim Kreieren von Bewusstsein kämpft.
Warum Ihr Gehirn so viele Sinnesdaten trasht
Warum nehmen Sie eigentlich nur so einen unendlich kleinen Bruchteil der Datenmenge, die Ihre Sinne liefern, bewusst wahr? Warum schmeißt Ihr Gehirn so viel weg? Wir erinnern uns an Yelena Slesarenko und die Lektion eins: Unser Körper hat physiologisch festgelegte Grenzen. Wir können versuchen, Höchstleistungen zu erbringen – aber nicht jenseits unserer physiologischen Beschaffenheit. Und genau an diesem Punkt müssen wir uns vom Körper-Geist-Dualismus freimachen. Bewusstes Erkennen ist ein physiologischer Prozess und als solcher ein riesiger Energiefresser.
Ihr Gehirn ist eine Art Cookie-Monster. Es macht nur 2% Ihres Körpergewichts aus, aber es verschlingt 20% der von Ihrem Körper produzierten Energie – im Normalzustand. Wenn es Vollgas gibt, verdoppelt sich dieser Prozentsatz. Dann verliert Ihr Körper die Fähigkeit, Organe zu reparieren oder z.B. Ihre Skelettmuskulatur ordentlich mit Sauerstoff zu versorgen. Viele andere Systeme werden heruntergefahren, um Ihrem Gehirn den für Hochleistungen notwendigen extra Energieschub zu gönnen.
Aber Ihr Körper weiß auch, dass er eine solch intensive Gehirnaktivität – wie etwa beim Schachspielen – nicht ewig ohne Schaden aushalten kann, also setzt er ein Zeitlimit. Ihr Körper legt also strenge Regeln für Ihren gesamtphysiologischen Energiehaushalt fest, damit Ihr Gehirn Sie nicht umbringt. Und diese Regeln kann auch Ihr Gehirn nicht missachten, egal, wie fokussiert Sie sein wollen. Egal, wie viel Aufmerksamkeit Sie Ihrem Gesprächspartner schenken wollen.
Das ist das Schöne an der Yelena-Story. Sie zeigt uns, wie es sich mit der Annahme unendlicher Bewusstseinskapazität verhält. Wer einen solchen Anspruch stellt, der erwartet von Yelena einen Mondsprung. Oder von sich selbst. Manche versuchen das. Doch wer körperliche Grenzen missachtet, dem kann es mitunter so ergehen wie Ibrahim Belgasem, der mit einer intellektuellen Hochleistung seine Belastbarkeit bis an die allerletzte Grenze ausreizt – und dann einfach umkippt.
Gaddafis UN-Rede und der mysteriöse Dolmetscher
22. September 2009: General Muammar al-Gaddafi betritt ein Beduinenzelt – nichts Ungewöhnliches im Leben des Libyers. In Tripoli dient ein besonders prachtvolles, kugelsicheres Zelt Gaddafi als Palast, in dem er internationale Würdenträger und Politiker empfängt. Aber er ist nicht in Tripoli. Er hat seinen Zeltpalast in fünf Frachtflugzeuge verpacken und nach New York fliegen lassen.
Dort wollte er es im Central Park von Manhattan aufstellen, sein Antrag wurde aber von den lokalen Behörden abgelehnt. Stattdessen errichtet er es dann auf Donald Trumps 86 Hektar großem Anwesen Seven Springs in Westchester. General Muammar al-Gaddafi, der angebliche Drahtzieher des Lockerbie-Bombenanschlags, auf dem Grund und Boden eines zukünftigen US-Präsidenten.
Kurz darauf machen kritische Beobachter darauf aufmerksam, dass Trump einen Terroristen beherberge, aber sie werden mit einem klaren Dementi konfrontiert: Trump habe sein Land an ein libysches Unternehmen verpachtet und wüsste überhaupt gar nichts von einer möglichen Verbindung zu Gaddafis Besuch, einem Ereignis, das sich seit Jahrzehnten anbahnt - denn Gaddafi ist nach New York gekommen, um nach 40 Jahren im Amt seine erste Rede vor der UN-Vollversammlung zu halten. Am Ende zwingt der Medienrummel Gaddafi dann doch, umzuziehen.
Am Tag darauf spricht er vor der UN-Vollversammlung. Er hatte 1969 die Macht in Libyen ergriffen, und in seiner Rede klagt er nun über jahrzehntelange westliche Manipulationen in Nordafrika. Dies mag einer der Gründe sein, warum er 100 Minuten spricht, statt der vorgesehenen 15.10 Die Länge seiner Rede wird unerwartete und lebensbedrohliche Folgen haben, insbesondere für Herrn Ibrahim Belgasem, Gaddafis persönlichen Dolmetscher.
Hier muss erwähnt werden: Ibrahim Belgasem ist ein Pseudonym. Aus Gründen, die gleich nachvollziehbar werden, wird der Name dieses Dolmetschers nicht offen gehandelt. Gaddafi hatte seinen Übersetzer übrigens persönlich ausgewählt, da die UN zwar für sechs Sprachen Dolmetscher zur Verfügung stellt, nicht aber für den lokalen libyschen Dialekt, in dem Gaddafi seine Rede halten wollte.
Gedolmetscht wird bei der UN simultan. Das bedeutet, dass der Sprecher nicht wartet oder Pausen einlegt. Die Dolmetscher müssen schnell, präzise und ununterbrochen weiterarbeiten – es bleibt keine Zeit, Fehler zu korrigieren oder kulturelle Nuancen im Detail zu erklären.
Simultandolmetschen erfordert ein so immenses Maß an Konzentration, dass es kein menschliches Gehirn stundenlang aushalten kann. Daher arbeiten UN-Dolmetscher paarweise und wechseln sich im 20-Minuten-Takt ab.
Ibrahim Belgasem hatte keinen Partner. In den Aufzeichnungen von Gaddafis Rede kann man sehen, dass er sich nach etwa einer halben Stunde immer schwerer tut. Nach 75 Minuten sagt Herr Belgasem plötzlich: „Ich halte es einfach nicht mehr aus!“11 Ein Raunen geht durch die Menge.
Diese Art Aussage widerspricht dem grundlegendsten Qualitätsanspruch für Dolmetscher: Sie sollen die unverfälschte Stimme des Kunden sein. Sie werden nicht angeheuert, um ihre eigene Meinung zu äußern, geschweige denn persönliche Frustrationen. „Ich halte es einfach nicht mehr aus!“ ist ein professioneller Todeswunsch. Oder ein echter, wenn man die Persönlichkeit des Auftraggebers bedenkt.
Doch es kommt noch schlimmer: Wenige Sekunden später bricht Ibrahim vor Erschöpfung körperlich und geistig zusammen – ein Novum in der Geschichte der UN-Vollversammlung. Und ein vermeidbares Schicksal, denn die arabische Chef-Dolmetscherin der UN, Rasha Ajalyaqeen, die für Ibrahim einspringt, erklärt später, dass sich Gaddafis „lokaler Dialekt“ nicht erheblich vom Standardarabisch unterschieden habe – eine der sechs Sprachen, für die die UN Weltklassedolmetscher zur Verfügung stellt, die in Paaren arbeiten.
Solche Extremsituationen zeigen uns, was passiert, wenn geistige Leistungsanforderungen körperliche Grenzen überschreiten. Ich kenne kein besseres Beispiel dafür, dass es Belastungsgrenzen für Bewusstsein und Aufmerksamkeit gibt und dass sie körperlicher Art sind. Also: Auch wenn wir im Alltag unser Gehirn wahrscheinlich nie derart überlasten werden, ist es doch interessant zu sehen, welch gravierende Konsequenzen eine Missachtung der Grenzen haben kann.
Damit wissen wir, was passieren kann, aber noch nicht genau, wo im Gehirn es passiert: Welche Gehirnareale sind es denn, die so viel Energie benötigen, um Bewusstsein zu ermöglichen?
PFC, ACC und andere energiefressende Teile Ihres Gehirns
Wir haben gelernt, dass Ihr Gehirn normalerweise circa 20% der vom Körper produzierten Energie verbraucht, dass aber intensive kognitive Prozesse einen Spike bis zu 35-40% verursachen können. Doch was bedeutet das? Welcher Teil des Gehirns schluckt so viel Energie?
Da das Gehirn äußerst komplex ist, machen wir das mal wie bei Google Maps: Wir zoomen einfach mitten rein.
Den äußeren Teil Ihres Gehirns, mit seinen einer Walnuss ähnelnden Furchen, nennt man die Großhirnrinde oder auch Cortex. Direkt hinter Ihrer Stirn sitzt der frontale Cortex, also der vordere Teil der Großhirnrinde. Hier finden Bewusstseinsprozesse statt. Der frontale Cortex befasst sich mit Problemlösung, Planung und Strategie. 12
Wir zoomen noch mal näher ran und finden im frontalen Cortex den PFC – das ist der präfrontale Cortex – und den ACC, den anterioren cingulären Cortex. Diese beiden sind bei komplexen Denkleistungen besonders aktiv.
Wir zoomen nun noch weiter hinein, bis auf Zellebene, und finden dort Spindelneuronen.13 Diese speziellen Neuronen, die mit dem Entstehen von Bewusstsein in Verbindung gebracht werden, befinden sich in nur wenigen Teilen des Gehirns. Unter anderen im präfrontalen und im anterioren cingulären Cortex.
Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass in jeder unserer Zellen Zucker mit Sauerstoff verbrannt wird. Als Abfallprodukt entsteht dabei CO2. Das heißt, der Vergleich mit anderen Verbrennungsmotoren ist nicht völlig abwegig. Wenn man sich also die Größen verschiedener Zellen anschaut, merkt man schnell: Auch unter Nervenzellen gibt es Kleinwagen, Familienautos und panzerähnliche SUVs. Die Zellkörper von Spindelneuronen sind etwa viermal so groß14 und verbrauchen ein Vielfaches der Energie anderer Neuronen. Spindelneuronen sind also die SUVs Ihres Gehirns.
Genug der Details. Wir zoomen wieder etwas heraus und schauen uns den frontalen Cortex an, den Teil der Großhirnrinde direkt hinter Ihrer Stirn. Der schon erwähnte Stanford-Professor Robert Sapolsky fasst das Energieproblem, das Ihre Kapazität für Bewusstsein einschränkt, so zusammen: „Der frontale Cortex hat einfach eine extrem hohe Stoffwechselrate.“15 So, damit haben unsere Schuldigen gefunden: Spindelneuronen, PFC, ACC – grob zusammengefasst: der gesamte frontale Cortex.
Aber um zu verstehen, warum Ibrahim Belgasem umkippte, müssen wir uns das Gehirn nochmals als großes Ganzes zu Gemüte führen. Wir zoomen also wieder ein Stück zurück: Da sehen wir unter der Großhirnrinde, im Zentrum Ihres Schädels, das Mittelhirn und das Stammhirn. Dies sind evolutionär ältere Teile des Gehirns, hochgradig automatisiert und sehr energieeffizient. Dagegen ist der frontale Cortex ein junger Spund, eine Art evolutionärer Teenager des Gehirns.16 Er ist lebhaft, strotzt vor Kraft und nimmt manchmal einfach so zum Spaß drei Treppenstufen auf einmal. Das Mittel- und Stammhirn tadeln ihn dann mit erhobenem Zeigefinger: „Gehen, nicht rennen!“
Ibrahims Problem ist aber, dass sein frontaler Cortex den erhobenen Zeigefinger nicht sieht: Er steht unter Druck. Er muss immer weiter dolmetschen, ununterbrochen. Gaddafi sagt man nicht einfach: „Ich brauch jetzt mal ne Pause.“ Nach guter SUV-Manier verbrennen deshalb Ibrahims Spindelneuronen ganz unverschämt viel Glukose mit Sauerstoff und pusten dann ganz unverschämt viel CO2 in seinen Körper. Aller Wahrscheinlichkeit nach verschlingt sein Gehirn gerade etwa 40% der Energie, die seinem ganzen Körper zur Verfügung steht. Andere überlebenswichtige Körperfunktionen werden dabei in Mitleidenschaft gezogen.
Ibrahims Mittel- und Stammhirn bemerken die sich anbahnende Energiekrise und tadeln den frontalen Cortex wiederholt: „Gehen, nicht rennen!“ Als das jedoch nichts bringt, ziehen sie den mächtigen Hypothalamus zu Rate. Der Hypothalamus agiert dabei wie ein Streitschlichter. Er ist verantwortlich für die Homöostase, die Ausgewogenheit aller Körperfunktionen.
Doch selbst auf den Streitschlichter kann Herr Belgasem nicht hören, denn ehrlich gesagt macht ihm Gaddafi mehr Angst. Sein „Teenager“-Gehirn kämpft sich weiter mit schwierigen Dolmetscheraufgaben ab, bis der völlig außer Rand und Band geratene Energiesog das ordnungsgemäße Funktionieren von Organen, Kreislauf und anderen lebenswichtigen Prozessen gefährdet.
Das lässt dem Streitschlichter und den älteren, weiseren Gehirnarealen schließlich keine Wahl. Also tun die, was die Alten eben tun, wenn ihnen ein Teenager zu wild wird: Sie setzen ihn unter Hausarrest und stellen den Strom ab.
Die Konsequenz: Ibrahim Belgasem bricht zusammen. Die Moral: Leg dich nicht mit dem Streitschlichter an.
Doch damit sind wir noch längst nicht am Ende der wichtigen Erkenntnisse, die wir aus der Geschichte von Herrn Belgasem ziehen können. Denn in diesem Kapitel geht es schließlich darum, wie wir in Gesprächen unsere Aufmerksamkeit lenken.
Das Belgasem-Beispiel macht klar: Aufmerksamkeit braucht Energie. Das erklärt auch, warum Pausen so wichtig sind, wenn die Energie schwindet, denn der Energiehaushalt beeinflusst unsere Aufmerksamkeit. Diese wird keineswegs nur von reiner Vernunft gesteuert, sondern evolutionäralte Gehirnareale, die man auch in Fischen und Salamandern findet, beeinflussen unsere Aufmerksamkeit mit: das Mittelhirn, das Stammhirn, der Schiedsrichter. Und wenn die dem Bewusstsein den Strom abschalten, dann ist es nicht weit her mit der Aufmerksamkeit.
Mia und Fred
Sie erinnern sich an unsere Protagonisten, die sich gerade im Zug kennengelernt haben: Mia und Fred. Nun befinden sich Mia und Fred in einer anderen Situation als Gaddafi und Ibrahim. Hier schimpft kein Despot, hier lauscht keine UNO-Vollversammlung, und im Großraumabteil unserer kleinen Geschichte werden niemandem übermenschliche Denkleistungen abverlangt – zum Glück nicht. Fred und Mia sollen ja auch nicht gleich umkippen. Sie lernen sich doch gerade erst kennen. Aber natürlich unterliegen ihre Gehirne genau den gleichen Einschränkungen wie das von Herrn Belgasem, auch wenn sie weniger unter Belastung stehen.
Nur ein Zweihundertmillionstel aller Sinnesdaten schafft es ins Bewusstsein. Nicht alles wird korrekt gehört. Dadurch entstehen Missverständnisse. Wie heißt Fred noch mal mit Nachnamen?
Sprache und kognitive Problemlösung fordern den frontalen Cortex. Bis die Sitzordnung geklärt ist, sind Freds und Mias PFCs und ACCs intensiv getriggert.
Selbst bei mittelmäßiger Belastung schauen dem präfrontalen Cortex immer auch andere Gehirnareale im Mittel- und Stammhirn über die Schulter. Sie bestehen auf ein Mitspracherecht bei der Energieverteilung und somit auch bei der Steuerung von Aufmerksamkeit.
Wenn man sich überlegt, was so alles in einem Zug los ist, dann gibt es da viel Potenzial für Ablenkungen. Und einige dieser Ablenkungen erfordern zwangsläufig Aufmerksamkeit: Der ältere Herr erhebt sich, Fred steht auf, alle tauschen die Plätze. Mia muss sich um ihren Koffer kümmern und holt ihren Laptop raus, geht ans Telefon.
Die Konsequenz: Da so wenig Kapazität zur Verfügung steht, um die Worte unseres Gegenübers in unser Bewusstsein zu hieven, ist eine gute Steuerung unserer Aufmerksamkeit auf eben diese Worte das A und O für jedes gute Gespräch.
Es kann also auch mal passieren, dass man etwas überhört, selbst wenn man direkt angesprochen wird. So hätte es sein können, dass Fred, noch ins Gespräch mit seinem Sitzpartner vertieft, Mias Worte gar nicht bewusst wahrnimmt, als sie sagt: „Entschuldigen Sie, ich glaube, Sie sitzen auf meinem Platz.“
Wenn wir an die 1-zu-200 Millionen-Wahrscheinlichkeit denken, dass Sinnesdaten überhaupt in unserem Bewusstsein landen, stellt sich die Frage: Was verleitet Freds Gehirn dazu, diese relevanten Daten – Mias Worte – aus der riesigen Summe anderer Input-Daten hervorzuheben? Woher weiß sein Gehirn denn, was relevant ist?
Warum wirft Freds Gehirn Mias Worte nicht versehentlich mit dem Rest des 399-Milliarden-999-Millionen-998-Tausend-Bit-pro-Sekunde-Mülls weg? Mias Worte in sein Bewusstsein zu hieven, ist für Freds Gehirn wie das sprichwörtliche Finden einer Nadel im Heuhaufen. Zuhören erfordert eine extrem ausgetüftelte Aufmerksamkeitssteuerung – die, wie es scheint, Freds Gehirn gerade zufällig bereitstellt.
So dargestellt, scheint gutes Zuhören etwas von einem Lotteriespiel zu haben, das wir immer wieder zufällig gewinnen. Nun gut, ganz so zufällig ist es dann doch wieder nicht. Das Gehirn hat einige spannende Tricks auf Lager, die wir gleich kennenlernen werden.
Erst kehren wir kurz zu Mia und Freds Gespräch zurück, und dann schauen wir uns einen ganz besonderen Mechanismus an, mit dem unsere Gehirne den schwachen Lichtkegel unseres Bewusstseins immer wieder auf die Worte unseres Gegenübers schwenken. Übrigens hat die Forschung diesen Mechanismus zwar aufgespürt – sie kann ihn aber nicht endgültig erklären.
Es bleibt also eine Prise Magie im Spiel.
Dialog 2
45 Minuten sind vergangen, seit Mia ihr Gespräch mit Herrn Brilldorst entgegennahm und den Großraumwagen verließ. Jetzt kehrt sie zu ihrem Sitzplatz zurück.
[Geräusche: sanftes Zug-Gerappel. Leise Gespräche.]
Mia:
[am Handy, sich nähernd] Ja, danke. Ihnen auch! Und schöne Grüße an Ihre Frau. [Mias Handy klingelt erneut; sie schaltet es schnell aus.]
Eine Frau:
Sie – jetz‘ aber! Die janze Zeit loofen Se schon mit Ihr‘m Handy rum, als wär‘n Se wat sonstwie Wichtijet.
Mia:
Ist schon aus, wollte Sie nicht stören.
Eine Frau:
Hammse aba.
[Mia setzt sich zu Fred.]
Mia
[zu sich selbst] Was der bloß über die Leber gelaufen ist.
Fred:
Man steckt da nicht drin.
Mia:
Wie bitte?
Fred:
In den Köpfen anderer.
Mia:
Ja, das können Sie wohl laut sagen.
Fred:
Und dann wiederum, manchmal doch.
Mia:
Wie meinen Sie das?
Fred:
Ach, ich denke gerade an das Gespräch mit Herrn Regensburg.
Mia:
Jetzt wollen Sie mir doch ein schlechtes Gewissen machen, dass ich sie unterbrochen habe ...
Fred:
Nein, nein. Wirklich nicht. Er war ja fertig. Aber kennen Sie das? Manche Leute sind einfach geborene Erzähler. Man denkt, man würde die Welt durch ihre Augen betrachten.
Mia:
Neuronales Entrainment.
Fred:
En-was?
Mia:
Entrainment.
Fred:
Noch nie von gehört – Sie sind nicht Neurologin, oder?
Mia:
Nein, ich organisiere Kongresse.
Fred:
Kongresse wofür – Gehirnscanner?
Mia
[lacht] Nein, aber die Branche stimmt schon. Medizintechnologie.
Fred:
Also doch Gehirnscanner. Muss ich jetzt aufpassen, was ich heimlich über Sie denke?
Mia:
Nein, aber wollen Sie wissen, warum manche Menschen geborene Erzähler sind?
Fred:
Na, dann erzählen Sie mal. Neuronales was …?
[FADE OUT]
Neuro-Tricks: So schwenkt Ihr Gehirn den kleinen Lichtkegel auf Gespräche
1656: Der niederländische Wissenschaftler Christiaan Huygens erfindet die Pendeluhr – und hebt damit die Qualität der Zeitmessung auf ein völlig neues, bis dato unbekanntes Niveau. Huygens Pendeluhr erhöht die Genauigkeit gegenüber früheren Uhren so enorm, dass seine Erfindung über knapp drei Jahrhunderte der genaueste Zeitmesser der Welt bleibt. Erst die Quarztechnologie der 1930er Jahre wird ihr in Sachen Präzision Konkurrenz machen. Und die Pendeluhr wird noch später – im 21. Jahrhundert – die Neurolinguistik beeinflussen. Davon wusste Huygens allerdings nichts, als er seine physikalische Entrainment-Theorie entwickelte.
1666: Christiaan Huygens hat für Präzisionstests zwei Uhren auf ein Holzbrett montiert. Er setzt sie in Gang, und sie ticken vor sich hin, jede für sich genau, aber nicht synchron mit der anderen. Wie ein Herzschlag: tick-tack, tick-tack, tick-tack. Und so soll es auch bleiben, denn wenn beide Uhren genau laufen, darf sich das Intervall zwischen „tick“ und „tack“ nicht ändern. Doch dann geschieht das Undenkbare: Minute um Minute verringert sich die Verzögerung zwischen den hörbaren Klicks der Uhren, bis sie sich vollständig synchronisiert haben.
Huygens ist beunruhigt. Er vermutet zunächst einen Konstruktionsfehler und dass durch eine winzige Geschwindigkeitsabweichung die eine Uhr die andere eingeholt hat. Er wartet, darauf, dass die schnellere Uhr die langsamere über holt. Aber Stunden später sind sie immer noch synchron. Mehrere Tage später ebenfalls.
Huygens kann sich das Phänomen nicht erklären, doch dann kommt er auf eine Idee: Was wäre, wenn die Schwingungen der Uhren sich irgendwie gegenseitig beeinflussten? Er findet des Rätsels Lösung in den Schwingungen des Holzbretts, auf dem die Uhren stehen. Da das Brett mitschwingt, koppelt es die Schwingungen der Pendel aneinander – und synchronisiert sie.
Aus dieser Erkenntnis entwickelt Huygens die Theorie des physikalischen Entrainments , also der natürlichen Tendenz gekoppelter Schwingungen, sich zu synchronisieren.17 Sie können ein einfaches Huygensches Entrainment-Experiment übrigens auch ohne Pendeluhren zuhause nachstellen – die Erklärung dazu finden Sie unter
hirnundherzbonus.de
Entrainment: Wenn Fred und Mia einander zuhören, werden ihre Hirnwellen synchronisiert
Das Spannende an der Entrainment-Theorie ist ihre große Allgemeingültigkeit. Sie gilt nicht nur für die Schwingung von Pendeln, sondern für alles, was schwingt: Gitarrensaiten, Wellen im Ozean, Luftmoleküle, Elektrizität. Und Synchronisationen können sogar über verschiedene Elemente hinweg stattfinden, solange eine geeignete Kopplung gegeben ist.
Mehr als 300 Jahre später wird eine Bühne für Uri Hasson vorbereitet, Professor für Psychologie und Neurowissenschaften an der Universität Princeton. Hasson wird der Welt neuronales Entrainment erklären. 2017 führt er in seinem TED-Vortrag aus:
Unsere Gehirne haben ein gemeinsames neuronales Protokoll entwickelt, das es uns erlaubt, Gehirnkopplung für den Informationsaustausch nutzbar zu machen.18
Vereinfacht gesagt, machen zwei Gehirne beim Sprechen etwas Ähnliches wie Huygens‘ Uhren: Sie synchronisieren sich. Hassons Forschung und sein TED-Vortrag sind so faszinierend, weil sein Labor nicht nur ein generalisiertes Entrainment nachweisen konnte, sondern sogar die spezifische Synchronisierung diskreter Hirnareale, die für bestimmte Schritte der Sprachverarbeitung verantwortlich sind.
Die Hirnareale für Sprachlauterkennung werden unabhängig von denen für lexikalischen Zugriff synchronisiert. Auch Grammatik und Semantik werden separat synchronisiert. Und manchmal läuft eine Synchronität gut, auch wenn es an anderer Stelle hapert.
So können die Hirnareale, die Bedeutung generieren, synchrone Schwingungen aufweisen, auch wenn die Synchronisierung der Sprachlauterkennung kurzfristig gestört ist, z.B. durch die Geräuschkulisse in einem fahrenden Zug.
Totschlag, Fressen, Sex: Was unsere Aufmerksamkeit sonst noch triggert
Neuronales Entrainment unterstützt also den Fokus auf gute Gespräche – aber natürlich nicht immer. Sonst hätten alle Paare, Kollegen und Diplomaten optimal synchronisierte Gespräche. Und wir wissen: So ist es nicht. Manchmal streiten wir, und manchmal hören wir einander einfach nicht richtig zu.
Denn es gibt ja so viele andere Dinge, die ebenfalls unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Evolutionär bedingte Steuerungsmechanismen lenken unsere Aufmerksamkeit etwa mit großer Vorliebe auf Bedrohungen, Nahrung und Fortpflanzungsmöglichkeiten.
Diese extern getriggerte Fokussierung löst dann blitzschnelle Reaktionen aus, wie z. B. die Angst vor einem vorbeiziehenden Rudel Wölfe, die Freude beim Entdecken eines wilden Erdbeerstrauches oder die Erregung durch einen potenziellen Sexpartner. Und doch hat die menschliche Spezies nicht nur überlebt, weil wir uns schützen, futtern und Babys machen. Homo sapiens‘ Erfolg beruht auch auf der Entwicklung von Sprache. Sprache ermöglichte uns, die Kraft der Kooperation intensiver und kreativer zu nutzen als andere Spezies.
Mit Voranschreiten der menschlichen Evolution lernten wir also auch, die Erdbeeren einen Moment lang zu ignorieren, um dem Stammesführer zuzuhören. Und als unsere sprachlichen Fähigkeiten und das komplexe kooperative Verhalten sich verfeinerten, änderten sich auch die Steuerungsmechanismen für Aufmerksamkeit im Gehirn. Sprachlaute wurden immer wichtiger, bis das menschliche Gehirn ihnen eine ähnliche Priorität einräumte wie Selbstschutz, Ernährung und Fortpflanzung.
Bei Tausenden von Generationen sprechender Vorfahren kann sich Fred also bedanken, wenn sein Gehirn Mias Worte aus dem Lärm herausfiltert, während der Zug durch einen Tunnel rauscht. Denn über Zehntausende von Jahren hat sich nach und nach das menschliche Gehirn darauf eingestellt, genau diese Laute zu priorisieren.
Sprachlaute haben bestimmte Frequenzen und erkennbare melodische Muster, und unsere Gehirne haben gelernt, diese Laute als „top priority“ zu kennzeichnen. So helfen sie uns, Sprachlaute aus dem Datenmeer der 400 Milliarden Bits pro Sekunde herauszupflücken, damit sie hoffentlich zu dem Ein-zweihundert-Millionstel gehören, das ins Bewusstsein gehoben wird. Fassen wir zusammen:
Die Evolution hat Ihr Gehirn gelehrt, Bedrohungen, Nahrung, Sex und (etwas später) Sprachlaute zu priorisieren. Diese „Prioritätskennzeichnung“ für Sprachlaute unterstützt das neuronale Entrainment in Gesprächen.
Aber wie genau? Bei Huygens‘ Pendeluhren ist es klar. Denen bleibt gar keine Wahl: Sie synchronisieren sich sozusagen zwangsläufig, denn das mitschwingende Holzbrett lässt keine Asynchronität zu. Doch wir Menschen haben die Wahl. Mal synchronisieren sich unsere Gehirne, mal nicht. Wir können die Kopplung ein- oder ausstellen.
Das Magische daran ist, dass Forscher noch nicht genau sagen können, wie die Kopplung zustande kommt. Nur, dass es sie gibt. Klar, es gibt Hypothesen. Aber das „Holzbrett“ hat noch niemand gefunden. Es bleibt ein Mysterium.
Erzählen Sie mal was Interessantes!
Glücklicherweise können wir allerdings sehr wohl etwas darüber sagen, welche Fähigkeiten gute Erzähler haben. In guten Erzählungen gibt es oft etwas Überraschendes, eine neue Erkenntnis, eine wichtige Information, die uns aus unseren Denkroutinen herauszwingt.
Das führt zu einem Noradrenalinschub, der uns aufweckt und Aufmerksamkeit auf das Gespräch ausrichtet. Dabei sind der Schwierigkeitsgrad und die Komplexität des Neuen wichtig – zu viel Verwirrung und zu viel Noradrenalin schaden der Aufmerksamkeit. Die Erwartung einer Auflösung oder eines positiven Ergebnisses hingegen – und damit einhergehende Dopamin-Ausschüttungen – fördern unsere Aufmerksamkeit.
Sowie unsere Gefühle: Wenn wir uns miteinander unterhalten, geht es oft um unsere Mitmenschen. Menschen, die wir entweder selbst kennen, oder Vorbilder, die uns Ideale aufzeigen. Manchmal geht es auch ganz direkt um uns selbst oder unseren Gesprächspartner. Die Gefühle, die wir diesen Personen gegenüber empfinden, lenken auch unsere Aufmerksamkeit.
Bei Gesprächsthemen, bei denen es nicht um Menschen geht, sind wir wählerischer. Eine Eröffnungsstrategie im Schach ist eben nur für die interessant, die Schach spielen. Wir werden noch sehen, wie wichtig Gefühle bei der Steuerung von Aufmerksamkeit sind.
Für jetzt gilt die These:
Wenig Gefühl heißt
wenig Aufmerksamkeit.
Viel Aufmerksamkeit hingegen generiert der zielführende Umgang mit gemeinsamen Aufgaben. Wenn also eine Gruppe von Architekten ein modernes Kunstmuseum entwerfen darf, kann der Dopaminspiegel schon sehr hoch sein.
Dieses Beispiel zeigt auch, wie wichtig Erwartungen eines positiven Resultats im Gespräch sind. So ein „positives Resultat“ muss dabei übrigens nicht immer etwas Praktisches sein wie der Entwurf eines Kunstmuseums. Als Erwartung eines positiven Resultats zählt auch die Hoffnung, dass man sich besser kennenlernt oder dass ein Gespräch angenehm verläuft. Vielleicht sogar, dass man sich näher kommt. Doch das ist gar nicht so einfach.
Womit füllen wir unsere Gespräche?
Wir können unsere Gespräche mit praktischen Themen füllen. Wo wir für teures Geld essen waren, und welchen Wein man zu sich nahm. Man kann sich über Fashion oder den Lederbezug im neuen SUV unterhalten. Doch wenn das Ziel eines Gespräches ein Kennenlernen ist, wenn wir nach Vertrauen und Verbundenheit streben, dann ist das Praktische nur bedingt hilfreich.
Die Frage ist doch: Wie führe ich mit jemandem ein Gespräch, in dem er etwas über sich selbst preisgibt? In dem ich den Menschen kennenlerne, nicht den SUV?
An diesem Punkt merken wir: Vielleicht ist ja das Interessanteste gar nicht das Erzählen, sondern das Fragen und Erzählen lassen. Aber natürlich gehört zu einem angenehmen Gespräch mehr, als jemanden mit Fragen zu löchern, und dazu liefert Ihnen dieses Buch noch viele Erkenntnisse und gibt praktische Tipps.
Für gute Gespräche gilt: Es ist egal, wer man ist – was zählt ist, wie man ist. Gespräche mit Menschen, die sich in andere hineindenken, die die richtigen Fragen stellen und die gute Rahmenbedingungen für geistige Intimität schaffen, sind tausendmal spannender als der geilste SUV, und sei er auch mit Kalbsleder gepolstert.
Sie sind spannend und sie fokussieren unsere Aufmerksamkeit, insbesondere durch emotionale Aufmerksamkeitslenkung – aber ich greife vorweg. Dazu kommen wir noch ...
Fazit
Die wichtige Erkenntnis in diesem Kapitel ist: Neuronales Entrainment unterstützt – fast magisch – unseren Fokus in guten Gesprächen. Dabei bedeutet die Möglichkeit von neuronalem Entrainment aber nicht, dass es immer funktioniert. Wir werden uns also in den folgenden Kapiteln auch damit beschäftigen, wie wir es unterstützen können.
Neuronales Entrainment ist noch nicht die Antwort auf all unsere Probleme, denn wenn wir abgelenkt werden, bricht es zusammen.
Ein Grund dafür: in Ihrem Gehirn streiten sich zwei Aufmerksamkeitslenker, und während der eine Entrainment tatkräftig unterstützt, ist der andere ein unverbesserlicher Entrainment-Widersacher.
Dialog 3
Einige Stunden später. Berliner Hauptbahnhof. Mia und Fred gehen Richtung Ausgang. Sie hatten sich im Zug unterhalten, über ihre Jobs, Hobbys und Familien. So erfuhr Fred, dass Mia in Berlin ihren Vater besucht.
[Geräusche: Ansagen, Züge fahren ein und aus. Berlin Hauptbahnhof]
Mia:
Taxe?
Fred:
S-Bahn. Und Sie?
Mia:
Mein Hotel ist gleich um die Ecke.
Fred:
Hat mich sehr gefreut … grüßen Sie Ihren Vater – hoffentlich geht es ihm bald wieder besser.
Mia:
Danke. Hat mich auch gefreut.
Fred:
Na dann, schönen Aufenthalt in Berlin!
Mia:
Ämm, warten Sie – ist das …? Egal: Eine Sache wollte ich Sie doch noch fragen.
Fred:
Ja?
Mia:
Ich fand‘s nur so lustig. Der ältere Herr, der auf meinem Platz saß. Hieß der wirklich Regensburg?
Fred
[lacht] Nein. Tja, der war schon ein Unikat. Hatte wohl mal schlechte Erfahrungen mit nem Journalisten, der sich aber nicht als Journalist ausgegeben hatte.
Mia:
Wieso? Wer war denn Ihr „Herr Regensburg“?
Fred:
Keine Ahnung. Als wir uns vorstellten, wollte er mir seinen Namen nicht nennen. Ich sagte „Caldwell“ und er nur: „Ich komme aus Regensburg.“
Mia:
Aber …
Fred:
Tja, und dann habe ich ihn halt Regensburg genannt.
Mia:
Aber …
Fred:
Aber was?
Mia:
Freut mich, Sie kennenzulernen, Herr Caldwell.
Fred:
Das verstehe ich jetzt nicht.
[Plötzlich fiepst das Ansagesystem der Bahn wie verrückt, es hört sich an wie eine Rückkopplung. Mias und Freds Gespräch wird jäh unterbrochen, aber nur kurz. Nach 1 bis 2 Sekunden ist schon wieder alles vorbei.]
Mia
[laut] Sie kommen aus Berlin. Und ich dachte schon, toller Name: Fred Bellini.
Fred:
Haha – tja, wie Herr Regensburg schon vor ein paar Stunden sagte: man reist, man spricht, man sieht sich nie wieder. Da war ich eben Herr Berlin.
Mia:
Naja. Man sieht …
[Mias Handy klingelt, sie schaltet es stumm, geht nicht dran.]
Fred:
Ihr Vater?
Mia:
Ich rufe ihn zurück.
Fred:
Tja,
Ihren
Namen werde ich jedenfalls nicht vergessen. Ich meine, diesen Doppelnamen gibt’s bestimmt nicht oft, oder?
Mia:
Ja, da war wohl meine Mutter stur, und jetzt haben wir den Salat. Also ich ihn – den Salat.
Fred:
Einen einzigartigen Salat.
Mia:
Na dann. Schöne Grüße auch an Ihre Frau.
Fred:
Danke – okay, bis dann.
Mia:
Bis wann?
Fred:
Ach so ja, nein, ich meine: Das sagt man so … auf Wiedersehen.
Mia:
Tschüß.
Zwiegespalten: Ihre Aufmerksamkeit kämpft mit sich selbst
Stellen Sie sich einen Wagen vor, von zwei Pferden gezogen. Ein Kutscher lenkt ihn, daher wissen die Pferde, wo’s langgehen soll – und das ist gut so, denn wenn man diese Pferde sich selbst überlässt, wären sie uneins und würden immer in entgegengesetzte Richtungen losgaloppieren.
Etwas Ähnliches wie diese beiden Pferde haben Sie auch in Ihrem Gehirn: zwei Schaltkreise, die im Wettstreit miteinander versuchen, Ihre Aufmerksamkeit zu lenken. Mit einem kleinen, aber wichtigen Unterschied: Den Kutscher gibt es nicht.





























