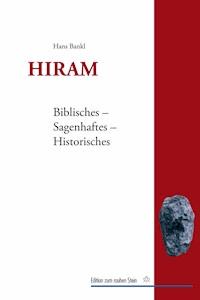8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Facultas / Maudrich
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
HANS BANKL, der große österreichische Pathologe, hat sein Leben dem Sammeln und Erforschen von Krankengeschichten und Todesursachen gewidmet. Schicksale berühmter historischer Persönlichkeiten und deren Ende – zusammengestellt in akribischer Kleinarbeit. Mord, Selbstmord oder doch ein natürlicher Tod? Die Frage, die oft nur EINEM gestellt wird – dem Pathologen. Spannend wie ein Krimi und informativ wie ein historisches Dokument lesen sich die Geschichten zu zwölf „besonderen Todesopfern“, die nicht nur durch ihre Persönlichkeit, sondern auch durch ihr Sterben in Erinnerung geblieben sind: • Gustav Klimt und Egon Schiele • Gustav Mahler und Franz Schubert • Thomas Bernhard und Ingeborg Bachmann • Kaiserin Elisabeth und Kaiser Franz Josef I. von Österreich • Kronprinz Rudolf und Baronesse Mary von Vetsera • Sigmund Freud und Ignaz Semmelweis
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Titel
Gestorben wird täglich
Die besten Geschichten des Pathologen Hans Bankl
Vorwort
In Shakespeares Drama sind die letzten Worte des sterbenden Hamlet: “The rest is silence.”
Solches ist grundfalsch, denn über jeden Verstorbenen wird gesprochen, und vor allem Lebenswerk und Lebensende historisch bedeutender Menschen haben uns Nachfahren immer etwas zu sagen. Zwar sieht ein Arzt den Ablauf eines Lebens anders als ein Historiker, denn es werden jeweils andere Aspekte als wichtig erachtet und in den Vordergrund gerückt – die Darstellung wird also subjektiv. Genau das ist aber bei den hier vorgelegten medizinhistorischen Biografien beabsichtigt.
Das Wissen um Leiden und Sterben herausragender Persönlichkeiten des Kulturlebens ist für das Verständnis ihres Lebenswerkes von einer Bedeutung, die weit über das biografische Interesse am Schicksal des einzelnen hinausreicht. Es handelt sich ja um Personen, die uns allen etwas gebracht haben, von denen wir lernen durften und auf deren verloschenem Dasein wir weiter aufbauen können.
Die berufliche und wissenschaftliche Aufgabe eines Pathologen ist die Erfassung von Krankheits- und Todesursachen. Wenn dazu ein privates Interesse für Geschichte und historische Persönlichkeiten kommt, so ist der Weg eigentlich klar, der zu diesem Buch führte.
Wie einige andere Menschen auch, denen es vergönnt ist, ihren Neigungen nachzugehen, bin ich Sammler, jedoch auf einem besonderen Gebiet – ich sammle Todesursachen und Obduktionsprotokolle.
Es gibt nur eine Möglichkeit, mit Sicherheit zu klären, was den Tod eines Menschen verursacht hat: die wissenschaftlich durchgeführte Leichenöffnung, die Obduktion. Das ist deshalb so wichtig, weil die ärztlichen Fehldiagnosen zu Lebzeiten der Patienten bis zu 40% betragen. Im Laufe meiner 25jährigen Tätigkeit als Pathologe habe ich im Seziersaal etwa 30.000 Leichenöffnungen gesehen, einen Großteil davon selbst durchgeführt. Die genaue Zahl kann ich nicht angeben, bei 800 habe ich zu zählen aufgehört. Eine solch große Zahl an untersuchten Toten und gleichzeitig die streng morphologische Erziehung in der Wiener Medizinischen Schule berechtigen einen Pathologen zur kritischen Bewertung von Krankengeschichten und Todesursachen.
In diesem Buch habe ich versucht, an exemplarischen Beispielen von elf historischen Persönlichkeiten deren Krankheiten zu analysieren und die Todesursachen klarzulegen. In allen Fällen, wo ein Obduktionsbefund vorlag, konnte ich mich vor allem auf diesen stützen und die Krankengeschichte rekonstruieren: Dass dies nicht immer einfach war, zeigen etwa die Fälle Semmelweis, wo zwei verschiedene Obduktionsbefunde existieren, ganz zu schweigen von der Affäre um Kronprinz Rudolf und Baronesse Mary Vetsera in Mayerling, da in dieser Sache von Regierung und Kaiserhaus Österreich eine kategorische Vertuschungsstrategie durchgeführt wurde.
Im Falle Sigmund Freud stand nur eine ausführlich dokumentierte Krankengeschichte zur Verfügung, der Psychoanalytiker wurde nicht seziert, da dies keine weiteren Erkenntnisse gebracht hätte, seine Krankheit und sein Sterben waren ärztlich klar.
Hans Bankl †
Unsere Sonderedition mit neu zusammengestellten Geschichten von Hans Bankl ist viel mehr als nur eine Ansammlung von Dokumenten aus der Vergangenheit. Jedes einzelne erinnert an eine „True Crime-Geschichte“ und zeigt, dass die spektakulären Todesfälle nicht erst niedergeschrieben werden müssen, sondern schon längst passiert sind!
Wien, im Juli 2014
Das Maudrich-Team
Die Kunst zu Grabe getragen
Gustav Klimt 1862–1918 und Egon Schiele 1890–1918
Ein Künstler in Wien – Gustav Klimt
Gustav Klimts Leben fiel in eine der aufregendsten Epochen der Wiener Kulturgeschichte. Hinter der konservativen Fassade der Kaiserstadt begann der Aufbruch in die Moderne – ein erwachendes Interesse am „weiten Land der menschlichen Seele“ (Arthur Schnitzler) und die Befreiung der Sexualität durch die Psychoanalyse (Sigmund Freud) wurden zu beherrschenden Themen.
Die Kunst schien um die Jahrhundertwende an eine Grenze gelangt: die Natur war durchmessen, die Realität erkannt; nun ahnte man die Abgründe, die dahinter lagen, die dämonischen Kräfte der Psyche und des Sexus, vor allem deren Kombination, die Erotik.
Klimt war kein Revolutionär, er begründete keine Richtung und keine Schule. Sein zentrales Thema, der Lebenszyklus des Menschen, stand voll mit der Untergangsstimmung des „Fin de siècle“ im Einklang. Er wollte in seinen Gemälden den ewigen Kreislauf zwischen Menschwerdung und Tod darstellen, den unabänderlichen Wechsel zwischen Freude und Leid vermitteln. Dies zeigte er aber nicht – wie etwa Egon Schiele und Oskar Kokoschka – mit Hilfe von Gesichtern und Körpern seiner Modelle in einem Zustand des Schmerzes, der Qual oder der Lust, sondern bediente sich strenger Kompositionen und symbolischer Details. Seine Menschendarstellungen sind in eine dekorative Ornamentik eingebettet, oft hat man den Eindruck als seien die Figuren nur Beiwerk; ein phantastisches Mosaik von Formen und Symbolen beinhaltet die eigentliche Aussage des Bildes. Das ornamentale Element wurzelt einerseits in Klimts Ausbildung an der Kunstgewerbeschule, andererseits waren viele seiner Bilder Teile großangelegter Innendekorationen. Häufig wurde der Rahmen zum festen Bestandteil des Kunstwerkes; mit den wertvollen Materialien, die er in seinen Bildern verarbeitete, dokumentierte Klimt, dass er die Gemälde als Kostbarkeiten in sich, als Gesamtkunstwerke, betrachtete. Seine Art, Natürliches zu abstrahieren sowie Farben und Formen ihrer dekorativen Beschaffenheit oder symbolischen Bedeutung wegen darzustellen, machte Klimt zum bahnbrechenden Künstler der Moderne.
Es gibt einen kurzen Text von Klimt – über sich selbst; wann er diesen verfasst hat, ist unbekannt.
„Kommentar zu einem nicht existierenden Selbstporträt.
Malen und Zeichnen kann ich. Das glaube ich selbst und auch einige Leute sagen, daß sie das glauben. Aber ich bin nicht sicher, ob es wahr ist. Sicher ist bloß zweierlei:
1. Von mir gibt es kein Selbstporträt. Ich interessiere mich nicht für die eigene Person als Gegenstand eines Bildes, eher für andere Menschen, vor allem weibliche, noch mehr jedoch für andere Erscheinungen. Ich bin überzeugt davon, daß ich als Person nicht extra interessant bin. An mir ist weiter nichts besonderes zu sehen. Ich bin ein Maler, der Tag um Tag vom Morgen bis in den Abend malt. Figurenbilder und Landschaften, seltener Porträts.
2. Das gesprochene wie das geschriebene Wort ist mir nicht geläufig, schon gar nicht dann, wenn ich mich über mich oder meine Arbeit etwas äußern soll. Schon wenn ich einen einfachen Brief schreiben soll, wird mir Angst und bang wie vor drohender Seekrankheit. Auf ein artistisches oder literarisches Selbstporträt von mir wird man aus diesem Grund verzichten müssen. Was nicht weiter zu bedauern ist. Wer über mich – als Künstler, der allein beachtenswert ist – etwas wissen will, der soll meine Bilder aufmerksam betrachten und daraus zu erkennen suchen, was ich bin und was ich will.“
Eigentlich sollte Gustav Klimt Zeichenlehrer an einer Mittelschule werden, denn dies war das erste Ausbildungsziel der Kunstgewerbeschule. Verständige Professoren haben sein Talent erkannt und ihn vor dem Eintritt in den Schuldienst bewahrt.
Die wesentlichsten Ereignisse im Leben Klimts waren die Gründung der Secession und später der Mut zum Bruch mit ihr; die markierenden Einschnitte in seiner Arbeit betrafen die Konzeption der Universitätsbilder, womit er „öffentliches Ärgernis“ auslöste und sein Entschluss zu ihrem Rückkauf, mit dem er seine bedrohte künstlerische Freiheit wiedergewann. Seine bedeutendsten Leistungen als Zeichner und Maler sind die Enttabuisierung des Erotischen in der Österreichischen Kunst und die Portraits von Frauen aus dem Großbürgertum.
Was war das für ein Mann, der all dies zusammenbrachte?
Ein Zeitgenosse1 beschrieb ihn so: „Er ist untersetzt, eher dick, Athlet, ... hat lustige, derbe naturburschenhafte Manieren, die braune Haut eines Seemanns, starke Backenknochen und flinke kleine Augen. Vielleicht um sein Gesicht länger zu machen, trägt er über den Schläfen das Haar etwas zu hoch. Das ist das einzige, das entfernt auf ein mit Kunst befaßtes Individuum deutet. Wenn er spricht, tönt es laut, und mit starkem Dialekt. Er neckt gern und kräftig ...“
Auf dem kraftstrotzenden Körper eines Herkules saß der Kopf eines Fauns, mit üppigem Bartwuchs und einem schalkhaften Zug um die Augen. Albert Paris Gütersloh2 charakterisierte ihn als „Mann mit ... den geheimnisvollen Zügen des Pan unter Bart und Haar des gealterten Petrus.“
In der Gestalt eines Bären lebte eine empfindsame Seele, ablehnende Kritik seiner Bilder hat ihn immer tief verletzt. Klimts Persönlichkeit faszinierte: Der bis auf die Knöchel fallende Malerkittel verstärkte den Eindruck eines Propheten; er war großzügig, gesellig und genussfroh, manchmal überwältigte ihn sein Temperament zu cholerischen Anfällen. Lange Fußmärsche und gymnastische Übungen halfen, die überschüssige Kraft loszuwerden. Gegen die Verführung durch sinnliche Reize war er hilflos. Er verdiente sehr viel, doch gab er auch alles aus. „Das Geld muß rollen, dann interessiert es mich.“
In Klimts Atelierräumen hielten sich meist – mehr oder weniger bekleidet – mehrere Modelle gleichzeitig auf; wenn dem Künstler danach war, standen die Mädchen sofort für seine erotischen Skizzen zur Verfügung. Immer wieder erzählte man auch, dass Klimt unter seinem langen Mantelkleid nichts weiter anhatte, und dies auch, je nach Laune, demonstrierte.
Als der Häuserkomplex in der Josefstädterstraße 1914 demoliert wurde, musste sich Klimt von seinem versteckten Häuschen trennen und zog nach Unter St. Veit im Bezirk Hietzing in ein ebenerdiges Haus in der Feldmühlgasse 11.
Im Sommer, den er viele Jahre hindurch mit seiner Freundin Emilie Flöge am Attersee verbrachte, wanderte er stundenlang durch die Wälder und Berge oder ruderte auf dem Wasser. Um seine Gesundheit scheint er sehr besorgt gewesen zu sein, ebenso war ihm das Wetter wichtig. War Emilie nicht bei ihm, so berichtete er jeden Tag über die Wetterverhältnisse sowie über jeden kleinen Schnupfen, der ihn plagte.
Die Gründung der Wiener Secession war das große künstlerische Ereignis im Wien der Jahrhundertwende. Gustav Klimt war maßgeblich beteiligt. Die „Genossenschaft bildender Künstler Wiens“ hatte ihren Sitz im Künstlerhaus und war die einzige Interessenvertretung der zeitgenössischen bildenden Künstler. Wenn jemand dem leitenden Ausschuss nicht genehm war, gab es für ihn praktisch keine andere Gelegenheit auszustellen. Es musste daher zwangsläufig zu einem Eklat kommen, als die alten zwar noch den Vorstand innehatten, jedoch viele junge Künstler andere Vorstellungen entwickelten. Typisch war der Fall des Malers Josef Engelhart (1864–1941), der 1893 aus Paris zurückgekehrt versuchte, sein Aquarell „Kirschenpflückerin“ auszustellen. Die Jury lehnte das Bild ab – ein nacktes Mädchen unter Bäumen in wechselndem Sonnenlicht – aber nicht aus künstlerischen Bedenken, sondern weil man ein solches Bild den Damen der Gesellschaft nicht zumuten könne. Im selben Jahr 1893 wurde Gustav Klimt ohne Gegenkandidaten als Professor für Historienmalerei an der Akademie der (primo et unico loco) Bildenden Künste vorgeschlagen. Zur allgemeinen Überraschung und wahrscheinlich auf Einspruch des Thronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand wurde vom Kaiser ein anderer ernannt, Kasimir Pochwalski, ein Name der uns heute nichts mehr sagt.
Solche Konflikte waren Munition für die unzufriedenen Künstler und als der Aufstand 1897 da war, nannte man ihn Secession. Dies sollte sich auf ein antikes Vorbild beziehen, die „secessio plebis“, der Auszug des Volkes von Rom (493 v. Chr.) vor die Mauern der Stadt mit der Drohung, unmittelbar daneben ein zweites Rom zu gründen, sollten gewisse Forderungen nicht erfüllt werden.
Die „Secession“ begann als „Vereinigung österreichischer Künstler“ am 3. April 1897. Während einer tumultuarischen Sitzung der Künstlerhausgenossenschaft am 22. Mai desselben Jahres verließen Klimt und acht Kollegen schweigend den Saal. Zwei Tage später traten sie offiziell aus der Genossenschaft aus.
Die Zeitschrift „Die Zeit“ versuchte das Ziel der „Vereinigung“ zu definieren: „Die Vereinigung wirft der Genossenschaft nicht vor: Du bist für das ,Alte‘ und sie ruft ihr nicht zu: Werde ,modern‘. Nein, sie sagt ihr bloß: Ihr seid Fabrikanten, wir wollen Maler sein! Das ist der ganze Streit. Geschäft oder Kunst, das ist die Frage unserer Secession.“
Klimt zeichnete Entwürfe für das Secessionsgebäude, welches später von Joseph Maria Olbrich (1867–1908) errichtet wurde; die Kunstzeitschrift „Ver sacrum“ wurde herausgegeben und die erste Ausstellung der Secessionisten fand vom 26. März bis 15. Juni 1898 im Gartenbaugebäude am Parkring statt. Klimts Plakat zur Ausstellung zeigte ursprünglich den nackten Theseus im Kampf mit dem Minotaurus. Die Zensur forderte einen Überdruck von Baumstämmen zur Abdeckung der Blöße des griechischen Helden; nicht einmal ein Feigenblatt wurde akzeptiert. Die Ausstellung wurde ein gigantischer Erfolg. Die neugierigen Wiener kamen und kauften – 57.000 Besucher und 218 verkaufte Objekte, etwas noch nie Dagewesenes!
Zur Eröffnung erschien der achtundsechzigjährige Kaiser Franz Joseph, zeigte sich sehr interessiert und widmete sich den Aquarellen von Rudolf von Alt (1812–1905), der 86 Jahre alt war. „Er setzte den Zwicker auf“ so berichtet die Presse, „sah jedes der sechs Aquarelle lange an und meinte, es sei überraschend und erfreulich, daß der alte Herr noch so Vorzügliches leiste.“
Bei einem bizarren Bild eines anderen Malers wiegte der Monarch verwundert das Haupt: „Was für Farben die Leute sehen!“ Und als er schließlich vor einer Landschaft stehenblieb, die ein Jagdhaus im Walde darstellte, fragte er den anwesenden Künstler: „Ist das ein See?“ „Nein, Majestät“, war die Antwort, „das ist eine Wiese.“ „Aber die ist doch blau ...!“ „Ich sehe sie aber so, Majestät“, erwiderte der Künstler stolz. „Na ja“, beschloss der Kaiser das Gespräch lächelnd, „dann hätten S’ halt nicht Maler werden sollen ...“
Gustav Klimt war von 1879 bis 1899 Präsident der Secession. Von Anfang an war geplant, die Vereinigung nur zehn Jahre bestehen zu lassen, um ihr Ziel, die Kunst dem Geschäft zu entreißen, zu erreichen. Die Secession bestand jedoch weiter, allerdings traten nach internen Streitereien 1905 Otto Wagner, Josef Hoffmann, Alfred Roller, Gustav Klimt und andere aus.
Das Zentrum des Jugendstils verlagerte sich auf die Wiener Werkstätten. Klimt ist vom geraden Weg seiner künstlerischen Überzeugung nie abgewichen, obwohl er Phasen pessimistischer Depression durchmachte.
1902 vollendete Klimt das Bild „Goldfische“. Es zeigt mehrere weibliche Wesen im Wasser, dazu einen goldenen Fisch. Die Figur am unteren Bildrand hat dem Betrachter nicht nur den nackten Rücken, sondern auch ihr großes Hinterteil zugekehrt, sie hat ihren Kopf gewendet und blickt mit einem ironischen Lächeln aus dem Bild. Nur auf Anraten guter Freunde unterließ es Klimt, dem Bild den Titel zu geben, den er dem Gemälde eigentlich zugedacht hatte. Es sollte ursprünglich „An meine Kritiker“ heißen. Er wurde aber auch so verstanden.
Während der große Gustav Klimt als Reibebaum für die konservative Kritik fungierte, wuchsen in seinem Schatten zwei wirklich „wilde“ junge Maler heran, Oskar Kokoschka (1886–1980) und Egon Schiele (1890–1918).
Das öffentliche Ärgernis
Unverstand, Spießertum, Scheinmoral, bornierte Professoren und ein ständig ätzender Karl Kraus bereiteten zu Beginn des Jahrhunderts einen Kunstskandal, dessen Leidenschaftlichkeit man sich heute kaum vorstellen kann.
Was war geschehen? Das Ministerium für Kultus und Unterricht hatte 1894 Gustav Klimt und Franz Matsch den Auftrag gegeben, die Deckengemälde für die Aula der neuerbauten Universität zu malen. Das Mittelfeld mit dem Thema „Sieg des Lichtes über die Finsternis“ und die „Theologie“, eines der vier Seitenfelder sollte Franz Matsch, die drei anderen Seitenfelder mit den Themen „Die Philosophie“ „Die Medicin“ und „Die Jurisprudenz“, sollte Gustav Klimt gestalten. Klimt entwarf Bilder von bislang unbekannter Kraft und Außergewöhnlichkeit in der Komposition des Themas. Auftraggeber und Professoren hatten sich zwar etwas Kolossales, aber Konventionelles erwartet; etwa, dass der Maler die großen Philosophen darstellen würde, mit ein bisschen Drumherum vielleicht. Klimt aber malte Allegorien und Symbole von ungeahnter Aussagekraft. In seiner Interpretation der „Philosophie“ steht das Werden und Vergehen der Menschen den unlösbaren Welträtseln gegenüber und das Bild scheint sagen zu wollen „Ich weiß, daß ich nichts weiß“. Das war ein erster harter Schlag für die Betrachter. In gleichem Sinn stellt die „Medicin“ nicht den Triumph der ärztlichen Wissenschaft, sondern Hilflosigkeit vor den Grundphänomenen unserer Existenz, Schmerz, Krankheit, Alter, Tod dar. Die „Jurisprudenz“ schließlich verweist auf die Institutionalisierung des Unrechtes und auf die Gnadenlosigkeit der Strafverfolgung, der das Individuum hoffnungslos ausgeliefert ist.
Die Bilder erschienen befremdlich und aggressiv, die unverhüllten Körper waren naturalistisch dargestellt. Aber solch eine, aller mythologischen Verkleidung beraubte Allegorie lag in der Absicht Klimts: der nicht-idealisierte nackte Körper, also die Natur selbst, sollte die Idee ausdrücken, sie „verkörpern“. Letztendlich ging es Klimt um die nuda veritas, aber die nackte Wahrheit war den Auftraggebern in dieser verlogenen Zeit zu brutal.
Die Universitätsprofessoren protestierten, es kam zu einer parlamentarischen Interpellation, Verteidiger und Kritiker der Bilder beschimpften einander, der Skandal war öffentlich. Einer der Professoren äußerte, er kenne weder Klimt noch die Bilder, aber er habe einen solchen Hass gegen die moderne Kunst, dass er ihr entgegentrete, wo und wie er nur könne. Fürstin Pauline Metternich, krampfhaft um eine Bemerkung bemüht, sagte über die Fakultätsbilder: „Wissen Sie, bevor ich nicht schreiben gelernt habe, habe ich keine Briefe geschrieben, der Maler sollte keine Bilder malen, bevor er nicht malen gelernt hat!‘‘
Einen Tag nach der Veröffentlichung des Protestes der Professoren, am 28. März 1900, legte die Secession einen Lorbeerkranz vor die ausgestellte „Philosophie“, auf dessen Goldschleife stand: „Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit“.
1905 war der Streit um die Fakultätsbilder beendet, Klimt hat nie mehr für den Staat gearbeitet. Mit dem Auftrag für den Stoclet-Fries in Brüssel eröffnete sich für ihn international die Möglichkeit, an einem Gesamtkunstwerk mitzuwirken.
Klimt hatte mittlerweile das Honorar von 30.000 Kronen mit Hilfe des Spirituosen-Fabrikanten August Lederer zurückbezahlt. Lederer erwarb die „Philosophie“, später kaufte Koloman Moser (1868–1918), der durch die Heirat mit Editha Mautner-Markhof finanziell unabhängig geworden war, die „Medicin“ und die „Jurisprudenz“. Nach Enteignung und Zwangsverkauf gelangten die Bilder in den Besitz der Österreichischen Galerie. 1945 verbrannten alle drei Fakultätsbilder zusammen mit anderen Werken Klimts im Schloss Immendorf, wo sie ausgelagert waren. Das Schloss wurde von den abziehenden deutschen Truppen in Brand gesteckt, weil diese befürchteten, man würde ihre Absetzbewegung nach Westen vom Schlossdach aus beobachten.
Klimt und die Frauen
Frauen spielten in Klimts Leben und Schaffen eine gleich große Rolle. Er liebte die Frauen als „das schönste Geschenk der Natur“, er portraitierte die Damen der Wiener Gesellschaft und war schönen Frauen in seiner ungestümen Sinnlichkeit verfallen.
Als Portraitist der Frauen vermögender Industrieller kam er früh zu Aufträgen und zu Geld; so erschlossen ihm die Frauen die finanzielle Basis seines Lebens. Klimt malt die Frau seiner Zeit, immer einen bestimmten Typ, aber das in drei Varianten.
Die Portraits betrafen Frauen aus dem liberalen Großbürgertum, meist jüdischen Ursprungs. Mütter und Töchter saßen ihm Modell und deren Väter konnten ihre eigene Wichtigkeit am Portrait messen. Diese mäzenatische Gesellschaftsschicht brauchte einen Künstler wie Klimt, und Klimt brauchte sie. Von ihm porträtiert zu werden bedeutete fast so viel wie ein Adelsbrief.
In ganz anderer Darstellung schuf Klimt die Allegorie eines Frauentyps, die „Femme fatale“, die Verführerin, den Vamp des Fin de siècle. Sinnlich, gefährlich, emanzipiert – die Frau, die sich nimmt, was sie begehrt.
Offen bekannte sich Klimt in unzähligen Zeichnungen zur Erotik, ja zur Sexualität als Triebfeder menschlichen Daseins und Glückstrebens. Seine eigene Sinnlichkeit übertrug er in die Bilder, die Laszivität seiner Darstellung scheuchte die Spießbürger auf.
Die Frauenbilder Klimts bewegen sich zwischen madonnenhafter Ikone, Luxusweibchen und Sexualobjekt; sie standen damit in krassem Gegensatz zum offiziellen Bild der Frau in der damaligen Zeit. Denn wie hatte die Frau der Jahrhundertwende nach außen zu erscheinen? Die jungen Mädchen trugen geschnürte Korsagen und hochgeschlossene Kleider, die Haare waren zu einem festen Knoten zusammengesteckt. Sie senkten den Blick, erröteten rasch und lasen die „Gartenlaube“. Sie schrieben ein artiges Tagebuch und hielten sich ein Poesiealbum, auf dem Klavier beherrschten sie „An Elise“. Was zur gleichen Zeit Sigmund Freud und Arthur Schnitzler schrieben, durfte zunächst nicht zur Kenntnis genommen werden; es setzte sich aber dennoch durch, genauso wie die Bilder Gustav Klimts. Dabei machte dieser es seinem Publikum wirklich nicht leicht, etwa als er das Bild eines nackten, schwangeren Mädchens präsentierte, die berühmt-berüchtigte „Hoffnung“. Über die Entstehung dieses Bildes erzählt man sich in Wien folgende Geschichte:
Es ging um ein weibliches Modell, nach dem Klimt mit Vorliebe seine figuralen Bewegungsstudien zeichnete. Denn „das Mädel hat einen Körper, von dem der Hintern schöner und intelligenter ist als das Gesicht bei vielen anderen“, wie der Meister urwüchsig, vermutlich aber zutreffend sagte. Nun hatte sich dieses Modell längere Zeit in Klimts Atelier nicht sehen lassen. Klimt war zuerst darüber ärgerlich, schließlich aber besorgt und gab der Befürchtung Ausdruck, dass dem Mädchen „etwas passiert“ sein müsste.
Eine Berufskollegin der Vermissten wurde beauftragt, ihren Verbleib auszukundschaften. Schon am nächsten Tag kam die Rechercheurin in Klimts Atelier und berichtete: „Hat sich net auszahlt, daß ma wegn dera so a Wasser macht! Der Herr von Klimt3hätt sich wegen der Hermakane Sorgen machen brauchn! Dera Pfnutschen4gehts ganz guat, ihr fehlt nix, im Gegenteil, sie hat a bisserl z’ viel ... sie ist nämlich in andere Umständ. Darum scheniert sie si, darum hat’ s nix von sich hören lassen.“
Klimt schmunzelte und sagte lakonisch: „Macht nichts. Die Herma soll trotzdem kommen. Ich brauch’ sie zu einer Arbeit, dringend. Richten Sie ihr das aus. Pfiat Gott!“ Das Modellmädchen war verdattert, machte die Augen weit auf, ebenso den Mund, schnappte nach Luft, wollte reden, schluckte und brachte endlich, puterrot geworden, stotternd heraus: „ja aber mit der Wampen! Entschuldigen schon bitte ... No, mir kans recht sein ... Bitt schön, Herr von Klimt, ich geh glei hin und werd ihrs durch ihre Mutter sagen lassen ... Jessas, die arme Frau, wie die mir derbarmt!“
Auf der Modellbörse auf dem Schillerplatz und in den Wandelgängen der Kunstakademie gab es am nächsten Tag große Erregung, ein Modell fragte das andere: „Hast es schon ghört? Der Klimt isübergschnappt! Er laßt sich a Schwangere als Modell ins Atelier kommen.“ Der gleichen Meinung waren kurze Zeit danach auch noch andere Leute, vor allem Kollegen von Klimt, Kunsthistoriker und Kritiker. Unfug! Verruchtheit! Verderbtheit! Entartung! Niedertracht! Schamlosigkeit! Sauerei! – diese und andere Schmähworte prasselten gleich Hagelkörner gegen den Meister.
So entstand das berühmte Gemälde, das er „Hoffnung“ betitelte und das eine junge schöne Frau im Zustand werdender Mutterschaft darstellt, allerdings nicht in der herkömmlichen, den „gesegneten Leib“ nur diskret andeutenden Weise, sondern splitterfasernackt, mit vorgestrecktem Bauch. Klimt hatte kein Wort der Abwehr wider all die heuchlerische Verleumdung, verständnislose Empörung, neidgeifernde Erniedrigung, er zuckte nur die Achseln und arbeitete unbekümmert um das Gezeter gelassen weiter. Das „Unglück“ eines armen Wiener Modellmädels hatte ihn zur Gestaltung eines ergreifenden Werkes der Kunst inspiriert. Das Gemälde „Hoffnung“ hat übrigens sogleich einen Käufer gefunden in der Person des Gründers der Wiener Werkstätten, des ebenso verständnisvollen wie mutigen Kunstfreundes Fritz Waerndorfer. Die Modelle Klimts aber, unter denen es sich herumsprach, wie er sich nicht nur gegenüber der ins Unglück geratenen „armen Herma“, ... sondern auch manch anderen gegenüber hilfreich erwies, ohne erst viel zu reden, wären allesamt fortan erst recht für ihn durch dick und dünn gegangen.
Die längste Beziehung hatte Gustav Klimt zu Emilie Flöge (1874–1952), die er 27 Jahre lang kannte und die viele Jahre seine Begleiterin war. Es ist nicht geklärt, wie die beiden wirklich zueinander standen, am ehesten scheint das Wort „kameradschaftlich“ passend.Ernst Klimt hatte Helene Flöge geheiratet, starb jedoch früh (1892). Die drei Schwestern Flöge stammten aus wohlhabendem Bürgertum und hatten in Wien einen großen und bekannten Modesalon in der Mariahilferstraße. Gustav wurde in die große Familie aufgenommen, er konnte kommen und gehen wie er wollte, man verbrachte gemeinsam die Sommerferien am Attersee. Die kluge, selbstbewusste und erfolgreiche Emilie wusste über die zahlreichen Liebschaften und Verhältnisse von Gustav Bescheid. Sie hat sich nie eingemischt, sie kannte die empfindliche Seele des athletischen Mannes.
Als Klimt am 11. Januar 1918 vom Schlag getroffen in seiner Wohnung zusammenbrach, waren die ersten Worte, die er zu stammeln vermochte: „Die Emilie soll kommen!“
Fast doppelt so alt wie Schiele
Als Gustav Klimt am 6. Februar 1918 starb, starb er im 56. Lebensjahr; er wurde damit fast doppelt so alt wie Egon Schiele.
„Gustav Klimt ist Mittwoch, am 6. Februar, um 6 Uhr morgens, nach kurzem, schweren Leiden gestorben. Unerkannt von den Vielen, umso inniger und ehrfürchtiger geliebt von seinen Freunden, schritt er den einsamen, geheimnisvollen Weg der großen Schaffenden. Die strenge Arbeit und der lautere Sinn waren seine Begleiter. Sein rastloser Anstieg ist erst durch den Tod gehemmt worden. Die Kunst hat Gewaltiges verloren, die Menschheit mehr.
Was sterblich an ihm war, werden wir am Samstag, den 9. Februar, um ½ 4 Uhr nachmittag, auf dem Hietzinger Friedhof von der dortigen Kapelle aus zu Grabe bestatten.“
So lautete die Todesanzeige des Bundes österreichischer Künstler, einer 1906 gegründeten Vereinigung, deren Präsident Klimt ab 1912 gewesen war.
Was war geschehen? Am 11. Januar morgens beim Ankleiden hatte Gustav Klimt einen Gehirnschlag erlitten. Er war halbseitig gelähmt. Seit sein Vater 1892 plötzlich gestorben war, hatte er gefürchtet, ein ähnliches Schicksal zu erleiden. Man brachte ihn zur Pflege in ein Privatsanatorium im 9. Bezirk. Ein Neffe berichtete über einen Krankenbesuch, die gelähmte rechte Hand sei unbeweglich auf Klimts Körper gelegen, mit der Linken habe er ihm zugewunken und gesagt: „Na, schau, wie ich jetzt dalieg‘! I kann mit der Rechten gar nichts mehr machen, und weißt’, was mich am meisten kränkt? Daß ich mich jetzt hilflos von Frauenhänden pflegen lassen muß“. Er wurde zunehmend apathisch, hat sich kaum mehr gerührt, denn er war sicher, gelähmt zu bleiben.
Am 3. Februar musste er, durch Aufliegen am Rücken wund geworden, in ein Wasserbett der Klinik Professor Riehl (spätere I. Universitäts-Hautklinik) im Allgemeinen Krankenhaus gebracht werden. Dort rasierte man ihm den Bart ab. Eine grippöse Lungenentzündung führte nach drei Tagen zum Tod. Klimt ist also Opfer jener bösartigen Grippe geworden, die damals tausende geschwächte Körper dahinraffte. Er wurde nicht obduziert. Egon Schiele kam in die Totenkammer im Keller des Institutes für Pathologische Anatomie und zeichnete dort das Gesicht des toten Klimt; auch eine Totenmaske wurde abgenommen.
Zur Beerdigung versammelten sich neben Freunden und der Familie Vertreter des Unterrichtsministeriums, Direktoren verschiedener Museen und Kunstschulen sowie die Wiener Künstler. Ein von der Gemeinde angebotenes Ehrengrab wurde von den Angehörigen abgelehnt. Der Architekt Otto Wagner (1841–1918), der seit dem Tode seiner Frau eine fiktive Korrespondenz mit dieser führte, notierte am 6. Februar: „Ich muß Dir heute noch einmal schreiben, etwas Entsetzliches ist geschehen. Klimt ist tot! Wenn diese blöde Welt wüßte, was sie heute verloren hat!“
Egon Schiele schrieb in der Zeitschrift „Der Anbruch“ am 15. Februar 1918: „Gustav Klimt. Ein Künstler von unglaublicher Vollendung, ein Mensch von seltener Tiefe. Sein Werk ein Heiligtum.“
Obwohl Klimt mit seinen Bildern viel Geld verdient hatte, hinterließ er nichts. Er hatte nie etwas gespart, sondern immer gleich alles wieder ausgegeben. Sein künstlerischer Nachlass, vor allem die zahlreichen Zeichnungen, wurde zwischen den Geschwistern Klimts und Emilie Flöge aufgeteilt. Seine Schwestern Klara und Hermine, die mit Gustav zusammengelebt hatten und von ihm unterhalten wurden, waren gezwungen, ihren Teil der Hinterlassenschaft zu verkaufen, um genügend Geld zum Leben zu haben.
Sein Atelier in Unter St. Veit konnte nicht erhalten werden, die große Wohnungsnot nach dem Krieg machte eine Umwandlung in Wohnungen notwendig.
Ein Eisenbahnerbub – Egon Schiele
Die kleine Kreisstadt Tulln, ungefähr 30 Kilometer westlich von Wien, war in der K. u. K. Monarchie ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt. Adolf Eugen Schiele amtierte dort seit 1887 als Stationsvorstand, Oberoffizial der K. u. K. Staatsbahn, also ein Eisenbahnbeamter des gehobenen Dienstes. Sein Vater Ludwig Wilhelm Schiele (1817–1862) stammte aus einer norddeutschen Familie und war ein bedeutender Eisenbahningenieur, designierter Generalinspektor der Kaiser-Ferdinands-Nordbahn. Obwohl er bereits mit 45 Jahren starb, hinterließ er ein namhaftes Vermögen, überwiegend Aktienbesitz. Dies teilten sich Egon Schieles Vater und dessen Schwester Marie, die den Ingenieur und Bahnoberinspektor Leopold Czihaczek (1842–1929) geheiratet hatte. Egons Mutter, Marie Soukup (1862–1935) kam aus Krumau a. d. Moldau, war die Tochter eines wohlhabenden Baumeisters und hatte Adolf Eugen Schiele 1897 geheiratet. In ihrer Familie gab es keine Beziehung zur Eisenbahn. Dem Stationsvorstandsehepaar in Tulln wurden 1880 und 1881 je ein Kind tot geboren. Es war dies die Folge einer Syphiliserkrankung des Vaters, der die Mutter angesteckt hatte, worauf die Kinder während der Schwangerschaft starben.
Für die Syphilis ist typisch, dass