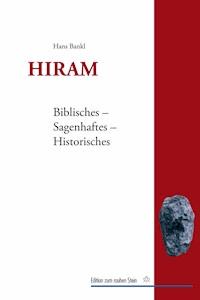7,99 €
7,99 €
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Starb der Mann mit den 16 Messerstichen im Rücken tatsächlich an Herzversagen? Hans Bankl, der Meister aus der Zunft der Detektive mit dem Skalpell, entführt den Leser auf einen humorvollen und informativen Streifzug durch die Welt des gewaltsamen Todes. Für Liebhaber skurriler Geschichten, ein Buch „zum Schmökern, Schmunzeln und Schenken.“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2009
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Buch
Autor
Vom Detektiv mit dem Skalpell zur Hightech-Wissenschaft
Ärzte und Juristen
Was ist gerichtliche Medizin?
Wie alles begann
Die frühesten gerichtsmedizinischen Gutachten
Nichts ist interessanter als ein toter Promi
Die Faszination des Verbrechens
Die sieben goldenen W des Kriminalisten
Auf Wunsch kommt die Gerichtsmedizin ins Haus
Frauen drängen zum Sektionstisch
Ein frisches und ein altes Herz
Mein erstes Mädchen hieß Ramona
Das Herz des Königs
Wer ist der Tote?
Spektakuläre Identifizierungen
Zwei SS-Verbrecher
Ringtheater und Kitzsteinhorn
Die Gerichtsmedizin am Werk
Von den Praterauen...
... bis Zentralafrika
Sogar Winnetou hat seziert
Knochenexperten am Werk oder das österreichische Schicksal von Skeletten
Zwei Wochen im Februar
Medizin ist keine Kunst, also gibt es keine Kunstfehler
Die 2. bis 18. Meinung
Dr. Zorro
Unleserlich
Der Blick in die Zukunft
Auch eine Art von Qualitätskontrolle
Das Versagen der Ärzte macht auch vor den Großen der Weltgeschichte nicht Halt
Wer schweigt, ist schuldig
Ein schweres Amt für einen schwer kranken Mann
Der Tod eines Ausländers
Ein Fehler mit weltpolitischen Folgen
Die Misere der Totenbeschau
Wer beschaut wen?
Zu Hause sterben ist gefährlich
Was so alles passiert
Hallo, ihr Minister! Wacht auf und tut was!
Die Zählung der Toten
Der Arzt am Tatort
Tot? Seit wann? Wie?
Wie gelingt ein perfekter Mord? Tipps vom Experten
Grundregeln für einen perfekten Mord
Ein Mord wird nicht erkannt, wenn …
Selbstmörder
Häufig, zu häufig
Kombinierter Selbstmord
Andere Länder, andere Sitten
Der Selbstmord und das Paradies
Bekannte Selbstmörder
Onkel Alf und Nichte Geli
Der Schuss ins Herz ging daneben
Wer war Geli Raubal?
Sex und Leberknödel
Ein unrichtiges Totenbeschauprotokoll aus Staatsräson
Die geheimnisvolle Welt der Gifte
Warum ist der Giftmord so beliebt?
Giftnachweis
Gifte und Apotheker
»… glaubte man gar, er sei vergiftet worden«
Gift im Vatikan?
Der Tod Mozarts
Digitalis in Athen?
Lehren aus der Geschichte
Gift oder Krebs, woran ist Napoleon gestorben?
Prominente und kuriose Vergiftungsfälle
Wiener und Prager Frauen
Seltsame Bräuche beim Militär
Wein macht Bauchgrimmen
Das giftige Hotelzimmer
Der Weg ins Jenseits
1. Austritt des Ich, »Out of body«-Erlebnis
2. Ablauf des »Lebenspanoramas«, Zeitrafferphänomen
3. Lichterleben, Verwandlung in eine andere Dimension
Mit dem Tod ist noch lange nicht Schluss
Kopfjägerei
Der Schädel Haydns wurde gestohlen
Über den Schädel Mozarts wird gestritten
Cromwells Leichnam wurde hingerichtet
Das Gesicht von Kardinal Richelieu
Das Verschwinden des Voltaire
Geschäfte mit Löwenherz
Das Gehirn Albert Einsteins
Nur Chopins Herz kehrte heim
Die Irrfahrten des Kolumbus
Ein Finger des Galilei
John Barrymores letzte Vorstellung
Der Kopf des Mörders Lucheni
Umbetter
Neues vom Geschlechtsverkehr
Sex oder Schneeschaufeln
Zu viel des Guten
Weitere Sexualzwischenfälle
Russisch, japanisch, arabisch
Je weniger Sauerstoff, desto mehr Genuss
Selbst ist der Mann
Der Blitzjude aus Wien
Die Schäden der Sportler
Wie gesund ist Sport?
Sogar Golfspieler leben gefährlich
Neue Todesursachen
Sterben im Flugzeug
Wenn der Busen zu groß wird
Schauspieler als Ärzte und Ärzte als Schauspieler
Ärzte spielen Ärzte
Schauspieler spielen Ärzte
Das Interview mit einem Beteiligten
Das Delikt Werbung
Koryphäen und Spitzenkräfte
Keine Chance für Chancengleichheit
Der Mordfall Marilyn Sheppard
»Titanic«, »Kursk« und Konzentrationslager
Literatur
Copyright
Buch
Sein Vater war Internist und wurde nicht müde, dem Sohn zu einem ärztlichen Beruf ohne täglichen Patientenkontakt zu raten. Und so entschied sich Hans Bankl – konsequent – für die Pathologie. Mehr als 30 000 Leichen hat der erfahrene Gerichtsmediziner und Bestsellerautor bis heute obduziert. Mit größter Gelassenheit schildert er schlimme Verbrechen, grausame Morde, erzählt humorvoll von den Gefahren des häuslichen Sterbens und berichtet über die beliebtesten Gifte der Geschichte. Er verfolgt die Irrfahrten berühmter Leichen, die oft Jahrhunderte nach ihrem Tod noch nicht zur letzten Ruhe gefunden haben; von mancher blieb gar nur ein halber Kopf übrig wie im Fall des Kardinal Richelieu. Hans Bankl gibt wertvolle Expertentipps für den erfolgreichen Selbstmord und den perfekten Mord, warnt jedoch zugleich, dass die Gerichtsmediziner nicht nur über gute Spürnasen und scharfe Instrumente verfügen, sondern auch auf modernste Hightech-Wissenschaft zurückgreifen können.
Autor
Hans Bankl, Jahrgang 1940, wurde mit 31 Jahren der jüngste Pathologie-Dozent Österreichs und gilt heute als international anerkannte Kapazität. An der Wiener Kunsthochschule unterrichtet er »Anatomie für Künstler«. Über seine 120 wissenschaftlichen Publikationen hinaus hat er sich mit Bestsellern wie »Die kranken Habsburger« und »Der Pathologe weiß alles... aber leider zu spät« einen Namen gemacht.
Vom Detektiv mit dem Skalpell zur Hightech-Wissenschaft
Ärzte und Juristen
Es ist höchst erstaunlich, dass sich zwei so grundverschiedene Wissenschaften wie Medizin und Juristerei doch in einem Fachgebiet treffen – der Gerichtsmedizin.
Wenn man ärztliche Angelegenheiten in die Hände von Juristen legt, so wird die Sache einem ungewissen Ausgang zusteuern. Denn, so sagen zumindest maßvolle Rechtsgelehrte, es ist niemals sicher, wie ein Rechtsproblem beurteilt wird und ein Rechtshandel ausgeht.
Nicht umsonst heißt es: »Auf hoher See und vor Gericht ist man nur mehr in Gottes Hand.«
Damit bestehen erstaunliche Parallelen und Gemeinsamkeiten zur Medizin. Auch in der Medizin ist die Prognose, d. h. das Vorhersagen, wie es ausgeht, stets zweifelhaft. Aber die Denkweise von Medizinern und Juristen ist grundsätzlich verschieden:
• Die Juristen berufen sich auf feste Anhaltspunkte und Eckpfeiler. In den Gesetzbüchern gibt es praktisch für alle Situationen entsprechend gültige Paragrafen, die das weitere Vorgehen im juristischen Bereich regeln.
• Bei den Medizinern ist dies völlig anders. Unsere Lehrbücher weisen eine Beständigkeit von weniger als fünf Jahren auf, dann müssen sie überarbeitet und ergänzt werden, weil neue Kenntnisse hinzugekommen sind und Diagnosemethoden wie Therapien sich geändert haben.
Was ist gerichtliche Medizin?
Gerichtliche Medizin bedeutet, und wir nehmen das dankbar zur Kenntnis, keine Verbindung von Juristerei und Medizin, sondern, wie es der Gerichtsmediziner Leopold Breitenecker (1902-1981) immer bezeichnet hat, medizinische Kriminalistik.
Gerichtsmediziner werden mit einer Fragestellung, mit einem völlig undurchsichtigen Problem, mit einer konkreten Spur oder mit der Feststellung von Befunden an einem Tatopfer konfrontiert. Daraus die nötigen Schlüsse und Konsequenzen zu ziehen, bewegt sich derzeit auf zwei Ebenen:
1. die pathologisch-anatomische Befunderhebung mittels Obduktion. Dies ist die klassische Vorgehensweise der Gerichtsmediziner als »Detektive mit dem Skalpell«.
2. Die Anwendung modernster Labormethoden zur Lösung bestimmter Fragen. Das ist die chemisch-analytische und molekularbiologische Vorgehensweise einer »Hightech-Wissenschaft«.
In der Praxis ist Gerichtsmedizin das Mitwirken ärztlicher Experten bei der Aufklärung von Kriminalfällen.
Die Gerichtsmedizin hat in den letzten Jahrzehnten einen enormen Wissenszuwachs erfahren und befindet sich heute weltweit in einem technischen, aber auch organisatorischen Umbruch. Hoch spezialisierte Ausrüstung und immer feinere Analysemethoden sind moderne Werkzeuge der einstigen Detektive mit dem Skalpell geworden, die es gestatten, das Netz einer sicheren Beweisführung zur Verbrechensaufklärung immer engmaschiger und sicherer zu knüpfen.
Wie alles begann
Die Geschichte der Gerichtsmedizin begann, als Ärzte von Behörden den Auftrag erhielten, Todesfälle, aber auch Wunden und Verletzungen zu begutachten. In Europa erfolgte dies nicht früher als um die Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert.
Was dem voranging, muss als Urgeschichte der Rechtsmedizin und wissenschaftliche Eiszeit gelten. Weder in der klassischen Antike Griechenlands noch in den frühen Hochkulturen Ägyptens, Assyriens und Babyloniens oder auch in den Vorschriften der mosaischen Bibel werden rechtsmedizinische Probleme angesprochen bzw. tritt der Arzt als Sachverständiger in Erscheinung. Dies ist erstaunlich, da in den Gesetzestexten ganz spezielle Delikte wie Kindestötung, Abtreibung, sexueller Missbrauch von Minderjährigen, Vergiftung, Mord und Totschlag sowie Magie, Hexerei und ärztliche Kunstfehler auftauchen, lauter Delikte, die einer ärztlichen Beurteilung bedurft hätten. Von Seiten des Staates wurden die Ärzte lediglich als Gutachter für das Militär herangezogen. Es war wichtig, ob ein Soldat dienstfähig war oder nicht, ob er als Invalide ausgemustert werden sollte oder ob eine Kriegsverletzung entschädigungspflichtig war. Die ärztlichen Belange der Zivilbevölkerung waren dem Staat nicht so wichtig, denn das gemeine Volk sorgte selbst für Nachwuchs, einen Soldaten jedoch muss man ausbilden, und das ist teuer. Allerdings entstand im alten Rom der Begriff »forensisch«. Die Gerichtsverhandlungen fanden nämlich auf dem großen Platz des Forum statt, und dort waren auch die zwölf Gesetzestafeln aufgestellt. Seit damals bedeutet forensisch soviel wie gerichtlich.
Es war nicht die zentraleuropäische Heilkunde, die auf die Entstehung der Gerichtsmedizin Einfluss nahm, sondern arabisch-jüdische Strömungen. In diesem Kulturkreis spielte das Recht eine große Rolle und eine Rechtsmedizin kann ja erst im Zusammenhang mit etablierten juristischen Grundlagen entstehen. Durch die Kreuzzüge kam es zum ärztlichen Kontakt mit dem Orient, andererseits fand der Kulturaustausch im arabisch besiedelten Spanien statt. Im ältesten deutschen Rechtsbuch, dem »Sachsenspiegel« aus der Zeit um 1235, findet man die ersten gerichtsmedizinischen Anklänge. Später kam es in den Statuten der aufblühenden Städte zur Integration der Medizin ins öffentliche Leben. Die Städte stellten besoldete Ärzte und Hebammen ein, die sich mit medizinischen Fragen des öffentlichen Wohls und natürlich auch der Aufklärung von Straftaten zu beschäftigen hatten. Das Denken der Menschen verließ die auf das Jenseits gerichtete Welt des Mittelalters und wandte sich der auf das Diesseits gerichteten Neuzeit zu. In der »Peinlichen Gerichtsordnung« des Kaiser Karl V., der so genannten »Carolina« von 1532, steht beispielsweise über die ärztliche Begutachtungspflicht »Von besichtigung eines entleibten vor der Begrebnuss« oder »So einer geschlagen wirdt und stirbt, und man zweiffelt, ob er an der Wunden gestorben sei«. In der »Carolina« ist auch vermerkt, dass der Gesetzgeber sich von ärztlichen Spezialisten beraten ließ. Das war eine ungeheure Erweiterung des Einflusses der Mediziner. Ärzte können bekanntlich sehr mächtig werden, sobald die Herrscher sich von ihnen gesundheitlich abhängig fühlen.
»Der Leibarzt eines Mächtigen betreut nicht nur dessen innere Organe, er hat vor allem auch dessen Ohr.«
Das galt für Kaiser und Könige und gilt für Präsidenten, Minister und den Rest der Politiker ebenso.
Die frühesten gerichtsmedizinischen Gutachten
Im Februar 1289 untersuchten zwei Ärzte über Auftrag der Behörde die Leiche des in der Kirche der heiligen Katharina von Saracocia niedergeschlagenen Jacob Rustighelli. In ihrem Bericht stand unter anderem:
»In primis, in pectore: septem vulnera mortallia. Item, in medietate frontis: duo vulnera mortallia. Item, in maxilla dextra: unum vulnus non mortalle.«
Zunächst, in der Brust: sieben tödliche Wunden. Ferner in der Stirnmitte: zwei tödliche Wunden. Weiters im rechten Oberkiefer: eine nicht tödliche Wunde.
Das ist schon ein ganz ordentliches Gutachten, wobei die Wunden des Opfers nach Zahl und Lokalisation angegeben und vor allem deren Tödlichkeit oder Nichttödlichkeit bestimmt wurde.
Berühmt ist ein Gutachten aus Bologna von 1302. Im Auftrag des Richters Jacobus wurde die Leiche eines gewissen Azzolino auf Spuren eines Giftmordes untersucht. Doktor Bartholomeus de Varignana und vier Magister der Medizin und Chirurgie stellten bei der Leichenöffnung »gestocktes Blut in verschiedenen Gefäßen der Leberregion« fest und schlossen daraus auf eine »tödliche mechanische Behinderung der Lebensfunktionen«. Ein von außen eingebrachtes Gift war nach ihrer Ansicht nicht für den raschen Eintritt der schwärzlichen Verfärbung der Leiche verantwortlich. Hier wurde also eine gerichtsmedizinische Obduktion durchgeführt. Die Befunde und ihre Interpretation sind aus heutiger Sicht völlig unbrauchbar, jedoch für die damalige Zeit war es der Beginn einer grundsätzlich neuen Untersuchungsmethode. Die Sektion wurde in der Folge für die Gerichtsmedizin zum wichtigsten Teil der Wahrheitsfindung.
Damit gab es drei Sparten der Medizin, in denen Leichenöffnungen durchgeführt wurden: die normale Anatomie zur Erfassung des Aufbaues des Körpers und seiner Organe, die pathologische Anatomie zur Entdeckung und Klassifizierung der Krankheiten und schließlich die Gerichtsmedizin.
Zwischen Pathologie und Gerichtsmedizin bestand seit Anbeginn Konkurrenz und kollegialer Brotneid um materielle sowie wissenschaftliche Erfolge. Vor allem die Pathologen drängten die Gerichtsmediziner an die Wand, besonders krass war dies im 19. Jahrhundert in Wien. Der damalige Oberpathologe Carl Rokitansky ließ wohl die Gerichtsmediziner Vorlesungen halten, die Leichenöffnungen der gerichtlich zu untersuchenden Todesfälle gab er jedoch nicht aus der Hand, denn es ging um eine jährliche »Remuneration von 600 Gulden«, wie er in seiner Selbstbiografie offen eingestand. Das wirtschaftliche Denken war schon immer bei manchen Medizinern überproportional ausgeprägt.
Nichts ist interessanter als ein toter Promi
Es gibt immer wieder Ereignisse, in deren Verlauf Aufbahrungshallen, Pathologien und Gerichtsmedizinische Institute regelrecht belagert werden. Immer dann, wenn ein Prominenter gestorben ist, finden sich Neugierige in Scharen ein, um noch einen Blick auf den Leichnam werfen zu können. Dazu kommen die professionellen Fotoreporter, die mit allen Tricks noch ein Porträt des Toten bekommen wollen.
Ich selbst hatte mehrfach große Mühe die Leute abzuwehren, denn sie versuchten es mit allen Mitteln. Man marschierte etwa in Begleitung eines Leichenbestatters auf, man gab sich als Kriminalbeamter aus, der noch an der Kleidung etwas zu suchen habe, oder man kannte jemanden, der im Kankenhaus arbeitete und zu einem günstigen Zeitpunkt die Türe öffnete. »Wie hat er/sie denn ausgesehen?«, lautet dann immer die neidvolle Frage der anderen. Das Interesse ist stets groß, egal woher die Prominenz der Toten stammt. Der wildeste Andrang, an den ich mich erinnern kann, herrschte beim Amokschützen Ernst Dostal, der nach tagelanger Verfolgungsjagd von der Gendarmerie in einem Feuergefecht erschossen worden war. Zeitungen und Rundfunk hatten laufend berichtet, das Fernsehen war damals vor fast 30 Jahren noch nicht so fix zur Stelle. Dieser tote Mehrfachmörder hatte im Keller unserer Pathologie den größten Publikumserfolg, aber die meisten Neugierigen konnten wir abhalten.
Als Kontrast dazu fällt mir die Schauspielerin Silvia M. ein, die durch einen Verkehrsunfall ums Leben kam. Hier war ohne Zweifel der Beweggrund, wenigstens einen Blick auf den nackten Leichnam werfen zu können.
Handelt es sich um internationale Stars, kommt auch noch sehr viel Geld ins Spiel. Als Elvis Presley kurz nach Mitternacht am 16. August 1977 nach Hause kam, knipste ihn vor dem Tor seiner Villa »Graceland« in Memphis einer der unermüdlichen Fans, die dort seit Stunden ausharrten. Der Fotograf konnte es dem Klatschblatt »The National Enquirer« für 10 000 US-Dollar verkaufen, denn es war das letzte Bild des lebenden »King«. Ein Bild des Toten zu beschaffen, kam indes teurer. Gegen Morgen an jenem 16. August erlitt Elvis im Badezimmer einen Kollaps. Er war mit Schlaftabletten und Aufputschmitteln voll gepumpt gewesen, eine »Apotheke auf zwei Beinen«, wie es hieß. Seine Braut Ginger Alden schlief ungestört bis in den Mittag hinein im Nebenraum. Erst um 14.30 Uhr entdeckte sie den Leblosen, alarmierte Leibwächter, Rettung und seinen Arzt, der um 16.30 Uhr erklärte: »He’s gone.«
Die Leute vom Klatschjournalismus drückten darauf jedem in Memphis, der zu »Graceland« Zugang hatte, eine Kamera in die Hand und versprachen ihm ein Vermögen für ein Bild des toten »King«. Einem jungen Elvis-Cousin gelang schließlich der Schuss – für den er angeblich 100 000 US-Dollar erhielt. Es war ein Triumph des Sensationsjournalismus, der bei der seriösen Presse nicht ohne Wirkung blieb.
Die Printmedien begründeten mit diesem Foto das Spezialgenre »Celebrity in a Box«, das fortan gepflegt wurde. Das Bild des toten Rock Hudson beschaffte ein Reporter, der per Fallschirm über dem Leichenwagen absprang, das Bild von Bing Crosby im Sarg machte ein als Priester verkleideter Fotograf. Das Bild des toten Rockstars Kurt Cobain allerdings, der sich in den Kopf geschossen hatte, fand sogar die abgebrühteste Sensations-Redaktion undruckbar. Trotzdem war eine neue Branche im »celebrity voyeurism« der »yellow press« aufgetan worden. Man muss nur denken, dass 1994 etwa 95 Millionen Amerikaner auf dem Bildschirm live die Flucht von O. J. Simpson in Los Angeles mitverfolgten. Der Sender CNN steigerte während der Zeit des Simpson-Prozesses den Preis pro Werbeminute um 600 Prozent.
Manchmal hat die Veröffentlichung solcher Bilder auch etwas Gutes. Als die Autopsieberichte des ermordeten US-Präsidenten J. F. Kennedy in einer Zeitung erschienen, war dies für die überwiegende Mehrheit der Betrachter nur gruselig. Aber andererseits konnte man eindeutig die Schädelverletzung identifizieren sowie die Tatsache, dass der Präsident von rückwärts getroffen wurde. Den zweiten Schützen, von dem immer wieder fantasiert wurde, gab es nicht. Die Fotografien des mit einem Kleinflugzeug abgestürzten »John-John« Kennedy jun. hat man zu Recht nicht publiziert, denn nicht nur die Piper Saratoga war in viele Bruchstücke zerlegt worden.
Die Faszination des Verbrechens
Das Ritual ist grotesk und bizarr. Mehrere Millionen Männer, Frauen und Kinder wirken wie ferngesteuert, wenn sie tagtäglich dasselbe tun. Einzeln oder in kleinen Gruppen verfolgen sie gespannt, wie ein oder mehrere Menschen getötet werden. Je drastischer, umso besser. Häufig wird sogar vergessen, dass es doch fiktive Tötungen sind. Die Schauspieler bleiben ja am Leben, denn wir sind im Kino oder beim Fernsehen. Besonders beliebt sind »true stories«, wobei von den Filmemachern genüsslich darauf hingewiesen wird – genau so hat es sich in der Realität abgespielt, genau so sind Menschen gequält, verletzt und umgebracht worden. Wer sich eine ganztägige TV-Berieselung antun möchte, findet sicher zu jeder Zeit ein passendes Programm und mindestens ein Kapitalverbrechen innerhalb von 30 Minuten. So käme man locker auf über 50 Leichen pro Tag.
Der Anreiz, den das Verbrechen ausübt, ist groß und vor allem zeitlos. Mord und Totschlag waren vor 3000 Jahren in den Räubergeschichten der Antike, man denke an Achilleus, Hektor und Agamemnon, genauso aktuell wie heute in den Romanen von Patricia Highsmith oder Donna Leon. Die alte Ilias oder das Nibelungenlied sind wesentlich grausamer als ein aktueller Tatort oder Columbo. Die menschlichen Abgründe in den dramatischen Tragödien lassen die Zuseher erschaudern, und genauso soll es sein, sagte schon Aristoteles, der Lehrmeister der Poetik. Schrecken und Entsetzen haben einen wichtigen Zweck, sie dienen der Reinigung des Menschen von seinen Erregungszuständen. Auch die Gladiatorenkämpfe im alten Rom spielten dieselbe Rolle, es war nichts anderes als eine Reality-Show. Und wenn heute darüber geklagt wird, dass die Massenmedien die Menschen mit Verbrechen überschwemmen, sollten wir eines bedenken: Gegen den Horror in den Königsdramen von Shakespeare ist »Das Schweigen der Lämmer« eine Gutenachtgeschichte.
Die kunstvoll konstruierte Kriminalliteratur ist noch keine 200 Jahre alt. Den Anfang machten E.T.A. Hoffmann mit »Das Fräulein von Scuderi« (1818) und E. A. Poe mit »Die Morde in der Rue Morgue« (1841). Da eigentlich alle Krimis von Bedeutung auch verfilmt wurden, kommen uns heute die Figuren der Handlung sehr vertraut vor, und nicht nur Kinder meinen, die besten Spurensucher wären Sherlock Holmes und Kommissar Rex.
Erst in den letzten Jahrzehnten tauchten die Gerichtsmediziner auf. Dr. Watson war zwar Arzt, aber lediglich Begleiter und Berichterstatter bei den Ermittlungen von Sherlock Holmes. Edgar Wallace und Agatha Christie kamen weitgehend ohne gerichtsmedizinische Untersuchungen aus. Bei Derrick erschien der Arzt zwar regelmäßig am Tatort, konnte jedoch außer einer stereotyp-ungefähren Angabe zum Todeszeitpunkt nichts Wesentliches beitragen. Da war der unermüdliche Quincy schon ein ganz anderes Kaliber, aber er kam der Realität ebenso wenig nahe wie Dr. Kay Scarpetta, die Heldin der Romane von Patricia Cornwell. Ganz gut charakterisiert ist die Rolle des Dr. Graf in der Fernsehserie »Kommissar Rex«, wo sogar in einem echten Seziersaal gedreht wird. Kurios wie immer in Film und Fernsehen ist der kurze Bildschwenk zur »Leiche«, die fein säuberlich zugedeckt daliegt.
Es würde ja wirklich das Publikum etwas überfordern, die Präparation eines Schusskanals quer durch den ganzen Körper mitverfolgen zu müssen, ganz zu schweigen von der Inspektion des aufgeschnittenen sieben Meter langen Darmes oder dem Zusammensetzen eines zertrümmerten Schädels. Aber da wir ja in den Nachrichtensendungen genug reale Leichen sehen, ist es gar nicht verwunderlich, dass findigen Köpfen im Sinne der »Authentizität« noch einiges eingefallen ist.
In Deutschland werden Mordermittlungen als Freizeitvergnügen angeboten, quasi als Abenteuerurlaub. Die Agentur »Blutspur« bietet Mordgeschichten zum Mitmachen an, pro Person um rund 360 Euro für ein Wochenende. Die Ausgangslage ist jeweils als Tatort konstruiert, Spuren sind gelegt, Indizien und Beweisstücke vorbereitet. Täter und Opfer sind Schauspieler, die sich bemühen, originalgetreu zu agieren. So liegt etwa die Opfer-Darstellerin mit roter Farbe beschmiert in der Badewanne. Die Veranstaltung wird allgemein als »besser als im Fernsehen« gelobt, jeder Fall wird am Ende aufgeklärt.
In Amerika ging man schon einen Schritt weiter. Der Kabelsender Court TV (Gerichts-TV) brachte Realität. In der Reihe »Confession« (Geständnis) erzählten verurteilte Schwerverbrecher 30 Minuten lang jeweils ihre Taten, und das hörte sich dann so an: »Ich habe Monica einmal auf den Hals geschlagen, daraufhin ist sie röchelnd zu Boden gegangen.« Auf die Frage aus dem Off, ob die junge Frau noch lebte: »Ihr Herz schlug noch. Zwei Stunden später, als ich von einer Marihuana-Lieferung zurückkam, war sie kalt, da realisierte ich, dass sie tot war. Dann habe ich ihren Körper total zerstückelt und ihren Kopf auf dem Herd gekocht.« Im Abspann liest man: »Daniel Rakowitz wurde von der Jury für geisteskrank befunden. Er befindet sich in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt.« Es gab fantastische Einschaltquoten, aber auch eine Flutwelle von Protesten. Nach zwei Folgen wurde die Sendung eingestellt.
Tote bringen Quote
DeutchlandMarktanteilZuschauerGerichtsmedizinerinDr. Samantha Ryan17 %2,9 Mio. ZuschauerQuincy14 %2,7 Mio. ZuschauerÖsterreichDer Bulle von Tölz51 %1,1 Mio. ZuschauerSiska21 %0,5 Mio. Zuschauer
Die sieben goldenen W des Kriminalisten
Die Arbeit des Gerichtsmediziners beginnt am Tatort. So bezeichnet man zunächst auch den Fundort einer Leiche, wobei noch nicht feststehen muss, ob tatsächlich eine Straftat begangen wurde. Auch kann sich erst später herausstellen, dass der Auffindungsort nicht jener Platz ist, wo die »Tat« verübt wurde. Der Gerichtsmediziner ist aber nicht der Erste, der am Ort eintrifft, und er hat es demzufolge auch manchmal schwer.
Der Leichnam wurde in der Regel von Zivilpersonen aufgefunden, eventuell angegriffen und in seiner Lage verändert. Die Ersten vor Ort, die jedoch wirklich nicht hingehören, sind neugierige Nachbarn und Passanten, hin und wieder auch die Reporter. Wenn solche Personen nur einen Zigarettenstummel wegwerfen, ist später das Chaos der Spurensicherung perfekt. Dann kommt die Polizei mit dem Polizeiarzt, manchmal ist vorher schon der alarmierte Notarzt oder der nächste erreichbare Arzt zur Stelle. Unbeschadet aller kriminalistischen Vorgehensweisen geht es schließlich darum, ob die »Leiche« wirklich tot ist oder eine tiefe Bewusstlosigkeit bzw. ein Koma vorliegt. Es ist daher notwendig, dass jeder Arzt wenigstens die Grundkenntnisse für eine Leichenbeschau besitzt. Hier klafft zwischen theoretischer Erfordernis und praktischer Realität eine große Lücke. Was da manchmal passiert, welche Vermutungen geäußert und natürlich kolportiert werden, wie viele Spuren verwischt oder überlagert wurden und was alles schließlich verabsäumt worden ist, lässt den erfahrenen Kriminalisten verzweifeln.
Es geschah bei einem Raubmord an einem Trödler, der mit Hammerschlägen gegen den Kopf getötet wurde. Da das Opfer nicht sofort tot war, reinigten und verbanden Ärzte in demselben Gewölbe, in dem die Bluttat geschehen war, seine Wunden. Schließlich lagen eine Menge von blutigen Wattebauschen auf dem Boden und zahlreiche Blutspritzer waren an Stellen aufzufinden, die nach der ganzen Situation nicht zu dem Überfall passen konnten. Dies erschwerte die richtige Deutung der Spuren des Verbrechens sehr, da der Überfallene, ehe er vernommen werden konnte, starb. Der Täter selbst gab den Mord nicht zu, sondern erklärte, es handle sich um einen Totschlag im Zuge eines Raufhandels. Es wäre für die Ermittlungen gewiss vorteilhafter gewesen, wenn man den Verletzten aus dem kleinen Geschäftslokal hinausgebracht und dort verbunden hätte. So wurden aber verschiedene Spuren falsch gelegt und andere verwischt.
Der Gerichtsarzt sollte bei einem Lokalaugenschein zunächst wirklich nur zuschauen, und zwar zuerst aus einiger Distanz und später erst aus der Nähe, aber vorerst nichts berühren, auch den Leichnam nicht. Die Situation muss durch Skizzen und Fotografien und durch ein ausführliches Protokoll fixiert werden. Ist das geschehen, kann man mit den Untersuchungen schrittweise weitergehen, den Leichnam anfassen, umlagern, schließlich aufheben, damit man auch sieht, was unter ihm liegt.
Der große Lehrer Breitenecker hat den treffenden Rat gegeben: »Die Hände in die Taschen – die Augen weit auf-, den Mund fest zumachen.« Die Hände sind deshalb in die Taschen zu stecken, um nichts zu verändern, um ja keine Spuren zu verwischen oder neue, so genannte Trugspuren, zu verursachen. Die Augen sind weit aufzumachen, um nichts zu übersehen, und der Mund ist fest zuzumachen, um nicht durch voreilige Bemerkungen Unsicherheit zu verbreiten.
Im Weiteren sollten sich die Überlegungen und Untersuchungen an die »sieben goldenen W des Kriminalisten« halten: wer, was, wo, womit, warum, wie, wann? Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando?
Richtig ausgesprochen und rhythmisch betont, ergeben die lateinischen Fragewörter einen klassischen Hexameter und sind deshalb leicht zu merken.
1. Wer ist das Opfer? Wer ist der Täter?
Die Feststellung der Personalien des Opfers kann ganz einfach sein (Personalausweis, Bekannte) oder aber beträchtliche Schwierigkeiten machen. Eine unbekannte, vielleicht sogar verstümmelte Leiche zu identifizieren, gehört zu den großen Herausforderungen der medizinischen Kriminalistik.
Die Frage nach dem Täter ist dann leicht zu beantworten, wenn ihn Augenzeugen erkannt haben. Meist ist dies jedoch nicht der Fall, sodass eine umfassende Spurensicherung notwendig ist. Dies reicht von Fingerabdrücken bis zu Körperausscheidungen, die auf individualcharakteristische Merkmale zu untersuchen sind.
Ein tatsächlich kurioser Fall einer Identifizierung durch hinterlassene Spuren trug sich vor vielen Jahrzehnten zu: Es ist nicht so außergewöhnlich, dass ein Täter neben dem Opfer seinen eigenen Harn oder Kot absetzt. Dies ist die Markierung einer gestörten Psyche. Aber dass in einem solchen Fall zur Selbstreinigung eine Tageszeitung verwendet wurde, mit Zustelladresse und Namen, war ein in der Kriminalität wohl einmaliger Fehler des Täters.
2. Was ist geschehen?
Eine erste grobe Orientierung sollte helfen zu entscheiden, ob überhaupt ein gewaltsamer Tod vorliegt, und inwieweit es sich um einen Unfall, Selbstmord oder ein Tötungsdelikt handelt. Es ist zweckmäßig, jeden plötzlichen oder unerwarteten Todesfall so lange als Mord anzusehen, bis das Gegenteil erwiesen ist.
3. Wo ist es geschehen?
Der Auffindungsort einer Leiche wird sehr oft auch der Tatort sowie der Sterbeort sein. Freilich können diese Orte auch ganz verschieden sein.
Es ist nicht ungewöhnlich, dass komplizierte Zusammenhänge aufgedeckt werden:
Bei Rivalitätsstreitigkeiten im Rahmen von Bandenkriminalität wurde ein Mann zusammengeschlagen und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Da man annahm, er sei tot, packte man ihn in den Kofferraum eines Autos und transportierte ihn an ein Seeufer. Dort wurde die vermeintliche Leiche ins Wasser geworfen. Er erwachte dadurch, ertrank jedoch nach kurzer Zeit. Die Leiche wurde einige Tage später angeschwemmt. Würgemale am Hals, Spuren von Erbrochenem im Kofferraum und Wasser in Magen und Lunge waren festzustellen, jedoch erst das Geständnis des Täters konnte den genauen Ablauf erklären.
4. Womit ist es geschehen?
Es ist die außerordentlich wichtige Frage nach dem Tatwerkzeug. Es kann sich dabei um Teile eines Fahrzeuges oder einer Maschine handeln, die charakteristische Verletzungen an einer Person herbeigeführt haben, oder um ein Werkzeug im engeren Sinn (Hammer, Axt, Messer, Strangulierungswerkzeug) oder um Schusswaffen.
Hat der Täter das Werkzeug nach der Tat mitgenommen, lässt sich dasselbe anhand der Verletzungen des Opfers jedoch ziemlich genau rekonstruieren. Aber auch hier lauert die Gefahr von Irrtümern: Bei einer Schießerei muss genau festgestellt werden, welche Projektile zu welchen Waffen gehören, wie die Schusskanäle verlaufen und welche Positionen die Beteiligten eingenommen haben. Weiterhin ist zu klären, womit die eigentliche Tötung erfolgt ist: Es kann ja jemand gewürgt, erstochen und angeschossen worden sein, vielleicht sogar von verschiedenen Tätern.
5. Warum ist es geschehen?
Die Klärung des Motivs wird kaum schon am Tatort möglich sein, jedoch sind Spuren und Indizien festzuhalten, wie z. B. Hinweise auf einen Raufhandel, Alkoholisierung, Drogen oder ein Sexualdelikt.
6. Wie ist es geschehen?
Zur Rekonstruktion des Tatablaufes sind alle entdeckten Spuren miteinander in Zusammenhang zu bringen. Dieselben dürfen nicht allein nur zu dem Hergang passen, sie müssen auch in einer logisch-nachvollziehbaren Ablaufkette stehen. Nicht zu vergessen ist, es kann ein Ereignis als Unfall beginnen und mit einer Tötung enden und umgekehrt kann ein Tötungsvorhaben durch einen Unfall oder einen Zwischenfall eine ganz andere Richtung nehmen.
7. Wann ist es geschehen?
Festzustellen, wann eine Tat begangen wurde, gehört zu den schwierigsten Aufgaben des Gerichtsmediziners. Je kürzer die Zeitspanne zwischen Tathergang und Untersuchung ist, desto zuverlässiger lässt sich die Todeszeit abschätzen. Gibt es aber keine anderen Anhaltspunkte, wie etwa zugeordnete Geräusche, stehen gebliebene Uhren oder Videoaufzeichnungen mit Zeitangaben, lässt sich nur ein Schätzwert angeben. Horrende Fehler sind dabei schon gemacht worden.
Überdies ist zwischen Tatzeit, Sterbezeit und Auffindungszeit zu unterscheiden.
Für die kriminalistische Untersuchung einer Gewalttat mit Todesfolge ist noch ein achtes W von großer Bedeutung: »Wem nützt es? Cui bono?« In den allermeisten Fällen bezweckt ja ein Täter etwas, meistens für sich selbst.
Wie wichtig zur Klärung eines Tatherganges die genaue, sachverständige ärztliche Begutachtung am Tatort sein kann, stellt der nachfolgende Fall unter Beweis, bei dem nur Untersuchung und Fotodokumentation unmittelbar nach Auffinden des Opfers ein überzeugendes Gesamtbild schaffen konnten. Insbesondere die Lage der Leiche als solche, die Stellung der einzelnen Körperteile zueinander, ihre Lagerung gegenüber verschiedenen Gegenständen der Umgebung, die Lage der einzelnen Kleidungsstücke ist nur an Ort und Stelle einwandfrei möglich. Auch manche Befunde an der Leiche selbst werden durch deren Übertragung an den Obduktionsort geändert, so z. B. die Stellung der Gliedmaßen, wenn der Leichnam zum Zwecke des Transportes in eine gedeckte Bahre gebracht werden muss. Auch noch beim Entkleiden der totenstarren Leiche werden Stellungs-änderungen der Gliedmaßen bewirkt.
Das 5-jährige Wiener Mädchen Mizzi W. verschwand am Abend des 1. Mai und konnte erst nach drei Tagen im Kellergeschoss des Wohnhauses als Leichnam aufgefunden werden, und zwar in einem Raume, der an eine Tischlerwerkstätte anstieß und zur Aufbewahrung von Tischlerholz diente.
Der Leichnam lag am Rücken, das rechte Bein war ausgestreckt, das linke im Knie gebeugt und so stark nach innen gedreht, dass die Innenseite des Knies und der innere Fußknöchel auf dem Boden auflagen. Die Kleider schienen in Ordnung, doch zeigte sich nach Zurückschlagen des Mantels und Röckchens, dass das mit Harn durchnässte Hemd über die Scham hinaufgeschoben und Letztere unbedeckt war. Hob man das Knie des linken Beines von der Erde auf, ohne die Lage des Fußes selbst zu ändern, so machte es den Eindruck, als ob nach dem Tode das schlaffe Bein zunächst aufgestellt, dabei weggespreizt und im Knie gebeugt und anschließend schlaff nach innen umgefallen wäre. Die Auffassung gewann dadurch an Wahrscheinlichkeit, dass ein ganz eigentümliches Klaffen der Schamlippen zu sehen war.
Es war mit Grund anzunehmen, dass zu jener Zeit, da das Körperfett des Leichnams erstarrt und durch die Erstarrung plastisch geworden war, also mindestens mehrere Stunden nach dem Tode, ein Gegenstand mit rundlichem Querschnitt, eventuell eine Fingerspitze, in die Vulva hineingedrängt worden war. Dass eine gewaltsame Tötung vorlag, dafür konnte gleich an Ort und Stelle der Beweis erbracht werden, denn es fanden sich Würgespuren am Halse. Alle Umstände und der Genitalbefund sprachen für Tötung aus sexuellem Motiv. Mit der Annahme, es seien die Genitalien noch an der Leiche berührt worden, war auch der Umstand wohl in Einklang zu bringen, dass das vermutlich während der Erwürgung durch Harnentleerung benässte Hemd auf den Bauch hinauf geschoben war. Durch den Transport des Leichnams in das Sektionslokal verschwand der ganz eigentümliche Befund am Genitale.
Als Täter wurde ein in jener Tischlerwerkstätte beschäftigter Gehilfe eruiert, der gestand, dass er das Kind am Abend des 1. Mai in den Keller geführt hatte, um es geschlechtlich zu missbrauchen. Er gab jedoch vor, er sei, als er sich zum Coitus anschickte, von einem epileptischen Zustand befallen worden. Schließlich gestand er, dass er am Morgen nach der Tat nochmals bei der Leiche gewesen sei und mit den Händen versucht habe, das Genitale zu spreizen. Dieses Geständnis erklärte somit den durch den Lokalaugenschein erhobenen Befund, wonach noch an dem Genitale der erkalteten Leiche manipuliert worden sei.
Nicht nur der Täter kehrt manchmal, allerdings nicht sehr oft, an den Tatort zurück, sondern vor allem der Gerichtsmediziner sollte es sich zur Gewohnheit machen, den Tatort am nächsten Tag noch einmal aufzusuchen. Dabei werden öfter wichtige, bisher übersehene Einzelheiten erkannt.
Auf Wunsch kommt die Gerichtsmedizin ins Haus
Amerika, du hast es besser! Zumindest was die Überprüfung von Todesursachen angeht.
Nehmen wir einmal an, der Großvater ist nach kurzem Krankenhausaufenthalt gestorben. »Lungenentzündung« haben die Ärzte diagnostiziert, eine Autopsie sei nicht nötig. Doch wenn die Angehörigen auf Nummer Sicher gehen wollen, braucht nur jemand zum Telefon zu greifen und eine Obduktion durch einen Privat-Pathologen bestellen. Dr. Vidal Herrera, Gerichtsmediziner aus Los Angeles, hat sich mit einem privaten Autopsieunternehmen selbstständig gemacht. Sein Angebot lautet:
• Private Autopsies
• Forensic Autopsies
• Medical Photography
• Civil and Criminal Consultant
Gerichte, Anwälte und Seniorenheime rufen – Herrera kommt und öffnet die Leichen. Im Grunde zielt sein postmortales Geschäft aber auf private Kundschaft. Wer den Tod eines Angehörigen dem Arzt oder Krankenhaus anlasten will und dafür Schadenersatz einklagen möchte, ruft Herrera. Kostenpunkt: 2500 Dollar. Das Unternehmen floriert, mit einigen Mitarbeitern werden pro Jahr 800-1000 Leichen untersucht.
Ein Obduktionsunternehmen aus Florida, Dr. Brian McCarthy, brachte die Anliegen seiner Kunden mit einem markanten Werbespruch auf den Punkt: »McPath. Seelenfrieden, Antworten auf Ihre Fragen.« McCarthy hofft, seine Firma zu einer Art »McDonald’s der Pathologie« auszuweiten, mit Autopsiezweigstellen im ganzen Land.
Frauen drängen zum Sektionstisch
Mindestens die Hälfte der Medizinstudenten sind Frauen. Dies macht sich in Pathologie und Gerichtsmedizin immer deutlicher bemerkbar. Kaum ein Institut, wo nicht Frauen am Sektionstisch stehen. Sie brauchen dabei gar nicht »ihren Mann zu stellen«, denn sie sind meistens deshalb gut, weil sie den Beruf aus Interesse ausüben.
Dr. Joye Maureen Carter (geb. 1957) ist seit 1996 leitende Gerichtspathologin der Millionenstadt Houston. Erstaunlich für den Süden der USA war lediglich, dass Joye Carter eine Schwarze ist. Sie hat ihre Ausbildung bei der Air Force gemacht und wurde Ausbildungsleiterin für Militärpathologie. Jetzt leitet sie ein Institut mit 70 Mitarbeitern und greift jeden Freitag selbst zum Skalpell, weil sie ihr Handwerk nicht verlernen will. Die Dame sitzt zwar in der Chefetage, steht jedoch auch im Erdgeschoss im Seziersaal.
Dr. Mary Manheim (geb. 1945) leitet seit 15 Jahren die gerichtsmedizinische Anthropologie der Louisiana State University in Baton Rouge. Ihr Spezialgebiet ist die Identifikation von Skelettresten. Aus den Knochen liest sie Alter, Größe, Geschlecht und Rasse der Opfer, oft genügt die Ermittlung von Ursache und Zeitpunkt des Todes. Sie erstellt Phantombilder vermisster Personen anhand von früheren Fotos und modelliert Gesichter über Skelettschädel. Solche Fahndungshilfen werden in den USA dann auf Plakaten oder Milchkartons veröffentlicht. Von 600 Fällen konnte Dr. Manheim 570 lösen und die Identität der Toten bestimmen.
Ein frisches und ein altes Herz