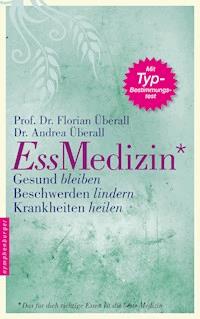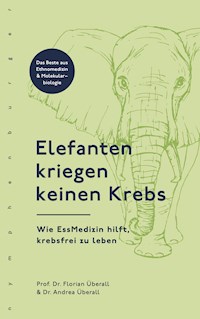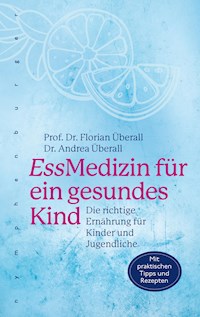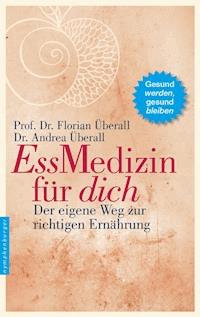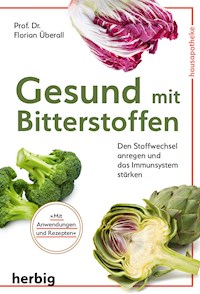
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Franckh-Kosmos Verlags-Gmbh & Co. KG
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Pflanzliche Herb- und Bitterstoffe haben eine erstaunliche Wirkkraft. Sie stimulieren das Immunsystem und die Verdauung, helfen bei chronischen Krankheiten, entgiften den Körper und sind wahre Fatburner. Der bekannte Essmediziner Prof. Florian Überall porträtiert die wichtigsten Pflanzen mit hohem Bitterstoffgehalt – von Brennnessel über Aubergine und Brokkoli bis zu Kurkuma und Zimt. Neben den Heilwirkungen und Anwendungen stellt er schmackhafte Rezepte vor, die den Körper rundum fit erhalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 88
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Florian Überall
Gesundmit
Bitterstoffen
Den Stoffwechsel anregen und das Immunsystem stärken
Bildnachweis
Mit 12 Fotos von Shutterstock (Bild2 ©Pohosian Hrant, Bild6 ©I. Rottlaender, Bild9 ©coffeehuman, Bild10 ©Marina Kisenko, Bild12 ©Diana Taliun, Bild13 ©avoferten, Bild14 ©Andrew Pustiakin, Bild18 ©Werner Spiess, Bild20 ©Kasabutskaya Nataliya, Bild21 ©Johanna Muehlbauer, Bild22 ©Elena Rostunova) sowie mit
9 Fotos von Adobe Stock (Bild3 ©Christine, Bild4 ©focus finder, Bild5 ©wonderisland, Bild7 ©omm-on-tour, Bild8 ©Grafvision, Bild15 ©Ademoeller, Bild16 © kobra78, Bild17 ©Ксения Коломенская, Bild19 ©ileana_bt).
Bild11: ©Florian Überall.
Impressum
Umschlaggestaltung von STUDIO LZ, Stuttgart, unter Verwendung von 3 Fotos von Shutterstock (Welthylady, Nik Merkular, Tiger Images).
Alle Angaben in diesem Buch erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Sorgfalt bei der Umsetzung ist indes dennoch geboten. Der Verlag und der Autor übernehmen keinerlei Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, die aus der Anwendung der vorgestellten Materialien, Methoden oder Informationen entstehen könnten.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernimmt der Verlag für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Unser gesamtes Programm finden Sie unter kosmos.de/herbig
© 2021, Herbig in der
Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG,
Pfizerstraße 5–7, 70184 Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-96859-015-8
Projektleitung: Nicole Janke
Redaktion: Ulrike Burgi, Köln, lektorat-burgi.de
Gestaltungskonzept, Gestaltung und Satz: DOPPELPUNKT, Stuttgart
E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
Produktion: Hanna Schindehütte
Inhalt
Vorwort
Bittere Gesundheitsboten, so wichtig wie nie zuvor
Wissenswertes und Kurioses
Historischer Abriss
Was Bitterstoffe alles können
Wie werden Bitterstoffen verwendet?
Porträts der wichtigsten Bitterpflanzen
Andorn – der bittere Saft der Ägypter
Angelikawurzel – die Magenwurzel
Artischocke – Heilgemüse des Mittelmeers
Benediktenkraut – die Basis bitterer Liköre
Bittermelone – Frucht der Diabetiker
Blutwurz – heiles Blut, gute Abwehrkraft
Eberraute – Alleskönner für Lunge und Blase
Gelber Enzian – jetzt wird es bitter
Galgant – eine bittere Gewürzpflanze für alle Lebenslagen
Gelbwurz – vom Gurgelwasser zum Antikrebsmittel
Granatapfel – Apfel der ganz anderen Art
Grüntee – begnadeter Alleskönner
Löwenzahn – Gallenelixier der Hildegard von Bingen
Mariendistel – der Leberschützer
Mönchspfeffer – Entspannung für den Unterleib
Myrobalane – eine Frucht heilt alle Krankheiten
Nachtkerze – verborgene Schönheit der Nacht
Olive – Gold des Mittelmeers
Preiselbeere – die bittere Heidelbeere
Salbei – der Rachenputzer
Schafgarbe – Wundheilerin und Faltenglätterin
Quitte – die Frucht der Liebesgöttin
Spitzwegerich
Schwarze Johannisbeere – für eine gesunde Sehkraft
Walnuss – Bindeglied zwischen Ur- und Neuzeit
Wermut – wenn der Magen streikt
Yamswurzel – pflanzliche Hormonkontrolle
Zimt – Gewürz der Seefahrer
Zirbe – Impulskraft der Alpen
Heilanwendungen mit Bitterstoffen von A bis Z
Adipositas (Fettleibigkeit)
Akne
Allergien
Anämie (»Blutarmut«)
Appetitlosigkeit
Arterielle Durchblutungsstörung
Asthma bronchiale
Azidose (Übersäuerung)
Bauchspeicheldrüse
Bindegewebe
Blasenentzündung
Blutergüsse
Colitis ulcerosa
Morbus Crohn
COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung)
Depressionen
Durchfall
Dyspepsie (Verdauungsstörung)
Entgiften (Leberreinigung)
Erbrechen (Magenbrennen)
Fieber
Gallenblasenentzündung
Gastritis
Gicht
Haarausfall
Hämorrhoiden
Heißhunger
Heiserkeit
Osteoporose
Parodontose
Prämenstruelles Syndrom
Prostataentzündung (Prostatitis)
Rheuma
Schlafstörung
Zellulitis
Bitteres auf dem Teller – die neue Gesundheitsformel
Bitteres zum Frühstück
Bitter am Mittag geht am besten
Bitterstoffe für das Gehirn
Bitterstoffe als modernes Anti-Aging und gegen Stress
Bitteres kann man auch trinken
Anhang
Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
immer, wenn ich im Alltag innehalte und gewahr werde, wie meine Gesundheit schwankt, wird mir eines klar: Nur auf das Glück zu hoffen, von Krankheit verschont zu bleiben, reicht nicht. Handeln ist notwendig.
Schon vor Jahrhunderten war bekannt, dass Bitterstoffe eine heilsame Wirkung entfalten können. Wir wissen nicht, ob auch die europäische Klostermedizin des Mittelalters das Elixir ad longam vitam mit der klaren Absicht erzeugt hat, das Leben zu verlängern. Der Erfolg des Getränks war jedoch erstaunlich. Die Tinktur aus Engelwurz, Enzianwurzel, Mariendistel und anderen Bitterkräutern, die dem Schweizer Arzt und Naturphilosophen Paracelsus zugeschrieben wird, hat als »Schwedenbitter« bis heute überdauert und wartet in so mancher Hausapotheke auf den Gebrauch.
Die Liste der heilsamen Bitterkräuter, die wir kennen, ist lang. Sie reicht von Andorn, Benediktenkraut, Ingwer, Kurkuma bis hin zu Tausendgüldenkraut, Schafgarbe, Wegwarte und Wermut. Als Tee, Abkochung oder alkoholisches Elixier führen Bitterstoffe zu einem raschen Sättigungsgefühl, wirken einem vermeintlich unstillbaren Süß- und Fleischhunger entgegen, und lassen so Fettleibigkeit und Diabetes keine Chance. Viele Bitterkräuter sind hervorragend für den Einsatz in der Küche als Salate und Kräuter geeignet, andere bekämpfen als Gurgellösung oder in Salben verarbeitet schädliche Bakterien und Viren.
Aber was macht den bitteren Geschmack aus? Können wir den bitteren Geschmack überhaupt noch in unsere Geschmackswahrnehmung einordnen? Es fällt uns zunehmend schwer, zu uniform ist unsere Zunge und unser Gaumen auf süß geprägt. Bitter stößt eher auf Ablehnung und Ekel. Eigentlich unglaublich, besitzen doch Bitterstoffe die größte Heilkraft aller Pflanzen und Pilze.
Mit diesem Buch möchte ich den Stellenwert von Bitterstoffen für den täglichen Gebrauch wieder in der Vordergrund rücken und Ihnen ihr Wesen und ihre Heilkraft näherbringen. Was ihren Einsatz angeht, können wir auf das Wissen großer Ärzte und Heiler aller Epochen vertrauen, dennoch erleichtert eine systematische Einordnung von Bitterstoffen den Umgang mit ihnen. Bitter ist nicht gleich bitter, und die Geschmacksempfindung reicht von aromatisch bitter bis zur reinen Bitterkraft. Diese unterschiedlichen Geschmacksnuancen sind für die vielfältigen therapeutischen und medizinischen Effekte verantwortlich. Diese gilt es zu ergründen.
Habe ich Sie neugierig gemacht? Schön, dann lade ich Sie ein weiterzulesen. So kann sich auch für Sie das Prinzip »Mit bitter immer fitter« offenbaren und zum täglichen Lebensglück werden.
Bittere Gesundheitsboten, so wichtig wie nie zuvor
Wissenswertes und Kurioses
Obwohl seit Jahrtausenden zur Heilung und Kräftigung von kranken Menschen in Verwendung, tragen Bitterstoffe bis heute Geheimnisse in sich. Glaubt man Forschern, welche am Fundort in der El-Sidrón-Höhle in Nordspanien die Gebisse von fünf Neandertalern untersucht haben, waren spezielle Bitterstoffe, wie sie für Wildkamille und Schafgarbe typisch sind, bereits Teil einer primitiven urzeitlichen Naturapotheke. Auch unser Eismann Ötzi hatte Kenntnis von Bitterstoffen, trug er doch auf seinen Wanderungen einen getrockneten Pilz mit sich: den überaus bitteren Birkenporling. Dieser war aufgrund seiner enormen Bitterkraft als Speisepilz völlig ungeeignet. Abgekocht diente der Sud jedoch zur Wundversorgung, schluckweise getrunken wahrscheinlich als Medizin gegen Magen- und Darmparasiten.
Meine ersten Erfahrungen mit bitter schmeckenden Pflanzen machte ich als kleiner Junge in unserem Garten und an einem nahen Bach hinter dem Haus. Büschelweise wuchs dort Brunnenkresse, und wir Kinder machten uns den Spaß, diese roh zu kauen. Später zog es mich hinaus in die Welt. Von Zentralafrika bis zum Baikalsee im burjatischen Sibirien, über Tibet bis nach Südindien, weiter ins ehemalige Ceylon und tief in den Dschungel von Myanmar, Thailand und Indonesien bin ich auf Bitterstoffe in ähnlicher volksmedizinischer Verwendung gestoßen. Medizinmänner sowie Mönche und Nonnen in asiatischen Klöstern waren häufig die Hüter ihrer Verwendung. Und wie sah es bei uns aus?
Die bekannteste Klosterfrau des deutschen Mittelalters, Hildegard von Bingen (1098–1179), Äbtissin und Mystikerin im Kloster Rupertsberg bei Bingen am Rhein, wurde zur Patin unzähliger bitterer Kräuterrezepturen. Die Mariendistel hatte es ihr besonders angetan. Sie nannte die Früchte als Universalmittel bei Leberleiden aller Art. Auch hochrangige tibetische Ärzte, wie Dr. Tenzin Choedrak und der Burjate Tschimit-Dorschi Dugarow, hinterließen »bittere« Spuren in ihren volksmedizinischen Zubereitungen. Tenzin Choedrak verkündete stets in seinen Konsultationssitzungen: »Der Tod sitzt im Darm«, und stellte am Hof des 14. Dalai Lama bitter schmeckende Darm- und Lebermischungen her. Tibetische Rezepturen reichen bis ins 12. Jahrhundert n. Chr. zurück. Die ayurvedische Lehre Indiens kennt rund 5000, die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) sogar 6000 Bitterpflanzen mit gesundheitsfördernden Wirkungen. In der modernen pharmazeutischen Industrie werden allenfalls 250 Bitterstoffpflanzen medizinisch genutzt. Das wird sich in Zukunft sehr wahrscheinlich ändern.
Bitterstoffe des Birkenporlings – Boten aus der Steinzeit.
Was sind denn nun Bitterstoffe?
Obwohl Bitterstoffe und ihre Zubereitungen seit Jahrtausenden in der Volksmedizin zur Heilung und Stärkung Kranker und Geschwächter verwendet wurden, ist das Wissen um ihre vielfältige Wirkung weitgehend im Verborgenen geblieben. Trotz Internet und sozialen Medien blieb ihre medizinische Bedeutung der breiten Bevölkerung unzugänglich. Vielleicht liegt es auch am Umstand, dass bitter nicht gleich bitter ist und unser Geschmacksempfinden Bitterstoffe meist als ungenießbar eingestuft hat. Wir sollten von der Natur lernen! Sie erzeugt Bitterstoffe zu ihrem Schutz. Ob in der Wurzel, im Blatt, der Blüte oder in Früchten – Bitterstoffe sind unverzichtbar für das Überleben der Pflanzen.
Interessanterweise sind nur drei chemische Stoffklassen nötig, um die gesamte Wirkkraft zu ermöglichen:
Da sind zunächst die Terpene. Das sind zyklische Wasserstoffverbindungen mit großer Ähnlichkeit zum Isopren, einem Baustein des menschlichen und tierischen Cholesterins. Sie sind sehr häufig in der Natur anzutreffen. Ein bestehendes Kohlenstoffgerüst, mehrfach aneinandergefügt und mit einigen chemischen Seitengruppen besetzt, und schon ist ein Terpen fertig. Eine Gruppe daraus ist Ihnen sicher geläufig, das sind die ätherischen Öle.
Sind bis zu zehn Kohlenstoffatome miteinander verknüpft, sprechen wir von Monoterpenen. Der Hauptwirkstoff des Enzians, Gentiopicrin, oder des Tausendgüldenkrauts, Centapicrin, gehören in diese Gruppe. Werden bis zu 15 Kohlenstoffatome aneinandergereiht, nennen wir sie Sesquiterpene. Absinthin und Artabasin des bitteren Wermutkrauts sind hier als wichtige Vertreter zu nennen. Werden die Ketten noch länger, sprechen wir von Triterpenen. Da sind dann schon mehr als 30 Kohlenstoffatome verknüpft. Triterpene kommen häufig in Hölzern vor, und man kann sie durch Wasserdestillation, etwa aus der Rinde oder den Blättern von Bitterpflanzen, gewinnen.
Alle anderen Bitterstoffe gehören in die chemischen Gruppen der Alkaloide, Bittersäuren, Glykosiden und Steroiden. Auch sie zählen, wie die Terpene, zu den sekundären Pflanzenstoffen, da sie nicht unmittelbar am Lebenszyklus der Pflanze teilnehmen, sondern zu ihrem Schutz synthetisiert werden. Terpene sind pharmakologisch sehr interessant, jedoch sind ihre biologischen Funktionen immer noch lückenhaft erforscht. Als flüchtige Verbindungen werden sie in der kosmetischen Industrie verwendet. Über ihr individuelles Geschmacksmuster, »Bitter ist nicht gleich bitter«, können wir fünf Kategorien unterscheiden:
Amara puraAmara aromaticaAmara acriaAmara adstrigentiaAmara mucilaginosa.Historischer Abriss
Das moderne Gesundheitswesen in der EU ist praktisch vollständig in ein wirtschaftliches Dienstleistungssystem integriert. Die ärztliche Behandlung folgt einem vereinheitlichten Schema evidenzbasierter medizinischer Richtlinien. Sowohl Diagnose als auch Therapie folgen einem engen Korsett. Alternative oder ergänzende Maßnahmen sind nicht Bestandteil dieser Versorgung.
Drehen wir das Rad der Zeit um einige Jahrhunderte zurück, bietet sich ein völlig anderes Bild. Bader, Quacksalber und einige wenige Wundärzte sowie kräuterkundige Mönche und Nonnen prägten das Heilwesen. Meine Tiroler Heimat, diesseits und jenseits des Brenners, war reich an berühmten Ärzten und Apothekern. Das »Annenberger Arzneibuch« war ebenso weit verbreitet wie auch das Ertzney-Buech von Melchior Miersperger (1607), einem Kitzbühler Wundarzt. In seinem Werk finden sich besonders viele Bitterrezepturen: »Ain schennes Ertzney-Buech mit vill guetten und bewährten stükken, durch mich … zu Khützbüchel, zusamen geschriben worden, Anno dominy 1607.«