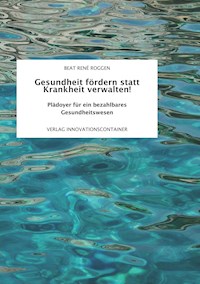
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Seit Jahrzehnten versuchen in Westeuropa Parlamente und Regierungen das Gesundheitswesen in den Griff zu bekommen. Konkret: Die Kosten zu senken, das Versorgungsniveau zu halten, Interessengegensätze auszugleichen und sich bei Unvereinbarkeiten irgendwie durchzumogeln. Mit meist schlechten Ergebnissen, weil die Lösungen primär auf ökonomischer Ebene gesucht werden, obwohl das Gesetz von Angebot und Nachfrage in dieser Branche ausgesprochen schlecht spielt. Das Hauptproblem der galoppierenden Kosten liegt denn auch darin, dass im Bereich der Präventiv-, Komplementär- und Sozialmedizin wichtige Erkenntnisse ignoriert und innovative Ansätze systematisch behindert werden. Dies unter anderem von einer marktmächtigen Gesundheitsindustrie, die an Kostenreduktionen nicht interessiert ist. Diese Effekte werden von einer immer stringenter agierenden Gesundheitsbürokratie noch verstärkt. In seinem Buch entwirft Beat René Roggen aufgrund seiner multiplen und tiefen Einblicke in nahezu alle Facetten des Gesundheitswesens wie auch seines Kenntnisstands über neue diagnostische wie auch präventiv- und sozialmedizinische Ansätze ein Lösungskonzept mit mehreren innovativen und praktikablen Ansätzen, die in dieser Form noch kaum je diskutiert wurden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Disclaimer
Die in diesem Werk enthaltenen Informationen und Hinweise dienen primär den Zielen der allgemeinen Orientierung und der Weiterbildung im Bereich neuer Wege und Optionen zur Reform des Gesundheitswesens im Sinne höherer Effizienz und niedrigerer Kosten. Sie sind nicht für individuelle diagnostische oder therapeutische Zwecke bestimmt. Und sie ersetzen auch nicht die Konsultation einer Fachperson für medizinische und/oder pharmazeutische Fragen, deren Beantwortung diesen vorbehalten ist. Scheuen Sie sich anderseits aber nicht, die von Ihnen konsultierten Fachleute mit dem Inhalt dieses Buches zu konfrontieren, wenn Sie dies für tunlich erachten.
Anmerkungen des Verfassers
Das vorliegende Buch ist nicht nach fachlichen, sondern nach journalistischen Kriterien abgefasst – als eine Mischung von Berichterstattung, kritischer Betrachtungsweise und Beschreibung neuer Erkenntnisse und Wege im Bereich eines komplementären Angebots an medizinischen Dienstleistungen, welches unter dem Titel „Regenerative Medizin“ im Unterschied zur kurativen Medizin auf eine ganzheitliche Diagnostik und auf die Förderung der Selbstheilungskräfte des Menschen ausgerichtet ist, getreu dem seit Hippokrates geltenden Grundsatz „Medicus curat, Natura sanat“ – der Arzt behandelt, die Natur heilt.
Im Mittelpunkt steht eine Palette von ganzheitlichen diagnostischen und sanften komplementärmedizinischen Systemen und Methoden, die im oben genannten Sinne sowohl präventiv wie auch therapieunterstützend eingesetzt werden können mit dem Ziel, dem Gesundheitswesen einerseits zu höherer Gesamt-Effizienz, anderseits zu einer signifikanten Kostendegression zu verhelfen. Die vorliegenden Zeilen sollen dazu keine wissenschaftliche Abhandlung liefern – das möge die Wissenschaft früher oder später nachholen – sondern vielmehr Informationen darüber vermitteln, welche neuen Wege dort beschritten werden können, wo die Ökonomie an Grenzen stösst und die adäquaten Lösungen in einer Verbesserung der Relationen von Aufwand und Resultat zu suchen sind.
Zur inhaltlichen Form und Gliederung ist anzumerken, dass jedes einzelne Kapitel die jeweils behandelte Thematik möglichst vollständig abzuhandeln sucht. Dadurch werden mehrfache Wiederholungen ein und desselben Sachverhalts unvermeidlich – wofür ich hier ausdrücklich um Nachsicht bitte. Unter anderem betrifft dies den häufig wiederholten Hinweis darauf, dass rund 80 % aller Krankheiten und über 95 % aller chronischen Leiden direkt oder indirekt mit Stress assoziiert sind – immerhin ein Aspekt den man angesichts der aktuellen Prädominanz der Thematik gar nicht genügend betonen kann.
Eine weitere Vorbemerkung betrifft das sogenannte Gender-Mainstreaming, das sich heute, getragen von der Forderung nach ultimativer „political correctness“, in immer mehr Texte einschleicht mit dem Ergebnis, dass in einer Zeit der sich pandemisch ausbreitenden SMS-Kultur und der damit einhergehenden kollektiven Leseschwäche die Lesbarkeit der Texte immer weiter erodiert. In diesem Sinne wird hier auf eine „Verweiblichung“ und (neu) „Versächlichung“ personen- und funktionsbezogener Sachverhalte bewusst zugunsten der männlichen Grundform verzichtet und lediglich dort differenziert, wo sich Gegebenheiten entweder auf das eine oder das andere Geschlecht beziehen.
Inhalt
Strategie gegen das disproportionale Kostenwachstum im Gesundheitswesen:
Neue Perspektiven für eine bezahlbare Sozialmedizin
Eine Kernfrage:
Und wo, bitte, bleibt der Patient?
Eine weitere Hürde für ein bezahlbares Gesundheitswesen:
In der Gesundheitspolitik hat Innovation ein gutes Image, aber schlechte Karten
Vordringlich: Beseitigung der Krankheits-Ursache Nr. 1:
Eine bislang massiv unterschätzte Epidemie gewaltigen Ausmasses bedroht unsere Gesundheit: Die 40 Volt-Krankheit
Ebenfalls vordringlich: Die Beseitigung der Krankheits-Ursache Nr. 2:
Auch geopathische Störzonen bedrohen unsere Gesundheit massiv
Schliesslich: Beseitigung der Krankheitsursache Nr. 3:
Die Kompensation des physiologischen Wassermangels zählt ebenfalls zu den wichtigsten Aufgaben der Präventivmedizin
Der digitalisierte Patient – Hype oder Horror?
Nutzen und Gefahren der Digitalisierung im Gesundheitsbereich
Diagnosen im Dienste von Qualitätssicherung und Prävention
Die Diagnostik als Kernkompetenz und Schlüsselproblem der medizinischen Versorgung
Im Sinne präventiver Effizienz:
Keine Diagnostik ohne Stress-Diagnose!
Neu: Ein Intermediär zwischen Publikum und Arzt:
Der Gesundheitscoach – Anlaufstelle und fachlicher Träger eines auf Stringenz und Effizienz getrimmten Gesundheitswesens
Anstelle der Erhaltung von Klein- und Regionalkliniken:
Das Regenerations-Zentrum – ein neues Modell im Dienste der Sozial- und Präventivmedizin
Ambulatorien versus Kleinspitäler:
Zukunftsmodell Tagesklinik
Zur Qualität medizinischer Leistungen:
Ganzheitliche Prädiagnose und klinisches Monitoring als Mittel seriöser medizinischer Qualitätssicherung
Der Arzt behandelt, die Natur heilt
Keine Heilungserfolge ohne Mitwirkung der Patienten
Nahrungs-Supplemente: lebenswichtig oder Luxus?
Dringend reformbedürftig: der überadministrierte Markt für Nahrungsergänzungsmittel
Die komplementäre Krankenkasse (KKK)
Neu: Eine Kasse zur Förderung und Belebung der Eigenverantwortung Im Gesundheitswesen
Versuch eines Auswegs aus der Pflege-Kostenfalle:
Ein Health Maintenance Center für Senioren im Süden Europas
Das ELDREADO-Modell
Epilog:
Wie weiter?
Zum Verfasser
Informationsquellen
Anmerkung zu den Quellen
Die im vorliegenden Buch präsentierten Innovationen, Konzepte und Vorschläge entstammen grösstenteils der Arbeitsgemeinschaft Innovationscontainer und ihrem erweiterten Netzwerk.
Beim „Innovations-Container“ handelt es sich um eine Arbeitsgemeinschaft von Entwicklungsingenieuren, Physikern, Ärzten, Konzeptionisten, Immaterialgüter-Bewirtschaftern, Marketing-Fachleuten und innovativen Unternehmern aus der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz), die sich der Förderung umwelt-, wirtschafts- und sozialverträglicher Innovationen verschrieben hat.
Schwerpunkte des Engagements bilden derzeit die Branchen Medizin, Energiewirtschaft, Sicherheit, Service Public und Umweltschutz. Die Arbeitsgemeinschaft tritt im Interesse des Schutzes ihrer Assets gegen aussen vorwiegend im Rahmen von Projekten und Kontaktanfragen in Erscheinung.
Homepage: www.innovationscontainer.com
Strategien gegen das disproportionale Kosten wachstum im Gesundheitswesen
Neue Perspektiven für eine bezahlbare Sozialmedizin
In den Mittelpunkt einer Reform des Gesundheitswesens, wie sie sich aufgrund der mehrheitlich als untragbar empfundenen Kostenentwicklung und durch die Marginalisierung der Patienten aufdrängt, ist weder die Spitzenmedizin noch die Gesundheitsökonomie, sondern vielmehr die Sozialmedizin zu stellen, wenn der Plan gelingen soll. Dies im Gegensatz zu den bisherigen Kostendämpfungs-Basteleien, deren Akteure sich stets über diese zentrale Aufgabe hinweggesetzt haben und die damit regelmässig auf die Nase gefallen sind. Sozialmedizin ist – vereinfacht ausgedrückt – eine „Medizin für Alle“. Sie steht im Mittelpunkt der bislang unbestrittenen Aufgabe des Staates, für seine Bürger eine gute medizinische Versorgung zu gewährleisten. Dabei sollen – unabhängig von Einzel- und Gruppeninteressen in den Domänen der Leistungserbringer und der Kostenträger – neue Erkenntnisse und auch Innovationen Berücksichtigung finden, die dem Gedanken der Sozialmedizin entsprechen und ein gutes Verhältnis zwischen Aufwand und Patientennutzen aufweisen – sowohl im Bereich der präventiven wie auch der kurativen Medizin.
Grundsätzliches
Im Rahmen der über die Sozialmedizin zu führenden Grundsatzdiskussion sind – wenn diese denn ihrem Ziel gerecht werden soll – alle für eine effiziente und primär den Patienten dienenden Ansätze einer „neuen Medizin“ auf den Tisch zu legen. Dies einschliesslich aller sinnvollen und zielführenden Innovationen, die im Rahmen der Verteilkämpfe unter den Akteuren im Gesundheitswesen auf der Strecke geblieben sind oder gar nicht erst in Betracht gezogen wurden. Wir beschränken uns hier auf die wichtigsten Gesichtspunkte und auf Massnahmen von hoher sozialmedizinischer Relevanz, die im Zuge einer grundlegenden Reform nach und nach zu einer kohärenten und bezahlbaren Strategie der allgemeinen Gesundheitsförderung zusammengesetzt werden können. Dies zunächst in der Form einer Übersicht, deren Komponenten danach in den folgenden Kapiteln mit grösserer Ausführlichkeit – wie sie für das Verständnis der entsprechenden Innovationen erforderlich erscheinen – zur Darstellung gelangen.
Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang die Feststellung, dass die innovativen Systeme, Methoden und Verfahren die konventionelle Medizin nicht ersetzen, sondern in wesentlichen Aspekten ergänzen und ihre Effizienz nachhaltig erhöhen sollen. Anderseits soll auch nicht verschwiegen werden, dass damit eine gewisse Volumenreduktion im Bereich des bestehenden medizinischen Angebots einhergehen wird und soll. Was sich jedoch kaum zu einem grösseren Branchen-Problem auswachsen dürfe, da ohnehin ein grosses Dilemma besteht in der Frage, wie die künftigen personellen und qualifikationsspezifischen Bedürfnisse in der Gesundheitsbranche bei einem munteren Fortschreiben der heutigen Entwicklung überhaupt gedeckt werden sollen.
Die Diagnostik – Kernleistung und Schlüssel problem der medizinischen Versorgung
Seit jeher hängen die Effizienz und die Qualität der medizinischen Versorgung von der richtigen Diagnose ab. Denn aus dieser entwickelt der Arzt das therapeutische Vorgehen, die Information und die Beratung der Patienten wie auch die adäquate Medikation. Deshalb geht man allgemein davon aus, dass die korrekte Diagnose auch zum richtigen Behandlungskonzept führt. Und dass wiederum das richtige Behandlungskonzept zur Genesung oder zumindest zu einer nachhaltigen Besserung des gesundheitlichen Zustands und/oder Befindens der Patienten hinführt. Diese Annahme ist – zumindest in dieser kurzen und einfachen Form – nicht zutreffend, um es gleich vorwegzunehmen.
Denn eine gute und vollständige – und damit brauchbare – Diagnose sollte sich stets aus drei Teilen zusammensetzen, nämlich:
der situativen Analyse des medizinischen Problems
der (mutmasslichen) Ursache dieses Problems, und
der allgemeinen physischen und psychischen Verfassung der Patienten
In der Praxis begnügt man sich jedoch zumeist mit der Analyse des Problems und entwickelt daraus die Patienten-Information wie auch das therapeutische Konzept und die Medikation, die dem Patienten zu einer Remission verhelfen sollen. Doch selbst unter der Voraussetzung, dass das Problem richtig erkannt wird, kann die aus dieser Erkenntnis abgeleitete Therapie richtig oder falsch sein. Handelt es sich um ein singuläres Ereignis monokausaler Natur – beispielsweise um einen viralen Infekt als Folge einer beim abendlichen Schlummertrunk an der Bar erlittenen Ansteckung – so ist das Problem mit der richtigen Medikation und einem adäquaten Verhalten der Betroffenen innerhalb weniger Tage gelöst – allenfalls auch ohne Hilfe eines Arztes.
Liegt aber eine persistierende, länger bestehende Ursache vor, so lässt sich das Problem auf dieser Stufe häufig nicht lösen, sondern es kommt von einem Rezidiv zum nächsten. Und sind ausserdem die physiologische und allenfalls auch die mentale Verfassung für den Erfolg einer Therapie nicht gegeben – beispielsweise durch Stress, Schwermetall-Belastung oder durch eine permanente Übersäuerung – so dürfte die Therapie ebenfalls nicht im erwünschten Masse anschlagen.
Fazit: In der Sozialmedizin ist demzufolge nach Möglichkeiten der Initial- oder Primärdiagnostik zu suchen, die auf möglichst rationelle und kostengünstige Art und Weise alle drei Aspekte einer Diagnose abzudecken vermögen. Vielversprechende Ansätze dazu sind vorhanden, werden aber von der Schulmedizin konsequent ignoriert. Doch bestünde gerade in deren Weiterentwicklung die Chance, daraus eine Prä- oder Primärdiagnostik schaffen zu können, die den weiteren zur Anwendung gelangenden Diagnosemethoden (wie beispielsweise die ärztliche Differentialdiagnose, das Elektrokardiogramm, die Ultraschall-Diagnostik und das Magnetresonanz-Scanning) die entscheidenden Indizien liefert.
Primärdiagnose: Instrument der Prävention und der medizinischen Qualitätssicherung
Die Prä- oder Primärdiagnose kann nicht nur die ideale und kostengünstige Vorlage für allfällige weitere diagnostische Schritte liefern, sondern auch die Qualität anschliessender therapeutischer Konzepte sichern und zugleich der therapeutischen Erfolgskontrolle dienen. Dies dadurch, dass die im Rahmen der Prädiagnostik ermittelten Parameter in den entsprechenden Patientendossiers abgespeichert und jederzeit nachgeführt werden können. Neben der Funktion als Primärdiagnose kann das Procedere auch für präventive Zwecke genutzt werden. Dies in dem Sinne, dass die entsprechenden Daten von den Probanden zur Optimierung ihres Gesundheitszustands und allenfalls auch für autotherapeutische Massnahmen genutzt und periodisch weitergeführt werden können.
Selbstverständlich können die Daten jederzeit mit dem Einverständnis der Patienten oder Probanden an einen behandelnden Arzt weitergegeben werden – sei es an einen Allgemeinpraktiker oder an einen Spezialisten, wobei der Allgemeinpraktiker oder Grundversorger eher zum Nachführen der Akte und zu der damit verbundenen Erfolgs- und Qualitätskontrolle prädestiniert ist. Damit wird zugleich der Grundstein zu einem elektronischen Patientendossier gelegt, welchem nach Bedarf jederzeit die medizinisch relevanten Daten entnommen und neue beigefügt werden können.
Die Primärdiagnose muss nicht von einem Arzt gestellt werden; sie kann auch von speziell geschulten Fachpersonen mit medizinischer Grundausbildung – einer Art „Gesundheitscoach“ als primäre Anlaufstelle – vorgenommen werden. Es würde Sinn machen, für diesen Zweck eine Art „Gesundheits-Intermediär“ in der Art des früheren chinesischen „Barfussarztes“ zu schaffen und zu institutionalisieren, der in einem Grossteil der Fälle bereits Hilfe zur Selbsthilfe bieten und in den anderen eine Überweisung an einen Allgemeinpraktiker oder einen Spezialisten veranlassen kann.
Stress-Diagnose als präventivmedizinische Primäraufgabe
„Wer den Stress besiegt, hat die Krankheit im Griff!“ Ganz so einfach ist es natürlich nicht, doch wenn man weiss, dass rund 80 % aller gesundheitlichen Probleme und über 95 % aller chronischen Leiden direkt oder indirekt mit Stress assoziiert sind, so dürfte diese scheinbar verwegene Aussage in gut zwei Dritteln aller Fälle zutreffen. Tatsächlich ist Stress das Hauptübel unserer Zeit: Während die Medizin sich anschickt, immer mehr Krankheiten behandeln oder gar heilen zu können, verhält es sich bei Stress und seinen multiplen Folgeerscheinungen genau umgekehrt.
Bislang war man in der sogenannten Schulmedizin der Ansicht, dass Stress, welcher sich durch ein Ungleichgewicht zwischen dem Sympathikus und dem Parasympathikus des vegetativen Nervensystems ausdrückt, weder wissenschaftlich diagnostiziert noch willentlich beeinflusst werden könne. Diese Auffassung ist falsch, wie neuere Untersuchungen bewiesen haben: Mit Hilfe des vor wenigen Jahren entwickelten innovativen Verfahrens der neurovegetativen Regulationsdiagnostik lässt sich die Stressbelastung von Menschen zuverlässig ermitteln und in Prozenten der Regulationsleistung darstellen.
Und da das System nicht nur diagnostisch, sondern auch im Monitoring betrieben werden kann, können von Stress Betroffene die Regulationsdiagnostik auch zum Training benutzen und schauen, welcher atmungstechnische Rhythmus ihnen am besten hilft, ihre Stress-Symptome abzubauen und loszuwerden. Somit steht eine mittlerweile in zahlreichen Fällen erprobte Methode zur Stressbewältigung zur Verfügung, welche stets dann zum Tragen kommt, wenn der dem Stressabbau und der Regeneration dienende Parasympathikus seine Aufgabe nur partiell oder gar nicht erfüllen kann. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Schlafstätten der Stressgeplagten durch elektromagnetische Felder belastet sind, welchen wir heute praktisch auf Schritt und Tritt ausgesetzt sind. Welch verheerende Folgen dies nach sich ziehen kann, beleuchten wir im folgenden Kapitel.
Ausschluss elektromagnetischer und pathogener Quellen als vordringliche präventiv- und sozialmedizinische Strategie
Wenn der nächtliche Stressabbau unter dem Einfluss elektromagnetischer Strahlung nicht oder nur ungenügend stattfinden kann, so tritt die Stress-Symptomatik immer stärker zutage. Was bedeutet, dass sich Stress, der anfänglich lediglich ein Indikator für eine Belastung darstellt und bei einem periodischen Abbau keine negativen Folgen zeitigt, nach und nach zu pathogenem Stress wandelt. Die Folgen zeigen sich in der Form erhöhter Krankheitsanfälligkeit, die schliesslich bis zur Chronifizierung und bis zu tödlich verlaufenden Leiden führen kann.
Messungen haben ergeben, dass heute die meisten Schlafräume in leichtem bis starkem Masse mit Elektrosmog befallen sind – erstaunlicherweise auch solche, die mit einer Freischalt-Automatik zur Bekämpfung des Elektrosmogs ausgerüstet wurden. Dies führt zur Feststellung, dass heute die meisten Fälle von pathogenem Stress auf elektromagnetische Störfelder in Schlafräumen zurückzuführen sind. Auch die meisten Arbeitsplätze sind mit elektromagnetischer Strahlung belastet, die die übliche Stress-Genese noch verstärken kann, anderseits jedoch nicht so sehr ins Gewicht fällt, weil deren Folgen nachts bei gutem Schlaf in entstörten Räumen wieder abgebaut werden können.
Angesichts der überragenden Bedeutung elektromagnetischer Strahlungen für die Entstehung von pathogenem Stress und der immer stärker in Erscheinung tretenden Stress-Pathogenese – die in den letzten Jahren zwar pandemischen Charakter angenommen hat, aber von den Gesundheitsbehörden nach wie vor ignoriert wird – ist es ein ultimatives sozialmedizinisches Gebot der Zeit, flächendeckend Massnahmen zur Vermeidung von Elektrosmog zu treffen. Die Aufgabe ist umso leichter zu bewältigen, als es mittlerweile effiziente Systeme zur Neutralisierung elektromagnetischer Strahlung gibt, deren Wirkung sich nachweisen lässt.
Ein weiteres sozialmedizinisches Problem, das es in diesem Zusammenhang zu bewältigen gilt, ist die Belastung durch geopathische Störquellen aller Art, von deren pathogenem Potenzial man schon seit über 80 Jahren weiss. Auch hier gibt es mittlerweile Mittel und Methoden, solche Störungen von Arbeits- und Schlafplätzen fernzuhalten. Und auch hier müsste mehr zum Abbau den entsprechenden Gefahren getan werden, zumal diese die menschlichen Organe und Gewebsareale nicht nur über die Stress-Genese, sondern auch direkt schädigen können.
Wasser – mehr als bloss ein billiges Getränk und Transportmittel
Eine weitere Thematik, die eine höhere sozialmedizinische Aufmerksamkeit verdient, ist Wasser. Zunächst einmal als Teil der menschlichen Nahrung und als zweitwichtigste Substanz, die der Mensch zum Leben braucht: Menschen können zwar bis zu 50 Tage ohne feste Nahrung auskommen, aber nur 5 bis 7 Tage ohne Wasser. Ungeachtet dessen geht eine weit verbreitete Lehrmeinung davon aus, dass Wasser im menschlichen Körper – der zu etwa 75% aus Wasser besteht – stets im Überfluss vorhanden sei.
Dieses Paradigma wurde vom iranischen Arzt Dr. Faridoon Batmanghelidj erstmals mit einer ganzen Reihe aufsehenerregender Publikationen angegriffen. Batmanghelidj fand heraus, dass viele Leiden auf eine zu geringe Wasseraufnahme zurückzuführen sind und mit der gezielten Einnahme von Wasser gelindert oder gar beseitigt werden können – darunter auch eine ganze Reihe von gesundheitlichen Störungen, auf die die etablierte Medizin mit Medikamenten aller Art statt mit einer Empfehlung zu einer erhöhten Wasseraufnahme reagiert. Dazu zählt insbesondere die weit verbreitete Magenübersäuerung, auf welche Mediziner herkömmlicher Lehre in der Regel mit der Verschreibung von Antacida statt mit der Empfehlung reagieren, über den Tag verteilt mehr Wasser zu trinken.
Zwei stark verbreitete Krankheiten, die unter anderem durch Wassermangel verursacht oder von diesem begünstigt werden, sind Arthrose und rheumatoide Arthritis. Erstere wird zu Unrecht einer Abnützung der Gelenke, letztere einer Defizienz des Immunsystems zugeschrieben. Sowohl beim einen wie auch beim anderen Leidensbild konnte der „Wasserarzt“ eine substanzielle Linderung bis zur Heilung dadurch erreichen, dass er seinen Patienten die gezielte und systematische Einnahme von Wasser empfahl. Tatsächlich ist Dehydration ein verbreitetes Leiden unserer Zeit, auf das die Sozialmedizin mit einer besseren Aufklärung der Betroffenen statt mit Medikamenten-Cocktails reagieren müsste.
Wasser ist indessen nicht nur ein Nahrungs-, Reinigungs- und Transportmittel, sondern auch ein Informationsträger. In der hochtechnisierten und chemisierten Welt, in der wir heute leben, nimmt Wasser unzählige Informationen – darunter auch viele negative – auf, die es im Zuge des Kreislaufs auch wieder abgibt. So kann beispielsweise Trinkwasser auch Informationen enthalten, die den Stromfluss stören und zusätzlichen Elektrosmog bewirken. Die Sozialmedizin hat also allen Grund, sich auch des Themas „Wasser“ in all seinen Facetten anzunehmen.
Regeneration und Prävention als neue Themen-Schwerpunkte
Zwar wird dem Grundsatz, wonach Prävention die beste und günstigste Gesundheits-Strategie sei, um dräuenden Befindlichkeitsstörungen und Krankheiten entgegenzutreten, kaum widersprochen. In der gelebten Praxis jedoch, die klar auf die Behandlung und Verwaltung von Krankheiten und nicht auf deren Vermeidung ausgerichtet ist, fehlt der Präventionsgedanke weitgehend. Dass anderseits jedermann von dessen Notwendigkeit spricht und dass mit grossem administrativem Aufwand in dieser Domäne Projektförderung betrieben wird, macht die Sache nicht besser.
Denn bei Lichte betrachtet handelt es sich dabei zumeist um Alibiübungen. Und wer dennoch einen ernstzunehmenden Vorschlag in dieser Richtung vorzubringen wagt, dem wird von den angesprochenen Stellen zumeist beschieden, sie seien dafür nicht zuständig. So ist es denn auch erklärbar, weshalb den Krankenkassen durch den zwingenden Risiko-Ausgleich jeder Anreiz für die Unterstützung präventiver Aktivitäten genommen wurde, ohne dass von irgend einer Stelle auf die negativen Konsequenzen der entsprechenden Bestimmungen hingewiesen wurde.
Tatsächlich kennt der heutige Medizinbetrieb kaum Anlaufstellen für präventive Ansätze und entsprechende Projekte. Wer sich dafür interessiert, wird in der Regel auf den Sportbereich verwiesen, der seinerseits im Ausgleichssport- und Fitnessbereich eine ganze Industrie zur Befriedigung entsprechender Bedürfnisse entwickelt hat. Eine Gesamtschau, die einerseits die gesundheitlichen Bedrohungsbilder und anderseits die Möglichkeiten zur Minimierung gesundheitlicher Risiken aufzeigt, findet jedoch kaum statt. Dabei liessen sich gerade auf der Stufe Prävention viele Probleme vermeiden, die später mit den Mitteln der astronomisch teuren personalisierten Medizin wieder aufgefangen werden sollen.
Prävention und Regeneration sind denn auch die Antwort der Sozialmedizin auf die hochgelobten und die Mittel der Krankenkassen nach und nach übersteigenden Spitzenmedizin, die vornehmlich die Folgen ungenügender präventiver Engagements ausgleichen muss. Die derzeit wichtigsten präventivmedizinischen Herausforderungen – die gleichsam ein Gegenmuster zu dem darstellen, was man heute unter dem Begriff versteht – haben wir in den ersten Abschnitten dieser Einführung in die Thematik dargestellt. Doch was ist unter Regeneration zu verstehen?
Den wichtigsten Aspekt eröffnet hier zweifellos das vegetative Nervensystem, dessen Parasympathikus in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle zufällt. Effektiv besteht das A und das O jeder Förderung regenerativer Prozesse darin, dem Parasympathikus des vegetativen Nervensystems optimale Konditionen für die Wahrnehmung seiner Funktionen zu bieten. Weitere, spezifisch organ- und funktionsbezogene Prozesse können diese Aufgaben sinnvoll ergänzen. So beispielsweise Massnahmen zur generellen Stärkung der Zellen und zur Förderung ihrer Lebensdauer im Sinne eines effizienten Anti-Agings, Strategien zur Stärkung des Knochenbaus und zur Erhaltung geschmeidiger Gelenke sowie Vorkehrungen zur Förderung des Metabolismus und der Mikrozirkulation. Weitere und konkretere Angaben zu dieser Thematik finden sich im Abschnitt „Neu: das Zentrum für Prävention und Regeneration.“
Die zum Teil noch verkannte Rolle der Nahrungsergänzungsmittel
Führende Ernährungswissenschaftler vertreten nach wie vor die Ansicht, dass eine sogenannt „ausgewogene“ Ernährung völlig ausreiche, um den menschlichen Organismus gesund zu erhalten. Dass an dieser These etwas nicht stimmen kann, ersieht sich allein schon daraus, dass ein Speiseplan, der all die von diesen Fachleuten empfohlenen Mikronährstoffe in ausreichender Menge enthält, die zuträgliche Kalorienmenge deutlich übersteigt. Dies hat unter anderem anthropologische Gründe: Während frühere Generationen ihren Lebensunterhalt im Schweisse ihres Angesichts bestritten, ist als Folge der heutigen, mehrheitlich im Sitzen ausgeübten Tätigkeiten der durchschnittliche Kalorienbedarf der Menschen in hochindustrialisierten Ländern deutlich gesunken. Umgekehrt ist jedoch der Bedarf an Mikronährstoffen als Konsequenz der stärkeren geistigen und neurologischen Beanspruchung dieser Menschen eher noch gestiegen.
Dazu kommt, dass die heute im Angebot stehenden Nahrungsmittel eine weitaus höhere Dichte an Betriebsstoffen und umgekehrt weniger Ballaststoffe aufweisen als frühere Speisebestandteile. Ausserdem muss davon ausgegangen werden, dass die Metabolisierung der zugeführten Nährstoffe nicht immer vollständig ist; oft kann nur ein Bruchteil der erforderlichen Mikronährstoffe verstoffwechselt werden, weil manche Enzyme nicht in genügender Menge vorhanden sind oder in ihrer Funktion blockiert werden. All diese Entwicklungen und Imponderabilien tragen dazu bei, dass in manchen Bereichen ein ausgesprochener Mangel an solchen Stoffen besteht, der letztlich nur durch eine Zufuhr von ergänzenden Mikronährstoffen ausgeglichen werden kann.
Als pars pro toto seien hier lediglich die Photonen erwähnt, die sich in den Pflanzen durch die Einstrahlung des Sonnenlichts bilden und die bisweilen auch „Lichtquanten“ genannt werden. Messungen haben gezeigt, dass viele Naturprodukte heute nur noch einen Teil des früheren Anteils an solchen Stoffen enthalten, die dem Körper zu geringen Teilen auch direkt durch das Sonnenlicht zufliessen. Photonen sind unverzichtbare Energiequellen für die Mitochondrien der Zellen. Der Abbau in den Nahrungsmitteln hat in verschiedenen Bereichen bereits dramatische Ausmasse erreicht. Honig beispielsweise ist in den letzten Jahren unter dem Einfluss von Pestiziden und einer Ausdünnung des Futterangebots in manchen Regionen um 50 bis 80 % ärmer an Photonen als noch vor 20 oder 30 Jahren. Zum wichtigsten Vitamin, mit welchem sich ein Defizit an Photonen teilweise ausgleichen lässt, ist deshalb Vitamin D-3 geworden: Mit dessen Hilfe kann dem Körper in gewissem Sinne zusätzliches „Sonnenlicht“ zugeführt werden.
Dazu ein konkretes Beispiel: Aus der Historie ist bekannt, dass die Malteser auf der Insel Zypern eine besondere Rebsorte pflegten, aus deren Trauben sie unter dem Titel „Commandaria“ einen Süsswein herstellten, wofür sie das Traubengut nach der Ernte noch während rund zwei bis drei Wochen dem Sonnenlicht aussetzten und so eine signifikante Photonen-Anreicherung bewirkten. Dieser Wein – Commandaria ist übrigens die erste Weinmarke der Welt; ihre Geschichte geht auf das 8. Jahrhundert zurück – wurde als spezieller Kraftwein angeboten. Er wirkte so überzeugend, dass er in Venedig den Status eines Medikaments erhielt und in den Genuss einer Steuerbefreiung kam. Dieses Kraftgetränk gibt es heute noch; es wird nach wie vor auf die gleiche Art und Weise hergestellt und unter gleicher Marke vertrieben.
Eine glaubwürdige Reform der Sozialmedizin müsste solchen Sachverhalten Rechnung tragen: Statt Nahrungsergänzungsmittel zu beargwöhnen und selbst bei erwiesenem Fehlen unerwünschter Nebenwirkungen hohe Zulassungshürden aufzubauen und deren Überwindung mit hohen Gebühren zu pönalisieren – was bei kleinen Absatzmärkten praktisch einer Prohibition gleichkommt – müsste vielmehr versucht werden, das entsprechende Angebot nach Qualitätskriterien zu fördern und proaktiv transparente Zulassungskriterien zu formulieren.
Neu: Das Zentrum für Prävention und Regeneration
Durch das Anziehen der Sparschraube im Gesundheitswesen und die verstärkte Bewertung medizinischer und pflegerischer Leistungen nach betriebswirtschaftlichen Kriterien sehen sich viele kleine Spitäler wie auch private Kliniken an den Rand ihrer Existenz gedrängt. Was zur Folge hat, dass manche dieser Institutionen geschlossen werden oder an private Ketten übergehen, die durch eine straffe Organisation und zentralen Einkauf gute Gewinne zu generieren trachten. Im einen wie im anderen Falle bleiben die Patienten auf der Strecke – gleichsam als schwächste Glieder in der Kette.
Anderseits gibt es jedoch kaum etwas daran zu rütteln, dass diese klinischen Entitäten auf der Basis des konventionellen Medizinbetriebs kaum unverändert weitergeführt werden können, da die Kosten nolens volens ins Uferlose steigen würden. Zugleich würde eine Reform der Sozialmedizin im hier skizzierten Sinne die Zahl stationärer Patienten wohl dramatisch schrumpfen lassen. Dies nicht nur durch eine Abnahme stringent Versorgungsbedürftiger im Bereich der Ersterkrankungen, sondern auch bei den Multimorbiditäten und insbesondere auch bei den Chronifizierungen. Hier könnten insbesondere durch die Beseitigung der erwähnten Stressquellen und durch bessere Behandlungsoptionen die Fallzahlen der verbleibenden Stresspatienten deutlich sinken.
Doch während auf der einen Seite stationäre Abteilungen und Kliniken wegen sinkender Nachfrage und/oder disproportionalen Kosten geschlossen werden müssen, generiert die besagte Reform der Sozial- und Präventivmedizin eine neue Nachfrage in den Bereichen der Primärdiagnostik, der Regeneration, der Information und Instruktion sowie des Monitorings, der Reihenuntersuchungen und der allgemeinen Prävention sowie der Vorbeugung drohender Epidemien und Pandemien. Dazu können sich noch einige weitere Spezialgebiete wie beispielsweise das Anti-Aging, die Körpergewichts-Kontrolle, die Stressprävention und die diätische Ernährung gesellen.
Unter den Leistungen, die in einem „Zentrum für Prävention und Regeneration“ erbracht werden können, befindet sich nach unseren Vorschlägen unter anderem ein „Zentrum für dorsale Regeneration“. Darunter ist eine Entität zu verstehen, die sich gezielt der Prävention und Remission von Rückenbeschwerden annimmt. Rückenbeschwerden zählen im Medizinbetrieb zu den häufigsten gesundheitlichen Störungen. Und zu den teuersten dazu:
Rechnet man alle Kosten, Unkosten und Kollateralschäden zusammen, die durch Rückenbeschwerden entstehen – so namentlich physiotherapeutische Hilfestellungen, Schmerzbehandlungen, riskante Operationen, Arbeitsausfälle und Invaliditäten – so stehen Rückenbeschwerden an der Spitze der Aufwand-Rangliste. Dieser ganze Aufwand lässt sich auf ein Minimum reduzieren, wenn sich Leute ab dem Alter 40 in regelmässigen Abständen – alle 2 bis 6 Jahre, je nach Beanspruchung der Wirbelsäule – einer spinalen Traktion unterziehen, mit der das Rückgrat jeweils schonend reponiert wird.
Eine ausführliche Darstellung dieses Projekts bzw. dieser Reformkomponente wird im Kapitel „Neu: Das Zentrum für Prävention und Regeneration“ präsentiert. Dort finden sich auch einige weitere Beispiele für spezifische Leistungen, die in einem solchen Zentrum angeboten werden können. Im Einzelfall ist zu prüfen, ob dies durch eine Umnutzung und einen Umbau aufgegebener Kleinspitäler und kleinerer Heime geschehen kann.
Unabdingbar: Die Mitwirkung der Probanden und Patienten
Vor allem Naturärzte und Heilpraktiker wissen davon ein Liedchen zu singen: Wenn ein Patient oder eine Patientin sich nicht am eigenen Heilungsprozess beteiligt, kann in der Regel keine gute Prognose gestellt werden. Besonders Heilpraktiker, die auf ihre Patienten näher eingehen können als dies zumeist selbst Allgemeinpraktikern möglich ist (wobei ersteren dafür in der Regel auch bedeutend mehr Zeit zur Verfügung steht), wissen, dass sie mit ihrer Kunst auf verlorenem Posten stehen, wenn sich die Patienten nicht selbst und nach Kräften am Heilungsprozess beteiligen. Deshalb kann auch eine reformierte Sozialmedizin nur erfolgreich sein, wenn sie die Patienten in die Heilungsprozesse mit einbezieht und wenn sie es versteht, die Bevölkerung für die Belange der Prävention zu gewinnen und zu begeistern.
Wobei gleich anzumerken ist, dass in der Bevölkerung viele falsche Vorstellungen über gesundheitlich adäquates Verhalten existieren. Sport beispielsweise bringt dem auf Gesundheit bedachten Zeitgenossen nicht allzu viel, wenn dieser die von ihm gepflegte Sportart nicht in einen Fitnessplan einzubringen vermag. Tatsächlich kann Sport sogar gesundheitsschädigende Effekte zeitigen, wenn dabei ein einseitiges Training einzelner Organe zulasten anderer erfolgt oder wenn dabei gewisse Körperpartien überstrapaziert werden.
Ein gesundheitliches Engagement sollte vielmehr auf einer Gesamtdiagnose aufbauen und darauf ausgerichtet sein, allfällige Defizite in der Versorgung und in der Beanspruchung der Organe auszugleichen. Die besten Gesundheitsaussichten bestehen dort, wo sich der gesamte Organismus in einer guten Balance befindet – allen voran das vegetative Nervensystem, bei welchem eine Dysbalance auf Stress hinweist.
Um in der Präventiv- und Sozialmedizin eine adäquate Mitwirkung der Probanden zu erreichen, ist eine Aufklärung auf breiter Basis unerlässlich. Dafür stehen grundsätzlich mehrere Wege offen, deren vier wichtigste hier kurz aufgeführt seien:
Das Web, in welchem die sachdienlichen Informationen im Rahmen mehrerer didaktisch konsolidierter Informations- und Lernroutinen angeboten werden





























