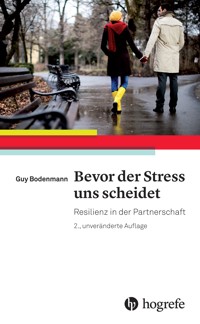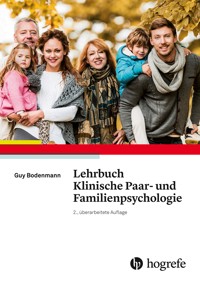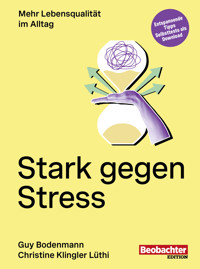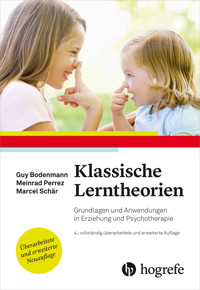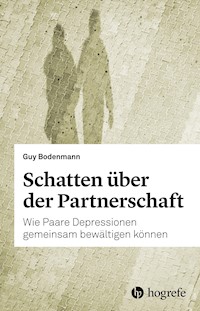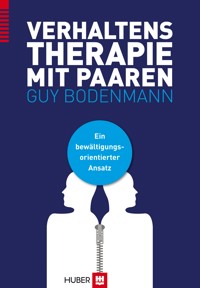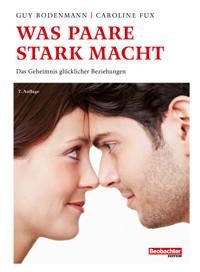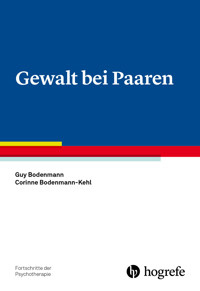
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Leichtere Formen von körperlicher Gewalt und insbesondere psychische Gewalt kommen in strittigen Paarbeziehungen häufig vor und sind daher in Paartherapien oft ein Thema. Der Band bietet Informationen zur Definition von Gewalt, zu deren Prävalenz bei Paaren sowie zu individuellen, partnerschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Risikofaktoren für das Auftreten von Gewalt in einer Partnerschaft. Verschiedene theoretische Erklärungsmodelle werden vorstellt und im Hinblick auf ihren Nutzen für die paartherapeutische Arbeit überprüft. Auf der Basis einer Typologie von Gewalt bei Paaren wird verdeutlicht, dass je nach Typ von Gewalt unterschiedliche therapeutische Vorgehensweisen gewählt werden sollten. Dies setzt eine gründliche Diagnose mittels funktionaler Bedingungsanalyse und Fragebögen voraus, auf deren Grundlage die Intervention geplant werden kann. Paartherapeutinnen und Paartherapeuten finden in diesem Band ein breites Repertoire an Methoden, welches sie zur Behandlung von Gewalt bei Paaren einsetzen können, wenn es sich um Gewalt in Form eines sich gegenseitig aufschaukelnden Prozesses handelt. Es wird auf Interventionen zur Erhöhung der Alltagspositivität sowie zur Förderung der emotionalen Selbstöffnung und des wechselseitigen Verständnisses eingegangen. Weiterhin werden Interventionen vorgestellt, die es ermöglichen, Gewalt bei ihrem Auftreten zu durchbrechen, und die zur Gewaltprophylaxe eingesetzt werden können. Weitere Themen sind Repair-Gespräche, der Einsatz von Anti-Gewalt-Verträgen und Versöhnungsrituale. Abschließend werden Ergebnisse zur Wirksamkeit von Paartherapie zusammengefasst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Guy Bodenmann
Corinne Bodenmann-Kehl
Gewalt bei Paaren
Fortschritte der Psychotherapie
Band 94
Gewalt bei Paaren
Prof. Dr. Guy Bodenmann, Dr. Corinne Bodenmann-Kehl
Die Reihe wird herausgegeben von:
Prof. Dr. Martin Hautzinger, Prof. Dr. Tania Lincoln, Prof. Dr. Jürgen Margraf, Prof. Dr. Winfried Rief, Prof. Dr. Brunna Tuschen-Caffier
Die Reihe wurde begründet von:
Dietmar Schulte, Klaus Grawe, Kurt Hahlweg, Dieter Vaitl
Prof. Dr. Guy Bodenmann, geb. 1962. 1985 – 1991 Studium der Klinischen Psychologie, Allgemeinen und Angewandten Psychologie in Fribourg, Schweiz. 1991 – 1995 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Fribourg. 1995 Promotion. 1996 – 2007 Direktor des Instituts für Familienforschung und -beratung der Universität Fribourg. 1999 Habilitation. 2001 Assoziierter Professor für Klinische Beziehungspsychologie an der Universität Fribourg. Seit 2008 Ordinarius für Klinische Psychologie an der Universität Zürich.
Dr. Corinne Bodenmann-Kehl, geb. 1963. 1985 – 1991 Studium der Klinischen Psychologie, Allgemeinen und Angewandten Psychologie in Fribourg, Schweiz. 1992 Lizentiat. Wissenschaftliche Mitarbeiterin sowie Psychotherapeutin an der Universität Fribourg, 1999 Promotion. 1999 bis heute Psychotherapeutin und Paartherapeutin an der Hochschulambulanz (zuerst Fribourg, danach Zürich) sowie Ausbildnerin und Dozentin.
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autor:innen bzw. den Herausgeber:innen große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autor:innen bzw. Herausgeber:innen und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
Fax +49 551 999 50 111
www.hogrefe.de
Satz: Sina-Franziska Mollenhauer, Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
Format: EPUB
1. Auflage 2025
© 2025 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-3211-3; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-3211-4)
ISBN 978-3-8017-3211-0
https://doi.org/10.1026/03211-000
Nutzungsbedingungen:
Durch den Erwerb erhalten Sie ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das Sie zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere dürfen Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernt werden.
Das E-Book darf anderen Personen nicht – auch nicht auszugsweise – zugänglich gemacht werden, insbesondere sind Weiterleitung, Verleih und Vermietung nicht gestattet.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
1 Beschreibung des Phänomens
1.1 Definition von Gewalt bei Paaren
1.2 Formen der Gewalt
1.3 Typologien von Gewalt
1.4 Epidemiologie
1.4.1 Polizeilich registrierte Gewalt
1.4.2 In epidemiologischen Studien erfasste Gewalt
2 Theoretische Ansätze zu Gewalt bei Paaren
2.1 Soziokultureller Ansatz
2.2 Persönlichkeitstheoretischer Ansatz
2.3 Sozial-lerntheoretischer Ansatz
2.4 Ökologischer Ansatz
2.5 Dyadischer Ansatz
2.6 Gewaltfördernde Faktoren
2.6.1 Individuelle Faktoren
2.6.2 Interpersonelle Faktoren
2.6.3 Soziale und gesellschaftliche Faktoren
3 Diagnostik
3.1 Funktionale Bedingungsanalyse
3.2 Erfassung von Gewalt in der Partnerschaft mittels Fragebögen
3.2.1 Conflict Tactic Scale (CTS)
3.2.2 Fragebogen zu Gewalt innerhalb der Partnerschaft (FGP)
4 Interventionen bei Gewalt in der Partnerschaft
4.1 Paartherapeutische Kursprogramme
4.2 Verhaltenstherapeutische Paartherapie
4.2.1 Psychoedukation
4.2.2 Anti-Gewalt-Vertrag
4.2.3 Erhöhung der Alltagspositivität
4.2.4 Förderung der emotionalen Selbstöffnung und des wechselseitigen Verständnisses
4.2.5 Gewaltspirale durchbrechen
4.2.6 Gewaltprophylaxe
4.2.7 Repair-Gespräch
4.2.8 Versöhnungsritual
4.3 Wirksamkeit der Paartherapie
4.4 Probleme bei der Durchführung
5 Fallbeispiel
6 Weiterführende Literatur
7 Literatur
8 Kompetenzziele und Lernkontrollfragen
9 Anhang
Fragebogen zu Gewalt innerhalb der Partnerschaft (FGP)
Karten
Exploration des Gewalttyps
Die drei Gewalttypen bei Paaren und ihre Kennzeichen
SaGeBe-Methode
SENF-Methode
Hinweise zu den Karten
|1|1 Beschreibung des Phänomens
In der Paartherapie begegnet man Themen wie Aggression und Gewalt bei hochstrittigen Paaren häufig. Aber auch allgemein stellt Gewalt bei Paaren ein wichtiges, jedoch häufig tabuisiertes Thema dar. Wird psychische Gewalt breit gefasst und werden darunter beispielsweise auch Beleidigungen („Du bist dick und faul“), Abwertungen („Ah, der Herr hat nicht mitbekommen, dass ich auch noch da bin“) und Provokationen („Wie soll man bei so jemandem Lust auf Sex haben?“) verstanden, betrifft es eine Mehrzahl der Paare in Therapie. Aber auch körperlicher Gewalt begegnet man oft.
Während einzelne Paare bereits in der ersten Sitzung Gewalt in der Problemanalyse thematisieren, sprechen andere Gewalt erst später an, wenn das Vertrauen zum Therapeuten bzw. zur Therapeutin1 etabliert ist. Andere sprechen Gewalt überhaupt nicht an und deren Vorkommen kann aufgrund des Umgangs miteinander nur vermutet werden.
Gewalt ist ein heikles Thema, weil es in vielen Fällen eine Gratwanderung bedeutet und es alles andere als klar ist, wie man sich als Therapeut:in verhalten soll. Soll man Beobachtungen oder Vermutungen in Bezug auf Gewalt proaktiv ansprechen? Wie soll man vorgehen, wenn einer der beiden Partner:innen das Thema konsequent negiert? Wann und in welchen Fällen sollen Behörden eingeschaltet werden?
Oftmals steht Gewalt zudem mit anderen Faktoren wie Persönlichkeitsstörungen (z. B. antisoziale oder Borderline-Persönlichkeitsstörung), problematischem Alkohol- oder Drogenkonsum oder Abhängigkeitsstörungen, Depressionen oder sexuellen Funktionsstörungen im Zusammenhang.
Entsprechend wichtig ist es, bei Gewalt in der Partnerschaft diagnostisch sorgfältig abzuklären, (1) wo und bei wem therapeutisch anzusetzen ist und (2) ob direkt bei der Gewalt (primäre Indikation) oder eher bei den gewaltfördernden oder gewaltauslösenden Bedingungen innerhalb der Paarbeziehung respektive bei der jeweiligen Persönlichkeit der Partner:innen (sekundäre Indikation) angesetzt werden sollte. Je nach Ergebnis der funktionalen Bedingungsanalyse (mithilfe des SORCK-Modells) ist ein anderer therapeu|2|tischer Ansatzpunkt erforderlich und die Paartherapie entsprechend anzupassen oder in Kombination mit einer Individualtherapie oder flankierenden polizeilichen Maßnahmen zu gestalten.
1.1 Definition von Gewalt bei Paaren
Gewalt bei Paaren wird als Teilmenge und gleichzeitig hauptsächliche Komponente der häuslichen Gewalt verstanden, welche vom Europarat (2011) wie folgt definiert wird:
Definition: Häusliche Gewalt
Unter den Begriff „häusliche Gewalt“ fallen „[…] alle Handlungen körperlicher, sexueller, psychischer oder wirtschaftlicher Gewalt, die innerhalb der Familie oder des Haushalts oder zwischen früheren oder derzeitigen Eheleuten oder Partnerinnen beziehungsweise Partnern vorkommen, unabhängig davon, ob der Täter beziehungsweise die Täterin denselben Wohnsitz wie das Opfer hat oder hatte“ (Istanbul-Konvention 0.311.35, Art. 3b; Europarat, 2011).
Die Gewalt bei Paaren ist eine Form der interpersonellen Gewalt mit dem Ziel, durch Worte oder Handlungen den Partner bzw. die Partnerin und dessen bzw. deren körperliche, psychische oder sexuelle Integrität zu beeinträchtigen.
Meist wird bei Gewalt in Partnerschaften an offene physische Gewalt (z. B. Handgreiflichkeiten) gedacht. Häusliche Gewalt ist jedoch vielfältiger und weist unterschiedliche Formen auf, welche sich in klassischer Gewalt, gewaltsamem Widerstand, intimem Terrorismus oder koersiver Kontrolle äußern können (Johnson & Ferraro, 2000). Gewalt kann zudem als Missbrauch, Misshandlung, Vernachlässigung oder in Form des Münchhausen-Stellvertreter-Syndroms2 vorkommen.
1.2 Formen der Gewalt
Es können verschiedene Formen der Gewalt bei Paaren unterschieden werden, welche sowohl einzeln als auch kombiniert auftreten können (Kersten, 2020). Tabelle 1 gibt einen Überblick über die verschiedenen Gewaltformen, welche klassischerweise unterschieden werden (|3|Eidgenössisches Büro für Gleichstellung von Frau und Mann [EBG], 2020a; Kersten, 2020; Postmus et al., 2020).
Tabelle 1: Formen von Gewalt bei Paaren
Physische Gewalt
(Verletzung der physischen Integrität)
Grobes Anfassen, Schubsen, Stoßen, Schütteln, Anspucken, An-den-Haaren-Ziehen, Ohrfeigen, Treten, Schlagen, Würgen, Beißen, Kratzen, Bedrohen oder Verletzen mit Gegenständen oder Waffen, Fesseln, Verprügeln, Verbrühen, Verbrennen etc.
Psychische Gewalt
(Verletzung der psychischen Integrität)
Einschüchterung, Demütigung, Erniedrigung, Bloßstellung, Herabsetzung, Nötigung, Drohungen, Verunglimpfung, Verleumdung, Erzeugung von Schuldgefühlen, eifersüchtiges Verhalten mit penetrantem Nachforschen und Nachstellen (Stalking), Cybermobbing, Zerstören von Gegenständen, die dem anderen lieb und teuer sind, oder Quälen von Haustieren respektive Gewalt gegenüber nahen Bezugspersonen des Partners bzw. der Partnerin. Diese Verhaltensweisen können sowohl im privaten als auch im öffentlichen Raum angedroht oder ausgeführt werden.
Sexuelle Gewalt
(Verletzung der sexuellen Integrität)
Sexuelle Belästigung und Nötigung, aufdringliches Zu-nahe-Kommen, sexuell anzügliche Sprüche, unerwünschte Berührungen oder Küsse, Belästigung durch Entblößen oder das Zeigen von pornografischen Bildern, Filmen oder Geschlechtsteilen, ungewollte Berührungen im Intimbereich, Zwang zu sexuellen Praktiken, die man nicht möchte oder Zwang zu sexuellen Handlungen mit anderen Personen, versuchte oder ausgeführte Vergewaltigung, Zwang zur Prostitution etc.
Ökonomische Gewalt
(Ausbeutung oder Einschränkung)
Beschlagnahmung von Einkünften des Partners bzw. der Partnerin, Ausnutzung der finanziellen Abhängigkeit des anderen, Verbot, arbeiten zu gehen oder Zwang zum Arbeiten, Unterbinden der Verfügungsgewalt über Finanzen, wirtschaftliche Ausbeutung des Partners bzw. der Partnerin durch Stehlen oder Verkaufen persönlicher Wertgegenstände.
Soziale Gewalt
(Verletzung sozialer Rechte)
Einschränkung des sozialen Lebens durch Verbot oder Kontrolle von Familien- und Außenkontakten, einsperren, um soziale Kontakte zu verhindern, oder auch das Verbieten, eine Landessprache zu lernen, Freiheitsberaubung, Zwangsheirat etc.
Vernachlässigung
(Verletzung der Fürsorge und emotionalen Bindung)
Wiederholte oder andauernde emotionale oder fürsorgliche Unterlassungen bei einem abhängigen Partner bzw. einer abhängigen Partnerin (z. B. aufgrund von Behinderung, Alter, psychischem Befinden).
Fallbeispiel: Sexuelle Gewalt
Das Paar ist seit zwei Jahren zusammen und lebt im selben Haushalt. Er ist 45 Jahre, sie 41 Jahre alt. Sie hat drei Kinder aus einer früheren Bezie|4|hung, ist seit vier Jahren geschieden und hat eine traumatische Kampfscheidung hinter sich. Er war ebenfalls geschieden, als sie sich kennenlernten. Seine Frau hatte ihn nach 15 Jahren Ehe vor fünf Jahren verlassen. Für beide waren diese Erfahrungen prägend und sie sehnen sich nach einer stabilen Beziehung.
Bei der Problemanalyse erzählt der Mann, dass er sich der neuen Partnerin emotional sehr nahe fühle und sie gerne heiraten möchte. Das Problem seien jedoch ihre sexuellen Präferenzen, die ihm sehr fremd wären, und mit denen er Mühe hätte. Sie möge SM-Sex und fordere diesen von ihm ein. Sie möge es sehr hart, mit Halsband, Peitschen, möchte Gruppensex und habe ihn schon mehrfach zu sexuellen SM-Treffen mit anderen mitgenommen.
Zuerst habe er beim SM-Sex mitgemacht, um sie nicht zu verlieren. Ihn widere diese Art der Sexualität jedoch an, die Szenen würden ihn im Schlaf verfolgen. Seit er diese Art von Sex erlebe, habe er Erektionsprobleme. Sie mache ihn deshalb lächerlich und er befürchte, dass sie ihn verlassen könnte. Im Streit habe sie dies bereits mehrfach angedroht.
Wie das Beispiel zeigt, geht sexuelle Gewalt häufig auch mit psychischer Gewalt einher, indem eine Person droht, die andere zu verlassen, wenn sie nicht mitspielt.
1.3 Typologien von Gewalt
Eine wichtige Differenzierung im Hinblick auf Gewalt bei Paaren stellt die Gewalttypologie von Jacobson et al. (1995) dar. Die Autoren unterscheiden zwei Typen von gewalttätigen Partner:innen (vgl. Tabelle 2). Typ-II-Gewalt ist in der Paartherapie häufiger und lässt sich erfolgreicher behandeln als Typ-I-Gewalt.
Eine andere Typologie von Gewalt bei Paaren wurde von Holtzworth-Munroe und Stuart (1994) respektive Holtzworth-Munroe und Meehan (2004) vorgeschlagen, bei der ebenfalls allgemein Gewalttätige im Sinne des Typs I nach Jacobson et al. (1995) unterschieden werden, Typ II jedoch noch breiter gefasst wird und hierunter zudem dysphorische oder Borderline-Gewalttätige subsummiert werden.
Fallbeispiel: Typ-II-Gewalt, komorbid mit Persönlichkeitsstörung
Frau G., 27 Jahre alt, kommt in die Therapie wegen anhaltender Beziehungsprobleme. Bei ihr wird eine Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Anamnestisch relevant ist ein sexueller Missbrauch durch einen Onkel. Sie wird im Rahmen einer individuellen Psychotherapie be|5|treut, bei der auch regelmäßige Sitzungen mit ihr und ihrem aktuellen Partner stattfinden („We-Disease-Gespräche“).
Seit rund einem Jahr ist Frau G. in einer On-off-Beziehung mit einem Mann, den sie als zu wenig verbindlich empfindet, aber dennoch als ihre große Liebe bezeichnet. Sie hat große Angst, dass er sie verlassen könnte. Da er nachts immer häufiger wegbleibt und sich Situationen häufen, in denen er sich „rarmacht“, wie sie es nennt, vermutet sie Untreue und reagiert mit massiver Eifersucht. Sie unterstellt ihm, dass er sich mit anderen Frauen treffe, was er verneint. Er brauche nur ab und zu Distanz und möchte auch sein eigenes Leben nicht völlig vernachlässigen. Er empfinde sie als zu vereinnahmend. Diese konstante Nähe würde ihn ersticken.
Zusehends häufiger eskaliert die Situation. Beim letzten Konflikt hatte er ihr mitgeteilt, dass er eine neue Stelle in einer benachbarten Stadt antreten werde und sie sich nur noch jedes zweite Wochenende sehen würden, da die Distanz zum Pendeln zu groß und jedes Wochenende zu kommen für ihn zu anstrengend sei. Es sei auch möglich, die Beziehung ganz zu beenden, wenn sie das lieber hätte.
Auf diese Ankündigung hin, verlor die Patientin die Kontrolle. Sie habe sich von ihm zurückgestoßen, erniedrigt und gedemütigt gefühlt. Sie habe nun die Gewissheit, dass er nur darauf warte, sich von ihr zu trennen. Ein unbändiger Hass sei in ihr hochgestiegen. Sie hätte ihn am liebsten erwürgt.
Tabelle 2: Typ I und Typ II gewalttätiger Partner:innen (nach Jacobson et al., 1995, Darstellung nach Bodenmann, 2016, S. 253)
Typ-I-Gewalt
Typ-II-Gewalt
Keine oder geringe physiologische Erregung (Kaltblütigkeit)
Hohe physiologische Erregung mit Verlust der Impulskontrolle