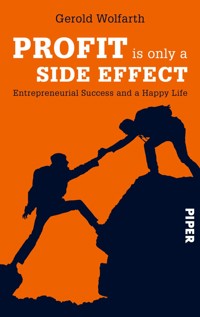9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
»Erfolg heißt für mich, alle Lebensbereiche, die mich als Mensch ausmachen, in der Balance zu halten.« Gerold Wolfarth zeigt Ihnen - zehn einfache Regeln, wie Sie unternehmerischen Erfolg und ein erfülltes Leben in Einklang bringen, - das perfekte Rüstzeug für den Führungsalltag von Unternehmen und für ein nachhaltiges Selbstmanagement, - wie Sie erfolgreich werden können, ohne sich zu verbiegen. GEWINN ist nur ein NEBENPRODUKT richtet sich an alle, die … - authentisch und bewusst leben, - effektiver kommunizieren, - ihre Kompetenz steigern, - selbstbewusster auftreten, - in allen Lebensbereichen erfolgreich und erfüllt sein, - die Menschen begeistern und mitreißen wollen. Sechs Jahre nachdem Gerold Wolfarth sich selbstständig gemacht hat, steht sein Betrieb plötzlich vor dem Aus. Aber der Jungunternehmer lässt sich nicht unterkriegen und findet eine Lösung. Während er seine Firma nun zu einem europaweit agierenden Marktführer ausbaut, macht er eine überraschende Entdeckung: Unternehmerischer Erfolg funktioniert auch und gerade dann, wenn man in allen Lebensbereichen für ein erfülltes Leben sorgt! Heute weiß Gerold Wolfarth, dass es zehn Punkte sind, die seinen Erfolg ausmachen. In »GEWINN ist nur ein NEBENPRODUKT« erklärt er, wie sie lauten und wie man nach ihnen leben kann. Neun überraschende Fakten zu Gerold Wolfarth: 1. Vom einfachen Bauernsohn wird er zum CEO eines europaweit tätigen Unternehmens. 2. Bereits mit elf Jahren managt er den elterlichen Hof. 3. Mit 22 Jahren absolviert er seinen ersten Ironman – über Monate beginnt sein Tag um 4.30 Uhr in der Früh. 4. Mit 26 ist er Geschäftsstellenleiter eines Franchise-Unternehmens. 5. Sein Unternehmen führt er von der One-Man-Show zum europaweiten Marktführer. 6. Sechs Jahre nach der Gründung steht sein Unternehmen vor dem Aus: Er rettet es. 7. Erfolgsrezept Nr. 1: Verbiege dich nicht, sei offen, ehrlich und direkt. 8. Erfolgsrezept Nr. 2: Konzentriere dich auf das Wesentliche. 9. Erfolgsrezept Nr. 3: Nimm dich und deine Mitmenschen in allen Lebensbereichen gleich ernst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
ISBN 978-3-492-05724-0
Konzeption und Text: Sibylle Auer, München
Lektorat und Beratung: Tanja Ruzicska, bookTRade UG, Berlin
© 2019 Piper Verlag GmbH, München
Covergestaltung: Heidi Jenner, München
Covermotiv: Fotolia (iStock)
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Cover & Impressum
Prolog
Gewissheiten
Der Junge auf dem Traktor
Gerold, du machst das schon!
Ewald und der Pickelstiel
Denken erlaubt?
Der Ironman
Der Weg zum Unternehmer
Beyond the Edge
Kopfüber ins kalte Wasser
Auf eigenen Füßen
Baukreativ-Straße 1
Gänsehaut
Die Geburtsstunde der bk Group
365 kreisrunde Grad
Zehn Leitlinien für ein erfülltes Leben
1. Sprechen Sie Klartext
Ohne Regeln geht es nicht
Wehret den Anfängen
Die Wirkung des gesprochenen Wortes
Das Paretoprinzip
Takeaway: Der Weg zu mehr Klarheit und Wirksamkeit in der Kommunikation
2. Definieren Sie Ihr Ziel
Wann ist ein Ziel ein Ziel?
Der Papatag
Idee zu verkaufen
Takeaway: Der Weg zu zielgerichtetem Handeln
3. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche
Was ist wesentlich?
Delegieren, aber kontrollieren
Der Inner Circle
Hier und Jetzt
Takeaway: Der Weg zu mehr Effizienz im täglichen Handeln
4. Seien Sie sich Ihrer selbst bewusst
Stift und Papier statt Coach und Berater
Ich bin einzigartig
Die Highlights des Tages
Takeaway: Der Weg zu mehr Selbstbewusstsein
5. Seien Sie authentisch
»’nen Scheiß muss ich!«
Ehrlich währt am längsten
Der Unternehmer in der Jogginghose
Tun Sie sich keinen Zwang an
Takeaway: Der Weg zur Authentizität
6. Handeln Sie mutig und konsequent
Der Worst-Case-Check
Der Realitätscheck
Das Unmögliche möglich machen
Takeaway: Der Weg zu mutigem und konsequentem Handeln
7. Motivieren Sie sich selbst
Das Zauberwort Selbstmotivation
Die Zielcollage
Ein Parkplatz vom Universum?
Takeaway: Der Weg zu wirksamer Selbstmotivation
8. Entscheiden Sie schnell und hören Sie auf Ihren ersten Impuls
Das Drei-Phasen-Modell
Vorausschauender Wandel
Die Entscheidungs-Diät
Die Ein-Minuten-Entscheidung
Die zeitversetzte Entscheidung
Takeaway: Der Weg zur effizienten Entscheidung
9. Seien Sie dankbar
Die Negativspirale
Die magischen fünf Dinge
Das Glückstagebuch
Takeaway: Der Weg zu einer positiven Sicht auf das eigene Leben
10. Finden Sie Ihren inneren Frieden
Die innere Kamera
Das innere Ventil
Takeaway: Der Weg zu mehr innerer Ausgeglichenheit
Erfolgreich in allen Lebensbereichen
Die bk family
Führungskräfte und Mitarbeiter der Zukunft
Handwerk hat goldenen Boden!
Ein »spiritueller Unternehmer«?
Die gute Tat
Ich habe einen Traum
Ein Blick in die Zukunft
Das Metaversum
Chancen für den stationären Handel
Mobilität und Logistik
Unternehmen und Industrie 4.0
Friede auf Erden durch Digitalisierung?
Dank
Zum Weiterlesen
Bildnachweis
Anmerkungen
Bildteil
Prolog
Edle, chromblitzende Besprechungsstühle.Eine meterlange Tischplatte aus amerikanischem Nussbaum, glänzend poliert und kalt wie eine Kunsteisbahn am frühen Morgen. Hartes Licht aus teuren Designerleuchten, das jede Unreinheit und jede Unebenheit im Gesicht gnadenlos ausleuchtet. Gemütlichkeit fühlt sich anders an. Aber um Gemütlichkeit soll es heute auch nicht gehen, sondern ums Geschäft – und um Umsatz. Viel Umsatz mit gutem Gewinn.
An der einen Seite des Tisches sitzen drei Männer mit »bk«-Badges an ihren Anzugrevers: zwei leitende Mitarbeiter der bk Group aus dem beschaulichen Endsee in Franken und ich, Gründer und CEO dieser Firma, die auf den schlüsselfertigen Ladenbau sowie den Innenausbau von Hotels, Restaurants, Autohäusern und Shoppingcentern spezialisiert ist.
Auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls drei Männer, die hier zu Hause sind, auch sie tragen Anzüge. Es ist Januar 2013, wir befinden uns im großen Besprechungsraum des Europa-Headquarters eines weltbekannten amerikanischen Retailers aus der Unterhaltungsbranche. Ein Spezialistenteam der bk Group hat für diesen Auftraggeber gerade drei hypermoderne Stores mit allen Finessen gebaut, die die hochpreisigen Produkte der Edelmarke angemessen in Szene setzen. Der Kunde ist so zufrieden mit den neuen Läden, dass er noch in diesem Jahr fünfzehn weitere bei uns in Auftrag geben will.
Verlockende Aussichten also auf einen prächtigen Umsatz, den wir gut gebrauchen können. Wenn die Sache nicht einen entscheidenden Haken hätte, über den ich mich maßlos ärgere. Und das heißt etwas, denn ich ärgere mich selten richtig.
»Herr Wolfarth, sind Sie interessiert an diesem Auftrag?«, höre ich gerade die Stimme des Leiters der Abteilung »Ladenbau International«. Ein schlanker, fast zwei Meter großer Mann mittleren Alters mit dunklem, zurückgekämmtem Haar. »Und wenn ja, wie sieht es mit den Terminen aus?«
Ich drücke mein Kreuz durch und hole tief Luft. Mein verantwortlicher Projektleiter, der rechts neben mir sitzt, wird mich steinigen. Er hat unglaublich viel Energie in die Realisierung der drei ersten Stores investiert.
»Wir bauen gern weitere Stores für Sie. Unter einer Voraussetzung ...« Ich mache eine Kunstpause und nehme aus dem Augenwinkel wahr, wie mich mein Kollege zur Linken, unser Abteilungsleiter für den Bereich Ladenbau, erstaunt ansieht: »Die Bedingung ist, dass Sie und Ihre Leute meine Mitarbeiter künftig als gleichberechtigte Partner behandeln. Fair und mit Respekt. Sie sind weder Ihre Laufburschen noch Ihre Fußabtreter. Andernfalls können wir nicht noch einmal für Sie tätig werden.«
Neben mir höre ich, wie unser Projektleiter scharf einatmet. Und noch während ich spreche, kann ich sehen, wie das Gesicht meines Gegenübers rot anläuft und seine Schläfenadern anschwellen.
»So etwas habe ich ja noch nie erlebt!«, schreit er ohne Vorwarnung, als ich mein Statement beendet habe, und springt so unvermittelt auf, dass sein Besprechungsstuhl nach hinten kippt. »Ist das Ihr Ernst? Sie wollen mir vorschreiben, wie wir Ihre Mitarbeiter zu behandeln haben?«, fragt er in den Lärm, den sein umfallender Stuhl macht.
»Ja, genau das.«
»Vergessen Sie’s. Wenn Sie mit uns zusammenarbeiten wollen, dann zu unseren Bedingungen! Sie können sich glücklich schätzen, wenn Sie für eine so renommierte Marke wie unsere tätig werden dürfen! Ihr Projektteam wird genau so behandelt wie bisher.«
Jetzt hält es auch mich nicht mehr auf dem Stuhl. Und wenn ich wütend werde, kann auch ich nachdrücklich werden. »Es tut mir leid, aber unter diesen Umständen haben wir kein Interesse an einer Realisierung Ihrer fünfzehn Stores!« Mir ist bewusst, dass sich gerade einige Millionen Umsatz in Luft aufgelöst haben, aber das ist mir egal. Hier geht es um eines der Grundprinzipien der bk Group und um meine Unternehmens- und Unternehmerphilosophie. Die würde ich niemals verkaufen, nur um unserer Referenzliste einen weiteren berühmten Namen hinzufügen zu können.
»Die Mitarbeiter des bk-Projektteams sind hart im Nehmen«, setze ich nach. »Die Zufriedenheit des Kunden und die Qualität der Arbeit stehen für uns alle immer an erster Stelle. Aber in der Zusammenarbeit mit Ihren Leuten wurde eine Grenze überschritten. Meine Mitarbeiter fühlten sich schlecht behandelt, der Umgangston war rau und von oben herab. Das ging, wie mir meine Leute berichtet haben, so weit, dass man ihnen vorgeschrieben hat, wann sie sich nebenan bei Starbucks einen Kaffee holen durften. Wir leben im 21. Jahrhundert, nicht im Zeitalter der Sklaverei! Unter Partnerschaftlichkeit und Fairness verstehe ich jedenfalls etwas anderes!«
Die Gesichtsfarbe meines Gegenübers wechselt während meiner Rede noch einmal, jetzt nähert sie sich einem ungesunden Rotblau. Als ich fertig bin, schreit er etwas von »Unverschämtheit« und »noch nie erlebt« und verlässt unter Türenknallen den Raum.
Etwas ratlos sehen meine Kollegen und ich uns an und warten ab. Nach einer Viertelstunde kommt unser cholerischer Gesprächspartner zurück, jetzt ist er fast blass.
»Haben Sie Ihre Entscheidung noch mal überdacht?«, will er wissen und sieht mich erwartungsvoll an. »Wir können immer noch handelseinig werden, wenn Sie Ihre Forderung zurückziehen. Ich wäre sehr daran interessiert, dass Sie unsere Läden bauen.«
»Ja«, entgegne ich, während ich in aller Ruhe die vor mir liegenden Unterlagen zusammenräume und in meiner Aktenmappe verstaue, »wir haben uns entschieden. Wir werden unter diesen Umständen nicht für Sie arbeiten. Auf Wiedersehen.« Während sich im Gesicht unseres soeben verlorenen Kunden Fassungslosigkeit ausbreitet, verlassen wir das Gebäude.
Ich werde diese Szene wohl nie vergessen. Als wir kurz darauf im Taxi saßen und zum Flughafen fuhren, fragte mich mein Projektleiter, wie es jetzt weitergehen solle. Er hatte von einem Moment auf den anderen keine Arbeit mehr und machte sich sichtlich Sorgen. »Das ist ganz schön viel Umsatz, der uns da gerade flöten gegangen ist. Wie stopfen wir dieses Loch jetzt?«
»Ganz einfach«, erwiderte ich. »Wir haben heute den Weg für Kunden frei gemacht, die besser zu uns passen. Und solche Kunden werden sich bald einfinden, das spüre ich. Macht euch keinen Kopf.«
Und tatsächlich: Bereits eine Woche später rief mich der Leiter der Bauabteilung eines führenden europäischen Hörgeräte-Akustik-Unternehmens an, mit dem wir noch nicht gearbeitet hatten. Er erkundigte sich, ob wir gut zwanzig Stores für ihn realisieren können, im aktuellen Kalenderjahr? Das Ende vom Lied: Er wurde unser Kunde und ist es bis heute – wie viele andere, mit denen ich mittlerweile seit gut zwanzig Jahren einen gemeinsamen und sehr erfolgreichen Weg gegangen bin.
Aus den jahrzehntelangen Erfahrungen mit den unterschiedlichsten Kunden und Menschen kann ich heute jedenfalls eines mit Überzeugung sagen: Nicht Druck führt zum Erfolg, denn Druck erzeugt immer nur Gegendruck. Wesentlich erfolgreicher ist mein Weg der Partnerschaft, der gegenseitigen Achtung und der Wertschätzung.
Mein Leben als der Unternehmer, der ich heute bin, begann im März 2006, sechs Jahre nachdem ich die spätere baukreativ AG gegründet hatte. Ein lauter Knall begleitete diesen Moment: Ein dicker Leitz-Ordner landete auf dem sorgsam gepflegten, hochpreisigen Holzfußboden im Besprechungszimmer meiner Hausbank. Papier, Papier, Papier, sicherlich dreieinhalb Kilo schwer. Zahlen und Fakten über eine prosperierende, auf schlüsselfertigen Ladenbau spezialisierte Firma, jedes Thema säuberlich durch Trennstreifen eingefasst. Das Abbild eines aufstrebenden Unternehmens und seines Gründers, ein Werdegang, der erst vor Kurzem im Hochglanz-Kundenmagazin der Bank als wegweisend dargestellt worden war! Die Erfolgsgeschichte eines Vorzeigeunternehmens in unserer Region lautete die Überschrift.
Mit diesem Knall, der mir noch heute in den Ohren klingt, drohte meine Erfolgsstory abrupt zu Ende zu gehen. Mit einer einzigen Armbewegung beförderte der Leiter der Kreditabteilung den Ordner auf den Boden, schaute mich dabei nicht einmal an und sagte ohne jede erkennbare Emotion: »Wissen Sie, Herr Wolfarth, all das, was wir jetzt hier haben, ist von nun an Geschichte. Das war’s.«
Mir war das passiert, was Unternehmen leicht passieren kann, wenn sie erfolgreich sind und mit hohem Tempo wachsen: Wir hatten Außenstände und Schulden und brauchten kurzfristig einen Überbrückungskredit, um durch diesen Liquiditätsengpass hindurchzukommen und Verbindlichkeiten begleichen zu können. Was macht man da? Man macht einen Termin bei seiner Hausbank.
Du gehst also zur Bank, sagst: »Passt auf, Leute, ich brauche zweihunderttausend Euro, wir müssen kurzfristig da durchkommen«, und erhältst die Antwort: »Nein, das Risiko ist uns zu groß. Sie bekommen das Geld nicht, außerdem sehen wir uns gezwungen, Ihnen den Kontokorrentkredit von sechshunderttausend Euro zu streichen, den Sie momentan bei uns haben.« Und du denkst: Falscher Film, ich will hier raus.
Aber niemand hält den Film an. Das bekam auch ich deutlich zu spüren. »Sie wissen schon, was das bedeutet?«, fragte ich nach einer Weile und versuchte mir den Schock nicht anmerken zu lassen. »Dann kann ich morgen meine Firma schließen!«
»Das tut uns leid, aber wir können nichts für Sie tun.«
Sechs Jahre. Und das sollte es gewesen sein? Ich konnte es nicht glauben. Seit ich meine Firma gegründet hatte, war sie stetig um jährlich über hundert Prozent gewachsen. Was als One-Man-Show in meinem Privatwohnhaus begonnen hatte, stand inzwischen prächtig da: fünfundvierzig Mitarbeiter, über sieben Millionen Euro Umsatz im vergangenen Jahr – Tendenz steigend – und ein eigener, neu erbauter Firmensitz in Endsee bei Rothenburg ob der Tauber, Adresse: Baukreativ-Straße 1. Alles paletti, sollte man meinen. Wenn da nicht dieser »kleine« finanzielle Engpass gewesen wäre, mit dem mich unsere Bank kalt stehen ließ.
Wie es der Zufall wollte – den es meiner Meinung nach übrigens gar nicht gibt –, war kurz zuvor der CEO eines großen Ladenbauunternehmens auf mich zugekommen und hatte vorgeschlagen, meine Firma zu übernehmen. Auf meinem Schreibtisch lag deshalb ein Angebot in Höhe von mehreren Millionen Euro. Mit einem Schlag wären meine finanziellen Probleme gelöst gewesen. Das hätte aber auch bedeutet, noch mindestens fünf Jahre als Angestellter in dem Unternehmen bleiben zu müssen. Eine Perspektive, die ich nicht besonders reizvoll fand.
Ich tat, was vermutlich auch Sie tun würden, wenn Sie vor einer Lebensentscheidung stehen: Ich wog die verschiedenen Optionen ab und beriet mich mit meiner Frau. Schließlich sollte sie mit entscheiden, es ging um nichts Geringeres als um unsere gemeinsame Zukunft und die unseres Kindes.
Wir entschieden uns, das Kaufangebot abzulehnen und die Sache selbst durchzuziehen. Das hieß, ich würde mir auf anderem Weg das dringend benötigte Geld besorgen müssen.
Meine Frau und ich beschlossen, eine neue Bank zu suchen und ihr unser Privathaus, das wir nicht nur aus eigenen Mitteln, sondern auch mit eigenen Händen gebaut hatten und das schuldenfrei war, zu verpfänden. Und es gelang. Zum nächsten Banktermin erschienen wir mit einem bis ins Detail ausgearbeiteten Business-Plan: Wir hatten alles Geld zusammengekratzt und brachten 285.000 Euro Eigenkapital in die Firma ein. Auf den bisherigen Kontokorrentkredit konnten wir sogar verzichten, denn nur drei Tage nach dem ersten Bankgespräch hatte ich einen nicht unwesentlichen Anruf erhalten: »Herr Wolfarth, ich habe ein Problem«, eröffnete am anderen Ende der Leitung einer meiner Kunden aus dem Luxussegment das Gespräch. O je, dachte ich bei mir, wenn ein Telefonat schon so losgeht, und das in unserer momentanen Situation – gefühlt führte ich damals fast nur noch solche Es-gibt-ein-Problem-Telefonate. Aber natürlich versuchte ich mir nichts anmerken zu lassen und locker zu klingen.
»Was haben Sie denn für ein Problem, das wir gern für Sie lösen?«
»Wir werden in Düsseldorf auf der Königsallee eine Filiale eröffnen«, erwiderte er. »Das Ladenlokal haben wir bereits gemietet, und wir möchten gern, dass Sie es für uns umbauen. Das Opening soll im August sein.«
»Ah, schön! Aber wo liegt dann Ihr Problem?«
»Das Problem liegt im Datum des Mietvertrags. Unser Geschäftsjahr beginnt am 1. Mai, aber der Vertrag für den Laden läuft erst ab dem 1. Juni. Früher kommen wir nicht dran, früher können Sie also auch nicht mit dem Umbau beginnen. Aber wir haben jetzt das Geld und müssen es, damit es noch ins alte Geschäftsjahr fällt, jetzt für den Umbau ausgeben.«
»Verstanden. Und was ist konkret Ihre Idee?«
»Konkret wäre meine Idee: Könnte ich Ihnen auf Basis einer Anzahlungsrechnung fünfhunderttausend Euro überweisen, Sie bauen die Filiale und schreiben mir dann nach Fertigstellung eine Schlussrechnung?«
Ich konnte es kaum glauben, aber er meinte es ernst. Im Hinterkopf dachte ich – leise, damit das Universum es nicht hörte –: »Hoffentlich will er von mir keine Bankbürgschaft als Absicherung für sein Geld.« Denn die hätte ich zu diesem Zeitpunkt niemals bekommen.
Im selben Augenblick sagte er, als hätte er meine Gedanken gelesen: »Herr Wolfarth, wir kennen uns jetzt so lange, ich vertraue Ihnen, dass das alles ordentlich läuft.«
Was für ein Wahnsinn! Eine halbe Million auf dem Silbertablett – und ohne weitere Sicherheitsforderungen! Trotzdem zwang ich mich, nicht sofort zuzugreifen, sondern mir etwas Zeit zu verschaffen und eine Nacht darüber zu schlafen. Denn eines war mir klar: Wenn ich jetzt Ja sagte und die fünfhunderttausend Euro nahm, musste die Sache laufen, egal wie. Ich würde mit dem Geld des Kunden arbeiten, und wenn ich das in den Sand setzte, zöge ich unausweichlich auch den Kunden in die Sache rein und würde sein Vertrauen missbrauchen. Dann wäre ich nicht nur als Unternehmer geliefert, sondern moralisch auch vor mir selbst. Ich bräuchte mich nirgends mehr blicken lassen.
»Ich prüfe, ob wir das so machen können, und melde mich dazu morgen früh bei Ihnen«, beschied ich dem Kunden und legte auf.
Es wurde eine schlaflose Nacht. Niemand konnte mir helfen, nicht einmal meine Frau. Am nächsten Morgen hatte ich meine Entscheidung getroffen. Ich rief den Kunden, der nach wie vor zu seinem Vorschlag stand, an und sagte ihm zu. Wir wurden handelseinig.
Zwei Tage später war die halbe Million auf dem Firmenkonto. Wie durch ein Wunder hatte ich also die Barmittel auf dem Konto, die ich brauchte, damit die Firma weiterarbeiten konnte. Heute, dreizehn Jahre später, stehen wir besser da als je zuvor, und wir wachsen stetig. Zufall also? Vorsehung? Geschick? – Ich denke, das Universum wollte, dass meine Firma weiter existiert. Das ist mein Weg, mein spezieller Glaube: Vertraue und sei stets zuversichtlich.
Ich wäre jedoch kein seriöser Unternehmer, wenn ich mich bei wichtigen Entscheidungen nur auf die Hilfe des Universums verlassen würde – mag sein, dass manche Management- oder Motivationsgurus gutes Geld verdienen, wenn sie diese Strategie vertreten. Nein, ich treffe meine Entscheidungen aufgrund bestimmter Kriterien, von denen ich aus Erfahrung sagen kann, dass sie funktionieren und belastbare Ergebnisse erzielen. Dennoch kann man nicht alles mit dem Verstand steuern, auch ein Unternehmen nicht. Herz gehört dazu, Intuition, Wertschätzung und vor allem: Liebe. Liebe zu den Menschen, zur Welt um dich herum. Liebe ist der zentrale Mittelpunkt meines Denkens und Handelns und der erste Schlüssel für meinen Erfolg!
Meine Entscheidungskriterien und Führungsmethoden sind unkonventionell und stehen in keinem Lehrbuch, aber dass sie funktionieren, ist bewiesen – durch mich und den ständig wachsenden Erfolg meines Unternehmens. Ich gehe meinen Weg und bin damit nicht nur erfolgreich, sondern habe ein erfülltes Leben.
Als ich damit begann, dieses Buch zu schreiben, haben mich viele gefragt, warum ich das tue? Es gibt ja tatsächlich viele andere Dinge, mit denen ich mich mindestens genauso gern beschäftige. Sport steht dabei ganz weit oben. Ich habe unter anderem dreimal den »Ironman Europe« in Roth bei Nürnberg mitgemacht – diesen Langdistanz-Triathlon, der heute »Challenge Roth« heißt und jeden Teilnehmer mit seinen 3,8 Kilometern Schwimmen, 180 Kilometern Radfahren und 42,2 Kilometern Marathon-Lauf an seine persönlichen Grenzen führt. Und ich habe nicht nur teilgenommen, sondern bin jedes Mal auch ins Ziel gekommen.
Warum also schreibe ich? Warum trainiere ich nicht lieber für den nächsten Triathlon, warum stelle ich mich nicht lieber an die Tauber und angle Forellen? Warum verschiebe ich die Reise mit meiner Frau nach Neuseeland, warum gehe ich nicht mit meinem Sohn Radfahren oder streife mit meiner Tochter durch die Stadt?
Weil ich glaube, dass ich mit der Weitergabe meiner Erfahrungen etwas Gutes bei den Lesern dieses Buches bewirken und damit unsere Welt ein klein wenig liebenswerter, vor allem aber friedlicher machen kann. Denn meine Management- und Führungsgrundsätze beruhen auf gegenseitiger Achtung, auf Respekt und Ethik, nicht auf Gewinnmaximierung. Gewinn ist bestenfalls das erfreuliche Nebenprodukt.
Die Botschaft, die ich Ihnen in diesem Buch vermitteln möchte, lautet klipp und klar: Du kannst alles erreichen, egal, von wo du startest, egal, wie dein Umfeld ist, was deine finanziellen Möglichkeiten sind und was dir mitgegeben wurde. Ich bin der lebende Beweis dafür, best practice sozusagen. Wir befinden uns mittlerweile im zwanzigsten Jahr nach dem Start meiner One-Man-Show Gerold Wolfarth, und heute bin ich CEO einer europaweit tätigen Firma mit über zweihundert Mitarbeitern aus dreiunddreißig Nationen, die in ihrem Segment Marktführer ist. So etwas geschieht nicht von selbst. Hinter einer solchen Erfolgsgeschichte stehen Fleiß, Mut, Konsequenz, vor allem aber motivierte, tatkräftige und liebevolle Menschen, die gemeinsam am Erfolg arbeiten und an ihn glauben.
Vielleicht fragen Sie sich jetzt: Erfolgsgeschichten von Unternehmern gibt es doch wie Sand am Meer, warum also noch eine weitere schreiben? Und überhaupt: Wer zum Donner ist Gerold Wolfarth?
Wer ich bin, erfahren Sie direkt im Anschluss, im ersten Kapitel. Und ja, Sie haben recht, Unternehmergeschichten gibt es wie Sand am Meer. Mich persönlich faszinieren Menschen wie Steve Jobs, Ingvar Kamprad, Elon Musk, Larry Page oder Bill Gates. Ich bewundere ihre Energie, ihre Visionen und ihre Kreativität, ihre Biografien habe ich verschlungen. Dennoch ist mein Weg ein völlig anderer.
Mein Weg der Unternehmensführung stellt den Menschen in den Mittelpunkt des unternehmerischen Handelns – und zwar mit aller Konsequenz, nicht nur auf dem Papier und auf Werbebroschüren, sondern in der täglichen gemeinsamen Arbeit. Mir geht es dabei nicht nur um unsere Mitarbeiter, so selbstlos bin ich nicht. Es geht mir ebenso um mich und insbesondere um meine Frau und meine beiden Kinder. Denn ich bin nicht nur geschäftlich, sondern in allen sechs Lebensbereichen – Beruf, Familie, Finanzen, Gesundheit, Freizeit und Freunde – erfolgreich und glücklich unterwegs. Das klingt schön, ist bei genauerem Hinschauen aber durchaus ambitioniert. Denn der Normalfall ist, dass einer oder mehrere Lebensbereiche leiden, wenn man in einem besonders erfolgreich ist. Sie kennen es wahrscheinlich von sich selbst: Wenn Sie im Beruf Vollgas geben, fehlt Ihnen meist die Zeit für solche elementaren Dinge wie Familie, Freunde, Gesundheit oder Sport.
Ich kann heute mit Sicherheit sagen, dass es mir dank meiner Methoden gelungen ist, dieses Ungleichgewicht auszubalancieren und in allen sechs Lebensbereichen ausgeglichen und zufrieden zu sein. Wie das möglich ist, davon handelt dieses Buch.
Erlauben Sie mir, bevor es losgeht, noch eine Bemerkung zum wichtigen Thema »gendergerechte Sprache«: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichte ich manchmal auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten jedoch immer gleichermaßen für das weibliche und das männliche Geschlecht.
Nun wünsche ich Ihnen viel Freude und Spaß beim Lesen. Und ich würde mich freuen, wenn auch Sie von meinen Methoden profitieren können – beruflich und privat.
Endsee, im Mai 2019
Gerold Wolfarth
Gewissheiten
Ich habe durch den Ironman für mein Leben Dinge gelernt, die ich auf keinem anderen Weg hätte lernen und erreichen können. Im Ironman steckt für mich alles, was für Erfolg und für ein erfülltes Leben wichtig ist. Er bringt alle elementaren Dinge auf den Punkt und vereint sie.
Laufkilometer 22 beim »Ironman Europe« in Roth, 1992. 3,8 Kilometer Schwimmen im Rhein-Main-Donau-Kanal und 180 Kilometer auf dem Rennrad liegen bereits hinter mir. Jetzt gilt es, zum Abschluss die zweite Hälfte des Marathons und damit die restlichen 20 Kilometer noch zu schaffen. Die Marathonstrecke führt am Rhein-Main-Donau-Kanal entlang und ist deshalb zum Glück topfeben.
Es regnet, meine weiß-roten Laufschuhe sind vollkommen durchweicht und hängen schwer wie nie an meinen Füßen. Mein Blick ist starr nach schräg unten auf die Straße gerichtet. Der Asphalt glänzt nass, das Wasser spritzt bei jedem Schritt auf.
Mein Blick wandert weiter, zu meinen Füßen. Sie bewegen sich, sie machen einen Schritt nach dem anderen, aber ich weiß nicht, warum sie sich bewegen. Es ist, als gehörten sie gar nicht mir. Aber wer steuert sie, wenn nicht ich? Mein Kopf ist es auf keinen Fall, der ist leer. Nicht einmal die Leere ist noch da. Der Körper macht es auch nicht, da ist ebenfalls nichts mehr. Es ist verrückt, crazy, fast fühlt es sich an, als sei ich nicht mehr in meinem eigenen Körper und als würde etwas anderes meine Füße bewegen.
Wenn man beim Sport an seine Grenzen geht – und beim Ironman geht man definitiv an seine Grenzen –, dann ist man in einer Art Tunnel, einem eigenen Universum unterwegs. Der Körper ist am Ende seiner Kräfte, und trotzdem hat man noch zwanzig Kilometer bis zum Ziel vor sich. Offenbar setzt in dieser Phase eine Art Schutzmechanismus ein, der Körper schaltet in einen Energiesparmodus. Alle Kraft, die noch da ist, konzentriert sich nur noch auf dieses eine Ziel: ankommen. Man ist vollkommen bei sich. Es fühlt sich weder gut noch schlecht an, denn für solche Einschätzungen ist kein Raum mehr. Alle Energieverbraucher, die nicht überlebensnotwendig sind, sind abgeschaltet. Gedanken und Emotionen fallen offenbar unter diese Kategorie. Es ist wie bei einem Elektroauto, dessen Akku fast leer ist: Es schaltet alle unnötigen Verbraucher ab, die gesamte Technik richtet sich nur noch darauf aus, dass das Auto die Ladestation erreicht. Die Zusatzbildschirme gehen aus, alles geht aus, man kann nur noch wenig Gas geben.
Der Körper macht es unter starker Belastung offenbar ähnlich: Alles wird zurückgefahren, um das eine Ziel zu erreichen. Das führt schließlich dazu, dass die Füße zwar laufen, man aber den Eindruck hat, dass das Gehirn keinen Impuls mehr dafür gibt.
Dasselbe Gefühl hatte ich später noch einmal während einer Radtour in Schweden, die ich gemeinsam mit meinem Mitarbeiter Dominik unternahm. Nach 180 Kilometern bei elf Grad und Dauerregen erreichten wir endlich unser Ziel, eine kleine Stadt, in der wir übernachten wollten.
Doch unsere Erleichterung, dass wir endlich angekommen waren, wich rasch der Ernüchterung: Es stellte sich heraus, dass es in diesem Ort keinerlei Übernachtungsmöglichkeit gab. Es war nicht einmal so, dass die Unterkünfte voll gewesen wären, es gab einfach keine!
»Ich versuche, jemanden zu erreichen, der sich hier auskennt«, meinte Dominik. »Irgendwo müssen wir doch unterkommen!« Und er begann hektisch, aber leider erfolglos herumzutelefonieren, während uns das Wasser aus den Radschuhen lief.
»Hör auf, lass es sein, wir müssen weiter!«, sagte ich schließlich, als er frustriert das Handy sinken ließ. »Wir sind klitschnass und kühlen total aus. Lass uns in die nächste Stadt fahren, das sind noch achtzehn Kilometer, dort muss es doch etwas geben!«
Dominik stimmte zu, und wir schwangen wir uns wieder auf die Räder. Wer viel Fahrrad fährt, weiß, dass man nicht mehr warm wird, wenn die Radklamotten einmal nass geworden sind, sie wirken dann wie ein kalter Wickel.
Nur achtzehn Kilometer, für trainierte Sportler wie uns eigentlich ein Klacks. Normalerweise brauche ich dafür eine gute halbe Stunde. Doch das hier war nicht normal. Mein Körper war mittlerweile so stark ausgekühlt, dass er auf dieser kurzen Strecke vollständig in den Sparmodus schaltete. Mein Blick war total fokussiert, ich schaute nicht mehr nach links und rechts, denn allein den Kopf zu bewegen hätte schon zu viel Energie verbraucht. Man kommt auch nicht auf die Idee, nach der Trinkflasche zu greifen, denn dafür müsste man ja eine Hand vom Lenker nehmen, und auch das braucht Energie. Energiesparmodus heißt, man macht nur noch das, was unbedingt notwendig ist. Man überlegt nur noch: Was muss sein, damit ich ans Ziel komme? Das Ganze geschieht quasi automatisch. Das Programm ist im Körper gespeichert und schaltet sich von selbst ein, wenn der Körper das für notwendig hält.
Diesen Überlebensmodus beschreiben Menschen, die in extremen Situationen waren, immer wieder. Die jungen thailändischen Fußballer, die zusammen mit ihrem Trainer im Sommer 2018 ganze zwei Wochen in einer Höhle eingeschlossen waren und nicht sicher sein konnten, dass sie gefunden und gerettet würden, haben vermutlich Ähnliches erlebt. Ich aber musste gar nicht in die Todeszone auf einen Berg oder in eine finstere, überflutete Höhle. Ich durfte beim Sport diesen Überlebensmodus auf angenehme Weise erleben, da ich meinen Körper freiwillig den Belastungen aussetzte, die ihn in diesen Zustand fallen ließen.
Das Gefühl zu wissen, es geht immer noch weiter, auch wenn schon alles auf Reserve läuft, ist unbeschreiblich. Es gibt große Sicherheit und Kraft.
Der Junge auf dem Traktor
»Archshofen? Den Namen habe ich noch nie gehört.« Kein Wunder. Archshofen, das Dorf, in dem ich geboren und aufgewachsen bin, hat gerade mal dreihundert Einwohner und liegt im Main-Tauber-Kreis in Baden-Württemberg, quasi auf der Grenzlinie zu Bayern. In der Holdermühle, einer Teilortschaft von Archshofen, verläuft die Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg sogar mitten durch den Kuhstall. Bei uns in Archshofen heißt es deshalb: »Die Kühe fressen in Baden-Württemberg, und ihre Fladen fallen auf Bayern.«
Das Dorf liegt direkt an der idyllischen Tauber, rechts und links erheben sich sanfte Hänge mit Obstbäumen, Feldern und Wiesen. Ein kleiner, versteckter Weg führt über ein paar Kurven zu meinem Lieblingsplatz, von dem aus ich meinen Heimatort und die Landschaft überblicken kann. Das Dorf unter mir sieht aus wie aus einem Märklin-Katalog: Hübsche, lang gestreckte Häuser mit dunkelroten Giebeln, manche mit Fachwerk, schmiegen sich in die Mulde rechts und links des Flusses. Viele davon waren früher Bauernhäuser, heute gibt es nur noch eine Handvoll Nebenerwerbslandwirte im Ort. Eines dieser ehemaligen Bauernhäuser ist das Haus meiner Familie. Hier kam ich zur Welt, als Sohn einfacher Bauern.
Meine Großeltern hatten in den 1920er-Jahren die Landwirtschaft daheim aufgebaut und arbeiteten hart, um sich und ihre beiden Töchter ernähren zu können. Die Jüngere, meine Mutter, blieb auf dem Hof, ihre Schwester zog, als sie erwachsen war, fort.
Als meine Mutter meinen Vater kennenlernte – er stammte aus Schäftersheim, ungefähr zwanzig Kilometer von Archshofen entfernt –, war er Landmaschinenschlosser und reparierte Traktoren, aber auch landwirtschaftliche Geräte wie Heuaufzüge, Sämaschinen, Pflüge und Mähmaschinen. Nach der Hochzeit zog mein Vater zu meiner Mutter und ihrer Familie nach Archshofen. Die beiden bekamen zwei Kinder – erst ein Mädchen, und zehn Jahre später, im Jahr 1970, mich. Damit die Familie von der Landwirtschaft leben konnte, musste der Hof vergrößert werden. Das hieß, dass die Großeltern zusätzliches Land pachteten. Trotzdem reichte es nicht, um alle satt zu bekommen. Der Eigenbesitz unseres Hofes umfasst sechs Hektar, schon damals war das eigentlich ein Witz: Zu der Zeit, als meine Eltern die Landwirtschaft übernahmen, gab es die Faustregel, dass man dreißig Hektar brauchte, um von einem Hof leben zu können. Heute liegt die Benchmark bei ungefähr hundertfünfzig Hektar.
Mein Vater wurde also Nebenerwerbslandwirt und arbeitete hauptberuflich bei einem Landmaschinenhändler, der Landmaschinen verkaufte und reparierte.
Wir hatten zu Hause fünf Kühe, alle paar Jahre auch Kälber, die wir verkauften, und ungefähr zehn Mastschweine, die, wenn sie groß genug waren, ebenfalls zum Schlachten verkauft wurden. Außerdem gab es fünfundzwanzig Hühner, fünfzehn Enten – unser Hof liegt direkt an der Tauber – und etliche Hasen. Und natürlich gab es Katzen. Später hatte ich sogar eine richtige Hasenzucht mit zwanzig bis fünfundzwanzig Tieren, mit denen ich an Ausstellungen des Kleintierzüchtervereins teilnahm. Etliche meiner Hasen wurden sogar prämiert, und ich bekam Pokale. Diejenigen, die sich nicht für die Zucht eigneten, landeten auf dem Mittagstisch.
Mein Vater und ich schlachteten die Hühner und die Hasen gemeinsam: Kopf ab, Federn raus, Bauch auf, Fell abziehen, das volle Programm. Ich bin nie gefragt worden, ob ich das machen wollte oder nicht, ich hatte gar keine Wahl. Es war schlicht so. Vielleicht bin ich dadurch heute Vegetarier geworden?
Auch wenn wir ein Schwein schlachteten, musste ich mit ran. Das erste Mal, an das ich mich bewusst erinnere, geschah 1976, ich war sechs Jahre alt. Erst setzt man dem Schwein das Bolzenschussgerät an den Schädel und drückt ab. Anschließend wird es angestochen, damit es ausblutet und das Blut nicht im Körper gerinnt, denn man braucht es später für die Blutwurst. Das Blut wird in einen Topf gefüllt, und man muss es ständig umrühren.
Also wurde die Sau vor meinen Augen mit dem Bolzenschussgerät erschossen, angeschnitten, das Blut schoss heraus, dann stellte mir jemand den Topf hin, und ich musste das Blut rühren. Ich konnte kaum über den Bottichrand schauen, aber auch da hat mich keiner gefragt. Es hat mich nicht weiter geschockt, denn so haben wir gelebt. Dass ein Kind mit fünf oder sechs Jahren in der Landwirtschaft mitarbeitete und das machte, was es konnte, war selbstverständlich. So war es eingebunden und beschäftigt, und niemand musste es beaufsichtigen. Als Kind gehörte es zum Beispiel zu meinen Aufgaben, Heu für die Kühe aus der Scheune nach unten zu werfen. Außerdem musste ich auf dem Traktor mitfahren, um Gras zu holen, oder bei der Ernte von Kartoffeln oder Rüben mithelfen.
Als ich elf war, änderte sich mein Leben abrupt: Mein Vater erkrankte mit neunundvierzig Jahren schwer an einer sehr seltenen Art von Leukämie und musste sich langwierigen Behandlungen im Krankenhaus unterziehen. In der Folge musste ich »richtig« ran und den Mann auf dem Hof ersetzen. Meine zehn Jahre ältere Schwester lebte zu der Zeit nicht mehr zu Hause, ich wuchs wie ein Einzelkind auf.
Die Ärzte meinten, mein Vater habe maximal noch ein Jahr zu leben. Eine Katastrophe für die ganze Familie. Händeringend suchten meine Eltern nach einem Arzt, der sich mit dieser Krankheit auskannte, und fanden schließlich einen Professor, der an der Uniklinik Freiburg praktizierte. Er hatte in Amerika zwei Patientinnen mit derselben seltenen Leukämie-Variante betreut und deshalb Erfahrung mit dieser speziellen Erkrankung.
Von nun an fuhr mein Vater regelmäßig zur Behandlung nach Freiburg, von Archshofen aus sind das vierhundert Kilometer. Doch die Therapie schien nicht anzuschlagen. Eines Freitagnachts, ich war dreizehn, ging das Telefon. Die Klinik war dran. Der Zustand meines Vaters sei so schlecht, dass meine Mutter schnellstmöglich kommen solle, wenn sie ihn noch einmal lebend sehen wollte.
Sofort klingelte meine Mutter die engste Familie aus dem Bett – meine Schwester und meine Tante, die Schwester meines Vaters –, und im Auto fuhren wir gemeinsam nach Freiburg, um uns von ihm zu verabschieden. Diesen Tag werde ich bis an mein Lebensende nicht vergessen.
Er lag auf einer Isolierstation, wir durften uns nur durch eine Glasscheibe mit ihm verständigen. Er war an mehrere Infusionen angeschlossen, kreidebleich und hatte mindestens zehn Kilo abgenommen.
»Mein Körper ist voll mit Rattengift«, meinte er und versuchte zu grinsen. Natürlich war es kein Rattengift, sondern die maximale Chemiekeule, die man in ihn hineingepumpt hatte. Die Strategie des Professors war: Entweder es hilft, oder es hilft nicht. Dementsprechend war mein Vater höchst infektionsgefährdet, weil sein Immunsystem vollkommen brachlag.
Dieser Tag am Krankenbett meines Vaters war für mich extrem prägend. Ich sah ihn hinter der Glasscheibe liegen und musste ununterbrochen daran denken, dass ich ihn gerade das letzte Mal sehe. Er hingegen schärfte uns ein, was in der Landwirtschaft alles zu passieren hatte, bis er wieder heimkäme: »Und verpachtet mir die Äcker auf der Höhe nicht, verkauft nicht unseren Anteil am Mähdrescher und erhaltet mir die saftigen Wiesen direkt an der Tauber!«
Mein Vater war sterbenskrank, aber er war ein Kämpfer. Sein Lebenswille war so stark, dass er die Prognose der Ärzte schlichtweg ignorierte. Er schien sich zu sagen: »Ich gebe nicht auf. Ich ziehe das Ding hier durch bis zum bitteren Ende.«
Er hat es geschafft. Eine Woche später waren wir wieder in Freiburg, um ihn zu besuchen, da hatte er das Schlimmste schon überstanden. Wir durften sogar zu ihm ans Bett. Der Professor kam aus dem Staunen kaum heraus. Er sagte, er habe selten einen Menschen mit einer solchen Kämpfernatur gesehen. Sein Organismus habe sich tagelang heftig gegen das Gift gewehrt, das durch seine Adern floss. Der ganze Körper habe sich in Krämpfen gewunden, sodass es ihn bis zu zwanzig Zentimeter im Bett angehoben habe! Stundenlang sei das so gegangen.
Mein Vater ist schließlich achtzig Jahre alt geworden, hat also die Prognose der Ärzte um einunddreißig Jahre überboten. Er musste allerdings seit der Erkrankung jeden Herbst für drei bis vier Monate nach Freiburg ins Krankenhaus, da er immer wieder unter Infekten litt. Sein Immunsystem war so schwach, dass sich ein harmloser Schnupfen sofort zu einer lebensbedrohlichen Lungenentzündung ausweiten konnte.
Immer, wenn mein Vater im Krankenhaus war und um sein Weiterleben kämpfte, musste ich gemeinsam mit meiner Mutter den Hof am Laufen halten, sie hätte die Arbeit allein nicht bewältigt. Niemand außer mir konnte ihr helfen, denn die Großeltern lebten nicht mehr, und meine Schwester wohnte im fünfunddreißig Kilometer entfernten Bad Mergentheim.