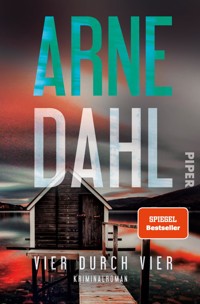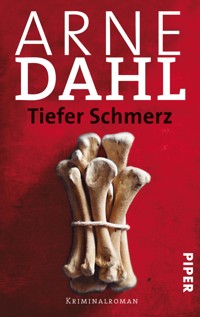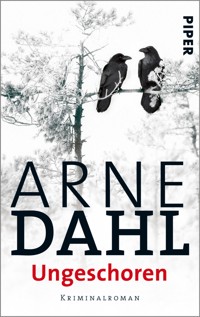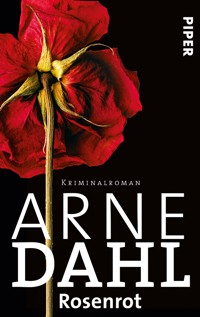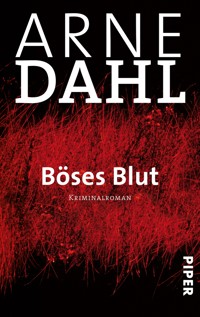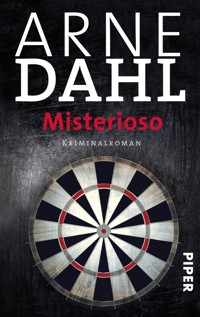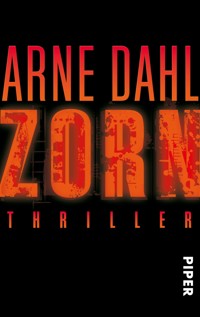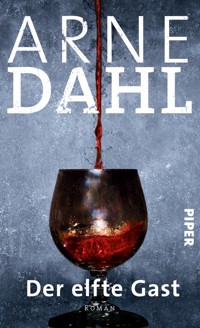9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Aus seinem Mund ergießt sich ein Schwall Blut. Es ist kaum zu verstehen, was der junge Chinese flüstert. Nur dass seine letzten Worte von entscheidender Bedeutung sind, ist den Polizisten instinktiv klar. Kurz darauf wird in einem Waldstück bei London eine weitere schrecklich zugerichtete Leiche gefunden – das geheime Europol-Team beginnt zu ermitteln. Was treibt die Drahtzieher der beiden Morde an? Europol tappt im Dunkeln. Nur eines wird den Ermittlern immer klarer: Die Dimension dieser Verbrechen lässt selbst den Erfahrensten unter ihnen den Atem stocken. Brisant, packend und so erschreckend realistisch, dass Sie die Nachrichten in Zukunft mit anderen Augen sehen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel »Viskleken« im Albert Bonniers Förlag, Stockholm.
Übersetzung aus dem Schwedischen von Antje Rieck-Blankenburg
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
2. Auflage 2012
ISBN 978-3-492-95517-1
© Arne Dahl 2011
Deutschsprachige Ausgabe:
© Piper Verlag GmbH 2012
Umschlaggestaltung: Hafen Werbeagentur
Datenkonvertierung E-Book: Kösel, Krugzell
1 – Einflüsterungen
Operation Glencoe
London, 2. April
Eigentlich kann es nicht noch kälter werden, denkt der Beobachter und zieht den Mantel eng um seinen Körper. Kälter als an den frostigen Tagen Anfang April kann es in London nicht werden.
Dieses Grau, denkt er und blickt die Themse hinunter in Richtung des Betonklotzes. Er heißt ExCeL, Exhibition Centre London, und in ihm wird in ebendiesem Moment der London Summit eröffnet, auf dem die Staatsoberhäupter der zwanzig reichsten Länder der Welt über die verheerende Finanzkrise diskutieren werden. Es ist das Gipfeltreffen der G20-Staaten.
Dieses unendlich feuchtkalte Grau. Und zu allem Übel noch dieses Warten. »Operation Glencoe«. Bei diesem Wort spürt er deutlich, dass ihn noch eine völlig andere Kälte erfasste. Ein Luftstrom, der nicht von außen zu kommen scheint, sondern aus der Tiefe der Geschichte.
Ausgehend von diesem Wort, über das er so lange nachgegrübelt hat.
Glencoe.
So hieß ein kleines Dorf in den schottischen Highlands, das an einem eisigen Februarmorgen im Jahr 1692 Schauplatz eines grausamen Massakers wurde. Wilhelm I. von Oranien hatte nach dem Sieg über die Katholiken unter König Jakob beschlossen, ein Exempel gegen Unruhestifter zu statuieren. Und so ließ er hundertzwanzig Mann in dem nichts ahnenden kleinen Glencoe einquartieren. Die Dorfbevölkerung nahm die Soldaten gastfreundlich auf.
In den frühen Morgenstunden des 13. Februar wurden achtunddreißig Männer in ihren Betten abgeschlachtet. Sämtliche Häuser wurden niedergebrannt, und vierzig Frauen und Kinder erfroren in der eisigen Kälte des winterlichen Tals. Es wären noch bedeutend mehr gewesen, wenn sich nicht einige Soldaten geweigert hätten, dem Befehl nachzukommen.
Warum zum Teufel benennt man den Sicherheitseinsatz bei einem Gipfeltreffen, das zum Ziel hat, die angeschlagene kapitalistische Wirtschaft zu retten, nach einem dreihundert Jahre zurückliegenden, außerordentlich heimtückischen Massaker in den Ausläufern der schottischen Highlands?
Der Beobachter von Europol, der europäischen Polizeibehörde, spürt, wie ihm der eisige Februarwind von damals durch Mark und Bein fährt. Es ist der Wind der Vorzeichen, der Wind des Vertrauensbruchs, der Wind des Verrats. Der Wind hinterlässt seine Spuren in ihm. Doch nun nimmt er seine Arbeit als Beobachter wieder auf. Vor ihm liegen die unendlichen Bürokomplexe der London Docklands. Von dem schottischen Tal ist nur der Name in Erinnerung geblieben.
Glencoe.
Und der Codename von Scotland Yard für den groß angelegten Polizeieinsatz in London während dieser Tage Anfang April lautet »Operation Glencoe«.
Der Beobachter von Europol agiert während dieser Tage allerdings nicht als Ermittler. Er soll nur wachsam sein.
Mir ist es in der Tat gelungen, die Gegenwart ziemlich intensiv in Augenschein zu nehmen, denkt er und zieht den Mantel noch etwas enger um seinen Körper. Vor allem aber hat er das gegenwärtige Geschehen rund um den Sicherheitsgipfel im Internet verfolgt. Vielleicht ist das Internet inzwischen ja die Gegenwart, überlegt der Beobachter. Mangels aktiverer Betätigungsfelder hat er die Protesteinträge gegen das Treffen und die überwältigende Zahl von Demonstrationsaufrufen durchforstet, die Aktivisten verschiedenster Gruppierungen, von Umweltorganisationen bis hin zu mehr oder weniger kampfbereiten antikapitalistischen Fraktionen, ins Netz gestellt hatten. Eine für ihn interessante Neuigkeit bestand in der Entdeckung, dass die Koordination der Aktionen über Twitter stattfinden sollte. Das bedeutete beispielsweise, dass man in der Lage war, choreografisch genau abgestimmte Protestzüge zu veranstalten wie den der sozialistischen Organisation »G-20 Meltdown« am »Financial Fool’s Day«. Am 1. April.
Das war gestern. Er ist dort gewesen, direkt gegenüber des gigantischen Palastes der Bank of England in der Threadneedle Street. Sie kamen aus vier verschiedenen Richtungen, vier wurmähnliche Züge in unterschiedlichen Farben, die sich durch die Stadt wanden, angeführt von vier mit Stoffkleidern ausstaffierten Holzpuppen, die vier Reiter der Apokalypse aus dem Buch der Offenbarung. Während sich die Reiter mit ihrem Gefolge näherten – das rote Kriegsross von oben aus der Moorgate, das grüne Ross des Klimawandels von der Liverpool Street Station, das silberne gegen finanzielle Verbrechen protestierend von der London Bridge her und das schwarze Pferd gegen geschlossene EU-Grenzen von der Cannon Street kommend –, konnte der Beobachter nicht umhin, an das geschlachtete Lamm aus dem Buch der Offenbarung zu denken, das ein Siegel nach dem anderen auf der heiligen Buchrolle bricht. Die ersten vier Siegel schicken die vier Reiter der Apokalypse los. Das fünfte offenbart die umherirrenden Seelen der Menschen, die für die Wahrheit ihr Leben ließen. Das sechste löst ein gewaltiges Erdbeben aus, »und die Sonne wurde schwarz wie ein Trauergewand, und der ganze Mond wurde wie Blut«. Und als sowohl das Lamm als auch der Beobachter das siebente Siegel erreichten, durch dessen Bruch die Apokalypse in ihre Schlussphase eintritt, waren alle vier Demonstrationszüge vor der Bank of England versammelt.
Aus diesem Grund waren sie schließlich hier. Denn die Finanzmärkte schienen gerade das siebte Siegel aufgebrochen zu haben. Aus purer Profitgier.
Der Beobachter ist ein verhältnismäßig erfahrener Polizist. Er meint, seine Pappenheimer zu kennen, zu wissen, wie sie denken und handeln. Und er ist der Meinung, dass die Entwicklung, die in den vergangenen Jahren vonstattengegangen ist, bei der die Finanzblase endlos aufgebläht wurde und schließlich explodierte, in auffällig hohem Maß an das Vorgehen eines Verbrechers erinnert. Gewinnmaximierung ohne jegliche Gedanken an die Konsequenzen. Aber wer ist eigentlich der Verbrecher? Und worin genau besteht dieses große und eigentümliche Verbrechen, in dessen Mitte wir unser Leben weiterleben?
Die vier Züge waren zu einem einzigen geworden und skandierten: »Build a bonfire, put the bankers on top.« Sie forderten die verschreckten Banker, die durch die Fenster der Zentralbank des Vereinigten Königreichs hinausschauten, lautstark auf, zu springen. Eine Stunde später waren die Demonstranten eingekesselt. Es dauerte sieben Stunden, dem Kessel wieder zu entschlüpfen. Der Beobachter benötigte immerhin fast eine Viertelstunde, um einem vor Adrenalin strotzenden Polizisten das Wort »Europol« begreiflich zu machen, bevor der ihn aus dem engen Kessel entweichen ließ. Danach pfiff er auf London, machte sich auf den Rückweg in sein mikroskopisch kleines Hotelzimmer und surfte weiter im Internet.
Während des »Financial Fool’s Day« fand eine Reihe weiterer Demonstrationen statt. Dreitausend Menschen waren unterwegs zum »Clima Camp in the City« in der Bishopsgate, und Hunderte Mitglieder der »Stop the War Coalition« marschierten von der amerikanischen Botschaft zum Trafalgar Square, wo sie sich mit anderen Demonstrationszügen vereinten. Insgesamt wurden viele Tausend Aktivisten eingekesselt.
Gegen Abend, als sein Magen ernsthaft zu knurren begann, kam dann auch die Meldung, dass ein Mann gestorben sei, ein unschuldiger Fußgänger wurde von der Polizei so stark misshandelt, dass er kurz darauf starb.
Je mehr er von dem Ganzen sah, desto erleichterter war er, lediglich Beobachter zu sein. Und in dem Moment, als ihn die Proteste seines Magens regelrecht dazu zwangen, sein Hotelzimmer zu verlassen, entdeckte er das Gerücht. In einer Twitter-Meldung, die wohl der Organisation »Stop the War Coalition« zuzuschreiben war, wurde jedenfalls behauptet, dass es sich um ein Gerücht handelte. Der Verfasser meinte, den Ort lokalisieren zu können, an dem ein gewisser »BO« aus seiner Limousine steigen und sich den Leuten stellen würde. Es wurde behauptet, die Information käme aus dem innersten Kreis.
Der Beobachter suchte fieberhaft weiter, um eine Bestätigung des Gerüchts zu erhalten oder es zumindest auf einer anderen Seite noch einmal zu entdecken. Doch es gelang ihm nicht. Es war nur ein einziges Mal herausgetwittert worden.
Dennoch steht er heute an der besagten Stelle, nicht weit von der Umzäunung entfernt, die den gesamten hässlichen Betonklotz an der Themse umgibt. Zahllose Demonstranten sind vor Ort, umringen ihn von allen Seiten. Er steht an der Straße, die, mit soliden Absperrungen gesichert, direkt zum ExCeL führt, dem Exhibition Centre. Mehrere Limousinen mit den Staatsoberhäuptern der zwanzig reichsten Nationen der Welt sind bereits vorbeigefahren. Obendrein werden handverlesene Gäste erwartet.
Sein Blick schweift zwischen der Straße und der Menschenmenge hin und her. Er beobachtet.
Die Mächtigen der Welt versammeln sich in dem hässlichen Betonklotz und werden versuchen, ein System zu bandagieren, das sich erneut selbst in den Fuß geschossen hat und wie ein fahrlässiges, psychopathisch veranlagtes Kind verbunden werden muss – ein System, von dem behauptet wird, dass es absolut notwendig für den Fortbestand der Menschheit sei. Aber dieses Mal ist nicht nur der Fuß verletzt, ein normaler staatlicher oder supranationaler Druckverband reicht nicht aus. Diesmal hat der Schuss obendrein das Bein getroffen, und ob die große Oberschenkelarterie unversehrt geblieben ist, ist noch unklar.
Eigentlich müssten die da drinnen die Existenzberechtigung dieses Wirtschaftssystems diskutieren. Aber sie diskutieren lediglich, wie viele Billionen aus Hilfs-, Ausbildungs-, Pflege-, Kultur- und Umweltfonds überführt und geradewegs in eine Bankenwelt gepumpt werden können, die auf diese Weise dafür belohnt wird, dass sie schlimmsten Raubbau betrieben hat. Nicht einmal die Bonifikationen der Chefs werden eingefroren.
Der Beobachter spürt, dass er für einen kurzen Moment seinen klaren neutralen Blick verliert. Wir leben wahrhaftig in einer merkwürdigen Zeit, denkt er jetzt. Genau in dem Augenblick, in dem die Weltwirtschaft kollabiert, kommt im größten Wirtschaftsimperium ein Politiker an die Macht, der das, was er sieht, keineswegs gutheißt. Der tatsächlich zu Veränderungen bereit zu sein scheint. Dem es gelingen könnte, eine Art Ideal mit dem Inferno der Realpolitik zu vereinen. Der dem Rest der Welt eine, wenn auch paradoxe, Hoffnung vermittelt.
Aber ist er wirklich der richtige Mann, um die Apokalypse zu verhindern? Ist er nicht nur eine Galionsfigur? Ein letztes machtloses Symbol unserer Träume. Wirkt er als mächtigster Mann der Welt nicht erstaunlich machtlos?
Der Beobachter steht auf der Straßenseite, wo sich die Menschenmenge nicht ganz so dicht drängt, ziemlich nahe am Straßenrand. Verschiedene Instanzen der »Operation Glencoe«, kurz gesagt viele Bullen, säumen die Straße, während eine weitere Limousine vorbeirauscht. Die türkische Flagge weht im Aprilwind. Premierminister Recep Tayyip Erdoğan. Der Beobachter mustert die Menschenmenge, während der Wagen passiert. Er nimmt wahr, wie sich der kollektive Zorn für einen Augenblick verstärkt. Wie Fäuste in die Luft gereckt werden, die aufgebrachten Rufe einen anderen, verzweifelteren Klang annehmen. Erdoğan hält nicht an. Bislang hat keiner angehalten.
Als die Limousine das ExCeL Exhibition Centre erreicht, sieht der Beobachter einen Schatten hinaus- und auf die geöffneten Wagentüren zutreten. Allem Anschein nach handelt es sich um Premierminister Gordon Brown. Der Gastgeber des G20-Treffens. Gestern Abend hat er zu einem Dinner in Downing Street Number 10 geladen. Brown ist ein untadeliger Gastgeber. Und vielleicht sogar ein Mann, dem es mit diesem Treffen ernst ist.
Eine weitere Limousine fährt vorbei. Diesmal weht die französische Flagge im Wind. Auch Präsident Nicolas Sarkozy hält nicht an, um die Menschen zu grüßen, deren Aggressivität erneut explodiert und in deren Gesichtern sich derartige Verzweiflung widerspiegelt.
Würde er es dennoch tun? Würde »BO« wirklich so dumm sein?
Wäre das tatsächlich Barack Obamas Stil?
Der Schwitzende steht unten an der Themse. Er schaut in das braune Wasser hinab und ahnt, dass er der Einzige in ganz London ist, der sich nach einem erfrischenden Bad sehnt. Er sieht einen ganz anderen Fluss vor sich, wunderbar kühl und erquickend. Damals war er das noch. Er sieht seine Freundin vor sich. Sie steigen gemeinsam hinunter in den Fluss, nackt. Das waren andere Zeiten.
Er nimmt sein Handy aus der Hosentasche. Betrachtet es. Das letzte Lebenszeichen. Dann lässt er es aus der Hand gleiten. Es versinkt rasch im braunen Wasser.
Ein letzter Augenblick des Innehaltens, denkt er und macht sich auf den Weg.
Er schiebt sich durch die Menschenmenge. Er weiß, dass es seine letzte und einzige Chance ist. Er wird ihn nur hier erreichen können. Nur hier.
Er ist immer noch weit von der Straße entfernt, steht tief im Inneren der Menge. Sie wogt. In ihr wogt der Wille nach Veränderung. Der Wille, die Welt mit klaren Augen zu sehen. Zu sehen, was tatsächlich mit ihr geschieht.
Es ist so eng, dass ihm heiß wird. Dabei ist es erst Anfang April, die Leute haben sich ordentlich eingepackt. Dennoch scheint keiner von ihnen zu schwitzen. Keiner außer ihm.
Der Schwitzende ist nicht gerade groß gewachsen, er kann kaum erkennen, was sich auf der Straße abspielt. Also muss er unbedingt noch näher heran. Er hastet vorwärts, aber die Menschenmenge scheint ihn zurückzudrängen, ihn geradezu zu erdrücken. Er spürt spitze Ellenbogen, den einen oder anderen Tritt, hört Beschimpfungen, die er nicht versteht. Aber er muss nach vorn. Er muss ganz nach vorn.
Schließlich steht er so zentral, dass er eine weitere Limousine vorbeifahren sehen kann – vorher hat er sie lediglich gehört. Sie fährt weiter, ohne anzuhalten. Ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, stehen zu bleiben. Er erkennt die Flagge wieder. Es ist ein groteskes Paradox. Die rot-gelbe Flagge. Im Wagen sitzt Hu Jintao, der Präsident. Aber jetzt kann er ihn nicht mehr sehen. Die Limousine hat die Absperrungen bereits passiert und befindet sich auf dem Weg hinunter zum ExCeL.
Der Schwitzende bebt innerlich. Er schiebt sich weiter voran. Er stößt mit einer Frau zusammen, die ebenso energisch vorwärtsstrebt wie er. Ihre Blicke begegnen sich für einen kurzen Moment. Hätte er es nicht eilig, würde er kurz innehalten. Irgendetwas an dem Blick der Frau kommt ihm bekannt vor. Er hat etwas Absolutes. Etwas Endgültiges. Es ist, als schaue er genau in dem Moment in die Augen eines Menschen, als der sein Leben aushaucht. Maximale Lebensenergie, gefolgt von der Ewigkeit des Todes, vereint in ein und demselben Blick.
Aber er hat keine Zeit. Sie auch nicht. Sie arbeitet sich weiter durch die Menge hindurch. Er ebenfalls, in seine Richtung. Der Schweiß brennt ihm inzwischen nicht mehr in den Augen, blendet ihn nicht mehr. Er ist jetzt fast an der Straße angekommen. Nur noch drei Reihen, aber das sind die standhaftesten, die mit den fanatischsten Aktivisten.
Weit in der Ferne sieht er, wie sich wieder eine Limousine nähert. Mit ungeahnter Deutlichkeit, als halte ihm jemand ein Fernglas vor die Augen, kann er die amerikanische Flagge ausmachen, die über dem Kotflügel des Wagens weht.
Sie spürt keinerlei Unbehagen mehr. Vermutlich hat sie es die ganze Zeit über nicht gespürt. Die Empfindungen, die sie hatte, als sie das Röhrchen einführte, entsprachen eher dem Gefühl, sich des Lebens zu erinnern, als einem realen Unbehagen.
Das Wichtigste war, dass sie ungehindert vorankam, und das kam sie, den ganzen Weg durch die Menschenmenge hindurch, bis sie geradewegs mit dem Chinesen zusammenstieß.
Chinese?, denkt sie und lächelt bitter. Vorurteile. Durch und durch.
Sie erinnert sich an seinen Blick. Wie es war, genau in dem Moment geradewegs in die Augen eines Menschen zu schauen, als der sein Leben aushaucht. Für den Bruchteil einer Sekunde fragt sie sich, was er hier wohl macht. Dann fokussiert sie den Blick wieder nach vorn. Schärft ihre Aufmerksamkeit aufs Äußerste. Wie sie es schon seit Langem tut. Blendet alles um sich herum aus. Alles, was ihr bisheriges Leben ausgemacht hat.
Inzwischen ist sie fast an der Straße angekommen. Sie hört den Wagen, noch bevor sie ihn erblickt. Ein diffuses Gefühl vermittelt ihr den Eindruck, dass sich dieses Motorengeräusch anders anhört. Lange bevor sie in der Ferne die amerikanische Flagge auf der Motorhaube der Limousine erkennt, weiß sie, dass er es ist.
Ihre einzige Chance.
Sie arbeitet sich bis zur Absperrung vor. Die skandierenden Aktivisten lassen sie jedoch nicht durch, sie brennen geradezu für etwas, das sie selbst noch nie empfunden hat. Wie ist sie eigentlich hier gelandet? Sie ist wahrhaftig keine von ihnen. Sie war noch nie Feuer und Flamme für irgendeine Sache und ist es nicht einmal jetzt. Aber ihre Entschlossenheit ist stärker als die der anderen. Sie wird es irgendwie schaffen, an ihnen vorbeizukommen. Sie scheinen zu merken, dass sie anders ist. Dass es für sie um so viel mehr geht.
Sie hängt genau in dem Moment mit dem Oberkörper über der Absperrung, als die Limousine in ungefähr fünfzig Meter Entfernung sichtbar wird. Ihr Winken kommt ihr so pathetisch vor. Sie kann nur darauf hoffen, dass er erkennt, wie andersartig es ist.
Hoffen.
Als könnte ihre Hoffnung in diesem Fall irgendetwas ausrichten.
Die Limousine nähert sich Meter um Meter, so schnell, wie die letzten Sandkörner in einem Stundenglas herunterrinnen, und dennoch kommt es ihr ziemlich langsam vor. Alles geschieht extrem langsam. Wie in Zeitlupe.
Sie sieht ihre eigene verzweifelt winkende Hand sich bewegen wie in einem durchsichtigen Gelee oder als befände sie sich auf dem Mond. Umgeben von einer ätherischen, beschaulichen Langsamkeit. Ein Walzer im Universum.
Die Limousine nähert sich ruckartig. Wie die Filme auf YouTube, wenn sie noch nicht vollständig geladen sind. Langsam und in gewisser Weise Stück für Stück.
Und fährt vorbei.
Die Limousine fährt an ihrer von Gelee umschlossenen Hand vorbei.
Steht sie womöglich doch an der falschen Stelle?
Hat sie sich derart getäuscht?
Dann scheint es, als würde die Limousine einige Meter weiter doch noch stehen bleiben. Eine unerwartete Hoffnung erfüllt sie.
Hoffnung.
Sie hört die Bremsgeräusche ganz deutlich.
Aber sie kommen aus der falschen Richtung.
In dem Moment begreift sie es.
Sie lässt die Hand sinken, und die Welt wird zu einem Stillleben.
Der Schwitzende steht zwei Reihen von der Straße entfernt, als die Limousine vorbeifährt. Sie fährt tatsächlich vorbei, hält nicht an. Er zwängt sich zwischen die vorn stehenden laut brüllenden Aktivisten und schaut ihr nach. Sie muss jeden Moment anhalten.
Sie muss.
Doch bereits in dem Moment, als die Limousine vorbeifuhr, begriff er es. Ihm ist klar geworden, dass sie nicht anhalten würde. Jetzt passiert sie die Absperrungen und fährt weiter hinunter in Richtung des ExCeL Exhibition Centre.
Er schaut ihr hinterher und schwitzt.
Und lässt die Hoffnung fahren.
Doch plötzlich weigert er sich, aufzugeben. Gewiss, er hatte all seine Hoffnung in das gesetzt, was gerade nicht eintraf, aber er will dennoch nicht aufgeben. Irgendetwas in ihm schaltet um auf Plan B. Es gibt zwar keinen Plan B, aber er entwickelt einen. In diesem Moment entwickelt er ihn.
Er schaut sich um. Überall stehen sie, die Uniformierten und Kampfbereiten, aber sich an sie zu wenden wäre regelrecht dumm. Es sind keine Menschen, mit denen man reden kann. Er lässt seinen Blick hinüber zur anderen Straßenseite schweifen, wo weniger Leute stehen. Irgendetwas bewirkt, dass sein Blick an einer bestimmten Person hängen bleibt. Warum, weiß er nicht genau, aber er beschließt, mit dieser Person zu reden. Diesem Mann will er alles erzählen. Und der wird ihn verstehen.
Er ist etwas größer als die anderen und beugt sich gerade zu einem Bereitschaftspolizisten hinunter, der in seine Papiere schaut. Er sagt etwas zu ihm. Und der Schwitzende begreift, dass der Mann Polizist ist, allerdings eine andere Art Polizist. Einer, dem der uniformierte Polizeibeamte nicht uneingeschränkt vertraut. Mit ihm muss er reden.
Denn jetzt muss er es loswerden. Unbedingt. Jetzt muss es die Menschheit erfahren.
Er heftet seinen Blick auf den groß gewachsenen Polizisten mit dem hellweißen Haar, schiebt sich unter der Absperrung hindurch und rennt quer über die Straße.
Der Weißhaarige schaut auf, und ihre Blicke begegnen sich.
»Mister Sadestatt?«, fragt der übereifrige Polizeibeamte der »Operation Glencoe« skeptisch und betrachtet den Ausweis durch seine Schutzmaske hindurch. Es gelingt ihm mit seinen dicken Handschuhen kaum, die Ausweispapiere festzuhalten.
»Actually«, entgegnet der Beobachter mit so liebenswürdiger Stimme wie möglich, »I am Chief Inspector Arto Söderstedt. From Europol in Den Haag. I’m here as an observer.«
Der Bereitschaftspolizist schüttelt den Kopf und mustert die eigentümlichen Ausweispapiere, die offenbar wichtiger sind als die Observierung der Demonstranten und die Bewachung der Route des Präsidenten der USA. Mit einer inneren Gereiztheit sieht Arto Söderstedt gerade noch die Limousine von Barack Obama hinter den Absperrungen verschwinden und in Richtung der grotesken Konferenzanlage hinunterfahren. Er verspürt eine gewisse Enttäuschung, weil die Twitter-Meldung ein Fake war. An dem Gerücht war nichts dran, vielleicht existierte es noch nicht einmal, vielleicht handelte es sich auch nur um einen dummen Witz. Doch er empfindet nicht nur Enttäuschung, sondern auch Erleichterung. Erleichterung darüber, dass der amerikanische Präsident nicht so dumm ist. Andernfalls hätte er ihn auch nicht für zukunftstauglich gehalten.
Sein Beobachterblick bleibt an einem anderen Punkt hängen. Er sieht, wie sich ein asiatisch aussehender Mann auf der gegenüberliegenden Straßenseite unter der Absperrung hindurchschiebt und losrennt.
Auf ihn zu.
Er hat seinen Blick fest auf Arto Söderstedts Augen gerichtet. Zweifellos ist er auf dem Weg zu ihm. Beinahe hat er ihn erreicht, ist nur noch ein paar Meter entfernt, als der Beobachter plötzlich begreift, dass er kein anonymer Beobachter mehr ist. Ein unerwarteter Schrecken erfasst ihn, ein kurzer Augenblick des Entsetzens, den er später ein ums andere Mal analysieren wird, eine Furcht vor dem Fremden, vor Selbstmordattentätern, vor Asiaten, eine Furcht, die seiner Person nicht angemessen ist.
Aber das Gefühl hält nur einen sehr flüchtigen Moment an.
Dann hört er ein Geräusch. Ein Motorengeräusch. Doch die nachfolgenden Ereignisse sind für ihn alle tonlos. Als das grafitgraue Auto dem Chinesen die Beine bricht, dringt kein Geräusch in sein Bewusstsein. Auch der nachfolgende fast senkrechte Flug durch die Luft ist lautlos. Nicht einmal, als der Körper hart, knochenhart auf dem Asphalt aufschlägt, hört Arto Söderstedt einen einzigen Laut.
Dann kommen alle Geräusche auf einmal. Als wären sie komprimiert worden und würden nun in einem einzigen Augenblick alle gleichzeitig herausgepresst werden. Das Quietschen der Bremsen, der Knall der Kollision, der Aufprall des Körpers auf dem Asphalt, die entsetzten Schreie der Aktivisten und sogar die unkontrollierten Ausrufe des Fahrers hinter der Scheibe des grafitgrauen Wagens. Söderstedt identifiziert den Wagen als Zivilstreife, während er dem Bereitschaftspolizisten seine Papiere aus der Hand reißt und unerwartet geschmeidig im Schersprung die Absperrung überwindet. Er geht neben dem stark blutenden Chinesen in die Hocke, traut sich jedoch nicht, ihn zu berühren. Der Mann lebt. Er sieht Arto Söderstedt wieder geradewegs in die Augen. Als wäre der ein Auserwählter.
Söderstedt hebt den Blick und lässt ihn über die Szenerie schweifen. Zu seiner Linken sieht er, wie zwei Männer in feinen Anzügen zögerlich aus dem grafitgrauen Wagen steigen. Rechts von ihm hat auf der anderen Straßenseite in einiger Entfernung ein weiteres Auto angehalten, um das herum ein gewisser Tumult entstanden ist.
Aber vor allem blickt er auf die Menschenmenge, die Friedenseiferer von »Stop the War Coalition«, er sieht den Schrecken in ihren Augen, und ihm wird klar, wie ähnlich sie einander alle sind, wie ähnlich sie reagieren. Die Polizisten der »Operation Glencoe« wie die Demonstranten. Ihre Blicke. Diese stummen geöffneten Münder hinter vorgehaltenen Händen. Er hat keine Ahnung, warum ihm das ausgerechnet jetzt durch den Kopf geht.
Er beugt sich hinunter zu dem verletzten Mann und sieht in seinem Blick, dass er kurz davor ist zu sterben. Zitternd schaut er einem Menschen genau in dem Moment in die Augen, als der sein Leben aushaucht. Der Mann hält sich gerade noch, mit einem letzten Quäntchen Willenskraft, am Leben. Und der Wille erscheint Arto Söderstedt plötzlich so zielgerichtet.
Er beugt sich über das Gesicht des Sterbenden. Es ist, als sei dessen ganzer Körper zerbrochen. Wie ein heißer Geysir speien die röchelnden Atemzüge des Mannes Blut in Söderstedts Ohr. Dennoch weicht er nicht zurück. Dieser Mann will ihm etwas mitteilen. Jetzt noch.
Söderstedt zittert und lauscht. Er schlottert immer stärker und hört, wie eine Anzahl merkwürdiger Silben mit dem Blut hervorsprudeln. Es ist so offensichtlich, dass der Mann etwas sagen will, dass sich hinter den fremden Silben ein gewisser Sinn verbirgt. Söderstedt schaut dem Mann in die Augen, als der stirbt. Er sieht, dass der Chinese in der Gewissheit stirbt, der Auserwählte habe seine Worte gehört.
Arto Söderstedts Kinn sinkt auf seine bebende Brust. Er spürt, wie ihm das Blut eines Fremden sachte aus dem Ohr tropft. Als er die Augen schließt, merkt er, wie entsetzlich kalt es ist. Gewiss, der April ist der heftigste Monat, aber nicht deswegen geht ihm ein Schauder durch Mark und Bein.
Er spürt einen eisigen Februarwind, einen harschen Wind des Verrats, der von dem verlassenen Tal herunterbläst.
Die Putzfrau
Nacka, Stockholm, 2. April
Wie die Putzfrau einige Stunden später selbst zugeben würde, wusste sie, dass sie spätestens um neunzehn Uhr das Haus hätte verlassen haben müssen. Aber sie wusste nicht, aus welchem Grund. Es hatte irgendetwas mit dem Alarm zu tun. Mit der Alarmanlage des Hauses. Sie brauchte an nichts weiter zu denken, so hatte man ihr eingeschärft, an nichts, außer an die Alarmanlage und daran, dass sie die Haustür um spätestens 19:00 Uhr von außen zuschloss. Bis dahin sollte sie alles geputzt haben.
Der ersten Vernehmungsleiterin gegenüber sagte sie aus, sie putze die Villa einmal die Woche, immer donnerstags, und es gäbe dort keine Besonderheiten. Es war eine Villa unter vielen. Die Putzfrau war bisher keinem der Familienmitglieder begegnet, nur als sie sich vorstellte, hatte die Frau des Hauses ihr ausführlich erklärt, was alles zu tun sei. Seither waren donnerstags alle außer Haus. An diesem Tag traf sie ohnehin keinen an, denn die Eheleute waren über das verlängerte Wochenende nach Paris geflogen, und ihr Sohn wollte bei einem Freund übernachten.
Möglicherweise spielte dieses Wissen eine gewisse Rolle bei den nachfolgenden Ereignissen. Denn sie war etwas entspannter, während sie putzte. Summte ein altes Volkslied aus ihrem Heimatdorf Bengbu vor sich hin, aber ohne Erinnerungen aufkommen lassen zu wollen.
Doch was sie dazu verleitete, sich auf das Sofa im Wohnzimmer zu legen, und weshalb sie obendrein auch noch einschlief, blieb ein Rätsel. Dergleichen hatte sie noch nie zuvor getan. Sie erledigte ihre Putzaufträge immer einwandfrei. Denn sie hatte große Angst, etwas falsch zu machen.
Wie alle anderen auch.
Und dennoch passierte es.
Sie hatte fertig geputzt, das alte Volkslied hallte noch in ihr nach, sie war zufrieden mit ihrer Arbeit – und fühlte sich in einer Art und Weise frei, die sie seit ihrer Kindheit nicht mehr erlebt hatte. Sie setzte sich aufs Sofa und fand sich bald in einer halb liegenden Position wieder, sank tiefer und tiefer in die Polster, die die angenehmsten waren, auf denen sie je gelegen hatte. Das Sofa wiegte sie in den Schlaf.
Eigenartig aber war, dass sie zwei Minuten vor 19:00 Uhr erwachte. Es dämmerte bereits, und sie brauchte eine ganze Weile, bis sie begriff, wo sie war. In dem Moment sprang die Uhr des luxuriösen DVD-Players auf 18:59 Uhr um. Und erst da fiel es ihr ein.
Sie sprang förmlich vom Sofa auf, raffte ihre wenigen Habseligkeiten zusammen und rannte in Richtung Haustür. Sie sah die Tür am Ende des unendlich langen Korridors und die kleine Box an der Wand daneben, das Gerät, das sie unter keinen Umständen berühren durfte.
Sie war schon lange nicht mehr gerannt, und sie war zu langsam.
Zwei Meter von der Haustür entfernt hörte sie, wie es in dem Gerät an der Wand klickte und das Kästchen einen dumpfen Summton von sich gab, bevor ein kleines blaues Lämpchen an seiner Unterkante aufleuchtete und zu blinken begann.
Sie stürzte auf die Tür zu, hielt jedoch inne, als ihre Hand bereits wenige Zentimeter über dem Türgriff war. Wie verhext starrte sie auf das Gerät mit dem blinkenden Lämpchen. Es war mit einer kleinen Uhr ausgestattet, auf der eine Zeitangabe zu lesen war. 06:30.
Das muss die Alarmanlage sein, dachte sie, obwohl es ihr schwerfiel, klar zu denken. Die Alarmanlage war aktiviert. Wenn sie den Türgriff jetzt herunterdrückte, dachte sie weiter und zog sachte ihre Hand zurück, würde der Alarm ausgelöst werden. Die Anlage würde anfangen zu piepen und zu lärmen, die Nachbarn würden angerannt kommen, bewaffnete Securityleute würden auftauchen, und sie würde nicht nur ihren Job verlieren, sondern außerdem im Gefängnis landen, die Polizei würde sie vernehmen, und ihr gesamtes Leben würde in die Brüche gehen.
Sie atmete aus. Und zog die Hand endgültig zurück. Zwang sich, nachzudenken. Vermutlich bedeuteten die Zahlen 06:30 auf dem Display, dass der Alarm morgens um halb sieben deaktiviert wurde.
Wenn es ihr gelänge, nicht in einem Anflug von Panik den Türgriff herunterzudrücken und die Tür aufzureißen, blieben ihr zwei Möglichkeiten. Sie könnte entweder ihre Arbeitgeber in Paris anrufen, sie bei ihrem romantischen Wochenendausflug behelligen und damit hinnehmen, dass sie ihren Job verlieren würde, nachdem man sie gehörig ausgeschimpft hätte. Aber immerhin würde sie aus der Villa kommen. Doch sie könnte auch etwas anderes tun.
Die Eheleute waren weit weg, mit ihnen müsste sie nicht rechnen. Der Sohn allerdings war ein Unsicherheitsfaktor. Aber danach zu urteilen, wie sein Zimmer allwöchentlich aussah – es sauber zu machen nahm jedes Mal mehr als die Hälfte der Zeit in Anspruch –, würde er wohl kaum vor morgen früh um halb sieben hereingestürzt kommen. Es bestand höchstens das Risiko, dass er heute Abend zu Hause auftauchen würde, weil er irgendwelche Utensilien für die Übernachtung bei seinem Freund vergessen hatte, oder dass er eine Party plante, weil er sturmfrei hatte. Aber die würde er sicher auf den morgigen Freitag legen. Und dann wäre sie längst weg.
Nein, das wahre Risiko waren die Nachbarn. Sie könnten sie morgen früh sehen und die Polizei rufen. Aber sie kannte die Nachbarn, jedenfalls einige, da sie auch bei ihnen putzte. Außerdem besaß sie die Fähigkeit, sich unsichtbar zu machen.
Sie blieb neben der beängstigend blinkenden Alarmanlage stehen und versuchte, so rational zu denken, wie sie es lange nicht mehr getan hatte. Es stand schließlich viel auf dem Spiel. Sie war nicht legal in diesem Land.
Allmählich nahm der Entschluss, im Haus zu bleiben, Form an. Sie würde ganz einfach über Nacht bleiben. Keiner würde etwas davon erfahren. Sie würde ihren Job retten. Außerdem war es nicht gerade so, dass zu Hause irgendjemand auf sie wartete. Und nach ihrem Zuhause sehnte sie sich nun wirklich nicht. Denn es war kein richtiges Heim. Eine heruntergekommene Einzimmerwohnung mit Küchenecke im fünften Stock in Vällingby, die sie sich mit drei anderen illegalen Putzfrauen teilte, die nicht unbedingt das Verlangen verspürten, ihre eigene Bude zu putzen, wenn sie nach einem vierzehnstündigen Arbeitstag nach Hause kamen.
Ja, dachte sie, warum sollte sie nicht für eine Nacht bleiben und ein wenig Luxus genießen? Aus der Not eine Tugend machen? Natürlich durfte sie kein Licht machen. Oder sie musste sich in den Räumen ohne Fenster aufhalten oder in den Räumen mit diesen lichtundurchlässigen Jalousien, die sie so ungern abstaubte.
Die Villa war so groß, dass es in der Tat ein vollständig eingerichtetes Zimmer ohne Fenster im Erdgeschoss gab. Es war das Arbeitszimmer des Mannes und in der Regel leicht zu putzen. Der Hausherr hatte offenbar einen Sinn für Ordnung.
Aber sie hatte nicht vor, ins Arbeitszimmer zu gehen. Nein, völlig unerwartet begann sie mutig zu werden. Sie wollte ins Schlafzimmer der Eheleute hinaufgehen, jenes Zimmer mit den am dichtesten abschließenden Jalousien, dem großen Flachbildschirmfernseher an der Wand und den vielen DVDs. Außerdem wollte sie etwas essen. Sie wusste, was sich im Kühlschrank und in den Küchenschränken befand. Die zahlreichen Köstlichkeiten würden wahrscheinlich schlecht werden, wenn sich ihrer keiner erbarmte.
Sie schlich in die Küche. Es war immer noch hell genug, um auch ohne Beleuchtung etwas sehen zu können, und das Licht im Kühlschrank brauchte sie wohl nicht zu fürchten. Außerdem konnte sie ja den kleinen Knopf herunterdrücken, damit das Licht nicht anging.
Sie kannte den Kühlschrank in- und auswendig, denn eine ihrer wichtigsten Aufgaben bestand darin, ihn zu putzen. Ihre Arbeitgeberin hatte nämlich keine besonders ausgeprägten hausfraulichen Qualitäten. Nach außen wollte sie einen perfekten Eindruck machen, aber einer versierten Putzfrau reichte ein kurzer Blick hinter die Fassade aus, um ein ganz anderes Bild zu erhalten. Die Frau des Hauses war eine richtige Schlampe.
Jeden Donnerstag musste sie den Kühlschrank vollständig ausräumen und säubern, und am darauffolgenden Donnerstag sah er dennoch wieder so aus, als hätte dort ein Meteorit eingeschlagen.
Dennoch gab es dort auch eine Reihe hochwertiger Lebensmittel, die bereits fertig zubereitet waren. Sie hatte sich zwar nie ganz an die fremdartige schwedische Kost gewöhnt, warum auch immer, aber es gab genügend anderes. Schmackhafte Käsesorten, leckeres Brot, sogar einige ausgesuchte asiatische Delikatessen – und Wein. Aber ganz so weit wollte sie es dann doch nicht treiben. Keinen Wein.
Sie deckte ein kleines Tablett mit verschiedenen Leckereien und nutzte die letzten Spuren des Tageslichts an diesem Aprilabend, um die Treppe hinaufzusteigen. Als sie das Schlafzimmer betreten hatte, warf sie vorsichtig einen Blick aus dem Fenster. Niemand, keine Nachbarn, die in ihre Richtung schauten. Vorsichtig zog sie die Jalousien herunter und vergewisserte sich, dass sie das Fenster bis über den Rahmen hinaus abdeckten. Nun konnte kein Lichtstrahl nach draußen dringen.
Sie stellte das Tablett auf einen leeren Nachttisch, ging zum Fernseher, nahm die Fernbedienung in die Hand und begann zu zappen. Doch sie verlor schnell die Lust. Lieber wollte sie einen richtigen Film sehen.
Sie fand die DVD unmittelbar. Ang Lee. Wunderbar. Der Regisseur, der ihre Gedanken lesen konnte. Wo Traum und Wirklichkeit ein und dasselbe waren. Wo hu cang long. Oder: Crouching Tiger, Hidden Dragon.
Die folgenden zwei Stunden vergingen wie im Flug. Als der Abspann des Films lief, stellte sie fest, dass das Tablett leer war. Außerdem musste sie auf die Toilette.
Die Uhr auf dem DVD-Player zeigte kurz nach halb zehn an. Vielleicht sollte sie sich noch etwas zu essen holen? Und möglicherweise einen weiteren Ang-Lee-Film ansehen. In der DVD-Sammlung gab es mehrere.
Sie griff sich das Tablett und ging vorsichtig die Treppe hinunter. Inzwischen war es im Haus stockdunkel. Aber sie tastete sich langsam und bedächtig voran. Als sie am Arbeitszimmer des Mannes vorbeikam, registrierte sie darin einen Lichtschein. Vor Schreck ließ sie das Tablett fallen. Scheppernd krachte es auf den Boden. Der Nachhall schien unendlich. Ihr Herz pochte heftig.
Ist der Sohn etwa nach Hause gekommen? Sitzt er dort drinnen und surft heimlich auf dem Computer seines Vaters?
Sie schlich bis zur Tür. Ihr Herz schlug wie verrückt in ihrer Brust. Dann warf sie einen Blick in den Raum. Jetzt hatte sie nichts mehr zu verlieren.
Doch da war niemand.
Sie wagte sich weiter in das Arbeitszimmer hinein. Schließlich konnte sie den gesamten Raum einsehen.
Kein Mensch weit und breit. Aber der Computer war eingeschaltet. Kreisförmige Gebilde huschten in eigentümlichen Mustern über den Bildschirm. Sie ging auf den Schreibtisch zu, griff nach der Maus und bewegte sie leicht.
Da erschien ein völlig anderes Bild auf dem Bildschirm. Eine Internetstartseite. Eigentlich nichts Besonderes, aber es war merkwürdig, dass der Mann vergessen hatte, den Computer auszuschalten, bevor er nach Paris gefahren war.
Sie setzte sich und begann langsam, den Inhalt des Computers zu erforschen. Sie wollte herausfinden, was er für Geheimnisse barg. Sie öffnete das E-Mail-Programm. Sollte sie wirklich einen Blick hineinwerfen?
Sie hatte bereits so viele Tabus gebrochen, dass es nun anscheinend keinerlei Grenzen mehr gab. Aber zunächst ging sie die Liste der zuletzt aufgerufenen Seiten durch, und dann begab sie sich selbst auf die Suche im Internet.
Nach einer Weile tippte sie einen langen, schwer zu buchstabierenden schwedischen Begriff ein, woraufhin es ungewöhnlich lange dauerte, bis die Trefferliste erschien. Danach gab sie dasselbe Wort in die Suchfunktion des Computers ein. Keine unmittelbaren Treffer.
Mit rasendem Puls begann sie, die E-Mails durchzusehen. Es kam ihr vor, als werfe sie einen verbotenen Blick in das Herz eines fremden Menschen.
Die Zeit verging. Viel Zeit.
Sie las eine ganze Menge. Und sah noch mehr.
Sie sah Dinge, die sie nicht sehen wollte.
Als sie plötzlich ein Geräusch hinter sich hörte, drehte sie sich erschrocken um. Mit offenem Mund blickte sie in zwei beachtliche Pistolenläufe. Zwei Männer standen mit gezogenen Waffen im Arbeitszimmer.
All ihre Albträume wurden mit einem Schlag Realität. Sie starrte auf die Schusswaffen und begriff, dass ihr Leben zu Ende war. Es war eine glasklare, vollkommen rationale Erkenntnis.
In dem Moment kam ein dritter Mann ins Zimmer. Er ging auf sie zu und nahm behutsam, aber bestimmt ihre Hände von der Tastatur. Als sie zu ihm aufschaute, sah sie, wie unglaublich groß er war.
Der Mann räusperte sich und hielt ihr seinen Polizeiausweis hin. »Mein Name ist Kriminalkommissar Jon Anderson von der Abteilung Internetkriminalität der Reichskriminalpolizei«, sagte er mit fester Stimme. »Kann es sein, dass Sie im Internet nach Kinderpornografie gesucht haben?«
Klare Worte
Den Haag, 6. April
Jutta Beyer aus Berlin war sich immer noch nicht ganz sicher, was sie eigentlich in Den Haag sollte. Sie war sich aber auch nicht sicher, ob irgendeiner ihrer Kollegen es wusste.
Sie selbst bevorzugte klare Strukturen, wie sie in der Abteilung 4 des Landeskriminalamts Berlin herrschten. Dort war sie Kriminalobermeisterin gewesen und hatte sich mit organisierter Kriminalität und ausgeklügeltem Bandenwesen herumgeschlagen, wovon Deutschland gegenwärtig geradezu überschwemmt wurde. Neben den russischen und osteuropäischen Gruppierungen unterwanderte auch die italienische Mafia, allen voran die Königin des europäischen Kokainhandels, die geheimnisvolle ’Ndrangheta aus Kalabrien, die Gesellschaft. Im Westen Deutschlands war es nach wie vor am schlimmsten – Nordrhein-Westfalen wurde regelrecht überrollt von internen Auseinandersetzungen der Mafia. Schließlich hatte die Arbeitsbelastung im Landeskriminalamt so bizarre Formen angenommen, dass selbst Jutta Beyer bereit war, ihre gewohnte Umgebung zu verlassen und sich auf etwas Neues einzulassen.
Da kam das Angebot von Europol.
Am 1. Juli würde die europäische Polizeibehörde Europol ihr zehnjähriges Jubiläum feiern, und bis zum Ende des Jahres sollte eine Umstrukturierung stattfinden. Außerdem plante man, aus dem mit Efeu umrankten ehemaligen Schulgebäude im schönsten Stadtviertel von Den Haag in einen riesigen Wolkenkratzer mit Büroetagen umzuziehen – Europol sollte zu einer formellen EU-Behörde werden. Nach wie vor war Europol eine nichtoperative Instanz, deren Mitarbeiter weder Personen festnehmen und verhören noch bei Verbrechen ermitteln durften, doch nun erstreckte sich das Mandat auf alle Formen von grenzüberschreitenden Verbrechen. Die Beschränkung auf organisierte Kriminalität galt nicht mehr. Die meisten Eingeweihten waren sich darin einig, dass dies ein deutlicher Schritt hin zu einer Europapolizei war, zu einem europäischen FBI.
Jutta Beyers Enthusiasmus darüber, an diesem historischen Ereignis teilhaben zu können, kannte keine Grenzen. Sie liebte historische Ereignisse, seit man sie als Zwölfjährige auf die Berliner Mauer gehoben hatte, während die Menschen aus dem Osten und Westen zu beiden Seiten das Gestein mit Hämmern und Hacken traktierten. In ihrem hellblauen Kleid, ihren Teddy in der Hand, stand sie auf einem niedrigen Mauersockel und blickte hinüber in den Westen. Zahlreiche Zeitungen rund um den Globus veröffentlichten Fotos von ihr. Historische Fotos.
Und historische Dimension könnte ihre neue Aufgabe auch haben.
In Berlin ließ sie niemanden zurück, sie hatte keine Familie und auch keine engen freundschaftlichen Verbindungen. Da war es ein wunderbares Gefühl, dem ausufernden Kleinkrieg gegen rechtsextremistische Banden, brutale russische Mafiosi mit niedrigem Intellekt, italienische Unterhändler und dem Füllhorn von Drogenhändlern den Rücken zu kehren und sich stattdessen dem Gebiet der weitaus bedeutenderen organisierten Kriminalität zuzuwenden.
Ihr Enthusiasmus erlosch jedoch rasch. In Den Haag war sie in einer internationalen Gruppe gelandet, deren Auftrag und Grenzen erstaunlich unscharf definiert waren. Oft hatte sie versucht, den operativen Chef der Gruppe – allein diese Bezeichnung in einer nichtoperativen Gruppe – zu einer Erklärung zu bewegen, worum es bei dem Ganzen eigentlich ging. Der Mann war extrem professionell und sympathisch, aber sie hatte den Eindruck, dass er ihr etwas vorenthielt. Ja, der gesamten Gruppe. Deren Mitgliederzahl auf absurde Art ebenfalls diffus war.
Zumindest das hatte der Chef ihr verraten: Die Strukturen der Gruppe waren gewollt flexibel. Das war der tiefere Sinn. Diejenigen, die nach Den Haag umgezogen waren, bildeten nur den harten Kern, denn diejenigen, die in ihren Heimatländern arbeiteten und sich nur zeitweise dem Team anschlossen, machten einen ebenso großen Teil der Mannschaft aus. Aber in welcher Hinsicht sich die neue Opcop-Gruppe eigentlich von ihrer Mutterorganisation Europol unterschied, blieb unklar. Zumal diese Europol Liaison Officers, diese verdammten ELOs, auch bei ihnen überall herumsprangen.
Einen Monat war sie jetzt hier, seit dem 1. März, und in dieser Zeit hatte sie sich hauptsächlich damit beschäftigt, Papiere hin und her zu schieben und sich mit dem Computersystem vertraut zu machen. Aber eigentlich verbrachte sie die meiste Zeit damit, sauer zu sein, da sie nicht genau wusste, was sie tun sollte und vor allem tun durfte. Es kam ihr vor, als wären der gesamten Europol-Behörde auf merkwürdige Weise die Hände gebunden.
Sie war eine Polizistin, die die Dinge endlich anpacken wollte, aber klare Richtlinien und Grenzen benötigte.
Doch bislang bestanden die Aktivitäten der Opcop-Gruppe hauptsächlich in Zusammenkünften. Sitzungen, bei denen man sich in erster Linie mit administrativen Fragen beschäftigte. Und zu einer solchen war sie auch an diesem frühen Montagmorgen Anfang April unterwegs.
In Den Haag, dieser seltsamen kleinen Puppenstubenstadt, hatte der Frühling Einzug gehalten. Es war in der Tat ein sehr schöner Morgen, an dem sie durch die Stadt radelte. Obwohl sie auch in Berlin häufig mit dem Rad unterwegs gewesen war, empfand sie den holländischen Radfahrer als sehr eigene Spezies. Die Leute fuhren, wie es ihnen gerade passte, bevorzugt mit drei, vier Kindern auf dem Lenker und einer Ente oder Guillotine auf dem Gepäckträger, entgegen allen Verkehrsregeln. Wo Jutta Beyer Regeln doch so schätzte.
Daher war es nahezu ein versöhnlicher Anblick, als sie den Raamweg hinaufradelte und sich das von wildem Grün umrankte Europol-Gebäude wie eine Oase nach einer langen Wanderung durch die Wüste vor ihr auftürmte. Als sie auf den Parkplatz einbog, bot sich ihr ein eigentümliches Bild. Das Gebäude von Europol sah irgendwie aus wie ein Weihnachtsbaum, den man mittels einer Schrottpresse zusammengefaltet hatte. Als sie beinahe mit Marek Kowalewski kollidierte, dem polnischen Kollegen mit dem etwas zu breiten Lächeln, verflüchtigte sich das Bild. Sie parkten ihre Fahrräder nebeneinander.
»Sollen wir sie zusammenschließen?«, fragte Marek und rasselte wie ein Gespenst mit seinem Fahrradschloss.
»Lieber nicht«, entgegnete Jutta und schloss ihr Fahrrad mit der eigenen Kette an.
Dass sie anschließend gemeinsam durch die Korridore zum Versammlungsraum gingen, konnte Jutta kaum vermeiden. Ebenso wenig wie die Begegnung mit der außergewöhnlich brüsken Rumänin Lavinia Potorac – einer ehemaligen Turnerin mit durchtrainiertem Körper, der stets in sackartiger Kleidung steckte, und einem unerträglichen Charakter. Sie kam gerade aus der Damentoilette und grüßte mit einem kurzen Nicken. Vor der Tür zum Versammlungsraum stand der elegante Madrilene Felipe Navarro und richtete gerade den Knoten seiner Krawatte. Lavinia Potorac schüttelte mit finsterer Miene den Kopf, zog ihren Ausweis durch das Lesegerät, tippte den Code ein und stieß die Tür mit voller Wucht auf. Navarro stoppte die Tür mit der Hand und hielt sie Jutta und Marek mit einer galanten Geste auf. Keiner der beiden dankte ihm.
Der Rest der bunten Schar hatte bereits Platz genommen. Jutta registrierte Miriam Hershey aus London und Laima Balodis aus Wilna, die bereits beste Freundinnen waren; daneben den etwas weltfremden Athener Angelos Sifakis und die in allen Lagen streitbare Französin Corine Bouhaddi. Ebenfalls anwesend waren Fabio Tebaldi, der mit Morddrohungen konfrontierte junge Mafiajäger aus San Luca an der Zehenspitze des italienischen Stiefels, und der Altmeister der Gruppe, der etwas sonderbare Schwede Arto Söderstedt. Wenn er nicht doch Finne war, Jutta Beyer wusste es nicht genau.
Außerdem waren momentan einige der nationalen Mitarbeiter in Den Haag. Sie erkannte keinen von ihnen wieder, die Gruppe blieb für sie diffus und konturlos.
Dazu trug auch diese Sprache bei. Sie alle waren gezwungen, sich mit »the EUnglish language« abzumühen, dieser merkwürdig klanglosen Kunstsprache, die innerhalb der EU verwendet wurde. Obwohl alle einen Grundkurs absolviert hatten, waren die Gespräche noch immer mühselig.
Jutta Beyers Stimmung hatte beinahe ihren Siedepunkt erreicht, als sie ihren gewohnten Platz im Versammlungsraum einnahm. Irgendetwas im Zimmer war verändert worden, aber Jutta hatte keine Zeit, darüber nachzudenken, denn in diesem Moment setzte sich Kowalewski etwas zu dicht neben sie. Und lächelte sie an. Noch breiter als sonst. Wahrscheinlich wollte er mit ihr übers Wochenende plaudern. Sie nahm sich unnötig viel Zeit, um ihre Unterlagen auszupacken, und hoffte inständig darauf, dass der Chef endlich hereinkommen würde.
Aber dem war nicht so. Die Zeit verging. Es war schon nach acht Uhr, und die Möglichkeiten, Papierstapel, Stifte und Notizbuch auf dem Tisch anzuordnen, waren irgendwann erschöpft. Nun würde sie doch mit Marek sprechen müssen. Sie wusste, dass sie manchmal sehr unhöflich sein konnte, wenn sie genervt war oder ihr jemand zu nahekam.
Doch als sie schließlich aufsah, stellte sie erleichtert fest, dass Kowalewski sich bereits abgewandt hatte. Und nun rief er laut: »Let’s play Chinese whispers, children!«
Alle Anwesenden sahen zu ihm hin. Sie hatten sich bereits an sein zwanghaftes Bedürfnis gewöhnt, den Klassenclown zu geben. Aber diesmal trafen ihn überwiegend erstaunte, wenn nicht sogar vorwurfsvolle Blicke.
»Shit«, sagte Kowalewski und legte die Ohren an. »Heißt das nicht so auf Englisch? Dieses Spiel, bei dem einer ein Wort flüstert und die anderen es weiterflüstern müssen?«
»Du hast also noch nicht gehört, was passiert ist?«, fragte die dunkelhaarige Engländerin Miriam Hershey und ließ ihren Blick zwischen Marek Kowalewski und Arto Söderstedt hin- und herschweifen. Doch der machte lediglich eine abwehrende Handbewegung.
»Was denn?«, fragte Kowalewski mit Nachdruck.
Söderstedt streckte den Rücken durch, sodass es hörbar in seinem hellhäutigen Körper knackte, und sagte: »Let’s just say I’ve had my fair share of Chinese whispers.« Von Stiller Post hatte er wirklich genug.
Jutta Beyer dankte dem Himmel, dass der Chef in diesem Augenblick den Raum betrat und alle ihre Aufmerksamkeit auf ihn richteten. Er nickte ihnen rasch zu und nahm hinter seinem Pult Platz. Der Leiter der Opcop-Gruppe war ein recht stilvoller Mann in mittleren Jahren mit mittelblondem, etwas längerem Haar, das an den Schläfen schon ein wenig grau geworden war. Und in der Region um den Hosenbund herum war sein Körper nicht mehr ganz so schmal. Auf der Wange hatte er einen kleinen roten Fleck, und er kam aus Schweden. Sein Name war Paul Hjelm.
»Guten Morgen. Ich kann euch heute mitteilen, dass Europol nun einen großen Schritt hin zu einer operativen Institution gemacht hat«, sagte er in seinem halbwegs gepflegten Englisch. »Am vergangenen Donnerstag wurde nämlich unser Kollege Arto Söderstedt in London in einen Vorfall verwickelt, bei dem es sich zwar nur um einen Unfall handelte, der die Führungsgruppe hier im Haus aber dazu veranlasste, am Wochenende bestimmte Prinzipien zu diskutieren. Ich weiß, dass ihr Prinzipien furchtbar leid seid, ich bin es auch.«
Er schaute auf die versammelte Opcop-Gruppe, und einige seufzten. Hjelm fuhr fort: »Vor allem aber bin ich es leid, die Dinge zu verschleiern. Ihr habt nun bereits einen guten Monat hier in eurer neuen Anstellung hinter euch, und es wird Zeit für klare Worte. Seid ihr bereit für klare Worte?«
»Mehr als bereit«, antwortete Felipe Navarro und richtete erneut seinen Krawattenknoten. »Wir haben uns zwar auf das Ganze eingelassen, ohne genau zu wissen, worum es hier geht, aber dass die Sache derart unklar ist, verblüfft uns doch ein wenig. Schließlich sollte eine neuartige internationale Polizeieinheit ins Leben gerufen werden.«
»Uns war nicht klar, dass das Neuartige darin besteht, dass wir nichts zu tun haben würden«, fügte Corine Bouhaddi sarkastisch hinzu.
Paul Hjelm lächelte kurz und sagte dann: »Man hat euch ja erklärt, dass Opcop ›Overt Police Cooperation‹ bedeutet, also offene Polizeiarbeit unter dem Dach von Europol. So lautet die offizielle Bezeichnung, aber praktisch gesehen sind wir ›Operating Cops‹. Wir sind eine Einheit, die erproben soll, inwieweit eine internationale Polizeitruppe handlungsfähig ist. Und währenddessen wird Europol zu einer formalen EU-Behörde umstrukturiert.«
»Erproben?«, rief Fabio Tebaldi aus. »Was zum Teufel soll denn ›erproben‹ bedeuten?«
»Zunächst einmal muss ich aufs Deutlichste betonen, dass alles, was hier in diesem Raum gesprochen wird, höchster Geheimhaltung unterliegt. Wer sich nicht an die Schweigepflicht hält, muss mit einer Gefängnisstrafe von bis zu zehn Jahren rechnen. ›Erproben‹ bedeutet, dass wir eine Einheit sind, die sich offiziell erst in Zukunft mit eigenen Ermittlungen befassen darf.«
Nun ging ein überraschtes Raunen durch den Raum. Denn Europols Aufgabe bestand bisher lediglich darin, die nationalen Polizeieinheiten bei der Koordination und Informationsbeschaffung zu unterstützen, Europol ermittelte nicht selbst aktiv. Und nun sollten die Polizisten von Opcop auch selbst Ermittlungsarbeit leisten, anstatt nur Befehle entgegenzunehmen und Daten abzugleichen.
»Im Grunde ist es ganz einfach«, fuhr Paul Hjelm fort. »Die internationale Kriminalität ist dabei, uns über den Kopf zu wachsen. Um wenigstens eine geringe Chance gegen die organisierte Kriminalität zu haben, die sich ja nie auf nur ein Land beschränkt, muss die Polizei ebenfalls international aufgestellt sein. Bis jetzt ist das von den Regierungen aber noch nicht abgesegnet. Wir sind also der Vortrupp, die Avantgarde, die heimlichen Wegbereiter. Wir werden erproben, ob es überhaupt möglich ist, polizeiliche Ermittlungen auf europäischer Ebene durchzuführen.«
Er hielt inne und ließ den Blick aus seinen blauen Augen über die Zuhörerschaft schweifen. Die erfahrenen Kriminalbeamten aus allen Ecken Europas tauschten skeptische Blicke aus. Etwas anderes war auch nicht zu erwarten gewesen. Er hoffte nur, dass sie seine eigene Skepsis nicht bemerkten.
Es war, wie erwartet, Corine Bouhaddi, die das Ganze auf den Punkt brachte: »Aber wie, bitte schön, sollen wir polizeiliche Ermittlungen im Geheimen durchführen?«
»Sehr gute Frage«, entgegnete Paul Hjelm. »Natürlich sieht die Praxis anders aus. Wir dürfen nur nicht herumposaunen, dass es diese Opcop-Gruppe gibt. Notfalls müssen wir immer auf die Polizeibehörden unserer jeweiligen Nationen verweisen können. Weitere Direktiven sind euch heute Morgen per Mail zugesandt worden.«
»Dürfen wir Waffen benutzen?«, fragte die Rumänin Lavinia Potorac.
»Wenn wir erfolgreiche Ermittlungen durchführen wollen, müssen wir auch bewaffnet sein, die Antwort lautet also Ja. Wir müssen uns aber bewusst machen, dass bei einem Schusswechsel etwas mehr als sonst auf dem Spiel steht. Es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass keine Spuren bis zu unserer Gruppe zurückverfolgt werden können, es ist aber keineswegs sicher, dass mir das immer möglich ist.«
Jutta Beyer reckte den Arm in die Luft. Die übrigen Anwesenden im Raum sahen sie verwundert an. Selbst Hjelm wirkte ein wenig irritiert und erteilte ihr mit einer kleinen Handbewegung rasch das Wort.
»Was passiert«, fragte sie, »wenn uns eine Ermittlung in ein EU-Land führt, das nicht durch die Gruppe vertreten ist? Zum Beispiel Ungarn oder Holland?«
Paul Hjelm nickte bedächtig. »Die EU hat aktuell siebenundzwanzig Mitgliedsstaaten. Eine Gruppe von siebenundzwanzig Polizisten wäre jedoch nicht nur so teuer, dass sich die Rechenkünstler der EU querstellen würden, sie wäre auch nicht handlungsfähig. Mehrere kleinere Länder werden sich daher bis auf Weiteres damit abfinden müssen, von einem Nachbarland repräsentiert zu werden. Wenn sich alles gut entwickelt, wird es später ein Rotationsprinzip geben. Ohne die großen Vier geht es aber nicht. Also sind Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien ständig vertreten. Schweden repräsentiert im Augenblick den Norden und Polen und Rumänien mit Litauen den Osten. Spanien steht für Südwesteuropa, Griechenland für Südosteuropa, Deutschland repräsentiert den deutschsprachigen Raum und die Beneluxländer und Großbritannien die Inselstaaten. Das ist nicht in jeder Hinsicht gerecht, und es gab auch bereits Proteste aus Holland, das sich jedoch momentan damit trösten muss, Gastgeberland unseres Hauptquartiers zu sein.«
Paul Hjelm hielt einen Augenblick inne und rieb sich den Nacken, dann fuhr er fort: »Und wie ihr seht, sind über das Wochenende in unserem Versammlungsraum einige Veränderungen durchgeführt worden.«
Die Polizisten sahen sich um. In die holzgetäfelten Wände waren Bildschirme eingepasst worden, die ausgeschaltet erst auf den zweiten Blick zu erkennen waren. Und wenn man sie zählte, was mindestens die Hälfte der Mitglieder der Opcop-Gruppe gerade zu tun schien, stellte sich heraus, dass es siebenundzwanzig Stück waren.
»Ziemlich kunstvolle Tischlerarbeit, oder?«, fragte Hjelm mit einem schiefen Lächeln.
»Eurovision Song Contest, meine Güte!«, rief Marek Kowalewski aus.
»Aber nur für Eingeweihte«, konterte Corine Bouhaddi trocken.
»Für die siebenundzwanzig Eingeweihten.« Paul Hjelm nickte. »Bleibt nur zu hoffen, dass wir sie nicht allzu oft brauchen, aber wir werden in jedem Fall regelmäßig Vollversammlungen mit sämtlichen nationalen Opcop-Beauftragten abhalten. Es muss also keiner das Gefühl haben, er sei außen vor.«
Felipe Navarro, dem es nur mit großer Selbstüberwindung gelang, die Finger von seinem Krawattenknoten zu lassen, räusperte sich. »Aber wahrscheinlich hat sich jeder von uns schon Gedanken darüber gemacht, dass Schweden hier in der Gruppe sehr stark vertreten ist«, sagte er. »Die EU hat momentan ziemlich genau eine halbe Milliarde Einwohner. Davon sind neun Millionen Schweden. Das sind weniger als zwei Prozent.«
»Aber wir bewohnen ziemlich genau zehn Prozent der geografischen Fläche«, warf da ein recht kleiner Mann mit dunklem Teint ein, der auf dem Platz neben Arto Söderstedt saß. Er arbeitete offenbar auf Länderebene und absolvierte gerade einen Pflichtbesuch im Hauptquartier. Die meisten hatten bisher angenommen, er sei Spanier, aber als Navarro am vergangenen Freitag versuchte, ein paar spanische Sätze mit ihm zu wechseln, antwortete er nur stockend und mit lateinamerikanischem Akzent.
»Bist du etwa auch Schwede?«, platzte es – zu seinem Ärger auf Spanisch – aus Navarro heraus.
»Tut mir leid«, erwiderte der Mann in auch nicht gerade flüssigem EUnglish. »Ich heiße Jorge Chavez. Und ich habe mich noch nicht endgültig entschieden, ob es so gut ist, Schwede zu sein.«
Jetzt räusperte sich Paul Hjelm geräuschvoll und sagte: »Es gibt ein schwedisches Gruppenmitglied, nämlich Arto Söderstedt. Dass der Chefposten mit einem Schweden, also meiner Wenigkeit, besetzt wurde, ist reiner Zufall. Der Direktor ist, wie ihr wisst, Brite, und die stellvertretenden Direktoren kommen aus Frankreich, Italien und Spanien. Die großen Länder haben also keinen Grund, sich zu beklagen.«
»Ich frage mich nur«, warf der Süditaliener Fabio Tebaldi ein, »ob die schwedische Polizei tatsächlich in der Lage ist, bei schweren internationalen Verbrechen angemessen zu reagieren. Da oben im Norden seid ihr doch weitgehend verschont davon.«
»Das ist ein Mythos«, entgegnete Jorge Chavez. »Der Mythos vom idyllischen nordischen Paradies. Aber das ist Bullshit.«
»Ihr seid jedenfalls gut darin, euch neutral zu verhalten«, warf Corine Bouhaddi angriffslustig ein.
»Na, na«, meinte Paul Hjelm beschwichtigend. »Wir haben uns wirklich bemüht, die Gruppe so repräsentativ wie möglich zusammenzustellen. Wir haben eine gerechte Geschlechter- und Altersverteilung, und ich glaube, dies gilt auch in geografischer Hinsicht.«
»Ich bin der Meinung, dass das gar nicht der springende Punkt ist«, stimmte ihm Miriam Hershey zu. »Ich bin britische Jüdin und fühle mich durchaus repräsentiert. Lasst uns das Thema beenden und zu den wichtigen Dingen kommen.«
»Nämlich: Gibt es irgendwelche Aufträge für uns?«, ergänzte Laima Balodis, als wären die beiden Zwillinge.
Paul Hjelm starrte das ungewöhnliche Duo einen kurzen Moment lang an und antwortete dann: »Nein.«
»Nein?«, kam es aus der Menge.
»Noch nicht. Aber jetzt sind wir jedenfalls bereit. Are we ready?«
Wie im Umkleideraum einer Fußballmannschaft, dachte Jutta Beyer genervt.
Die Antwort war ein Gemurmel, aus dem heraus sich schließlich eine Stimme erhob. Es dauerte eine Weile, bis es Angelos Sifakis gelang, sich Gehör zu verschaffen. Dann fragte er leise: »Aber was ist denn eigentlich in London passiert?«
»In London?«
»Was war so wichtig, dass die Vollversammlung sich gezwungen sah, das Wochenende damit zu verbringen, über Prinzipien zu diskutieren? Und schließlich zu diesem Ergebnis kam?«
»Ach so«, sagte Paul Hjelm, der auf dem Schlauch gestanden hatte. »Das.«
»Tja, das«, schaltete sich Arto Söderstedt ein. »Das war auf dem G20-Treffen in London. Ein Mann ist in meinen Armen gestorben. Ein Asiate.«
»Arto war als Beobachter dort, und er wurde nicht in kriminelle Handlungen verwickelt«, beteuerte Hjelm. »Aber das hätte genauso gut passieren können. Und dann hätte er keine Handlungsbefugnis gehabt. Wir sind am Wochenende zu dem Schluss gekommen, dass sich keiner von euch in so einem Fall machtlos fühlen soll.«
»Der Verbrecher ist möglicherweise der Linksverkehr«, sagte Söderstedt. »Weshalb ich nun doch glaube, dass es sich um einen Chinesen gehandelt hat. Japan hat Linksverkehr, China Rechtsverkehr. Der Mann hat den Polizeiwagen ganz einfach nicht gesehen, der auf der linken Spur angebraust kam.«
»Also schlichtweg ein Unfall?«, fragte Sifakis, in dessen Stimme möglicherweise eine Spur Enttäuschung mitschwang.
»Schlichtweg ein Unfall«, bestätigte Paul Hjelm. »Wenn auch ein ziemlich außergewöhnlicher.«
»Aber er wollte etwas von mir«, sagte Söderstedt. »Er hat mir etwas zugeflüstert. Unmittelbar bevor er starb.«
»Arto, das haben wir doch schon ausdiskutiert«, wiegelte Hjelm ab, und er klang müde. »Du musst das vergessen. Das weißt du. Selbst wenn es irgendeinen Verdacht auf ein Verbrechen gäbe, wir haben keinerlei Anhaltspunkte. Das Opfer ist noch nicht einmal identifiziert. Aber sein ungewöhnlicher Tod hat die Opcop-Gruppe aktiviert, und die wird jetzt in ihre wunderbare Bürolandschaft zurückkehren, fleißig ihre internen Mails lesen und abwarten, bis ich angemessene Aufträge ausgemacht habe. Das Meeting ist hiermit beendet.«
Die Opcop-Gruppe blickte ihren Chef verdutzt an. Das epochemachende Meeting verlief gewissermaßen im Sande. Wie ein spärliches Rinnsal in einem trockenen Flussbett verließ die Gruppe den Raum. Nur drei Männer blieben zurück.
Es waren Paul Hjelm, Arto Söderstedt und Jorge Chavez, und die Erleichterung der drei, wieder Schwedisch sprechen zu können, war deutlich.
»Mir fällt gerade ein, dass ich noch nie zuvor einen Chefposten innehatte«, sagte Hjelm. »Hoher Polizeibeamter war ich, ja. Aber nie Chef. ›Are we ready?‹ Meine Güte, wie peinlich.«
»Jetzt weißt du jedenfalls, wie Politik funktioniert«, meinte Chavez.
»Nun komm schon«, warf Söderstedt ein. »Du bist jetzt schon einen Monat lang der Chef von diesem Haufen. Es läuft doch gut.«
»Ich weiß, dass du die Sache mit diesem Chinesen weiterverfolgen wirst«, sagte Hjelm und sah ihm in die Augen. »Aber jetzt wissen alle von dem Vorfall. War es denn wirklich nötig, das hier aufs Tapet zu bringen?«
»Ich hab doch gesagt, du weißt jetzt, wie Politik funktioniert«, wiederholte Chavez. »Arto hingegen weiß es nicht. Aber er ist ja auch nicht der Chef.«
»Lediglich hoher Polizeibeamter«, warf Söderstedt ein. »Außerdem will ich, dass die Sache auf unserer Agenda steht.«
»Offenbar hast auch du gelernt, wie es in der Politik läuft«, sagte Chavez. »Das hätte ich von unserem ungekrönten König der Fettnäpfchen nicht erwartet.«
Paul Hjelm legte seine Hände flach auf das Katheder und betrachtete sie eine Weile. Dann sagte er: »Wie steht ihr eigentlich zu dem Ganzen? Meint ihr, Opcop ist eine Totgeburt?«
»Es wird nicht einfach werden – aber das Modell ist vermutlich das einzige zukunftstaugliche«, meinte Söderstedt. »Jedenfalls, wenn wir die großen Schurken fangen wollen. Wir entwickeln uns gerade zu einer Gesellschaft, in der man einfach davonkommt, wenn man das Verbrechen über die Grenzen verschiebt.«
»Aber steuern wir so nicht auf eine Überwachungsgesellschaft zu?«, entgegnete Hjelm. »Haben wir nur die Wahl zwischen dem einen oder dem anderen?«
»Das sollten wir lieber heute Abend bei einem Bier diskutieren«, meinte Chavez. »Bis jetzt ist es jedenfalls herrlich, Strohwitwer zu sein, Jungs.«
»Das bin ich schon seit dem Jahreswechsel«, klagte Hjelm. »Während du erst am Freitag gekommen bist. Das ist ein Unterschied.«
»Aber dafür hast du meine Frau für ein paar Wochen hiergehabt, du Bandit«, konterte Chavez.
»Das ist eben die Kehrseite der Arbeit im Ausland«, meinte Söderstedt. »Ab morgen bin ich übrigens nicht mehr allein. Meine Familie zieht hierher.«
»Oh, wirklich?«, stieß Hjelm aus. »Davon hast du noch gar nichts erzählt.«
»Ich habe es nicht zu hoffen gewagt, aber jetzt scheint es in der Tat zu klappen. Anja hat aushandeln können, dass sie für ihren Job nicht vor Ort sein muss, und wir haben ja nicht mehr so viele Kinder im Haus.«
»Nicht mehr als vierzehn?«, fragte Chavez.
In dem Moment ertönte ein eigentümlicher Summton aus Hjelms Computer auf dem Katheder. Mit einer routinierten Handbewegung klickte er mit der Maus ein Symbol an und sagte: »Es ist an der Zeit, die Akustik dieser Kathedrale zu testen.«
Ein bläulicher Blitz schien durch den Versammlungsraum zu zucken. Es dauerte einen Moment, bis sie ihn an einer bestimmten Stelle an der Wand lokalisierten. Ein bläulich blitzendes Quadrat leuchtete in der Reihe der dunkelgrauen Flächen auf. Auf dem Bildschirm erschien ein weibliches Gesicht. Es sah allerdings gar nicht sanftmütig aus. Eher aufgebracht. Die Wangen waren leicht gerötet.
»Oh, Mann!«, platzte es aus Söderstedt heraus. »Schließt schnell die Türen. Wenn die anderen das zu sehen bekommen, werden sie Pogrome gegen uns Schweden anzetteln.«
»Hallo«, sagte die dunkelhaarige Frau auf dem Bildschirm. »Funktioniert es?«
»Du hast gerade unsere neu installierte Europol-Videokommunikationsanlage eingeweiht«, erklärte Paul Hjelm. »Hallo, Schatz.«
»Schatz?«, wiederholte die Frau. »Ist das hier nicht ein offizieller Europol-Kanal?«
»Er kann es sein«, antwortete Hjelm. »Und zwar dann, wenn ich es sage.«
»Die Macht ist ihm tatsächlich zu Kopf gestiegen«, seufzte Jorge Chavez. »Ich bin voll und ganz deiner Meinung, Kriminalkommissarin Kerstin Holm, das hier ist ein offizieller Europol-Kanal, der nicht mit Privatgesprächen kontaminiert werden darf.«
Auf dem Bildschirm tauchte ein anderes Gesicht auf. Mit blonden kurzen Haaren, aber ebenso unverkennbar weiblich.
Beim Anblick dieses Gesichts fuhr Chavez fort: »Hej, Schatz, bist du etwa auch da?«
»Wer ist denn dieser eigentümliche Spanier?«, fragte Sara Svenhagen in Stockholm und machte wieder Platz für ihre Chefin.
»Es handelt sich hier um einen offiziellen Anruf von der schwedischen Einheit der Opcop-Gruppe in Stockholm«, sagte Kerstin Holm.
»Das Ganze erinnert allerdings mehr an eine Schlangengrube«, ließ Arto Söderstedt verlauten.
»Seht zu, dass ihr diesem aufmüpfigen Finnen das Maul stopft«, forderte Kerstin Holm, »und hört gut zu, was ich zu sagen habe.«
»Ich höre«, erwiderte Paul Hjelm klar und deutlich.
Kerstin Holm räusperte sich und sagte: »Ich glaube, ich habe den ersten Fall für die Opcop-Gruppe aufgetan.«