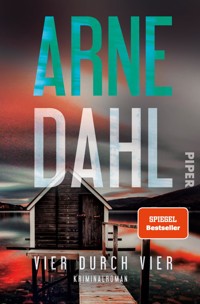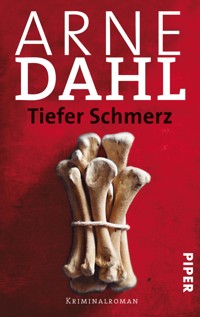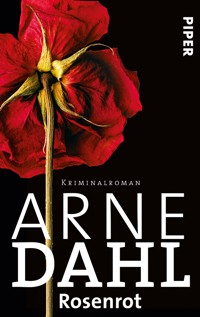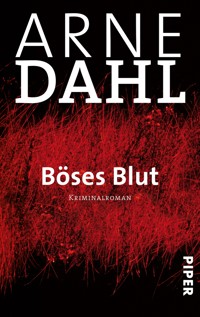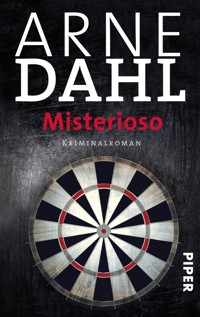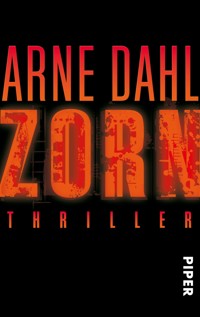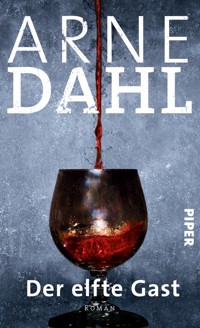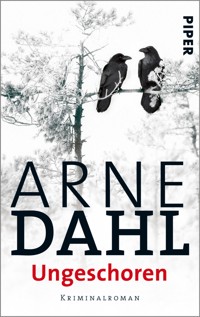
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vier mysteriöse Buchstaben, P-U-C-K, und vier Opfer, die scheinbar nur eines miteinander verbindet – eine kaum sichtbare Tätowierung. Am hellsten Tag des Jahres präsentiert uns Arne Dahl einen gespenstisch düsteren Täter … Ein kniffliger Fall für das Stockholmer A-Team um Kommissarin Kerstin Holm. Raffiniert, atemberaubend und geradezu teuflisch geht dieser Kriminalroman an die Grenzen des Genres.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Schwedischen von Wolfgang Butt
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe
3. Auflage 2011
ISBN 978-3-492-95195-1
Die Originalausgabe erschien 2003 unter dem Titel »En midsommarnattsdröm«, Ordupplaget, Stockholm 2003. Deutschsprachige Ausgabe: © Piper Verlag GmbH, München 2007 Das Zitat in Kapitel 32 stammt aus: William Shakespeare: »Ein Sommernachtstraum«, aus dem Englischen von Erich Fried. © Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 1970 Umschlagkonzept: semper smile, München Umschlaggestaltung: Cornelia Niere, München Umschlagfoto: Oxford Scientific / mauritius images
1
Dort unten liegt Schweden. Tief unten. Der junge Mann sieht die lang gezogene Küste gut zehn Kilometer unter sich.
Es ist ein wolkenloser Sommertag. Ganz Schweden ist klar erkennbar, ganz Skandinavien. Er kehrt nach Hause zurück. Aber zu Hause ist jetzt etwas anderes.
Er hat Bauchschmerzen.
Der junge Mann versucht zu verstehen. Er versucht, all das Neue zu verstehen. Alles, was geschehen ist. Er liest in einem dicken Stoß Papiere und versucht zu verstehen, was die Mittsommerwoche bedeutet hat.
Alles, was sie mit sich gebracht hat.
Alles, was sie verwandelt hat.
Alles, was sie zurechtgerückt hat.
Das Leben kann immer noch überraschen, denkt der junge Mann überrascht. Ich bin als ein Mensch abgereist und komme als ein anderer zurück. Und zu Hause ist auch etwas anderes.
Er wendet sich wieder dem Stoß Papiere zu.
Und weiß, dass nichts jemals zu Ende ist.
2
Das Land, in dem die Nächte den ganzen kurzen Sommer über immer dunkler werden, dachte sie. Es ist mein Land.
Und genau dieser Gedanke war verboten.
Es ging nicht mehr. Es konnte so nicht weitergehen. Heute Nacht, in dieser hellen Sommernacht, sollte eine Veränderung eintreten. Auf die eine oder andere Weise.
Sie wollte nicht hinausgehen und sich dem Sog der nordischen Angst dieser schönen Sommernacht aussetzen. Diesem seltsam schönen, süß ziehenden Schmerz, der bis ins Mark drang.
Der Wehmut.
Noch nicht richtig.
Sie blieb stehen und sah durchs Treppenhausfenster hinaus. Ein wenig unbeteiligt. Von der Seite. Immer noch durchs Fenster.
Es war wie ein Gemälde.
Und das einzige Motiv war das nackte, reine Mittsommerlicht.
Und es ist meins, dachte sie. Ich habe es mir verdient. Ich habe ein Recht darauf. Das, wenn nichts sonst, hat mich eingeladen.
Dann trat sie hinaus in die helle Nacht.
Hell und rein. Und kalt. Sie hielt einen Augenblick inne und setzte sich der Kälte aus. Bis sie schauderte. Das Schaudern setzte sie in Bewegung.
Bald war die hellste Nacht des Jahres. Bald würden die Nächte wieder länger werden. Sommer konnte man es noch nicht nennen. Nicht im Ernst. Man konnte doch diese Eiseskälte nicht im Ernst Sommer nennen. Ihr Körper, wenn nichts anderes, erinnerte sich an ganz andere Sommer.
Sie wollte nur ihr Leben weiterleben. Ihr eigenes. Das war alles. Und das durfte sie nicht.
Nedim. Die Trauer überfiel sie. Mit voller Wucht.
Sie musste stehen bleiben. Ihr Herz erstarrte zu Eis.
Nedim. Mein Bruder. Nedim und Naska. Nur ein Jahr zwischen ihnen. Immer zusammen. Immer füreinander da. Immer bereit. So nah, wie man sich nur kommen kann. Die kleinen Geschwister.
Wie ähnlich wir uns waren.
Wie unglaublich ähnlich.
Aber jetzt nicht mehr.
Sie wanderte weiter durch das menschenleere Hochhausgebiet. Es war zwanzig nach zwei in der Nacht und taghell. Als wäre die Welt leer. Vollständig leer – bis auf ein klares, klares Licht.
Und sie selbst.
Nedim, warum musste es so kommen? Warum war es nicht möglich, sich zu lösen? Alles, was ich will, ist leben.
Die Unterdrückung durch die Unterdrückten.
Neuer Name, neue Telefonnummer, neue Adresse, neue Stadt – es reichte nicht. All die Mühe, die du darauf verwendet hast, mich zu finden, Nedim, kann man sie als Liebe deuten? Als verzerrte Bruderliebe?
Stockholm hätte mich schlucken sollen, aber du hast mich gefunden. Du hast nach einer Nadel im Heuhaufen gesucht, und du hast sie gefunden. Aber sie wird dich stechen. Es kommt nur darauf an, zuerst zu stechen. Denn Wörter werden niemals reichen. Wörter haben mit der Sache nichts zu tun. Er benutzte Wörter nicht auf diese Art und Weise. Als Gespräch. Als Dialog.
Das Telefongespräch gestern Abend. Nicht viele Wörter. Die Wörter als Maskierung. Als ob er ein geschäftliches Gespräch führte.
»Wir müssen uns treffen, Naska.«
»Ich heiße nicht Naska. Ich heiße Rosa.«
Am Wegrand wuchsen überall Blumen. Sie pflückte eine und betrachtete sie. Sie war lila und roch komisch.
Sieben Sorten Blumen unter dem Kopfkissen, und die Mittsommernacht würde magisch sein. All diese merkwürdigen Wörter: Kommt, Lilien und Akeleien, kommt, Rosen und Salbei, komm, liebliche Krausminze, komm, Herzensfreude.
Was war eine Akelei?
Asphaltblumen mussten reichen, dachte sie und lächelte schief. Sie pflückte eine welke blaue. Noch fünf, und ihre Wünsche würden in Erfüllung gehen, die Welt würde verwandelt sein.
Die Nacht magisch werden.
In gewisser Weise war sie es schon. Dieser Sog. Der Klumpen in der Magengegend. Das Licht, das im Hals in die Irre ging.
Nur eins sprach dafür, dass sie die Nacht überleben würde.
Und das war nicht das Messer. Das alberne kleine Schweizer Klappmesser in ihrer Tasche. Das sie außerdem erst aufklappen musste, um es zu benutzen. Sie pflückte noch eine Blume, eine stark verzweigte gelbe. Natürlich würde sie das Messer aufklappen. Sobald sie sieben Sorten Blumen hatte, um sie in die Handtasche zu legen.
Aber nicht vorher.
Das Flüchtlingslager in Schonen. Sie war sechs, er sieben. Während sie warteten, lernten sie Schwedisch. Aber vor allem badeten sie. Der kleine See. Das eiskalte schwedische Wasser. Zu dem sie heimlich schlichen. Nedim und Naska.
Die kleinen Geschwister.
Warum nicht einfach die Polizei rufen? Warum nicht dafür sorgen, dass die Polizei am Treffpunkt ist?
Weil es ein Ende haben musste. Weil sie – obwohl er nicht zuhörte – mit ihm sprechen musste, ihn dazu bringen musste zu verstehen. Es war so wichtig, dass er und seinesgleichen verstanden. Die jüngere Generation. Früher oder später mussten sie alle zuhören.
Und weil er ihr Bruder war.
Sie pflückte eine seltsame orangefarbene Blume mit zerzausten Blütenblättern. Vier. Sie musste die Namen lernen.
Jetzt sah sie das Haus. Es war niedriger als die anderen. Ein Clubhaus, Vereinsheim, Sarg.
Sie sah auf die Uhr. Bald halb drei. Der Todesaugenblick.
Da brach die Angst über sie herein. Es kam ihr vor, als sollte sie erstickt werden, die Angst zwang ihr die Zunge zurück in den Rachen, und es war ihr unmöglich zu atmen.
Es war einfach nicht möglich.
Warum ging sie ihrem Tod entgegen? Es hätte verhindert werden können. Hatte er nicht angerufen und sie gewarnt, gerade damit sie ihn hindern sollte? War es nicht eigentlich eine Bitte, die lautete: Halte mich auf, ich kann mich nicht selbst aufhalten, die Tradition von Jahrhunderten drückt mir das Messer in die Hand, und ich kann mich nicht selbst aufhalten.
Du musst es für mich tun, Naska, deshalb rufe ich dich an.
Nein, Nedim, du selbst musst dich aufhalten, du selbst musst die Wahl treffen, du selbst musst die Jahrhunderte umstülpen und das Abgestandene auslüften. Das kann ich nicht für dich tun.
Ich gehe meinem eigenen Tod entgegen, weil ich mich darauf verlasse, dass du dich auf deine Vernunft besinnst. Dass du Wörter wieder zu Wörtern werden lässt. Weil gerade du gerade jetzt mit der Familientradition brechen sollst. Mein wehrloser Körper stellt diese Forderung an dich. Meine Worte.
Aber sie hatte ja das Messer. Solange das Schweizer Klappmesser ungeöffnet in ihrer Handtasche lag, waren ihre Argumente verständlich. Sobald sie das Messer öffnete und in die Hand nahm, sagte sie etwas ganz anderes.
Es war eine Gratwanderung.
Sie bewegte sich wieder vorwärts. Die Blumen wuchsen immer spärlicher. Hätte sie noch die Zeit, sieben Sorten Blumen zusammenzubekommen? Hätte sie noch die Zeit, sich auf eine schwedische Tradition zu verlassen?
Sie wusste nicht, ob die kleine rosa Pflanze, die aus dem Steinpflaster zwischen dem Bürgersteig und der Straße wuchs, wirklich als Blume zählte, doch sie riss sie aus und steckte sie in den Strauß. Fünf jetzt. Fünf Blumen unter dem Kissen.
Aber was für einem Kissen?
Dem Sargkissen?
Sie war bei dem niedrigen Vereinslokal angelangt. Keine Blume, so weit das Auge reichte, nicht einmal im Blumenbeet. Als wäre es vorbestimmt, dass sie keine richtige Chance hätte.
Sie sah die Öffnung, den gewölbten Durchgang zum Hinterhof. Den Treffpunkt. Nicht ein Laut, nicht eine Bewegung, nur das glasklare, blendende Nachtlicht.
Eine schöne Nacht zum Sterben.
Sie erreichte die Ecke. Eine Weile blieb sie an die Wand gedrückt stehen. Sie sah auf ihre Füße. Zwischen ihren Sportschuhen wuchs eine kleine weinrote Blume aus dem Asphalt.
Sie nahm sie und lächelte schwach. Sechs Sorten sind es geworden, dachte sie und bog um die Ecke. Das nennt man »knapp daneben«.
Er saß auf einer Bank ein paar Schritte im Hinterhof. Sein gebeugter Rücken war ihr zugewandt, sein Gesicht war nach unten gerichtet, auf die Knie. Als drückte das Gewicht der ganzen Welt seine Schultern zu Boden.
Sie schlich vorwärts. In der Hand hielt sie kein Schweizer Klappmesser, nur sechs Sorten Blumen in einem traurigen Strauß.
Sie selbst war die Waffe. Ihre Erscheinung. Alles, woran sie damit appellieren konnte. Das war ihre Waffe.
Sie hatte ihn fast erreicht. Er blieb sitzen, bewegte sich nicht. Die Schwere erschien unerträglich.
Gleich würde er sich umdrehen. Das Messer würde in seiner Hand aufblitzen: der entscheidende Augenblick.
»Nedim?«, sagte sie tonlos.
Er antwortete nicht. Saß nur da und schien todmüde zu sein.
»Nedim?«, wiederholte sie, etwas lauter, und legte die Hand auf seinen Rücken.
Leicht, leicht.
Da kippte er nach vorn.
Die unsichtbare Schwere drückte ihn hinunter auf den Asphalt. Er fiel, haltlos, schwer, plump.
Seine Augen starrten dunkel in die helle Sommernacht. Unter den Augen war es vollkommen schwarz, als hätte er Monate nicht geschlafen.
Jetzt würde er ewig schlafen.
Sie betrachtete ihren Bruder. In der Rechten hielt er ein großes Messer mit einer breiten Klinge. Es blitzte nicht.
Sein weißes Hemd war ganz rot.
Und in einem Knopfloch steckte eine blauviolette Blume. Sie sah aus wie eine schön geformte Glocke. Als sie sie aufnahm und in ihren Strauß steckte, schoss es ihr durch den Kopf, dass sie tatsächlich wusste, wie diese Blume hieß.
Akelei.
Ganz still öffnete sie ihre Handtasche und legte den Strauß mit sieben verschiedenen Sorten Blumen neben das ungeöffnete Schweizer Klappmesser.
Dann schloss sie die Tasche.
Rührte sich nicht. Atmete.
Und aus Tiefen, die sie für ausgestorben gehalten hatte, stieg ein Weinen auf, das sich mit dem schwedischen Mittsommerlicht zu einem uralten Trauergesang vereinte, älter als alle menschlichen Grenzen.
3
Der Fotograf schloss sich auf dem Weg durch die Korridore einem Paar mit Zwillingskinderwagen an. Sie schienen sich auszukennen.
Der Familienvater, mit seiner schweren Lederjacke wohl eine Spur zu warm angezogen, warf ihm einen Blick zu und nickte kurz. Er war ein großer Mann in den Fünfzigern mit einem in die Länge gezogenen, gelangweilt wirkenden Gesicht. Aus dem Zwillingskinderwagen blickten zwei hübsche Mädchen auf. Sie waren etwa zwei und drei Jahre alt, und beide hatten ihres Vaters lang gezogene Gesichtsform. Es sah ziemlich lustig aus.
»Warte, Viggo«, rief die Ehefrau hinter ihm. Der Mann stöhnte hörbar und brachte das Gefährt mit einer Vollbremsung zum Stehen.
»Wir sind schon zu spät dran«, sagte er ungnädig. »Was ist denn jetzt schon wieder?«
»Wir müssen die Blumen auswickeln, man soll doch nicht sehen, dass sie aus dem Konsum sind«, sagte seine Frau.
»Es ist noch ein gutes Stück, das kannst du im Aufzug machen.«
»Im Aufzug gibt es Überwachungskameras«, sagte seine Frau und kämpfte mit dem Papier des mittelmäßigen Blumenstraußes. »Warum muss dieses Fest überhaupt im Polizeipräsidium stattfinden?«
»Was ist denn daran nicht in Ordnung?«
»Es ist ein Labyrinth. Niemand findet hin. Sieh doch nur den Mann neben dir.«
Der Mann in der Lederjacke drehte sich um und blickte auf den Fotografen hinunter. »Wollen Sie auch hin?«, fragte er. »Zum Fest?«
»Ja«, nickte der Fotograf. »Ich bin der Fotograf. Ich habe mich wirklich ein bisschen verlaufen.«
»Aha«, sagte der Mann und streckte ihm die Hand hin. »Sie haben mir den Job abspenstig gemacht. Sonst bin ich der Mann mit der Kamera. Die Kollegen sagten, sie wollten diesmal eine etwas professionellere Arbeit.«
Der Fotograf ergriff die Hand und schüttelte sie, doch bevor er sich vorstellen konnte, rief die Frau: »So, das war’s, ich hoffe nur, er sieht nicht, dass die Tulpen verfault sind.«
»Du meinst ›verwelkt‹. Man sagt ›verwelkt‹ bei Blumen.«
»Nein, ich meine ›verfault‹.«
Nach einer ausgedehnten Wüstenwanderung erreichten sie den Aufzug. Die Kinder starrten den Fotografen misstrauisch an, während er die große Kamera auspackte und das Blitzlicht aufschraubte. Worauf das ältere Mädchen dem jüngeren eine Rassel übers Jochbein schlug und beide ein Heulkonzert anstimmten.
»Charlotte!«, rief der Mann mit untröstlicher Stimme und schnappte sich die Rassel.
Da glitten die Aufzugtüren zur Seite, und zwanzig Augenpaare richteten sich auf sie. Von der Decke des Saals hing ein großes Spruchband herab und verkündete in knallroten Buchstaben: ›Endlich! Hultin geht in Pension!‹ In etwas kleineren, anscheinend vor kurzem erst geschriebenen Buchstaben stand darunter: ›Wie Schwedens Nationalmannschaft!‹
Die brüllende Familie befreite sich aus dem Aufzug, und ein auffallend weißhaariger Mann trat ihnen entgegen; er schien der Einzige zu sein, der sich in ihre Nähe wagte.
»Für mich?«, sagte er in finnlandschwedischem Tonfall und griff nach der Rassel. »Das wäre aber nicht nötig gewesen.«
»Schnauze«, erwiderte der Mann in der Lederjacke und schnappte sich die Rassel wieder.
»Und ausgerechnet heute scheidet Schweden gegen Senegal aus«, fuhr der Weißhaarige fröhlich fort. »Das hätte Finnland besser gemacht.«
»Was redest du da?«, murmelte die Lederjacke. »Glaubst du, ich hätte Zeit, mir die Fußball-WM anzusehen? Alles, was ich mache, wenn ich zu Hause bin, ist, Windeln zu wechseln.«
»Wo haben wir denn den Jubilar?«, fragte die Ehefrau hinter seinem Rücken.
»Bist du auch noch da, Astrid?«, fragte der Weißhaarige, schob den Großen zur Seite und umarmte sie: »Was für flotte Tulpen.«
»Still, Arto«, stieß sie hervor. »Glaubst du, er merkt was?«
»Er merkt nichts. Er schwebt auf Champagnerperlen.«
Der Aufzug leerte sich. Der Fotograf blieb allein zurück. Er schoss ein Bild von dem Mann mit dem weißen Haar.
Dieser blinzelte einen Moment geblendet, bevor er sagte: »Ah, ausgezeichnet. Vom Fotoring? Wir haben schon auf Sie gewartet.«
»Tut mir leid, dass ich ein wenig verspätet bin«, sagte der Fotograf. »Ich habe mich verirrt.«
»Da sind Sie nicht der Einzige. Ich bin Arto Söderstedt, Festkomitee. Jetzt störe ich Sie nicht länger bei der Arbeit. Nur rein ins Getümmel und frisch drauflos mit dem Auslöserfinger.«
Der Fotograf brachte die Kameratasche in Ordnung und stürzte sich ins sogenannte Getümmel.
Nachdem der Geräuschpegel durch die spektakuläre Ankunft des Zwillingskinderwagens vorübergehend gedämpft worden war, stieg er wieder an. Die Gäste standen in kleinen Gruppen zusammen, die sich mit gewisser Regelmäßigkeit auflösten und neu formierten.
Der Fotograf machte eine Reihe von Übersichtsbildern. Bald hatte man sich an seine Blitze gewöhnt und nahm sie als natürlichen Bestandteil des Fests.
Zuerst das Spruchband. Verschiedene Konstellationen unter dem Spruchband, verschiedene Winkel.
Es war nicht schwer, die Person, der zu Ehren das Fest stattfand, zu entdecken. Der Mann stand mit einem Champagnerglas in der Hand da und unterhielt sich mit Gratulanten zur Rechten und zur Linken. In regelmäßigen Abständen schob er die Minibrille hoch, die darauf bestand, auf seiner enormen Nase abwärtszugleiten.
»Die Blumen riechen ein bisschen eigenartig«, sagte er und schüttelte die ausgestreckte Hand der Lederjacke.
»Es sind spezialimportierte holländische Tulpen«, sagte die Lederjacke. »Du kannst jetzt aufhören, misstrauisch zu sein, Jan-Olov. Die Zeit ist vorbei.«
»Und die Streifen verschwinden über Nacht?«
»Es wird gut gehen. Kerstin weiß, was sie tut.«
»Das ist mir klar«, sagte die Hauptperson. »Ich habe sie selbst ausgesucht.«
»Vielleicht nicht ganz allein, oder?«, sagte ein braungebrannter blonder Mann, der von der Seite herantrat und der Hauptperson einen freundschaftlichen Faustschlag auf den Oberarm versetzte.
»Doch«, sagte die Hauptperson sachlich und betrachtete den Oberarm, doch da hatte sich der Blonde, dessen welliges Haar stark an ein Toupet erinnerte, schon der Ehefrau der Lederjacke zugewandt.
»Ich glaube, wir kennen uns noch nicht«, sagte er mit funkelndem Lächeln. »Ich bin Waldemar Mörner, der formelle Chef der A-Gruppe.«
»Astrid«, sagte die Angesprochene. »Ich gehöre zu Viggo Norlander.«
Der Fotograf schoss ein paar Bilder und streifte dann durch den Saal.
Eine unglaubliche Menge Kinder geriet jetzt vor die Linse der Kamera. Wie eine Mischung aus Jugendzentrum und Kindergarten. Er zählte neun etwas kleinere Kinder und zwei etwa sechzehnjährige Mädchen, die für sich an einem Tisch saßen und gelangweilt dreinblickten. Die neun kleineren waren eine gemischte, aber auffallende Schar: vier waren Mulatten, vier kreideweiß, und ein Junge war dunkelhaarig. Er war vielleicht acht Jahre alt und schien sich wie im Paradies zu fühlen, so wie er herumlief und die Mädchen an den Haaren zog. Sie schrien wie auf Bestellung. Wie Orgelpfeifen.
Die Kamera fing jetzt die beiden größeren Mädchen ein. Eines war strohblond und gehörte eindeutig zu den vier kleineren kreideweißen Kindern. Das zweite war dunkelblond und schwerer zuzuordnen.
»Voll ätzend hier, so was Beschissenes«, sagte die Strohblonde.
»Volltrottel«, sagte die Dunkelblonde. »Scheiße, dass mein Alter mich mitgeschleppt hat. Ich muss nett zu ihm sein, jetzt, wo sie sich scheiden lassen.«
»Ich wollte, meine täten es. Dann hätte ich ein eigenes Zimmer.«
Der Fotograf drückte ab. Der Blitz sprang ihnen in die Augen.
»Hau ab«, fauchte die Strohblonde. »Verfluchter Dodel.«
»Oberfreak«, zischte die Dunkelblonde.
Das Kameraauge schwenkte weiter durch den Saal.
Ein sehr großer Mann hob das Champagnerglas in Richtung eines ungleichen Paars um die dreißig und sagte mit Nachdruck: »Mädchen sitzen im Schoß, und Jungen trägt man unterm Herzen.«
Das ungleiche Paar wechselte einen Blick. Die Frau war groß, blond und kurzgeschoren, der Mann bedeutend kleiner, von dunklem Typ und mit halblangem Haar. Vor seiner Brust hing ein Bündel in einem Tragegurt.
Der Fotograf drückte mehrmals ab und kassierte eine Serie wenig freundlicher Blicke. Er behielt die Kamera vorm Gesicht.
»Mädchenbauch«, sagte die kurzgeschorene Frau versonnen. »Du hattest recht, Gunnar.«
»Das ist unfehlbar«, sagte der Riese und streichelte behutsam über die dunklen Haarstoppeln des kleinen Bündels. »Isabel ist ein schöner Name. Wann ist die Taufe, Sara?«
»Das steht noch nicht ganz fest«, sagte der dunkelhäutige Mann mit einem Anflug von Irritation. »Wir diskutieren noch, welche Kirche. Katholisch oder protestantisch.«
»Dass man immer etwas findet, worüber man sich streiten kann«, sagte der Riese bedächtig. »Es ist ein natürliches Bedürfnis. Wir zum Beispiel streiten uns um ein Haus.«
»Ein Haus?«, sagte die Kurzgeschorene.
»Eher eine Hütte. Ein Häuschen. Griechenland oder Italien. Ludmila hat ein kleines Anwesen in Venetien gefunden, vierzig Kilometer von Venedig entfernt. Ich will immer noch auf die Kykladen.«
»Aber wie könnt ihr euch das leisten?«, platzte der Dunkelhäutige heraus.
Der Riese zuckte mit den Schultern. »Tja, Jorge«, sagte er. »Wir haben beide eine ganze Reihe von Jahren unser sparsames Singleleben geführt. Keine wirklichen Ausgaben. Plötzlich können wir es uns leisten. Es war schön, das zu entdecken. Ich hatte nicht einmal mit dem Gedanken gespielt.«
»Wie kann man sich auf der anderen Seite einen neuen E-Bass leisten?«, fragte die Kurzgeschorene. »Mit eben erst gekaufter Wohnung und einem neugeborenen Kind?«
Der Dunkelhäutige gab keinen Mucks von sich. Er war vergrätzt.
Der Riese sagte: »Also dafür nutzt du deinen Erziehungsurlaub, Jorge?«
»Wenn man mit dem Messer an der Kehle etwas Positives über dich sagen müsste, Gunnar, dann dass du billige Pointen in der Regel vermeidest.«
»Ich habe es ganz wörtlich gemeint. Wertfrei. Nutzt du dafür deinen Erziehungsurlaub?«
»Es ist doch nichts, worüber man sich aufregen müsste. Es war eine gute Gelegenheit, wieder mit dem Spielen anzufangen. Wir sind eine Gruppe von Amateuren, die im Erziehungsurlaub sind.«
»Aber E-Bass? Ich dachte, du spielst Jazz?«
»Das eine schließt das andere nicht aus«, sagte die kurzgeschorene Frau mit schmalem Mund. »Er hat auch einen neuen Kontrabass gekauft. Auf Raten.«
»Jetzt wollen wir doch nicht streiten«, sagte der Große väterlich. »Denkt lieber an Henri Camara. Dann haben wir Grund, gemeinsam sauer zu sein. Gemeinsam Trübsal zu blasen.«
»Hör bloß damit auf«, sagte der Dunkelhäutige. »Scheißspiel.«
»Henri Camara?«, fragte die Kurzgeschorene.
»Der Mann hat im Achtelfinale Schweden gegen Senegal zwei Tore geschossen. Henrik Larsson hat eins geschossen, und das war prima. Denkt positiv.«
Es war eine gute Gelegenheit, sich zu entfernen. Der Fotograf feuerte ein paar Prachtblitze ab, und seine Schritte, als er die schwachen Babyschreie hörte, waren eindeutig beschleunigt.
Er machte bei einer anderen Menschentraube halt.
Eine kohlschwarze Frau sagte im Dalarnadialekt: »Wie schön sie spielen. Ich hatte mir ein bisschen Sorgen gemacht, dass es ein Chaos werden würde.«
Der kreideweiße Mann, den der Fotograf am Aufzug getroffen und der sich als Arto Söderstedt vorgestellt hatte, legte den Arm um eine fast ebenso kreideweiße Frau und sagte nachdenklich: »Es erinnert an Schach …«
Der Fotograf drehte sich zu den spielenden Kindern um, die eine Hälfte weiß, die andere schwarz. Er lachte und machte ein paar Bilder.
Die kohlschwarze Frau lachte laut und vernehmlich. »Ja, Wahnsinn«, stieß sie aus. »Das Finale.«
Die Frau in der Umarmung sagte im finnlandschwedischen Tonfall: »Die weißen sind unsere – die Bockige da am Tisch auch –, und die schwarzen sind eure. Das ist nicht schwer zu erkennen. Aber wer ist der Junge, der die ganze Zeit herumläuft und die Mädchen an den Haaren zieht?«
»Der Joker im Spiel«, sagte der weiße Mann.
»Ich weiß es nicht«, sagte die schwarze Frau.
»Aber ich weiß es«, sagte der weiße Mann. »Und wenn man vom Teufel spricht, siehe da, die dritte Mutter. Mama Kommissar.«
Eine kleine dunkle Frau um die vierzig mit einem großen jüngeren Mann im Schlepptau gesellte sich zu der Gruppe. »So spricht man aber nicht über seine Vorgesetzte«, sagte sie in klassischem Göteborgdialekt.
Der Fotograf konnte noch ein paar Schnappschüsse machen, bevor sie sich zu den Kindern umwandte und schrie: »Anders! Was fällt dir denn ein! Du sollst die Mädchen nicht an den Haaren ziehen.«
Der Junge lachte laut und zog gleich wieder ein Mädchen an den Haaren.
»Es ist okay«, sagte die schwarze Frau. »Noch finden es die Mädchen ganz lustig.«
»Das Problem ist, dass wir nie aufhören, es ganz lustig zu finden«, sagte die Göteborgerin und streckte die Hand aus. »Ich bin übrigens Kerstin Holm, und ich tippe mal, du bist Elsa Grundström.«
Die schwarze Frau schüttelte ihre Hand und sagte: »Ja, natürlich. Genau. Du übernimmst den Posten von Jan-Olov. Gratuliere. Oder was sagt man?«
»Das muss die Zukunft erweisen«, lachte die Göteborgerin. »Ja, das kann man sagen. Dies ist übrigens Jon Anderson, unser Neuzugang.«
Der große junge Mann streckte die Hand aus, verneigte sich höflich vor den Damen und nickte dem weißen Mann kurz zu.
»Jethro Tull?«, sagte die schwarze Frau.
»Was?«, sagte der große junge Mann.
»War das nicht der Sänger von Jethro Tull? Der die Flöte spielte und ziemlich pathetisch war? Jon Anderson?«
»Nein, nein, nein«, sagte der weiße Mann ernst. »Der hieß Ian Anderson. Jon Anderson hat in Yes gesungen. Einer anderen bemerkenswerten Dinorockband.«
»Aha«, sagte die schwarze Frau und ließ die Hand des jungen Mannes los.
»Und du bist …?«, fragte er höflich.
»Ja, Entschuldigung. Elsa Grundström, Niklas Grundströms Frau.«
Der große junge Mann machte ein fragendes Gesicht.
Der weiße Mann half ihm auf die Sprünge: »Hüte deine Zunge, Yes. Niklas Grundström ist Chef der Abteilung für Interne Ermittlungen.«
»Yes?«, platzte die weiße Ehefrau heraus. »Ist das nicht ein Spülmittel?«
Der große junge Mann sah jetzt äußerst verwirrt aus.
»Wir nennen ihn Yes«, sagte der weiße Mann. »Nach dem erwähnten Sänger von Yes. Also nicht nach dem Spülmittel.«
»Und du bist …?«, wiederholte Yes, eine Spur weniger höflich, mit dem Blick auf die weiße Frau.
»Anja Söderstedt. Weiße Dame.«
»Und ich bin die schwarze Dame«, sagte die schwarze Dame und zeigte auf die wilde Schachpartie.
Der große junge Mann gab auf. Sein Lächeln, als er die Gesellschaft mit einem Nicken verließ, wirkte ausgesprochen aufgesetzt. Der Fotograf fand es passend, genau in diesem Augenblick abzudrücken. Klick. Geblendet und verwirrt segelte der junge Mann in den Saal hinaus.
»Ein wenig steif vielleicht?«, flüsterte die weiße Frau vorsichtig.
»Ich habe gesagt, dass ihr so etwas nicht machen sollt, Arto«, ermahnte die Göteborgerin. »Wir müssen ihm eine Chance geben.«
»Yes, Sir«, sagte der Weiße.
Sie sah ihn resigniert an und schüttelte den Kopf.
»Ich wusste nicht, dass ihr euch vergrößert habt«, sagte die weiße Dame. »Arto erzählt nichts. Und auch von diesem Fernsehmord höre ich kein einziges Wort.«
»Da brauchst du doch nur irgendeine Abendzeitung aufzuschlagen«, sagte der Weiße mürrisch.
Die Göteborgerin nickte. »Es handelt sich leider nicht um Vergrößerung. Eher um Kompensation. Wir haben ja eine Reihe von Spitzenkräften verloren. Unter anderem an deinen Mann, Elsa.«
Die schwarze Frau nickte.
»Da siehst du«, sagte die Weiße. »Ihr Mann erzählt mal was. Du erzählst mir nichts.«
»Ich dachte, du wolltest es nicht wissen«, sagte der weiße Mann verlegen.
»Jon Anderson ist seit ein paar Monaten bei uns«, sagte die Göteborgerin. »Und wir haben heute Abend noch eine zukünftige Mitarbeiterin unter uns. Irgendwo steckt sie.«
Der Fotograf machte ein letztes Foto von der gemischten Gesellschaft und wanderte weiter. In seinem Sucher zeigte sich jetzt eine ungefähr fünfundzwanzigjährige Frau in kaputter Jeans mit Bauchnabelpiercing unter einem minimalen hellblauen Oberteil. Sie war mit einem Champagnerglas in der Hand unterwegs zu einer Menschentraube, hielt aber mitten im Bild inne und machte ein flehendes Gesicht. Der Fotograf drückte nicht ab, behielt aber die Kamera im Anschlag.
»Nicht mich«, flüsterte sie ihm zu. »Mir war nicht klar, dass man ordentlich gekleidet sein sollte. Es ist schon so peinlich genug.«
Der Fotograf blickte sich im Saal um. Das Bekleidungsniveau war zweifellos eine Spur höher. Er nickte. Sie dankte ihm schweigend, bahnte sich einen Weg durch den Kinderschwarm und schloss sich mit einem frischen »Hallo, hier komme ich« der Gruppe an.
Die Gruppe verstummte und sah sie abwartend an.
»Ich weiß nicht, ob ich jemanden von euch kennen sollte«, fuhr sie ein wenig angestrengt fort. »Ich habe die A-Gruppe bisher nur auf Bildern gesehen. Aber ich glaube nicht, dass ich hier jemanden erkenne. Müsste ich das?«
»Das kommt ganz darauf an, wer du bist«, sagte ein strammer, äußerst gut gekleideter Mann und fixierte sie.
Sie erwiderte seinen Blick, ohne mit der Wimper zu zucken.
»Ich nehme an, du hast schon eine Reihe von Schlussfolgerungen gezogen, was mich betrifft«, sagte sie. »Junges Ding mit zerrissener Jeans und Bauchnabelpiercing. Eine Spionin aus der Unterwelt, die auf einer Bananenschale hereingerutscht ist? Ein angeheuertes Callgirl? Eine Überraschungsstripperin?«
Ein Mann lachte laut hinter ihrem Rücken. Laut und herzlich. Sie drehte sich um. Die Blitze aus ihren Augen erloschen, als sie den dunkelblonden Mann mit einem roten Mal auf der Wange und einer trendgerechten Plastikbrille auf der Nase sah.
»Ich glaube, ich weiß, wer du bist«, sagte er ruhig. »Kerstin hat von dir erzählt. Schade, dass ich nicht mehr die Chance bekomme, mit dir zusammenzuarbeiten.«
»Dann bist du Paul Hjelm!«, rief die Frau aus. »Die Brille hat mich getäuscht. Du siehst aus wie ein Verwaltungsmensch.«
»Was ich inzwischen bin«, sagte der Mann und befingerte seine Leichtgewichtbrille. »Bald schaffe ich mir auch eine Armbanduhr an, dann ist die Verwandlung perfekt.«
Die junge Frau reichte ihm die Hand und schien plötzlich die Sprache verloren zu haben. »Paul Hjelm«, sagte sie nur.
Der Mann namens Paul Hjelm schüttelte ihre Hand und sagte: »Weil es keinen aus der A-Gruppe hier gibt, ist es wohl am besten, dass ich dich allen vorstelle. Hört mal alle her. Dies ist Lena Lindberg, der jüngste Neuzugang der A-Gruppe. Ihr erster Arbeitstag ist …«
»Morgen. Und entschuldigt meinen Aufzug. Ich wusste nicht, dass es ein so formelles Fest ist.«
»Das ist es auch nicht«, sagte Hjelm. »Für die meisten ist es einfach nur die richtige Art und Weise, einen Mann zu feiern, dem wir vieles verdanken.«
»Ich habe gehört, dass Hultin ein guter Chef war …«
»Erst jetzt, wo ich selbst Chef bin, weiß ich, wie gut. Der stramme und gut gekleidete Mann, dem du eben auf den Schlips getreten bist, ist Polizeiintendent Niklas Grundström, Chef der Abteilung für Interne Ermittlungen, also ein Mann, dem man tunlichst nicht auf den Schlips treten sollte. Dann haben wir Ludmila Lundkvist, Dozentin für slawische Sprachen und die Frau deines zukünftigen Kollegen Gunnar Nyberg.«
»Lebensgefährtin«, korrigierte eine dunkle kleine Frau mit schwachem russischen Akzent und nickte der jungen Frau zu. »Gunnar ist der große Kerl dort hinten.«
Der Fotograf machte ein paar Bilder. Die Blitze zuckten durch den Festsaal, als wäre ein mächtiges Gewitter im Anzug.
Der Mann mit der Plastikbrille fuhr fort: »Dann haben wir den Abteilungsdirektor Waldemar Mörner, den formellen Chef der A-Gruppe.«
Der Fotograf erkannte den Mann mit den an ein Toupet erinnernden blonden Locken und ließ einen weiteren Blitz los, dass es um das kreideweiße Lächeln Funken sprühte wie von Wunderkerzen.
»Entzückend«, sagte der Toupetmann und buckelte wie ein Lakai am Hofe Ludwigs XIV.
»Da sieht man’s«, sagte die junge Frau und hielt die Erscheinung mit dem Blick fest. »Worüber habt ihr gesprochen, bevor ich hereingeplatzt bin?«
Die Mitglieder der Clique beobachteten einander vorsichtig, um zu sehen, ob jemand sich erinnerte.
Die kleine dunkle Frau mit dem russischen Akzent sagte schließlich: »Kinder, glaube ich.«
»Genau«, sagte der Toupetmann. »Ich habe zurzeit eine Vaterschaftsklage am Hals. Oder wo man sie hat, vielleicht etwas weiter unten.«
»Weiter unten?«, fragte die junge Frau unbedacht.
»Ich habe nicht gesagt, weiter unten am Hals. Weiter unten als am Hals, habe ich gemeint. Falls es stimmt, habe ich irgendwo in Dalsland einen fünfundzwanzigjährigen Sohn. Ein interessanter Gedanke für einen Mann, der es eigentlich sein Leben lang ›mit‹ gemacht hat.«
Die junge Frau erkannte, dass sie keine höheren Wellen verursacht hatte, als sie hereingestürmt war. Hier wehte bereits ein frischer Wind. Äußerst sonderbare Bilder traten vor ihr inneres Auge.
Die Übrigen blieben ungerührt – sie kannten offenbar den Toupetmann und seine Schrullen. Der Fotograf machte noch ein Bild. Von dem verblüfften Gesicht der jungen Frau. Sie hatte nichts dagegen.
»Nein«, sagte die russische Frau in sachlichem Ton. »Ich glaube, das Gespräch fing damit an, dass ich zugab, wie mir Kinder fehlen. Vor allem jetzt, wo ich ein paar erwachsene Plastikkinder als Zugabe bekommen habe.«
»Plastikkinder?«, sagte die junge Frau.
»Ist das falsch?«, fragte die Russin besorgt. »Kann man das nicht sagen?«
Der gut gekleidete stramme Mann griff ein: »Da unsere familiären Verhaltensmuster dazu geführt haben, dass Begriffe wie ›Plastikpapa‹ und ›Plastikmama‹ in den Wortschatz aufgenommen worden sind, müsste man auch ›Plastikkind‹ sagen können. Obwohl ich glaube, dass das Wort in Schweden noch nie benutzt worden ist. Jedenfalls nicht in dieser Bedeutung.«
»Was ist denn ein Plastikpapa?«, fragte der Toupetmann und schien zu befürchten, selbst einer zu sein.
»Mamas neuer Freund«, sagte die Russin bestimmt.
»Aha«, seufzte der Toupetmann erleichtert. »Ja, von Frauen mit Kindern hält man sich natürlich fern. Das ist eine Binsenwahrheit.«
»Obwohl ich glaube«, sagte der Stramme und Gutgekleidete, »dass die Diskussion ganz woanders anfing. Ich glaube, sie begann bei Herrn Waldemar Mörners absoluter Unfähigkeit, an genetische Codes zu glauben.«
»Nun wollen wir mal nicht so sein«, sagte der Toupetmann gutmütig.
Der Gutgekleidete ignorierte ihn und wandte sich lächelnd der jungen Frau zu. »Wir können ja die Gelegenheit nutzen und die Überraschungsstripperin testen.«
»Sag bloß, Niklas«, platzte der Mann namens Hjelm heraus, »du warst die ganze Zeit auf Rache aus.«
»Nur ein bisschen«, gestand der Gutgekleidete und ließ ein unerwartet helles Jungenlachen hören. »Aber es ist auch ein Spiel, ein Detektivspiel. Die Fähigkeit, Anhaltspunkte aufzuschnappen. Denn es hat schon ein paar gegeben. Dies hier ist auch einer.«
»Okay«, sagte die junge Frau ruhig. »Die Überraschungsstripperin ist bereit.«
Der Gutgekleidete fixierte sie und wählte seine Worte sorgfältig: »Welches oder welche von den Kindern sind meine?«
Die junge Frau sah ihn überrascht an und blickte dann in den Saal. Der Fotograf folgte ihrem Blick. Es waren viele Kinder, aber sie waren ziemlich leicht zu sortieren. Ein kleiner dunkelhaariger Junge von etwa acht Jahren. Vier braune Kinder, deren schwarze Mutter leicht zu erkennen war. Vier sehr blonde, hellhäutige Kinder. Nein, fünf, wenn man das große Mädchen mitzählte, das mit einem ungefähr gleichaltrigen dunkelblonden Mädchen an einem Tisch saß und maulte. Dazu ein kleines Bündel auf dem Bauch eines dunkelhäutigen Mannes sowie zwei kleine Mädchen mit länglichen Gesichtern, die umhertapsten und mit Rasseln aufeinander einschlugen.
Die junge Frau beobachtete die Kinderschar eine ganze Weile und überlegte. Der Fotograf knipste ein Bild. Mit der verschmitzt lächelnden Gruppe im Hintergrund. Es wurde das drittbeste Bild des Tages.
Dann drehte sie sich um und sagte: »Das Mädchen am Tisch. Die Dunkelblonde, die so sauer ist.«
Der Gutgekleidete klatschte triumphierend in die Hände.
Der Mann namens Hjelm schob die Plastikbrille in die Stirn und sagte: »Auf gewisse Weise ist es richtig. Da und nirgendwo sonst hat diese Diskussion angefangen. Nämlich mit meiner Prahlerei, dass es mir gelungen ist, meine Tochter Tova mitzubringen. Eine unwahrscheinliche Leistung.«
Die junge Frau beobachtete ihn und runzelte die Stirn. Dann wandte sie sich fragend an den Gutgekleideten, der sich noch immer erfreut die Hände rieb. Er betrachtete sie eine Weile – lange genug, um sie dazu zu bringen, erste Anzeichen von Irritation zu zeigen.
Das war das Signal.
»Es sind die kleinen schwarzen«, sagte er.
Da lachten sie laut. Allesamt.
Sie lachte am lautesten von allen.
»Dann ist jetzt der Zeitpunkt für etwas ganz anderes gekommen«, sagte der Toupetmann und faltete ein zerknittertes Papier auseinander, das er aus seiner Tasche gefischt hatte. »Jan-Olov!«, rief er unnötig laut. »Es ist an der Zeit, dass ich ein paar passende Worte sage! Als Dank für die gemeinsamen Jahre!«
Die Kamera war jetzt auf die Hauptperson des Abends gerichtet und holte den Jubilar mit dem Zoom heran, wie er, den Arm um eine gut erhaltene ältere Frau gelegt, zehn Meter entfernt unter dem Spruchband stand. Es wurde ein Foto der wahrlich entlarvenden Gesichtsausdrücke.
Das zweitbeste Bild des Tages.
Selten war eine so große Nase so gerümpft.
Der Toupetmann stieg geschmeidig auf einen Stuhl, um von da aus weiter auf den Tisch zu klettern. Leider stand eines der Stuhlbeine auf einem kleinen Feuerwehrauto, sodass der Stuhl rasant zur Seite glitt. Das rechte Bein des Mannes war bereits auf dem Tisch, und das linke rutschte zurück, sodass er in einer Position landete, die man als Spagat bezeichnen musste. Da zog er das linke Bein an sich, bekam es unter den Tisch und riss es heftig hoch. Der ganze Tisch hob ab und schwebte einen Augenblick direkt über ihm, während er waagerecht in der Luft lag.
In dem Moment machte der Fotograf das beste Bild des Tages.
4
Gedankenlesen, dachte er. War so etwas wirklich möglich? Und wenn ja, passierte es ihm gerade? Saß da draußen jemand und zoomte seine Gedanken heran und lachte darüber, wie klein sie waren? Darüber, wie sie sich wiederholten?
Denn das war jetzt fast der einzige Gedanke, der ihn beschäftigte.
Am Tage war er ein wenig lächerlich. Dann konnte er selbst darüber lachen. Aber nachts entwickelte er sich zu einer Heimsuchung. Da war für Lachen kein Platz.
Keinerlei Platz.
Eng. Alles war inzwischen eng. Nirgendwo gab es Platz. Nachts rückten die Wände so dicht heran.
Er war noch nie zuvor in der Nähe einer Haftanstalt gewesen. So etwas hatte in seiner Vorstellungswelt kaum existiert. Es ging irgendwo anders vor sich. Auf der Schattenseite der Gesellschaft. Wohin die Blicke gewöhnlicher Menschen nie gelangten.
Und er durfte sich wohl als einen ziemlich gewöhnlichen Menschen bezeichnen. Ein Haus in Bagarmossen. Nichts Extravagantes. Eine ziemlich normale Familie mit Kindern im Teenageralter und allzu intensivem Kontakt mit den Nachbarn. Journalist, ohne sich direkt hervorzutun. Ehrenauftrag nach ein paar Jahrzehnten bei einem der Stockholmer Boulevardblätter. Ungefähr wie eine goldene Armbanduhr.
Und es sollte so einfach werden. Endlich ein richtiger Selbstgänger. Drastisch verringerte Redaktionsarbeit, keine trostlosen Reportagereisen mehr, keine versauten Wochenenden. Überhaupt ein bisschen weniger Anstrengung. Zwei Fernsehchroniken pro Woche, und das würde fast seinen Vollzeitjob abdecken.
Wie geschmiert würde es laufen, die gut zehn Jahre bis zu seiner Pensionierung. Eine angenehme, beneidenswerte Existenz.
Er war kein Intellektueller, kein Kultursnob, kein Intelligenzaristokrat. Er war ein ganz gewöhnlicher Journalist, der die Feuilletonseiten verachtete und sie als Luxus betrachtete. Täglich bediente er sich des sogenannten Feuilletonseitengriffs, was bedeutete, mittels einer speziellen Umblättertechnik das Feuilleton zu überblättern, ohne auch nur daran zu denken.
Nein, er war ein höchst normaler Journalist mit Wertvorstellungen, die seiner Meinung nach recht gut mit denen des durchschnittlichen Schweden übereinstimmten. Er war ein weißer Mann aus der Mittelschicht in den fortgeschrittenen mittleren Jahren, dessen Frau ihm täglich Essen machte, der das Militär, den Automobilismus und den Industrialismus verteidigte, der Fußball und Leichtathletik im Fernsehen und Strömlingfischen in der Wirklichkeit liebte, der dann und wann ein paar Hunderter auf Pferde setzte und davon überzeugt war, dass mindestens fünfundneunzig Prozent der Verbrechen im Lande von bekifften Einwanderern verübt wurden. Er hatte durchaus die Voraussetzungen dafür, wie geschmiert durchs Leben zu surfen.
Wie mit einem Lottogewinn, ungefähr.
Okay, er hatte seinerzeit nicht besonders viel ferngesehen. Filme und Sport und einzelne Unterhaltungsprogramme im staatlichen Fernsehen. Seine Stimme sollte ›Volkes Stimme‹ repräsentieren, neben den Stimmen der kenntnisreichen Experten. Die Redaktion hatte sich wohl die eine oder andere leichtsinnige Verteidigung lockerer Unterhaltung vorgestellt.
Ungefähr wie in der eigenen Zeitung.
Und so fing er an fernzusehen. Viel. Er sah Tag und Nacht fern. Alle Kanäle. Es war Teil seiner Arbeit. Ein Digitalfernseher als Gehaltsaufbesserung.
Der erotische Traum des Schweden.
Und trotzdem kam es, wie es kam.
Ohne zu verstehen, wie und warum und aus welchen Tiefen, baute er den allerheiligsten Zorn auf, den er je in seinem ganzen normal temperierten Leben empfunden hatte.
Er traute seinen Augen nicht.
War es tatsächlich möglich, dass dies das Leben so vieler Menschen bestimmte? Dieser – Mist war eine zu schwache Bezeichnung. Er fand keinen Ausdruck, der niedrig genug war. Er konnte sich nicht damit abfinden, dass etwas Derartiges in die menschliche Sphäre eingedrungen war.
Und er hatte geglaubt, recht abgestumpft zu sein. Auf festem Grund und Boden.
Es war einfach sagenhaft, was da vierundzwanzig Stunden lang ins Bewusstsein der Menschen geflimmert wurde. Konstant verdummende Werbung mit kurzen Unterbrechungen für noch mehr verdummende Programme. Soaps, Dokusoaps, Spiel- und Quizprogramme, Sexsofas mit Pseudopromis, sogenannte Dokumentationen bar jeder Recherche, immer dürftigere Sportproduktionen. Sogenannte Formate, die wahllos für Fantasiesummen aus allen Ländern gekauft wurden. Die Werbung erschien plötzlich als ein versöhnlicher Zug des Mediums.
Wie kam es, dass die gesamte westliche Welt in nur wenigen Jahren jedes grundlegende Gefühl für Qualität verloren hatte?
Plötzlich war ihm klar – wie in einer religiösen Offenbarung –, dass die Geschichte diese Epoche als verloren einstufen würde. Eine tote Zeit. In der Generation auf Generation mental eingeschläfert wurde – mit Billigung der Regierungen. In der Kinder nie die Chance bekamen, erwachsen zu werden, und Erwachsene zu Kindern degradiert wurden – allerdings zu Kindern ohne jede Kreativität oder Intelligenz. Ohne all das, was Kindheit eigentlich bedeutet.
Seine erste Fernsehchronik gestaltete sich zu einer rasenden Attacke gegen das auf Werbung basierende Fernsehmedium ganz allgemein. Es war die erste seit undenklichen Jahren. Ein Text, der sich so drastisch vom Rest der Zeitung abhob, dass er eine enorme Durchschlagskraft bekam.
Es war Zufall, dass er nicht rausgestrichen wurde. Der Redakteur musste ganz einfach gepennt haben.
So kam es, dass ausgerechnet er – gegen jede Wahrscheinlichkeit – zum Feind Nummer eins der Fernsehindustrie wurde. In einer der größten Tageszeitungen des Landes, einer der am meisten gelesenen Publikationen aller Kategorien.
Zuerst bekam die Redaktion einen Schluckauf. Der Chefredakteur beschimpfte ihn nach allen Regeln der Kunst und feuerte ihn kurzerhand. Dann kamen die Reaktionen – auf den Feuilletonseiten, nun gut, doch vor allem von sogenannten Normalbürgern, Menschen, wie er selbst einer war. Endlich, hieß es, endlich jemand, der kein Blatt vor den Mund nahm und das aussprach, was man die ganze Zeit dachte, im Grunde aber zu denken nicht das Recht hatte.
Dass das ganze Land mit Schund gefüttert wurde. Als ob es Nahrung wäre.
Und er durfte weitermachen. Er saß zu Hause und wälzte Selbstmordgedanken und grämte sich, als der Chefredakteur anrief und sich entschuldigte. Statt der Entlassung bekam er eine ordentliche Gehaltserhöhung. Plötzlich saß er im Fernsehen und sagte direkt in die Kamera, dass alle aufpassen müssten, dass es so nicht weitergehen könne. Und seine Fernsehchroniken wurden Schwedens meistgelesene Texte.
Es war fast so, als ob ein einzelner Mensch alles verändern könnte.
Nach einiger Zeit kristallisierte sich eine ganz besondere Zielscheibe heraus. Ein Hassobjekt. Seine Chroniken richteten sich mehr und mehr auf die selbstständigen Fernseh-Produktionsgesellschaften im Allgemeinen und auf eine von ihnen im Besonderen.
Es waren die freien Produktionsgesellschaften, die ›Formate‹ aus den USA kauften. Hinter dem irrwitzigen Begriff verbarg sich so etwas wie eine Programmidee. Niemand in Schweden wagte mehr, eigene Vorstellungen davon zu haben, wie Fernsehprogramme gestaltet sein sollten – so etwas musste von Marktführern mit extrem kostspieligen Zuschauerbefragungen im Rücken durchgeführt werden. Stattdessen importierte man lausige amerikanische Ideen, deren Markttauglichkeit schon mit fein geschliffenen wissenschaftlichen Instrumenten getestet worden war. Die Instrumente wiederum hatte man an privat gesponserten Universitäten entwickelt und zielbewusst an der Öffentlichkeit mit der absolut geringsten Allgemeinbildung der westlichen Welt getestet. Dem Kanonenfutter. Den biologischen Einheiten, als deren Lebensaufgabe festgesetzt worden war, hinter den Kapitalstarken die Aufräumarbeiten zu machen und – falls erforderlich – in den Kriegen der Kapitalstarken den Heldentod zu sterben. Die mit Fernsehen gemästet werden sollten. Gefüttert und verarztet und in Schach gehalten wie Schweine in ihren Verschlägen. Fleisch auf Zuwachs. Es galt, sie am Leben und gleichzeitig passiv zu halten. Dafür zu sorgen, dass sie unter keinen Umständen auf die Idee kamen, ihre Boxen zu verlassen und über ihr Leben und ihre Lebensumstände nachzudenken. Künstliches Engagement lautete die Losung. Darauf achten, dass die Gehirne nicht völlig eintrockneten, aber gleichzeitig aufpassen, dass jedes Engagement in garantiert harmlose und werbeempfängliche Bereiche umgelenkt wurde. Dass dann der einzige Protest des Publikums in Gewichtszunahme bestand – dem Anschwellen zu grotesken Proportionen –, konnte als gesunder passiver Protest akzeptiert werden.
Und jetzt stieg auch das Durchschnittsgewicht des Europäers an, nicht zuletzt das des Schweden, und zwar in rekordverdächtigem Tempo. Bei Kindern ebenso wie bei Erwachsenen.
Alles in diesen ›Formaten‹ – wirklich alles – war darauf angelegt, so viel Zuschaueraufmerksamkeit wie möglich auf die Werbung zu lenken. Die Programme wurden so gestaltet, dass so viele und so lange Werbepausen wie möglich eingefügt werden konnten, ohne dass der Zuschauer einen Unterschied merkte. Qualität war seit langem schon identisch mit der Einschaltquote.
Diese Sichtweise wurde jetzt von den freien Produktionsfirmen blind auf das schwedische Fernsehen übertragen. Und eine Produktionsfirma war ihm besonders aufgefallen. Sie war immer die schlimmste. Jedes Mal, wenn man glaubte, der Tiefpunkt sei erreicht, kein neuer Niedrigwasserstand sei mehr vorstellbar, war Kalastelevision zur Stelle und versetzte die Welt in Staunen. Dieser Sender war auch der mutigste – allgemein bewundert für die Fähigkeit, neue ›Formate‹ zu schaffen. Echt schwedische ›Formate‹.
Die wiederum ins Ausland verkauft wurden. Doch nicht in die USA.
Dokusoaps waren zwar nichts Neues mehr – seit vielen Jahren hatten die Zuschauer sich daran gewöhnt, Zeitgenossen dabei zuzuschauen, wie sie in den künstlichsten und erniedrigendsten Situationen hochgeschraubte Versionen ihrer selbst spielten – aber die neue Dokusoap von Kalastelevision hatte ihn an die Decke gehen lassen. Ganz im Ernst. Es reichte nicht mehr zu schreiben – plötzlich musste gehandelt werden.
Das war sein Sturz.
Und der war tief.
Die neue Dokusoap von Kalastelevision hieß ›Makeover‹ und spielte in einem schwedischen Großkrankenhaus.
Zahlreiche schwedische Krankenhäuser befanden sich wirtschaftlich derzeit in einem eigenartigen Zustand, sie waren teils staatlich, teils in Privatbesitz. Eine unglaublich lukrative Grauzone, deren Struktur so diffus wie die Verteilung glasklar war: Geld wurde aus dem öffentlichen Sektor zu diversen Aktieninhabern hinübergepumpt. Vollkommen einseitig. Die Provinzregierungen, verantwortlich – zumindest offiziell – für das Gesundheitswesen im Land, wurden häufig von einer Partei geführt, die die Provinzregierungen abschaffen und das Gesundheitswesen privatisieren wollte. Dieses Paradox gipfelte darin, dass man mehr oder weniger bewusst die Provinzregierungen in den Konkurs trieb. Um zu zeigen, dass sie nicht funktionierten. Der Auftrag lautete ganz einfach, so schlechte Arbeit wie nur irgend möglich zu leisten. In krassem Widerspruch zu den Gesetzen des Landes verkaufte man bedenkenlos Krankenhäuser, die folglich im gelobten Gebiet der Grauzone landeten, wohin alle Aktieninhaber strebten, weil man dort ganz einfach viel mehr Geld von den Bürgern geschenkt bekam. Viel näher konnte man einem echten, altmodischen Monopol nicht kommen. Da lagen sie, wiewohl in einer juristischen Zwickmühle, in einem catch 22 der Öffentlichkeit, sanktioniert von der Provinzregierung, nicht sanktioniert vom Gesetz, und zogen Knete an Land. Je länger dieser catch 22 anhielt, desto besser. Und am Ende des langen, hellen Tunnels offenbarte sich ein anderes, noch klareres Licht: ein rein privates Gesundheitssystem. Zu dem alles längst tendierte. A-Krankenhäuser für Kapitaleigner und erlesene Angestellte, B-Krankenpflege für alle anderen. Es bedurfte großer Anstrengungen, diese Entwicklung aufzuhalten. Alles war schon vorbereitet.
In einem dieser Krankenhäuser spielt ›Makeover‹. Kalastelevision hatte sich in die Stationen für plastische Chirurgie eingekauft und sie für ein halbes Jahr belegt. Zwanzig Personen, die mit ihrem Aussehen unzufrieden waren, hatte man aus Tausenden und Abertausenden Bewerbern ausgesucht. Die Teilnehmer sollten eine vollständige Verwandlung durchlaufen, gratis, ein ›makeover‹, vom Kleidungsstil und der Frisur bis zum Gesicht und zur Körperform. Ungefähr die Hälfte der Bewerber schied aus, ohne eine Chance zu bekommen. Die Woche begann mit einer Abstimmung in der Sonntagssendung ›Makeover – The Selection‹. Sämtliche Kandidaten stimmten anonym darüber ab, wer verwandelt werden sollte. Wer die meisten Stimmen bekam, konnte sein ›makeover‹ beginnen. Die plastischen Chirurgen leiteten die Verwandlung ein. Bierbäuche verschwanden, Nasen wurden halbiert, Doppelkinne lösten sich in Luft auf, Schultern wurden verbreitert, Wangen geliftet, Brüste vergrößert, Penisse verlängert, Lippen aufgefüllt. Dann kamen die Make-up-Künstler an die Reihe, die Friseure und Modedesigner, und am Samstag war es so weit für die große erste Prüfung, die Hauptnummer des Programms: ›Makeover – Lookalike‹, zur besten Sendezeit. Der verwandelte Teilnehmer wurde, zusammen mit acht ›lookalikes‹, also Menschen, die ungefähr ähnlich aussahen, in einen Raum gebracht. Jetzt war ›People’s Voice‹ gefragt. Die Zuschauer riefen für je eine Gesprächseinheit neun verschiedene Nummern an, eine Nummer für jede Person im Raum, um zu raten, wer die verwandelte Person war. Ein vor der Verwandlung gemachtes Foto der Person war die ganze Zeit eingeblendet. Wenn man es durch dieses Nadelöhr geschafft hatte – also wenn die Anrufer falsch geraten hatten –, stand man im großen Finale. So ging es weiter, bis zehn Personen übrig waren. Dann folgte ›Makeover – The Final‹. Und nun waren es die Ausgeschiedenen, die mit ihrer ganzen Enttäuschung im Bauch über das beste ›makeover‹ abstimmen sollten. Täglich wurde eine halbe Stunde ›Makeover‹ gesendet, teils mit Szenen vom eigentlichen ›makeover‹ – mit astreinen Operationsbildern –, teils mit Bildern aus den Räumen, in denen die Kandidaten ihre Wartezeit verbrachten. Handfeste Intrigen waren vorab von der Boulevardpresse aufgetischt worden, weil man alles aufgezeichnet hatte. Die chirurgischen Komplikationen waren seit langem finanziell abgeklärt.
Kalastelevision war selbst der Ansicht, man habe die optimale Synthese von Krankenhaussoap und Dokusoap geschaffen.
Mehrere unabhängige Quellen behaupteten, ›Makeover‹ habe das Budget des Krankenhauses verdoppelt, doch die Behauptungen blieben unbekräftigt. Nicht einmal die Wirtschaftsjournalisten, die in der Regel am tiefsten gruben, vermochten sich ein Bild von den finanziellen Transaktionen zu machen.
Er saß allein zu Hause und sah den ersten Teil. Die Familie war verreist. Und er war fassungslos. Er zog auf der Stelle den Laptop heran, um die Tageschronik zu schreiben. Aber seine Hände zitterten mehr als nur ein klein wenig – ein gutes Zeichen, ein Zeichen dafür, dass er engagiert war, angebissen hatte. Nein, seine Hände wurden förmlich geschüttelt. Seine Finger würden nie die richtigen Tasten treffen.
Und plötzlich waren Wörter nicht mehr ausreichend.
Plötzlich erkannte er, dass er weder die Produktionsgesellschaften noch das Medium Fernsehen als solches je würde beeinflussen können. Sie benutzten Wörter nicht auf diese Weise. Als Gespräch. Als Dialog. Stattdessen benutzten sie die Wörter als Maskierung. Sie taten so, als ob sie ein Gespräch führten.
Hier war eine ganz andere Sprache gefordert.
Dann wurde es diffus. Vielleicht fing da das Gedankenlesen an. Von jenem Augenblick an waren seine Erinnerungen verschwommen.
Er wusste noch, dass er eine Pistole in die Tasche legte. Ein altes Stück, noch aus seiner Zeit in der Heimwehr. Er wusste noch, dass er sie geladen hatte. Er wusste sogar noch, dass er schoss. Aber an Menschen erinnerte er sich nicht. An gar keine Menschen.
Und alles war sehr seltsam.
5
Das Reihenhausgebiet lag verlassen da. Verlassen auf die ursprüngliche Art und Weise. Eine archaische Verlassenheit.
Wie der Tod.
Wenn auch nur aus einem einzigen Blickwinkel.
Nämlich dem von Paul Hjelm.
Er saß in seinem schicken neuen Dienstwagen, einem metallicgrünen Volvo S-60, den bisher niemand in Norsborg kannte, und beobachtete das Geschehen aus der Distanz. Vollständig anonym. Vermutlich waren die Nachbarn zur Stelle, genau wie immer, neugierig durch Lücken und Zäune spähend, aber er sah sie nicht. Und sie sahen ihn nicht. So viel Erkundungsgewohnheit besaß er.
Nein. Die Verlassenheit war in unangenehm hohem Grad eine innere Verlassenheit.
Er hätte natürlich nicht da sein sollen.
Nicht genug damit, dass es seine Arbeitszeit war, nicht genug damit, dass alles bis ins kleinste Detail arrangiert war. Er hatte, um das Maß voll zu machen, mit der Sache überhaupt nichts zu tun. Dies war nicht mehr seine Welt.
Aber er konnte nicht anders. Es war seine Art, Abschied zu nehmen. Von einer Epoche. Einer Epoche, die im Großen und Ganzen ein Leben umfasste.
Er hatte nicht viele Erinnerungen an sein Leben vor der Zeit, als er hierher gezogen war. Frisch verheiratet und frisch examiniert und mit dem Ziel, eine Familie zu gründen und ein reibungsloses Leben zu führen. Weiter hatte sein Ehrgeiz kaum gereicht. Aber im Großen und Ganzen hatte es wohl funktioniert. Das war es, was er getan hatte. Auch wenn er das Ende der Fahnenstange nicht ganz erreicht hatte.
Er saß schon dort, als der Möbelwagen zwischen die Reihenhäuser rollte und die lärmenden Möbelpacker dem Mittsommeridyll den Garaus machten. Er saß dort, während sie seine Sachen herausschleppten, die allesamt in einen Müllcontainer geworfen werden sollten. Er saß dort, als sie fluchend und verkatert das Klavier hinauswuchteten; durchs Küchenfenster sah er den Papageien – zweifellos der Einzige, der es vermissen würde – erstaunt hinterherschauen. Er saß da, während die Familie, ein Mitglied nach dem anderen, auftauchte, um ein wenig halbherzig aufzupassen, dass nicht die eigenen Sachen im selben Aufwasch beseitigt wurden. Und er saß noch da, als die Türen des Möbelwagens ein letztes Mal zugeklappt wurden und das Gefährt ein wenig ungestüm zwischen den Rasenflächen davonzischte.
Paul Hjelm hatte dort nichts zu suchen.
Danne war da. Er hatte dort etwas zu suchen. Paul Hjelm spürte einen Stich in seinem schon durchstochenen Herzen, als er sah, wie sein Sohn die CD-Sammlung kontrollierte, um sicher zu sein, dass der Vater keine CDs mitgehen ließ, die ihm nicht gehörten. Danne, der schon ausgezogen war, in eine Studentenwohnung am Roslagstull, die ihm nach zweijähriger Wartezeit zugeteilt worden war, während er wechselnde Fächer an der Uni studierte, immer noch darauf wartend, Polizist zu werden. Dummkopf. Auch Danne war hergekommen, wahrscheinlich als Stütze für die Mutter in einer schweren Zeit.
Und ich selbst? dachte er bitter. Brauche ich keine Stütze?
Sein Leben war mittlerweile eine einzige endlose Trennung. Hatte er nicht ein noch größeres Bedürfnis nach Stütze in einer schweren Zeit?
Es war seine eigene Schuld, würden sie antworten – und er müsste ihnen recht geben. Du hast all diese Trennungen selbst herbeigeführt. Du hast dich entschieden, die A-Gruppe zu verlassen, um Chef der Stockholmsektion der Abteilung für Interne Ermittlungen zu werden. Ein Karrieresprung. Du selbst warst es, der sich entschieden hat, Mama zu verlassen und in die Stadt zu ziehen. Du hast nur auf diesen Augenblick gewartet.
Du hast nie richtig in dieses Reihenhausviertel gepasst.
Aber stimmte das wirklich? Wer von ihnen wollte sich scheiden lassen? Wollte sich überhaupt jemand scheiden lassen?
Man kann immer weiterkämpfen, dachte er, während er seiner Tochter Tova zusah, wie sie eine Tüte mit Schmutzwäsche nach der anderen durchwühlte. Tova würde noch zwei Jahre zu Hause wohnen. Hätten sie nicht bis dahin warten können? Er betrachtete sein jüngstes Kind mit Sorge. Erwachsen oder nicht erwachsen, das war hier die Frage. Genau an der Grenze. Was würde eine Scheidung gerade jetzt, in diesem Übergangsstadium, bei ihr auslösen?
Es gab keine Antworten. Vielleicht würde jahrelange Therapie erforderlich sein, um der Folgen Herr zu werden. Vielleicht war es nur gut für sie.
Vielleicht war die lebenslange Paarbeziehung ganz einfach nicht möglich, dachte er bitter und sah Cilla aus dem Haus treten und stehen bleiben. Sie stellte sich in den mäßig gepflegten kleinen Garten. Sie stand nur einfach da und sah den Möbelpackern zu, die etwas bisher ziemlich Abstraktes in etwas sehr Konkretes verwandelten. Eine konkrete Abwesenheit. Sie war viel zu weit weg, als dass er ihren Gesichtsausdruck hätte erkennen können, aber Erleichterung war es nicht, so viel meinte er sehen zu können. Eher eine Art recht kühl zur Kenntnis genommener Schmerz.
Jaha, so wird es sich also anfühlen.
Sie war so schön mit ihrem blonden zerzausten Haar, das von der milden Mittsommersonne beleuchtet wurde, eine kleine, magere Engelsgestalt in seinem – seinem – riesigen alten Morgenmantel. Vermutlich hatte sie Nachtschicht gehabt.
Cilla.
Jetzt brauchte er jedenfalls nicht mehr auf ihre komplizierten Arbeitszeiten Rücksicht zu nehmen, dachte er und war dem Weinen nahe. Dann dachte er: Nun wirf ihn schon fort! Wirf den Morgenmantel in einen Umzugskarton, und steh nackt da. Er gehört mir. Du stehst da und siehst so unschuldig aus, während du höchst aktiv meinen Morgenmantel stiehlst.
War dies hier wirklich richtig? dachte er, als sie sich umwandte und sich langsam wieder ins Reihenhaus zurückzog. War es wirklich notwendig gewesen? Er und Cilla, die gemeinsam so viel Schweres durchlebt und neu angefangen und sich wieder zusammengerauft hatten und wieder aufs richtige Gleis gekommen waren. Und dann dieser Kollaps. Dieser Schiffbruch. Warum?
Macht.
Als die Türen des Möbelwagens ein letztes Mal zugeklappt wurden und das Gefährt ein wenig ungestüm zwischen den Rasenflächen davonzischte, dachte er erneut: Vielleicht ist die lebenslange Paarbeziehung ganz einfach nicht möglich. Vielleicht beruht die Idee der Kleinfamilie auf einer Hierarchie, für die es keine Grundlage mehr gibt. Wir versuchen, in den familiären Mustern einer entschwundenen Zeit zu leben, und statt einer klar geregelten Arbeitsverteilung haben wir einen endlosen, zersetzenden Machtkampf bekommen. Den infizierten Machtkampf der Gleichstellung.
Dass es zwischen uns immer zerrüttet sein muss.
Nur weil wir endlich gleich sind.
Er blickte dem Möbelwagen nach, bis die schwarze Abgaswolke verflogen war. Wenn er heute Abend von der Arbeit nach Hause käme, würde die neue Wohnung nicht mehr scheidungsleer sein. Die alten Sachen würden in chaotischer Unordnung dastehen und ihn an die Vergangenheit erinnern. An die Zeit, als er eine Familie hatte.
Und Chaos würde sein Name sein.
Sein Blick wanderte über den dürftigen Miniaturgarten. Er lag verlassen da. Verlassen auf die ursprüngliche Art und Weise. Eine archaische Verlassenheit.
Wie der Tod.
Er ließ den Motor an, schob die Brille in die Stirn, warf einen Blick auf die Armbanduhr, legte die Aktenmappe auf dem Beifahrersitz zurecht und zupfte den Schlips gerade.
Und dachte: Nein.
Dann fuhr er davon.
6
Es war nicht ganz unproblematisch, seinen Sohn am Tag, an dem man den Posten als Chefin einer der Eliteeinheiten der Polizei antrat, mit zur Arbeit zu nehmen. Anderseits galt es, ein Zeichen zu setzen – die Spezialeinheit beim Reichskriminalamt für Gewaltverbrechen von internationalem Charakter, bekannt als die A-Gruppe, wurde mittlerweile von einer alleinerziehenden Mutter geleitet, und wenn man das nicht hinbekam, hatte man dort nichts zu suchen.
Wenn Kerstin Holm allerdings ganz ehrlich sein wollte, so war das eine nachträgliche Konstruktion. Es war in Wirklichkeit viel einfacher. Sie hatte nur keine Ferienbetreuung für ihren achtjährigen Sohn Anders Holm gefunden. Sie hatte nicht die Zeit gehabt, hatte es nicht geschafft, den komplizierten Prozess in die Wege zu leiten, ja, sie hatte nicht einmal geahnt, dass es ein so komplizierter Prozess war. Der Juni war ein anstrengender Monat gewesen.
Formell hatte sie den Posten schon zum ersten Juni angetreten, doch da hatte ihr Vorgänger, der legendäre Jan-Olov Hultin, noch parallel mit ihr gearbeitet, bis zu dem Tag, an dem er offiziell in Pension ging, und das war gestern gewesen. Sonntag, der sechzehnte Juni. Er hatte ihr zwei Wochen Hilfestellung geleistet. Erst heute war er endgültig fort. Obwohl er versprochen hatte, immer zur Verfügung zu stehen, ›nie mehr als drei Meter vom Handy entfernt‹.
Sie sah hinaus auf den Hof des Polizeipräsidiums, zu dem sich die kristallklare Mittsommersonne auf unergründlichen Wegen Zugang verschafft hatte. Es sah nicht aus wie gewöhnlich. Irgendetwas war schief. Etwas irritierte sie. Sie überlegte schon seit geraumer Zeit, was es sein mochte.
Es war die Perspektive.
Erst heute war sie in Hultins Zimmer gezogen. Der Raum lag nur einige Zimmer entfernt von ihrem alten, sodass die Perspektive nur leicht, ganz leicht verschoben war. Doch es reichte aus, den täglichen Ruhepunkt für den Blick zu verändern.
So sah die Chefperspektive aus.
Der Raum war leer, bis auf die Standardeinrichtung: Schreibtisch, Telefon, Computer, Fax, Drucker, Kaffeemaschine. Die Wände waren kahl wie Hultins Schädel. Es war ein Zimmer, das sich nicht im Geringsten von ihrem alten unterschied. Außer dass sie allein war.
Früher hatte sie das Zimmer mit Gunnar Nyberg geteilt, der damals noch den Ehrentitel Schwedens größter Polizist trug, und es war ziemlich eng gewesen. Dann waren die A-Gruppen-Karten neu gemischt worden, und das ein wenig logischere Paar Kerstin Holm/Paul Hjelm hatte das Licht des Tages erblickt. Der Betrieb Jalm & Halm auf Englisch.
Im Dezember vergangenen Jahres war dieser Betrieb gesprengt worden, als Hjelm zum Leiter der Stockholmsektion der Abteilung für Interne Ermittlungen ernannt wurde.
Als einziger Bewerber, wie sie in Gesprächen mit dem genannten Potentaten zu ergänzen pflegte.
Sie hatte sich nämlich selbst bewerben sollen, aber es war etwas dazwischengekommen.
Ihr Leben.
Sie hatte es jahrelang verlegt. Aber jetzt war es wieder am Platz.
›Wieder‹ war bei genauerem Hinsehen zu viel gesagt. Jetzt war es am Platz. Punkt.
Das vergangene knappe Jahr war die überwältigendste Zeit ihres Lebens gewesen. Sie hatte ein Kind bekommen. Und das Kind war acht Jahre alt.
Es war viel zu kompliziert für ein armes kleines Hirn, daran zu denken, und so ließ sie die Sache auf sich beruhen. Sie blickte jedenfalls auf ihre linke Hand und stellte fest, dass die Frühjahrssonne endlich alle Spuren des alten Verlobungsrings ausgelöscht hatte. Sie hatte nicht in ein Solarium gehen wollen. Der weiße Ring auf ihrer Haut musste auf natürliche Weise verschwinden. Es war eine kleine Fixierung. Hoffentlich die letzte.
Sie hatte eine Therapie gemacht. Einen vorsichtigen Versuch. Und es hatte sich gut angefühlt. Wie Pflaster auf Wunden, die auch von allein heilen würden. Um die Bakterien fernzuhalten.
Sogar die Gleichnisse änderten sich, wenn man Kinder bekam. Anders hatte eine Tendenz, sich Schürfwunden an den Knien zu holen. Unfehlbar. Und immer wollte er Pflaster haben, fast so, als holte er sich die Schürfwunden, um die bunten Pflaster betrachten zu können. Pflaster gab es mittlerweile in den abenteuerlichsten Formen und Farben. Das zumindest hatte sie im vergangenen Jahr gelernt.
Er saß auf dem zweiten Stuhl am Schreibtisch und zeichnete. Autos, immer Autos, und immer vor dem Hintergrund einer Stadtsilhouette. In Bewegung. Immer in Bewegung, immer auf dem Weg von einem Ort zum anderen. Zu einer Stadt. Als verarbeitete er seine Erlebnisse.
Aber vielleicht legte sie zu viel hinein.
Was sie aber mit unumstößlicher Sicherheit wusste, war, dass sie ihn liebte. Auf eine Weise, zu der fähig zu sein sie bezweifelt hatte. Vorbehaltlos.
Ende der Leseprobe