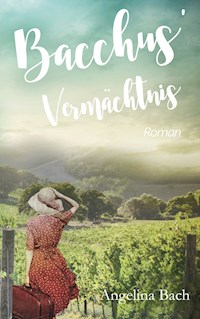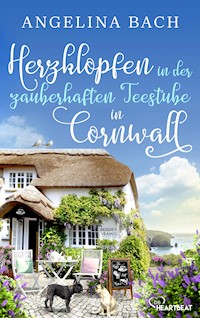Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bayern, 1799. Vor dem Hintergrund der napoleonischen Kriege suchen drei Bauernkinder nach dem Tod des Vaters ihren Weg. Afra folgt dem Onkel als Dienstmädchen nach München in dessen Brauerei Pschorr, während ihre beiden Brüder Bayern den Rücken kehren. Bartl schließt sich dem Volkshelden Hofer an, der die Tiroler in einen Bauernaufstand führt. Der jüngste Bruder, Loisl, kämpft in der österreichischen Armee gegen die Franzosen. Während sich Bayern zum Königreich und Napoleon zum Bezwinger Europas aufschwingen, ist die Gesellschaft im Umbruch. Wann werden die Geschwister sich wiedersehen? Und auf welcher Seite werden sie dann stehen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 544
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In dieser Reihe erschienen/geplant:
Licht und Schatten - Teil 1 von 1899 bis 1945 (BoD, 2017)
Licht und Schatten - Teil 2 von 1945 bis 1999 (BoD, 2017)
Neuauflage in neuem Design, 2025
Glanz & Gloria – Unter Dampf, Teil 2 (demnächst bei BoD)
Glanz & Gloria – Neue Welt, Teil 3 (demnächst bei BoD)
„Der Mensch ist frei geboren, und überall liegt er in Ketten.“Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
Inhalt
Teil 1
Ankunft
Kathreintanz
Wendung
Aufbruch
Wege
Entscheidungen
Bündnisse
Schäferstündchen
Teil 2
Hochzeit
Freiheit
Bergisel
Freiersfüẞe
Neue Wege
Abkehr
Waterloo
Teil 3
Neuordnung
Neuanfang
Freundschaftsdienst
Familienbande
Aufwind
Höhenflüge
Niedergang
Teil 4
Krönung
Wohlfahrt
Wiedersehen
Epidemie
Bibliogaphie
Glossar
Danksagung
Über die Autorin
So geht es weiter:
TEIL 1
Aufbruch in eine neue Zeit
1799 - 1806
„Es ist keine Kunst, ein ehrlicher Mann zu sein, wenn man täglich Suppe, Gemüse und Fleisch zu essen hat.“Georg Büchner (1813-1837)
I.
ANKUNFT
München, März 1799
Am 12. März fuhr der frischgebackene bayerische Kurfürst Maximilian IV. Joseph in einer offenen vierspännigen Kutsche zu seinem Empfang in München ein. Kinder mit Blumenkränzen säumten die Straßen, die Häuser waren mit Fähnchen und Kränzen herausgeputzt worden und aus allen Fenstern winkten die Bewohner. Schon an diesem Tag ließ sich erahnen, was für ein populärer Herrscher Maximilian werden würde.
Als der Zug durch das Karlstor in die Neuhauserstraße rollte, löste sich ein beleibter Mann aus den Reihen der Schaulustigen und lief auf die vorüberfahrende Kutsche zu. Die perplexe Leibwache ließ ihn gewähren. Er griff nach der behandschuhten Hand des Kurfürsten und rief voll Inbrunst aus: „O Maxl, weil du nur da bist, jetz geht alles gut!“1
Nachdem die Parade des Kurfürsten vorübergezogen und das Geklapper der Pferdehufe auf dem gestampften Boden der Straße verklungen war, betrat der Brauherr Josef Pschorr, der den neuen Kurfürsten so eindringlich begrüßt hatte, den Oberkandlerbräukeller, zog den Zylinderhut vom Lockenkopf und verlangte: „Rosl, bring mir ein Bier!“
Die angesprochene Bedienung beeilte sich, dem nachzukommen.
„Bittschön“, sagte sie und stellte das schäumende Gebräu vor ihn auf den Tisch.
Pschorr nahm einen tiefen Zug aus dem irdenen Krügel und stellte es mit einem genussvollen Seufzer zurück auf den Eichentisch.
„Sagen’S, sind Sie ned der Herr Pschorr? Vom Hackerbräu drüben?“, fragte die junge Frau neugierig.
Josef Pschorr lehnte sich entspannt zurück und antwortete nicht ohne Stolz: „Ja, genau der bin ich. Und das hier war einmal mein Lehrbetrieb.“
In diesem Moment betrat der Hausherr den Schankraum. Er stutzte. Dann verzog sich sein breiter Mund zu einem Grinsen. „Ja Sepp!“, begrüßte er den Jüngeren freudig. „Der Pschorr Joseph, schau an. Was treibt dich denn wieder einmal hierher?“
Aus alter Gewohnheit duzte der Lehrherr seinen ehemaligen Lehrbuben immer noch, obwohl der inzwischen ein gestandenes Mannsbild war und den Oberkandlerbräu um einen halben Kopf überragte.
Pschorr schüttelte seinem ehemaligen Dienstherrn die Hand und erwiderte das Grinsen. „Wollt mal nachschauen, ob euer Bier noch schmeckt.“
„Und?“, fragte der Oberkandler.
„Geht schon“, antwortete Pschorr immer noch grinsend und fügte hinzu: „So gut wie's Hacker-Pschorr is es natürlich ned.“
Der Oberkandler drohte ihm scherzhaft mit dem Zeigefinger. „Vergiss ned, wer dir 's Brauen gelernt hat, mein Lieber!“
Anstelle einer Erwiderung nahm Pschorr noch einen ordentlichen Zug und leerte sein Krügel fast aus. Er wischte sich den Schaum von der Oberlippe und wechselte das Thema: „Habt's unsren neuen Kurfürsten vorbeifahren sehen?“
„Freilich“, erwiderte der Oberkandler.
„Jetzt wird sich hoffentlich einiges ändern bei uns“, prophezeite Pschorr.
„Das wär zu hoffen“, pflichtete der Ältere ihm bei. „Wobei ich ja schon gespannt bin, ob der Neue das Regieren überhaupt gelernt hat. Als Soldat, der er war.“
„Offizier“, verbesserte Pschorr sofort. „Ich bin seit einiger Zeit Hoflieferant, mein Lieber, wennst was wissen willst, was sich so tut, dann frag mich. Ich weiß Bescheid!“ Auf seine Kontakte zu den allerhöchsten Kreisen war Pschorr mächtig stolz. Über den neuen Herrscher in der Residenz hatte er bereits frühzeitig Erkundigungen eingezogen. „In einem Regiment zu Straßburg sei er untergekommen, als sein Vater früh verstarb, heißt es. Man hat ja damit nicht rechnen können, was für ein saumäßiges Glück er noch einmal haben würde.“
„Mit saumäßigem Glück kennst du dich ja aus“, versetzte ihm der Oberkandler einen Seitenhieb.
Auch dem heutigen Brauereibesitzer Joseph Pschorr war seinerzeit ein gewisses unsagbares Glück zuteil geworden. Von einem einfachen Braugehilfen war der Bauerssohn aus Kleinhadern in der Reichshauptstadt zum angesehenen Brauherrn aufgestiegen. Vor sechs Jahren hatte er die Brauerstochter Maria Theresia Hacker geehelicht und seinem Schwiegervater mit Hilfe seines Heiratsguts und auch beträchtlicher Schulden die Brauerei an der Ecke Hacken- und Sendlingerstraße für 34.000 Gulden abgekauft. Inzwischen hatte er das hoffnungslos veraltete Unternehmen wieder saniert und zum ersten Haus am Platz gemacht. Dafür hatte es allerdings weniger Glücks als vielmehr handwerklichen Geschicks und Weitsichts bedurft.
Auf die Stichelei des Älteren ging Pschorr jetzt aber dennoch nicht ein. Er sagte nur: „Am Ende zählt ja, dass der Alte weg ist und der Neue unserm Bayernland mehr Glück bringt.“
Der Oberkandler winkte seiner Bediendame, um noch ein Bier für sich und seinen Gast zu ordern. Dann sagte er: „Ganz so neu ist er ja auch nicht mehr, der Kurfürst Max. Der hat schon ein recht bewegtes Leben hinter sich mit seinen zweiundvierzig Jahren, oder was der is.“
„Das Soldatenleben ist halt ein recht bequemes, wenn man nicht in den Krieg muss“, erklärte Pschorr geringschätzig.
„Ein Kind von Traurigkeit war er sicherlich nicht, der Kurpfälzer.“ Klatsch und Tratsch aus der Residenz hörte der Oberkandlerbräu in seiner Wirtschaft auch genügend, damit trumpfte er jetzt auf: „Man erzählt sich von einem lustigen Junggesellen- und Spielerleben mit zahlreichen Affären und Schulden, bis seine Familie dem ein jähes Ende bereitet und den Gauner verheiratet hat. Da wird's die Ärmste, diese Darmstädter Prinzessin, auch nicht leicht gehabt haben mit ihm am Anfang.“
Pschorr winkte ab. „So schlecht, mein ich, war's um die Ehe gar nicht bestellt. Immerhin hat er von seiner Seligen fünf Kinder, oder etwa nicht?“
„Fünf von der Ersten und noch mal acht von der zweiten“, gab der Oberkandler zurück. „An Erben fehlt's also dieses Mal nicht!“
„Der junge Kronprinz soll allerdings recht aufmüpfig sein, wie man hört“, ergänzte Pschorr. „Kommt am Ende ganz nach dem Vater.“ In München mangelte es nicht an Geschichten und Gerüchten über den neuen Herrscher. Der Klatsch hatte schon lange vor dem Kurfürsten an der Isar Einzug gehalten.
Tatsächlich war der rebellische Ludwig das einzige der fünf Kinder aus Maximilians erster Ehe mit der verstorbenen Auguste Wilhelmine von Hessen-Darmstadt, das sich mit der neuen Stiefmutter Karoline Friederike nicht verstand und seinem Vater manches graue Haar wachsen ließ.
„Einfach war's bestimmt trotzdem nicht“, schloss der Oberkandler. „Wegen den ständigen Unruhen in der Pfalz war er ja in Ansbach, als ihn die Nachricht erreicht hat, dass er nicht mehr nur der Pfalzgraf, sondern auch der Kurfürst von Bayern geworden ist.“
„Bei uns hier muss er eher die Österreicher als die Franzosen fürchten. Mir ist's ganz gleich, wer kommt, solang sie nur immer unser Bier trinken“, grinste Pschorr und prostete seinem Lehrmeister mit der frischen Halbe zu.
Die Wellen, die die Französische Revolution vor zehn Jahren geschlagen hatte, waren noch nicht verebbt, als der Jahrhundertwechsel heraufdämmerte. Die europäischen Fürsten und Könige fürchteten einen ähnlichen Umbruch. Im Kurfürstentum Bayern hatte bis zum Ende des 18. Jahrhunderts der Kurfürst Karl IV. Theodor regiert. Ursprünglich selbst ein Anhänger der Aufklärung, zog er in seinem Reich die Zügel lieber vorsorglich straffer an. Die Bayern lernten in dieser Zeit ihren Kurfürsten von seiner schlechtesten Seite kennen. Ein Tyrann sei er, wisperten sie sich auf den Märkten und in den Städten zu. Reformen, die sich Kurfürst Karl vielleicht sogar selbst wünschte, duldete er nun einmal nicht, wenn man sie ihm aufdrängte. Spätestens seit jenem denkwürdigen 14. Juli 1789, als die Pariser Bastille brannte, regierte der Bayer seine Untertanen mit unerbittlich strenger Hand. Zehn Jahre lang tyrannisierte er die Bayern und zog sich ihre tiefe Verachtung zu.
Am 16. Februar dieses Jahres 1799 hatte der ungeliebte Kurfürst für immer die Augen geschlossen. Beim Kartenspiel hatte der Schlag den Vierundsiebzigjährigen getroffen und eine Weile schwankte er noch zwischen Leben und Tod. Der Münchner Theologe Lorenz von Westenrieder, ein eifriger Lokalpatriot, schrieb dazu: „Das Volk kann aus Angst, dass es wieder besser gehen könnte, nicht essen, nicht schlafen und nicht denken.“2
So jubelte das bayerische Volk dann auch, als endlich die Totenglocken läuteten. In der Münchner Theatinerkirche fand die Beisetzung statt. Sein Herz wurde – nachdem manch einer sich wunderte, dass er überhaupt eines besessen hatte – nach alter Wittelsbacher Tradition getrennt vom Leichnam in der Gnadenkapelle von Altötting bestattet. Trotz seiner zwei Ehen, die letzte mit der um ganze zweiundfünfzig Jahre jüngeren Habsburger Prinzessin Maria Leopoldine, war Karl Theodor ohne Thronfolger aus dem Leben geschieden. Zwar hatte der Monarch, so munkelte man, unzählige Liebschaften gepflegt, und daraus waren auch eine stattliche Anzahl Bastarde hervorgegangen, doch zu einem legitimen Erben war Karl nie gekommen. So war Maximilian IV. Joseph aus einer Seitenlinie der Wittelsbacher unversehens zu seinem Nachfolger geworden.
Großhadern, März 1799
Draußen in Hadern, wo der erfolgreiche Unternehmer Pschorr einst geboren worden war, ging das Leben noch einen beschaulicheren Gang. Knapp dreißigtausend Gehöfte zählte das Kurfürstentum zu dieser Zeit. Grundherr von mehr als der Hälfte war die Kirche, der Adel hielt die Rechte an etwa vierundzwanzig Prozent und der Landesherr an vierzehn. Neben den nichtständischen Grundherren, wie zum Beispiel Armenhäuser, Spitäler und Almosenämter, blieb nur noch ein verschwindend geringer Rest an freien Gütern und Höfen. Auf den Höfen des Kurfürsten war es üblich, die Fron in Geldzahlungen umzuwandeln, die meisten anderen verlangten ihren Zehnten in Naturalien: Getreide, Eier, Butter, Flachs, Geflügel und Vieh. Wenn die Ernte gut ausfiel, dann kamen die Bauern einigermaßen über die Runden. Schwierig wurde es, wenn die Ernte ausblieb und die Abgaben nicht geleistet werden konnten.
Der Wimschneiderhof in Großhadern – der Bauer war ein entfernter Verwandter von Joseph Pschorr – gehörte zur Benediktinerabtei Schäftlarn. Das Auskommen auf dem kleinen Hof war nie besonders üppig gewesen, aber es reichte gerade eben zum Überleben. Die Wimschneiderbäuerin Agathe kümmerte sich um den kleinen Gemüsegarten hinter dem Haus, als unerwartet der Dorfpfarrer bei ihr auftauchte.
„Gott zum Gruße, Weib“, begrüßte er sie.
Agathe schlug rasch ein Kreuzzeichen mit den von Erde schmutzigen Händen. „Grüß Gott, Herr Pfarrer“, erwiderte sie. „Entschuldigen’S, ich hab Ihnen ned erwartet.“
Agathe war bald vierzig Jahre alt, auch wenn sie älter aussah. Schwere Arbeit und fünf Kinder, von denen zwei Totgeburten gewesen waren, hatten sie vorzeitig altern lassen. Sie wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn und steckte den Spaten in den regennassen Boden.
„Es ist eine traurige Nachricht, die ich dir zu bringen habe, Wimschneiderin.“ Der Pfarrer faltete in einer automatischen Geste die Hände vor dem Wanst.
Beunruhigt fragte die Bäuerin: „Was ist denn geschehen?“
„Dein Mann ist zu unsrem Herrn gerufen worden. Drunten ham's ihn gefunden, auf dem Acker beim Bach. Sein Pflug ist noch im Boden gesteckt und der Ochs ist ganz ruhig dagestanden. Wahrscheinlich war's ein Schlagerl.“
Agathe fühlte sich, als würde der Boden sich vor ihr auftun und sie verschlingen. Sie schwankte. Hilfesuchend blickte sie sich um, fand Halt am Spatenstiel und krallte sich daran fest. „Nein …“, flüsterte sie, als ob sie das Unausweichliche durch Leugnung von sich fernhalten könnte.
„Es ist wahr, Wimschneiderin. Er kommt nicht mehr heim“, sagte der Pfarrer zur Bekräftigung.
Da stieß die Frau einen Schrei aus, der den Hochwürden vor Schreck zusammenfahren ließ. Die älteste Tochter kam aus dem Haus gelaufen, um zu sehen, wer so geschrien hatte. Eine Schar Hühner stob aufgescheucht auseinander und gackerte empört. Die Bäuerin war auf die Knie gesunken und hielt sich die Schürze vors Gesicht.
„Mutter!“ Afra, ihre Tochter, stürzte auf sie zu und wollte ihr auf die Beine helfen, doch es gelang ihr nicht.
Die Mutter weinte haltlos in die karierte Schürze.
Afra wandte sich an den Pfarrer. „Hochwürden, was ist denn mit ihr?“
„Du armes Kind, dein Vater ist von uns gegangen.“ Der Priester bekreuzigte sich.
Da kamen auch schon die Waldarbeiter, die den Wimschneider-Bauern gefunden hatten, den Weg zum Hof herauf. Der eine führte den Ochsen am Riemen, der andere ging hinterher, den Toten hatten sie über den Pflug gelegt.
Afra lief ihnen entgegen. „O Vater!“
Im Hof hievten sie die Leiche des Wimschneiders herunter und trugen ihn ins Haus. Inzwischen waren die Kleindirn und die beiden jüngeren Kinder, der elfjährige Bartl und sein zwei Jahre jüngerer Bruder Loisl, sowie der Knecht herbeigeeilt.
„Was ist denn mitm Vater? Was hat denn der Vater?“, wollte Loisl wissen und drückte sich an seine Schwester.
„Sei still, Bub“, herrschte ihn die Kleindirn an. „Hin ist er halt!“
Leiser flüsterte das Kind seiner Schwester zu: „Wird er wieder gesund, der Vater?“ Afra schüttelte nur traurig den Kopf, selbst noch ganz benommen.
Mit den Hüten in den Händen kehrten die Waldarbeiter zurück aus der Wohnstube ins Freie. Der Pfarrer bedankte sich im Namen der Bäuerin bei ihnen und schickte sie wieder an ihre Arbeit. Dann trat er ins Haus, um nach der Witwe zu sehen. Weil man auf die Schnelle nicht gewusst hatte wohin mit ihm, lag der Tote auf dem Esstisch ausgestreckt. Seine Gesichtszüge waren ruhig, als ob er schliefe, ein beinahe erstaunter Zug lag auf ihnen. Die Bäuerin, unfähig zu irgendeiner sinnvollen Handlung, stand neben ihm und weinte immer noch in ihre Schürze. Hinter ihr drängten sich die drei Kinder. Die Dirn stand an der Tür, dem Pfarrer im Weg, und starrte wie hypnotisiert auf den Leichnam, sodass er sie anstoßen musste, um sich Zutritt zu verschaffen.
„Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnaden, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit sei die Frucht deines Leibes, Jesu, der für uns Blut geschwitzet hat …“, begann der Priester.
Automatisch fielen die Anwesenden in die vertrauten Gebetsformeln ein und antworteten: „Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.“
* *
Die nächsten Tage boten wenig Gelegenheit, um sich Gedanken über die Zukunft zu machen. Die Uhr in der guten Stube wurde angehalten, die Fensterläden geschlossen und der Tote auf einem Schragen aufgebahrt. Agathe und Afra wuschen den Vater und zogen ihm das Leichenhemd an. Den Bartl schickten sie zu Fuß los durch den Sendlinger Forst hinüber nach Sendling zum Schreiner, um einen einfachen Sarg in Auftrag zu geben. Der Knecht musste in den Stall hinaus und ein Schwein schlachten, denn zur Leich würden die Verwandten anrücken, und die wollten verköstigt sein.
Wer vom Läuten der Totenglocken noch nicht die Kunde erhalten hatte, wurde vom Leichenbitter darüber informiert. Daraufhin kamen die Nachbarn und Dorfbewohner vorbei, um ihre Aufwartung zu machen. Auch der Pfarrer kam noch einmal zum Gebet.
Der Wimschneider lag mit geschlossenen Augen und hoch gebundenem Kinn auf dem Totenbrett in der guten Stube, in den starren Händen den Rosenkranz. Wachs war teuer, deshalb litt es ihm nur eine einzige Kerze. Drei Tage und Nächte hielten seine Angehörigen die Totenwache bei ihm, dann zog ihn sein Ochs in einem schlichten Kiefernsarg auf dem Wagen zum Friedhof hin. Agathe, Afra und die Jungen begleiteten den Vater auf seinem letzten Weg hinüber zur Dorfkirche Sankt Peter. Dahinter folgten die Nachbarn und Verwandten. Durch die schwere Eichentür betrat die Trauergemeinde das Barockkirchlein mit dem charakteristischen Turm. Draußen war es schon frühlingshaft, doch in der Kirche herrschte empfindliche Kälte. Die Kerzen am Altar flackerten von den Windstößen, die durch die schlecht schließenden Fenster pfiffen.
Afra kniete in der ersten Bank auf der Frauenseite neben ihrer Mutter und zog sich das Schultertuch eng um den Hals. Der Pfarrer predigte vom Fegefeuer und den Qualen der Hölle und Afra fühlte sich, als ob sie bereits über sie gekommen wären. Was sollte denn jetzt nur werden?
Der Knecht und die Kleindirn, die beiden einzigen Helfer, die sie auf dem Hof gehabt hatten, hatten noch nicht einmal die Leich abgewartet. Sie waren noch in der Nacht, als man den Vater tot nach Hause gebracht hatte, mit ihren paar Habseligkeiten davongelaufen. Die Mutter hatte gesagt, dass sie es ihnen nicht verdenken könne. Auf dem Wimschneiderhof war kein Auskommen mehr zu verdienen. Aber wohin sollten sie gehen? Die Mutter und die Brüder? Sie konnten nicht einfach ihre Sachen packen und weglaufen.
Die Mutter war ganz sicher keine Frau, die einfach die Hände in den Schoß legte und aufgab. Aber Afra hatte sie nachts in ihrem Bett weinen hören. Wahrscheinlich hatte die Bäuerin gedacht, in der Dunkelheit in ihrem Bettkasten konnte sie es sich erlauben. Doch die Tochter hatte ebenfalls nicht schlafen können und die Verzweiflung in ihrem eigenen Herzen wurde ihr von der anderen Seite der Schlafkammer her durch das Schluchzen der Mutter zurückgeworfen. Afra war kein Kind mehr, sie wusste, wie schlecht es jetzt um sie stand. Sie beweinte nicht so sehr den Toten als vielmehr die, die noch lebten.
Als der Pfarrer geendet hatte und die Sargträger den Holzsarg auf die Schultern hoben, bemerkte Afra im Hinausgehen einen fremden Mann ganz hinten unter der Empore. Er stand da, hielt den Hut in der Hand und wirkte irgendwie seltsam deplatziert. Sein Anzug war zu fein, sein Haar zu gut frisiert und der Bart auch. Außerdem hatte sie ihn noch nie im Dorf gesehen. Der Wimschneider-Bauer war in seinem arbeitsreichen Leben gewiss nicht weit herumgekommen. Wer erwies da also dem Vater die letzte Ehre?
Auf dem Friedhof vor der Kirche hatte der Totengräber schon das Loch geschaufelt und mit Holzplanken abgesichert. Dort stellten die Träger jetzt den Sarg nieder. Der Pfarrer kam mit seinen Ministranten und schwenkte den Weihrauchkessel so heftig hin und her, dass Afra von dem aufsteigenden Geruch ganz schwindlig wurde.
„Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus …“
Afras Lippen formten die eingeübten Phrasen ganz automatisch, während ihre Gedanken bei dem Fremden waren. „Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.“
Was konnte die Heilige Jungfrau für sie wohl tun?, fragte sich Afra in ihrem Herzen. Sie wusste, dass es eine Sünde war, so etwas auch nur zu denken. Aber sie erwartete sich keine Erlösung aus dem Gebet. Der Vater war tot. Der einzige Mensch, der in der Lage gewesen war, sie, ihre Brüder und die Mutter zu versorgen. Wenn sie nur gewusst hätte, wohin …
Nach dem Ave-Maria verfiel der Pfarrer in die Litanei. „Kyrie, eléison. Christe, eléison. Kyrie, eléison. Christe, áudi nos, Christe, exáudi nos, Pater de cælis, Deus …“
„Miserére nobis“, murmelte die Trauergesellschaft im Chor.
Der Pfarrer rief die Heilige Dreifaltigkeit, die Jungfrau Maria und alle Engel, Erzengel und Heiligen zur Fürbitte an. Afra fürchtete, gleich neben dem offenen Grab niederzusinken. Sie umklammerte ihr Gebetsbuch so fest, dass die Knöchel an ihren Händen weiß hervortraten. Sie schaffte es nicht, den Blick von dem tiefen Loch abzuwenden, in das der Sarg ihres Vaters jetzt gleich hinuntergelassen werden würde.
Endlich kam der Pfarrer zum Schluss: „Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.“
Erleichtert wandte Afra sich zum Gehen.
Als sie ihrer Mutter zwischen den Gräberreihen zum Friedhofstor hin folgte, fiel ihr wieder der unbekannte Herr auf. Er löste sich aus dem Schatten der Birken und kam direkt auf sie zu. Nun würde sie wohl gleich erfahren, wer er war.
„Mein Beileid, Agathe“, kondolierte er der Mutter.
„Danke, Joseph. Es ist sehr großherzig von dir, dass du eigens hergekommen bist von München. Das hätt ihn sicher sehr gefreut. Darf ich dich einladen? Wir haben leider keine große Leich, aber bei uns auf dem Hof hat die Nachbarin Kaffee und Schmalzgebäck gerichtet. Wenn du magst …“, sagte die Mutter.
Afra überlegte, ob der Vater Verwandtschaft in München gehabt hatte, von der sie nichts wusste.
„Das ist sehr freundlich von dir, Wimschneiderin. Ich komme gern, ich habe eh noch was zu reden mit dir“, erwiderte der Fremde, den die Mutter Joseph genannt hatte.
Die Mutter erklärte: „Afra, Bartl, Loisl, das ist euer Onkel, der Pschorr Joseph aus München. Gebt dem Onkel die Hand.“
Artig hielt Afra dem stattlichen Großstädter die Hand zum Gruß hin und knickste.
„Grüß dich Gott, Afra“, sagte Pschorr. „Groß bist du geworden. Ich glaub, ich hab dich nimmer gesehen, seit du ein so kleines Zwetschgerl warst. Eigentlich habe ich mehr mit dir zu reden, aber die Mutter soll halt auch einverstanden sein.“
Überrascht sah Afra von dem fremden Onkel zur Mutter und wieder zurück. Es drängten noch mehr Leute zum Friedhofstor hinaus und alle wollten der Wimschneiderin noch einmal ihr Beileid aussprechen, deshalb musste die seltsame Unterhaltung auf später vertagt werden. Tatsächlich kamen sie erst nach dem Kaffeetrinken wieder dazu, denn auch auf dem Hof riss die Anteilnahme der Nachbarn und Verwandten nicht ab. Alle wussten, was der Tod des Wimschneiders für seine Familie bedeutete. Auch, dass ihnen das Gesinde schon davon war, hatte sich im Dorf herumgesprochen. Der Heindl-Bauer, der größte Bauer in der Umgebung, bot großzügig an: „Ich schick dir eine Kleindirn, Agathe, damit wenigstens in den nächsten Tagen euer Hof versorgt ist. Das bin ich dem Lugge schuldig.“
Agathe nahm das Angebot dankend an. Aber zu ihrer Tochter sagte sie draußen: „Das kommt dem doch grad recht. Jetzt spielt er den Großzügigen. Wenn er den Vater nicht so getriezt hätt mit seinen unverschämten Preisen, dann würd er vielleicht noch leben!“
In der Küche fand Pschorr die beiden Frauen und nahm das Gespräch vom Kirchhof wieder auf. „Ich wollte auch ein Angebot machen, Agathe. Ich würd die Afra gern zu mir in Anstellung nehmen. Dann hast du eine Sorge weniger. Wie alt bist du, Kind?“ Die letzte Frage galt Afra.
Erschrocken wusste sie gleich gar nichts zu antworten.
„Fünfzehn ist sie“, antwortete die Mutter an ihrer Stelle.
„Fünfzehn. Ja, das passt doch. Ich war auch fünfzehn, als ich nach München bin. Das war anno 1785. Und jetzt schau mich an. Vom Bauersbub zum größten Brauherrn in der Stadt hab ich's bei aller Bescheidenheit gebracht. Du kannst als Abräumerin in meiner Gastwirtschaft anfangen. Dafür wirst du schon taugen. Und in ein paar Jahren vielleicht Hausmädchen?“
Afra wusste gar nicht, wie ihr geschah. Nach München gehen? Mit dem fremden Onkel? In seine Brauerei?
Vor Schreck ganz stumm, stand das Mädchen daneben, während die Erwachsenen sich weiter über ihre Zukunft unterhielten. Die Mutter wirkte sichtlich erleichtert: „Das ist ein sehr großzügiges Angebot, Joseph. Ich weiß gleich gar ned, was ich sagen soll.“
„Sag nichts, Agathe. Ich weiß, dass ihr’s schwer habt. Vergiss nicht, dass ich auch von hier stamm. Ich hab’s jedenfalls noch nicht vergessen. Was das Mädel bei mir lernt, kann sie überall gebrauchen. Vielleicht geht sie eines Tages zurück und heiratet einen großen Bauern. Oder sie bleibt in der Stadt und hat ein eigenes Auskommen. Deine Buben sind noch zu klein, die will ich nicht mitnehmen. Da reden wir noch einmal, wenn sie größer sind. Aber ich glaub, die bringst du auch hier unter. Dann muss sich einer halt erst einmal als Knecht verdingen, auch wenn der Vater einen eigenen Hof gehabt hat.“
Der Pschorr hielt der Mutter die Hand hin und die schlug ein. So war das Geschäft um Afra besiegelt.
München, April 1799
Das Mädchen kam am Dienstag, den zweiten April in der Residenzstadt an. Ein freundlicher Nachbar hatte das Mädchen auf seinem Holzfuhrwerk mitfahren lassen, mitten im Straßengewirr ließ er sie absteigen. „Behüt‘ dich Gott, Mädel“, rief er ihr zum Abschied noch nach, dann trabten die beiden Braunen wieder an.
Die Stadt erschien dem Dorfkind Afra unendlich groß und laut. Die schiere Anzahl an Pferdefuhrwerken, Handwägen und Fußgängern überforderte sie. In Hadern war der nächste Nachbar ihres Elternhauses fast einen halben Kilometer entfernt gewesen, dazwischen lagen Wiesen, Weiden und Felder. Im Haus hörte man das Knarren der Dielen, das Klappern der Kochtöpfe auf dem Herd und vor allem an langen Winterabenden das Knacken des Kaminholzes und das stete Surren des Spinnrades. Vor der Tür ließen sich die Rindviecher vernehmen, die an ihren Ketten zerrten, mit den Hufen aufstampften oder muhten. Darunter mischten sich Hühnergackern, Hundebellen und natürlich die Kirchenglocken, die vom Morgengeläut bis zum Gebetläuten am Abend den Tagesrhythmus vorgaben. Hier in München ließ sich gar nicht sagen, wo die einzelnen Geräusche herrührten. Irgendwo wurde immer etwas gebaut oder abgeladen, schlugen Pferdehufe auf den Boden, rumpelten Räder …
Obendrein waren die Straßen erfüllt von einem geradezu bestialischen Gestank. Gewisse unangenehme Gerüche waren Afra nicht fremd, sie kannte den Geruch von Viehdung im Stall, vom Misthaufen im Hof und von der Gülle, die auf den Feldern ausgebracht wurde. Doch das alles war nichts im Vergleich zu dem scharfen Gestank von Urin und Fäkalien und von Abfall jeder Art, der die Straßen hinauf und hinunter wehte.
Afra hielt einen abgegriffenen Zettel in der Hand, darauf stand die Adresse des fremden Onkels, der sie in Dienst nehmen wollte. Wohin genau sie sich wenden musste, wusste sie nicht. So viele Straßen und Ecken. Wie sollte sie da das richtige Haus finden?
Sie lief ein paar Straßen entlang, doch dann ging ihr auf, dass München viel zu groß war, um es Straße für Straße abzu-suchen, bis sie die richtige Adresse fand. Die Häuser sahen ja alle gleich aus, hatten so viele Fenster und Türen. Was sollte sie machen? Einfach jemanden anhalten und fragen?
Dazu kam, dass sie gar nicht besonders gut lesen konnte. Sie hatte zwar die Dorfschule besucht, aber gerade in den Sommer- und Herbstmonaten, wenn auf dem Hof viel zu tun gewesen war, hatten die Eltern nicht auf ihre Hände verzichten können. Im Winter war der Weg zur Schule häufig so beschwerlich, dass sie ihn nicht schaffte. Außerdem hatten die Schulkinder jedes seinen Anteil Brennholz mitzubringen gehabt, um den Ofen im Schulhaus anfeuern zu können, das war für drei Kinder über den ganzen Winter eine Menge Holz. Und bei einem Mädchen hielt man die Schulbildung ohnehin nicht für so wichtig. Afra hatte für sich darin nie einen Vorteil gesehen. Jetzt zeigte sich, dass es doch besser gewesen wäre, sie hätte mehr Zeit im Schulhaus zugebracht. Sie kam sich unheimlich dumm vor.
Die feinen Herren und die hübschen Damen mit ihren Hüten und weiten Gewändern wagte Afra nicht anzusprechen, doch dann erreichte sie einen Platz, in dessen Mitte ein Brunnen plätscherte, dort standen ein paar Waschweiber beisammen und schwatzten über ihre Arbeit hinweg. Die erschienen dem Mädchen weniger fremd und sie fasste sich ein Herz und sprach die Frauen an.
„Grüß Gott! Ich bitt', meine Frage zu entschuldigen, aber ich kenn mich hier ned aus.“
Eine dickliche Wäscherin wandte sich Afra zu, begutachtete sie ausgiebig vom Haaransatz bis zu den Spitzen ihrer abgewetzten Schuhe und befand: „Ja, das denk ich mir.“
„Schau, Frau. Ich müsst da hin“, fuhr Afra unbeirrt fort, aus Angst, der Mut könnte sie verlassen, wenn sie jetzt innehielte.
Die Frau nahm ihr den Zettel aus der Hand und drehte und wendete ihn. Dann reichte sie ihn an die nächste weiter. So machte der Zettel erst einmal die Runde, bis ihn jede der Frauen einmal in der Hand gehabt hatte. Die letzte schließlich entzifferte darauf: „Hacker-Pschorr, Sendlingerstraßen. Das Pschorr-Bräu? Sucht sie die Brauerei vielleicht?“
Erleichtert nickte Afra. „Ja, ja, die Brauerei, die such ich. Bittschön, weiß denn eine von euch, wo die ist?“
Die Frau, die immer noch ihren Zettel in der Hand hielt, lachte. „Die Brauerei vom Joseph Pschorr, die kennen wir schon. Die kennt ein jeder Münchner. Aber das ist ein Stück zu gehen.“
„Sie hat ja junge Füße“, warf die Dicke ein und musterte Afras nackte Beine in den wollenen Socken, die unter ihrem Rock hervor lugten.
Dann erklärten die Frauen Afra, wie sie zu gehen hatte. Weil sie so froh über die Auskunft war und keine Ahnung hatte, wie die Gepflogenheiten in München waren, knickste Afra mehrmals zum Dank und zur Verabschiedung. Als sie in die angegebene Richtung davonlief, hörte sie noch lange das Gelächter der Waschweiber in ihrem Rücken.
* *
Das Stammhaus der Brauerei Hacker-Pschorr war ein klobiges, dreistöckiges Stadthaus in Ockerbraun. Das respekteinflößende Bauwerk mit seinen langen Fensterreihen hätte Afra um ein Haar gleich wieder in die Flucht geschlagen, doch dann entdeckte sie eine junge Frau, die einen Eimer auf der Straße ausleerte.
Afra eilte auf sie zu und sprach sie an. „Entschuldigung bitte, ich bin die Afra. Vom Wimschneiderhof in Hadern. Ich soll hier in Dienst kommen.“
Die Angesprochene stellte ihren Eimer ab und wischte sich die nasse Hand an der fleckigen Schürze ab. „Ich bin die Frieda. Ich bin hier schon im Dienst“, erwiderte sie.
Frieda kam Afra zu ihrer Erleichterung so normal und freundlich vor, so, wie die Leute bei ihr zu Hause auch waren, dass sie sie gleich ins Herz schloss. Im Vertrauen fragte sie: „Wie ist es denn so?“
Frieda zuckte die Schultern. „Wie soll's schon sein? Der Pschorr ist kein schlechter Dienstherr. Man kann schon auskommen mit ihm. Wennst deine Arbeit machst und dir ned zu schad bist anzupacken, dann kannst es hier schon aushalten.“
Da war es Afra endlich ein wenig leichter ums Herz. Das Arbeiten war ihr nicht fremd. Zu Hause war die Arbeit auch immer zu viel gewesen und das Geld immer zu wenig. Das kannte Afra. Vielleicht würde sie sich dann an München schon gewöhnen.
1 Aus „Die Chronik Bayerns“, S. 276
2 Aus „Die Chronik Bayerns“, S. 275
II.
KATHREINTANZ
München, November 1802
Seit dreieinhalb Jahren stand Afra nun schon in der Hacker-Pschorr-Brauerei in Dienst. Das verschüchterte Mädchen, das im Frühjahr 1799 in München angekommen war, mauserte sich schnell zu einer fleißigen Kraft im Hause ihres Onkels. 1800 war Therese Hacker gestorben. Der Patron hatte sich schnell wieder verheiratet, mit der Tochter eines Kochs, der bei ihm im Gasthof angestellt war. Die neue Frau Pschorr führte ein weniger strenges Regiment im Haus als die Verblichene und Afra war bei ihr zum Stubenmädchen aufgestiegen.
Am Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert zählte Bayern etwa 1,2 Millionen Einwohner und achtundzwanzig Millionen Gulden Schulden. Die Österreicher waren zum vierten Mal in Bayern eingefallen und hatten die Städte besetzt. Nun war Bayern mit Österreich im Bund und Franz II. von Österreich zog gegen die Franzosen, die vom Westen her einfielen. Vor allem aus Landshut und Ingolstadt hörte man grausige Geschichten von marodierenden Soldaten und Plünderern. Zwar war es den Österreichern und ihren Verbündeten gelungen, die bayerischen Städte wieder freizukämpfen, doch erst mit dem Frieden von Lunéville 1801 kehrte in Bayern tatsächlich wieder Ruhe ein. Die Münchner blieben vom Kriegsgeschehen weitgehend verschont, bis auf die Soldaten, die zum täglichen Straßenbild gehörten. Auch im Pschorr-Keller gingen die österreichischen Soldaten ein und aus.
Aus der ersten Begegnung mit Frieda war eine innige Freundschaft gewachsen. Die beiden jungen Frauen teilten sich ein Zimmer unter dem Dach und sich außerdem gegenseitig alle Gedanken und Geheimnisse mit. Frieda, die zwei Jahre älter war als Afra, hatte davon gerade ziemlich viele. Seit Kurzem traf sie sich mit einem Stallburschen der Residenz. Die beiden jungen Leute wollten gerne heiraten, doch leider hatten sie beide kein Vermögen und ihre Löhne waren für eine Heiratserlaubnis zu niedrig.
An einem Sonntag Ende November fragte Frieda ihre Freundin, weil sie beide einen halben Tag Ausgang bekommen hatten: „Kommst heute endlich mal mit? Es ist Kathreintanz beim Seewirt in der Kleinhesselohe.“
In der kleinen Ansammlung von Holzhäusern um eine Meierei am Ufer des Kleinhesseloher Sees betrieb der Auwächter Josef Tax eine Gastwirtschaft mit Bierausschank. Schon 1789 hatte der alte Kurfürst Carl Theodor das Gebiet im Osten der Militärgärten zum Volksgarten ernannt und vom Hofgärtner Friedrich Ludwig von Sckell nach dem Vorbild der Natur in einen englischen Park umgestalten lassen. Erst 1800 hatte der Freiherr von Werneck den kleinen, vom Schwabinger Bach gespeisten Tümpel zu einem See ausbauen lassen. Ursprünglich sollte der Volkspark zu Ehren des verstorbenen Monarchen Theodors-Park heißen, doch der Name setzte sich aufgrund der Unbeliebtheit des vorigen Kurfürsten nicht durch, stattdessen prägte sich bald der Begriff Englischer Garten im Volksmund ein. Um die Hirschau und die aufgelösten Militärgärten erweitert, war der Englische Garten inzwischen der größte Volksgarten Europas und ein beliebter Treffpunkt der Münchner quer durch alle Stände.
„Kannst du dir das leisten?“, fragte Afra zweifelnd. „Das Bier beim Seewirt kostet doch bestimmt vier Kreuzer.“
„Ich will ja ned zum Trinken hin, sondern zum Tanzen!“, rief Frieda und drehte sich um die eigene Achse, dass sich der Rock ihres einfachen Arbeitskleides bauschte.
Afra grinste. „Du willst mit dem Steffel poussieren.“
„Mögen würd ich vielleicht schon“, räumte sie ein. Friedas Wangen färbten sich augenblicklich rot. „Aber solang, wie wir kein Aufgebot kriegen, bleibt’s beim Tanzen. Kommst jetzt mit?“, fragte sie noch einmal, um von sich abzulenken.
Afra zuckte die Achseln. „Was soll's, dann komm ich halt mit.“
Nachdem ihr Tagwerk für heute getan war, banden die jungen Frauen ihre Schürzen ab, wuschen sich Hände und Gesicht am Brunnen und machten sich dann auf den Fußweg zum Englischen Garten. Zum Glück ließ dieses Jahr der Winter noch ein wenig auf sich warten. Es war zwar schon kühl, aber immerhin schneite es noch nicht, obgleich auch der Winter seinen Reiz hatte, wenn der Kleinhesseloher See zufror und zum Schlittschuhfahren einlud.
Beim Seewirt hatte schon die Kapelle Aufstellung genommen. Vier Musikusse mit Steirischer, Geige, Hackbrett und Zither spielten bereits zu einem Landler auf. Friedas Kavalier war auch schon da und holte seine Herzensdame ohne Umschweife auf den Tanzboden. Afra stand ein wenig unsicher herum und wusste nicht, was sie jetzt ohne ihre Freundin tun sollte. Sie postierte sich in Sichtweite zum Tanzboden und wippte im Takt der Musik mit.
„Ganz allein da?“, fragte unvermittelt eine fremde Stimme.
Afra fuhr erschrocken herum.
„Pardon, ich wollte Sie nicht erschrecken, gnädiges Fräulein.“ Zu der Stimme gehörte ein junger Mann mit einem wirren Lockenschopf. Er trug einen schicken Anzug nach der neusten Mode und wirkte damit in dem recht einfachen Wirtshaus seltsam fehl am Platz.
„Ich bin doch kein Fräulein, schon gar kein gnädiges!“, wunderte sich Afra kichernd. „Ich bin die Afra.“
Der junge Mann deutete eine Verbeugung an. „Angenehm. Nennen Sie mich … Karl August äh … also Karl. Nennen Sie mich Karl.“
Afra konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. „Mei, so steif. Sie sagt man bei uns ned. Da könntest ja in der Residenz vorstellig werden, mit deinen feinen Manieren.“
Karl August wurde rot bis unter seine widerspenstigen Locken. „Nun ja, da komme ich ja auch gewissermaßen her. Ich … also ich wohne … nein, arbeite ja auch in der Residenz.“
Jetzt hatte Afra endgültig die Neugierde gepackt. „Was, wirklich? Wie lustig. Meine Freundin hat einen … na ja, sie ist halt mit einem … also verlobt sind's noch ned, aber sie stehen halt zusammen, verstehst mich schon, oder? Die Frieda, da drüben tanzen sie. Und das ist der Steffel, der ist Stallknecht in der Residenz.“
„Steffel, ja, den kenne ich natürlich. Der ist … gewissermaßen mein Kamerad“, antwortete Karl.
Trotz seiner höfischen Manieren stotterte Karl bei fast jedem Satz. Das machte ihn Afra gleich sympathisch.
Dann standen sie eine Weile nur so da. Afra fehlte es an Erfahrung im Umgang mit jungen Männern. Daheim im Dorf waren die Jungen anders gewesen und sie außerdem noch ein Kind. Und dieser war, wie sie nicht umhin kam festzustellen, sehr stattlich und für ihre Verhältnisse fast ein wenig zu vornehm. Gerade als das Schweigen anfing peinlich zu werden, sagte er unvermittelt: „Möchtest du auch tanzen, Afra?“
Die Kapelle spielte jetzt einen Walzer.
„Ich glaub … ich kann das gar ned“, gestand Afra und warf einen neidischen Blick zu Frieda hinüber, die sich wie selbstverständlich von Steffel über den Tanzboden führen ließ.
„Ach, das ist nicht schwer“, sagte Karl. „Ich zeig es Ihnen … äh. Komm, ich zeig's dir.“
Karl entpuppte sich wirklich als ein recht geübter Tänzer. Obwohl Afra mehr über ihre eigenen Füße stolperte und mehrmals auf die seinen trat, gelang es ihm, sie halbwegs im Takt herumzuwirbeln.
Nach ein paar Runden war Afra völlig außer Atem. Karl führte sie, ganz Kavalier, zu einer freien Bank. „Das ist anstrengend, wenn man nicht daran gewöhnt ist“, sagte er.
Afra, die an mindestens zwölf Stunden harte Arbeit täglich gewohnt war und auch heute schon seit fünf Uhr morgens auf den Beinen stand, wollte nicht wie ein Püppchen behandelt werden. Sie erwiderte: „Ans Tanzen bin ich ned gewohnt, das stimmt. Hat mir auch keiner gesagt, dass das so schnell geht.“
Karl lachte zum ersten Mal, seit sie sich kennengelernt hatten, herzlich auf und in seinem Gesicht zeigten sich zwei Grübchen.
„Möchtest du vielleicht etwas zu trinken? Ich äh … hol dir ein Bier.“
Afra, die an ihre leere Geldbörse dachte, winkte verlegen ab. „Nein, lass. Es geht gleich wieder.“
„Ich hole aber trotzdem etwas. Was möchtest du denn?", beharrte Karl.
Verschämt gestand Afra: „Das Bier hier kann ich mir gar nicht leisten. Ich bin doch nur ein Dienstmädel.“
„Da müssen die Münchner Edeldamen ja eine Gefahr für das ganze Reich sein, wenn schon die Dirnen so schön sind“, entfuhr es Karl.
Afra spürte, wie sie tiefrot anlief. Mit solchen Schmeicheleien war sie nicht vertraut. „Kennst wohl gar keine Adligen, obwohl du in der Residenz ein- und ausgehst?“, fragte sie, um abzulenken.
Karl zögerte mit der Antwort. „Doch, schon. Ich bin nur noch nicht so lange in München.“
„Wo kommst denn dann her?“, wollte Afra wissen.
„Geboren bin ich in Straßburg. Die letzten Jahre war ich viel in Landshut und in Göttingen, da habe ich studiert.“
Afra staunte. „Was hast du? Studiert? Ja geh, hör auf!“
Aber Karl winkte ab. „Das ist in meiner Familie so üblich. Aber ehrlich gesagt, so bemerkenswert ist der Umstand auch wieder nicht. Erzähl mir lieber von dir! Aber warte, erst hole ich uns ein Bier. Ich bestehe darauf.“
Karl verschwand zwischen den Leuten und Afra sah ihm ungläubig hinterher. Der wunderliche junge Mann faszinierte sie. Jemand Vergleichbarem war sie noch nie zuvor begegnet. Ihr war wohl bewusst, dass sich dieses vertrauliche Gespräch mit einem Mann, den sie gar nicht kannte, nicht gehörte. Schon gar nicht, weil offensichtlich war, dass er höher stand als sie. Aber sie machte ja gar nichts. Was konnte schon dabei sein?
Als Karl mit dem Tonkrug zurückkehrte, nahm Afra das angebotene Getränk doch gerne an. Die ungewohnte Tanzerei machte durstig. Sie trank einen großen Schluck und wischte sich danach den Schaum mit dem Handrücken von der Oberlippe.
Karl lachte herzhaft. Peinlich berührt erkannte Afra, dass sich ihr Verhalten für Frauen, wie Karl sie gewohnt war, wahrscheinlich nicht schickte. Er musste sie für entsetzlich provinziell halten.
Doch stattdessen sagte er: „Du bist wirklich ein ganz zauberhaftes Weibsbild.“
Er drehte den Krug herum und trank von der anderen Seite. Dann wischte er sich in Nachahmung ihrer Geste den Mund. Da musste auch Afra lachen.
Frieda und Steffel kamen vom Tanzboden, die Kapelle machte gerade eine kurze Pause. Steffel schien die Anwesenheit seines Kameraden unangenehm zu sein. Sichtlich nervös setzte er an: „Aber Ma… was …“
„Scht!“, unterbrach ihn Karl sofort. „Verdirb uns nicht den Abend, Steffel. Heute wollen wir einmal vergessen, wer wir sind und wo wir herkommen, und einfach nur tanzen und lustig sein.“
„Aber …“ Steffels Blick wanderte unsicher zwischen Afra, Karl und Frieda hin und her.
„Kein Aber. Bitte, tu einem alten Kameraden den Gefallen.“
Frieda zwinkerte Afra verschwörerisch zu und flüsterte ihr ins Ohr: „Mensch, der ist aber auch schick!“ Dann zog sie Steffel mit sich fort. Sie hatte im Gedränge am Ausschank bekannte Gesichter entdeckt. Steffel schien erleichtert, von dem Gespräch mit seinem Kameraden entbunden zu sein.
Afra war die seltsame Stimmung zwischen Karl und Steffel nicht entgangen. Sie fragte: „Was hat er denn?“
Karl erwiderte: „Ach, nichts. Weißt du, Steffel ist ja auch im Stall und normalerweise stehe ich ihm … also gewissermaßen vor. Aber heute sind wir einfach mal privat. Es ist so ein schöner Tag. Möchtest du spazieren gehen?“
Afra nickte und ließ sich von Karl hinausbegleiten. Die frühe Dämmerung dieses Novembertages hatte sich bereits über den Englischen Garten gelegt. Die Wildenten und Schwäne auf dem Kleinhesseloher See waren schon schlafen gegangen. Afra fröstelte nach der erhitzten Atmosphäre im Seewirt. Karl entging das nicht.
„Ist dir kalt?“, fragte er, und ohne eine Antwort abzuwarten, zog er seine Jacke aus und legte sie ihr um. Sie roch nach ihm.
Er steuerte eine Holzbank am Ufer des Sees an. Eine Trauerweide, deren blattlose Äste durch das flache Wasser der Uferzone schleiften, verbarg den Blick auf das Wirtshaus. Die Musik und das Gelächter wehten aber noch in leisen Fetzen zu ihnen herüber.
Ganz selbstverständlich legte Karl den Arm um Afras Schultern. Afras Herz begann zu rasen. So nah war sie einem Mann noch nie zuvor gekommen. Sie wusste, dass sie von ihm abrücken und sich gegen die Vertraulichkeiten wehren sollte. Schon, dass sie allein hier saßen, hätte sie verhindern müssen. Doch sie stellte fest, dass sie das gar nicht wollte. Es fühlte sich auf aufregende Weise gut an.
„Du wolltest mir von dir erzählen“, nahm Karl das Gespräch von vorhin wieder auf.
Afra hatte das Gefühl, gar nicht sprechen zu können. Sie stammelte: „Ich habe nichts Aufregendes zu sagen.“
Karl wandte ihr das Gesicht zu. Im dämmrigen Licht konnte sie seine Züge nur erahnen, aber die Lampen vorm Seewirt spiegelten sich in seinen Augen. „Mich interessiert alles. Woher kommst du? Bist du hier in München geboren?“
Afra schmeichelte sein Interesse an ihrer Person. „Ich bin ned aus München. Ich bin aufm Dorf geboren. Hadern heißt es. Meine Eltern hatten dort einen Bauernhof. Aber mein Vater ist gestorben und danach war es für meine Mutter schwer, mit dem Hof und uns Kindern …“
„Das tut mir leid“, sagte Karl leise.
Afra wollte die Stimmung nicht verderben und fuhr fröhlicher fort: „Das ist alles schon ein paar Jahre her. Ich kam damals nach München zu meinem Onkel in Stellung. Er ist Brauherr, die Brauerei in der Sendlinger Straße gehört ihm. Dort bin ich jetzt Hausmädchen.“
„Die Hacker-Pschorr-Brauerei?“, fragte Karl. „Die kenne ich natürlich. Dein Onkel ist unser Hoflieferant in der Residenz.“
Mit jedem Satz verlor Afra mehr von ihrer anfänglichen Scheu. Sie kuschelte sich in die wärmende Jacke und an Karls Arm und erzählte. Die Worte sprudelten nur so aus ihr heraus. Sie schilderte ihren Arbeitsalltag in der Brauerei, die kleine Stube unter dem Dach, die sie sich mit Frieda teilte, und in besonders bunten Bildern den elterlichen Hof und das Dorfleben. Karl hörte zu, lachte und hielt ihren Redefluss mit interessierten Nachfragen am Laufen. Sie merkten gar nicht, wie die Zeit verging. Auf einmal hörten sie lautes Rufen.
„Afra? Af-ra!“
Es war Friedas Stimme. Afra schreckte hoch. Die geliehene Jacke rutschte von ihren Schultern. Vom Seewirt her näherte sich eine Gruppe mit Lampen. Sie wiederholten Friedas Ruf.
Schnell trat Afra aus dem Schutz der Weide heraus auf die Gruppe zu.
„Gott sei Dank, da bist du ja!“ Frieda eilte Afra entgegen. „Meine Güte, hab ich mir Sorgen gemacht. Du Kuh! Mach das ja nie wieder, hörst du?“ Sie fiel der Freundin um den Hals. „Was machst du überhaupt allein hier? Ist dir ned kalt? Wo hast du dein Wolltuch?“
Afra wollte einwenden, dass sie gar nicht allein war, doch als sie sich umdrehte, war Karl verschwunden. Ungläubig suchte sie den Uferstreifen ab, wo sie eben noch zusammen gesessen hatten.
„Ist dir was? Sag, ist alles in Ordnung?“ Frieda schob Afra auf die Männer zu, die sie begleitet hatten. Im Schein der Lampen musterte sie die Freundin.
„Ist sie verletzt?“, fragte Steffel und hielt Afra seine Laterne vors Gesicht.
Afra schüttelte vehement den Kopf.
„Dann können wir ja wieder hineingehen“, stellte ein anderer der Begleiter fest. Sie setzten sich wieder in Bewegung. Frieda und Steffel nahmen Afra in ihre Mitte.
„Wo ist denn dein fescher Galan von vorher hin?“, wollte Frieda wissen und knuffte Afra in die Seite. „Ich hab schon gedacht, du bist mit ihm durchgebrannt!“
Steffel ließ ein empörtes „Pah!“ hören.
„Ja, was denn? Das soll schon vorgekommen sein“, verteidigte Frieda sich.
„Aber ned bei dem“, erklärte Steffel kategorisch.
Afra sagte nichts. Die vergangenen Ereignisse hingen ihr noch nach. Sie ließ sich widerstandslos zurück in den Schankraum des Seewirts schieben, von Frieda in ihr wollenes Tuch hüllen und anschließend von der Freundin nach Hause führen. In ihrem Kopf drehten sich die Gedanken. Wohin war Karl so plötzlich verschwunden? Warum hatte er sie nicht zum Seewirt zurückbegleitet? Was hatte das alles zu bedeuten?
III.
WENDUNG
München, Juni 1803
Die Zeiten waren hart zu Beginn dieses neuen Jahrhunderts. Die europäischen Großmächte rangen miteinander und drohten, das kleine Kurfürstentum Bayern zwischen sich aufzureiben. Durch die jahrelangen Kriege und die damit einhergehende marode Wirtschaft litt das bayerische Volk in weiten Teilen große Not. Im Jahr 1802 kamen in der Residenzstadt München bei 30.000 Einwohnern auf jede Geburt zwei Todesfälle. Dazu sah sich Bayern gezwungen, sechs Millionen Gulden Kontributionen an die Franzosen zu zahlen, was mehr war als die gesamten Steuereinnahmen eines Jahres. Nur dem mehrheitlichen Rückhalt in der Bevölkerung und seinen diplomatischen Fähigkeiten verdankte es der unerfahrene Kurfürst Max Joseph, dass er die gerade erst errungene Macht nicht sofort wieder abgeben musste. Gleichwohl gab es auch in München Republikaner, die den Adel stürzen sehen wollten.
Ein Umstand aber kam den Bayern zu Hilfe: Das Heilige Römische Reich deutscher Nation bröckelte. Nachdem die Niederlagen in den Koalitionskriegen sie zum Friedensschluss mit Frankreich gezwungen hatten, mussten Preußen, Österreich und ihre Verbündeten große Gebietsverluste hinnehmen. Das Kurfürstentum Bayern büßte die Pfalz und einige Besitzungen in den Niederlanden ein. Die Sieger, Frankreich und auch Russland, zeigten sich großzügig gegenüber Kurfürst Max Joseph, wohl weil sie davon ausgingen, dass ein starkes Bayern gleichzeitig eine Schwächung Österreichs und Preußens bedeuten würde. So kam es, dass bei der Ratifi-zierung der Hauptschlussakte im März 1803 in Regensburg Kurfürst Maximilian unterm Strich als Gewinner hervorging. Zum bisherigen bayerischen Kernland wurden die Fürstbistümer Augsburg, Bamberg, Freising und Würzburg zugeschlagen, außerdem Teile von Eichstätt, Passau und Salzburg sowie fünfzehn Reichsstädte und dreizehn Reichsabteien. Franken und Schwaben gehörten damit erstmals weitgehend zu Bayern.
Max Joseph setzte auf Säkularisation. Mit der Entrechtung der Kirche und Enteignung von kirchlichem Besitz konnte der Kurfürst seinen Machtanspruch zusätzlich sichern. Zuerst nahm er der Kirche das Schulwesen aus der Hand und führte die allgemeine Schulpflicht ein. Von nun an sollten alle Kinder ohne Ausnahme vom 8. September bis zum 15. Juli eines jeden Jahres, mindestens sechs Jahre lang, zur Schule gehen. Die gesetzlichen Schulferien deckten die Erntezeit ab, denn ohne die Hilfe der Schulkinder – das wusste auch der Kurfürst – war die Feldarbeit für die Bauern nicht zu schaffen. Das Schulgeld wurde auf zwei Kreuzer pro Woche festgesetzt. Er verfügte auch, dass die altehrwürdige bayerische Landesuniversität in der Festung Ingolstadt nicht mehr sicher war. Schon vorher hatte es Bestrebungen gegeben, sie umzusiedeln, denn die kleine Reichsstadt an der Donau galt als Nest revolutionärer Kräfte. Bei sich in München wollte der Kurfürst die Studentenschar allerdings auch nicht haben, da gemeinhin der Studiosus als umtriebig bekannt war und die Universitäten als Keimstätten von Revolution und Widerstand galten. Deshalb zog die „Hohe Schule“ von der Donau an die Isar nach Landshut um. Kurfürst Maximilian nahm den Umstand zum Anlass, eine Reihe von Landshuter Klöster aufzulösen und ihre Besitztümer umzuwidmen. In Summe sollten in Bayern hunderteinunddreißig Klosterniederlassungen aufgelöst sowie ihre Besitztümer enteignet werden. Kirchen wurden niedergerissen, Glocken eingeschmolzen, ganze Bibliotheken und wertvolles Kirchengerät in die Schatzkammern nach München verbracht oder als Makulatur verkauft.
Großhadern, Juni 1803
Auf dem Land, wo immerhin mehr als drei Viertel der bayerischen Bevölkerung lebte und arbeitete, war man von den Entwicklungen noch weitgehend unberührt geblieben. Auf den Höfen und den Feldern war das Interesse an der Politik gering. Ändern ließ es sich ohnehin nicht, was die Obrigen beschlossen. In Hadern auf dem Hof von Afras Eltern wirtschaftete die Mutter mit den beiden jüngeren Kindern mehr schlecht als recht vor sich hin. Vom Aufwind, den die Münchner verspürten, merkten sie hier nichts. Der Ertrag reichte gerade so für die Abgaben. Die Winter dehnten sich erbarmungslos lang. Im Sommer hingegen reichte der Tag für die viele anfallende Arbeit kaum aus.
Da erschien eines Nachmittags unerwartet ihr Nachbar, der Heindl-Bauer, auf dem Hof. Ihm gehörte das größte Gut in der Gegend.
Agathe Wimschneider wischte sich die schmutzigen Hände an der Schürze ab und richtete sich auf. Sie hatte zwischen den Rüben auf ihrem kleinen Acker hinter dem Haus Unkraut gejätet. Es war ein mühseliges Unterfangen und der Einbruch der Wühlmaus in die Anbauten machte es obendrein zu einem sinnlosen, denn die meisten Rüben waren schon angefressen.
„Grüß Gott, Heindl. Was führt dich denn hierher? Hast du bei dir keine Arbeit zum Machen?“, begrüßte Agathe den unerwarteten Besucher und streckte den müden Rücken durch.
„Doch, ich komm aber in einer wichtigen Angelegenheit. Könnten wir uns vielleicht kurz niedersetzen?“ Das Gesicht des Bauern war ernst.
Agathe führte ihn um das Haus herum nach vorne, wo auf dem Grät genannten erhöhten Eingangsbereich eine einfache Holzbank unter dem Fenster stand.
„Wimschneiderin, schau, ich hab Nachrichten aus der Stadt“, begann er das Gespräch.
Agathe horchte auf. „Von meiner Afra? Sag bloß … Hast etwas von ihr gehört? Mir schreibt sie immer seltener.“
Heindl schüttelte den Kopf. „Nein, nicht von der Afra. Aus der Residenz.“
„Aus der Residenz?“, wiederholte Agathe überrascht. „Geh, sag gar, was würde denn die Residenz dir für Nachrichten schicken?“
„Nicht direkt für mich ist die Nachricht. Mehr für uns alle. Hast du schon gehört, dass die Klöster rundherum aufgelöst werden?“
„Die Klöster? Aufgelöst? Ja, wie denn das?“ Agathe erkannte noch immer keinen Zusammenhang zwischen der Neuigkeit und ihr. Wie die meisten Bauern in der Gegend war sie aber tiefgläubig und die Auflösung von Klöstern kam ihr wie ein unerhörtes Sakrileg vor.
„Auf allerhöchsten Befehl werden die Klöster und Abteien aufgelöst und ihr Besitz geht an den Staat über …“
„Alle Klöster? In ganz Bayern?“, unterbrach Agathe ihn ungläubig. Das Prämonstratenser-Kloster Schäftlarn gehörte selbstverständlich zu ihrem täglichen Leben, obwohl sie selbst noch nie dort gewesen war. Ihre Familie aber arbeitete schon seit Generationen für den Abt des Konvents, der ihr Lehensherr war. Die Abgaben waren hoch, doch dass sich daran einmal etwas ändern könnte, wäre der Witwe gar nicht erst eingefallen. Die Lehensordnung war gottgegeben, so wie die Jahreszeiten und das Wetter.
„Hör mir halt zu!“, schalt der Heindl-Bauer sie. „Alle Klöster und Abteien werden oder sind schon aufgelöst. Verstehst du denn nicht? Auch Schäftlarn. Du und ich, wir gehören nicht mehr länger dem Kloster!“
Für einen Augenblick glaubte Agathe Wimschneider, dass die schier endlose Last ihr von den Schultern genommen wäre. Doch dann wurde ihr schlagartig klar, dass sich lediglich der Lehensherr ändern würde. Für sie, die Fronbauern, änderte sich damit aller Wahrscheinlichkeit nach gar nichts. Am Ende wurden die Abgaben vom neuen Grundherrn sogar noch erhöht.
„Was ändert’s denn für uns?“, fragte sie müde.
„Alles, wennst willst“, sagte der Heindl enthusiastisch.
„Ach geh, das glaubst doch selber ned. Dann ist es halt nicht mehr der Abt, der uns die Abgaben abnimmt, sondern ein anderer. So war’s immer.“
Der Heindl machte ein triumphierendes Gesicht. „Aber so muss es ned bleiben. Der Kurfürst gibt den Bauern die Möglichkeit, das Lehen abzulösen. Das heißt, wer will, kann sich und seinen Hof freikaufen. Dann hat es sich mit den Abgaben, ein für alle Mal!“
Der Heindl machte ein Gesicht, als hätte er ihr die Offenbarung verlesen, doch Agathes Mut sank noch ein Stück weiter. „Das kannst du vielleicht, Heindl-Bauer. Du hast den größten Hof im ganzen Gäu. Aber ich kann mir ja jetzt schon die Abgaben nimmer leisten. Von was sollt ich denn meinen Hof ablösen? Und für die, die sich ned freikaufen, wird der Kurfürst bestimmt keine geringeren Abgaben ansetzen als bisher. Der braucht doch auch Geld, zum Kriegführen und was weiß ich.“
Der Heindl-Bauer zuckte die Schultern. „Wie du willst, Wimschneiderin. Ich wollt's dir bloß gesagt haben. Du kannst ja mit deinen Buben noch drüber reden. Deine Afra, die ist ja in der Stadt bestens versorgt, um die brauchst dir keine Gedanken mehr machen. Vielleicht findet sich einer, der sie heiratet, und wenn ned, dann ist sie auch gut aufgehoben beim Pschorr Sepp in der Brauerei. Ein Bier wird immer getrunken. Aber deine zwei Buben, an die musst halt denken!“
Das war Agathe selbst bewusst. Jeden Tag quälte sie sich mit der Frage, was aus ihren zwei jüngeren Kindern einmal werden sollte. Aber den Hof zu kaufen, das stand völlig außer Frage. Und das musste dem Nachbarn doch ebenso klar sein.
Der Heindl erhob sich umständlich und wandte sich zum Gehen. Dann überlegte er es sich anders und setzte sich noch einmal neben sie. „Oder, vielleicht gibt's doch noch einen anderen Weg … wennst willst …“, begann er.
„Wie meinst?“
„Na, vielleicht gibt's doch noch eine andere Lösung. Ich überleg mir grad … nur so als Idee …“
Der Heindl-Bauer gab sich Mühe, den Anschein zu erwecken, als käme ihm das alles gerade erst in den Sinn, aber Agathe beschlich das Gefühl, dass sie Zeugin eines wohl-überlegten Schauspiels wurde. Es war ja auch nicht wahrscheinlich, dass der Großbauer mitten am Tag den Weg zu ihr auf sich nahm, nur um mit ihr über Politik zu ratschen. Das sah ihm nicht ähnlich. Aber für ein gutes Geschäft, da wäre er wohl kilometerweit gegangen.
Prompt kam er zu dem Kern seiner Idee. „Also ich hab für mich schon entschieden. Die Gelegenheit lass ich mir nicht entgehen. Ich kauf meinen Hof mit alle Felder und den Wald. Dann bin ich mein eigener Herr und was in München entschieden wird, das geht mich nichts mehr an. Ich hab auch Kinder, an die ich denken muss. Mein Xaver, der übernimmt einmal den Hof, wenn ich nicht mehr kann, das ist schon klar. Aber ich hab ja noch den Ferdl und den Franz. Wenn ich den Hof irgendwann durch drei teilen muss, da bleibt ja nicht mehr viel für jeden. Ob das dann zum Leben noch reicht? Deshalb hab ich mir gedacht, wär's vielleicht gut, wenn ich gleich mehr kaufen würd, jetzt, wo die Gelegenheit so günstig ist. Verstehst schon? Man weiß ja nicht, was dann wieder für Zeiten kommen. Einmal dreht sich's vielleicht wieder. Da bin ich lieber auf der sicheren Seite.“
Agathe ahnte bereits, was nun kommen würde. Sie hatte dem nichts entgegenzusetzen. Also zog sie es vor, zu schweigen.
„Wenn du ihn ned willst, Wimschneiderin“, sagte der Heindl. „Dann nehm ich ihn vielleicht, deinen Hof. Was meinst?“
Von wollen kann ja keine Rede sein, dachte Agathe bitter. Aber welche Möglichkeit blieb ihr denn?
„Wennst meinst, Heindl. Ich kann’s dir ned verdenken, und streitig machen gleich gar ned“, sagte sie. „Es wird halt am Ende so kommen, wie’s eben muss, ned?“
Damit erhob sich der Heindl, klopfte Agathe noch aufmunternd auf die Schulter und ging seines Weges. Etwas Triumphierendes lag in seinem Schritt. Agathe sah ihm nach, wie er über die Felder verschwand. Das Leben kam ihr ungerecht vor. So einer hatte Geld wie Heu und konnte es sich gut einrichten, für seine Söhne konnte er vorsorgen und ihnen ein besseres Leben nicht nur wünschen, sondern aktiv gestalten. Sie aber, die sich ein Leben lang abgerackert hatte für ein klitzekleines Stück vom Glück, sie stand am Ende mit leeren Händen da.
In verzweifelter Wut trat sie gegen den Blecheimer, der auf der Grät stand, begleitet von einem gotteslästerlichen „Kreuztürkensakradi!“ Der Eimer kippte scheppernd um und entleerte seinen Inhalt, Weizenspelze für die Fütterung der Hühnerschar, auf den sandigen Boden. Gackernd machte sich das Federvieh darüber her.
Der Anblick der eifrigen Tiere brachte Agathe wieder zur Vernunft. Schnell bekreuzigte sie sich und hob den Eimer wieder auf. Am Ende aller Tage würde nicht nur sie mit leeren Händen vor ihrem Herrn stehen, sondern auch der Heindl. Das letzte Hemd hat nun einmal keine Taschen, dachte sie grimmig, aber auch ein wenig getröstet.
* *
„Im Leben nicht!“, schrie Bartl, der ältere der beiden Wimschneider-Brüder, völlig außer sich. „Lieber krepier ich!“
Seine Mutter versuchte ihn zu beruhigen. „Geh, Bartl, sei gescheid. Es hilft ja einmal nicht …“ Sie sah ihre eigene Frustration über die neusten Entwicklungen im Zorn ihres Sohnes gespiegelt.
„Und ob da etwas hilft! Mit mir nicht. Ich geh nicht zum Heindl. Und wenn der Saukrippel hierher kommt, dann hau ich ab!“ Bartl warf seinen Löffel auf den Tisch und lehnte sich zurück. Der Appetit war ihm vergangen.
„Ich komm mit dir“, stimmte Loisl sofort entschlossen zu. Auch er legte sein Essbesteck beiseite.
„Bartl, nimm doch Vernunft an!“ Jetzt wurde auch die Mutter laut. „Du bist erst fünfzehn und dein Bruder ist dreizehn! Wo wollt's ihr denn hin?“
„Die Afra hast du auch gehen lassen“, argumentierte Bartl. „Und die ist bloß ein Mädel!“
Agathe nickte. „Ja, ich hab sie gehen lassen. Nach München in die Brauerei. Dort gab es Arbeit für sie. Und der Pschorr ist ja kein Fremder. Aber hier gibt es auch Arbeit genug. Es ist doch sehr freundlich vom Heindl, dass er uns allen dreien anbietet, bei ihm zu arbeiten. So können wir zusammenbleiben. Hier, wo wir daheim sind.“
„Als Knecht auf unserm eigenen Hof“, widersprach Bartl sofort.
„Was macht das denn für einen Unterschied? Bisher haben wir doch auch für den Abt in Schäftlarn gearbeitet und ned für uns allein. Dann bekommt die Abgabe eben jetzt der Heindl-Bauer. Das ist doch egal.“ Agathe wusste, dass es sich nicht wie dasselbe anfühlte. Tat es auch für sie nicht. Aber welches Heil im Fortgehen liegen sollte, das begriff sie genauso wenig.
„Das ist überhaupt nicht egal!“, begehrte Bartl prompt auf. „Der Abt ist nicht eines Tages vor der Tür gestanden, um den Hof zum Übernehmen und uns fortzumjagen. Und auf den Tag kannst warten, wenn der Heindl-Bauer hier das Sagen hat. Spätestens wenn der Heindl Xaver den Hof von seinem Vater übernimmt, dann stehen bei uns hier der Ferdl und der Franze und wollen ihr Wohnrecht. Und wer sind wir dann? Du die Oberdirn und ich der Knecht vom Heindl Ferdl, der wo jünger ist als wie ich und nicht einmal anständig lesen und schreiben kann? Nein, sag ich!“
Die leidenschaftliche Ansprache seines älteren Bruders riss zumindest Loisl mit. „Genau!“, rief der Jüngere und reckte die geballte Faust in die Luft.
„Ich hätt's ja auch lieber anders“, räumte die Mutter hilflos ein. „Aber wir haben doch keine Wahl. Den Hof selber beim Kurfürsten auslösen können wir ned und einen anderen Weg seh ich nicht.“
„Ich schon“, beharrte Bartl stur. „Wenn der Hof überschrieben ist, dann geh ich. Mich hältst du nicht auf, Mutter. So viel Gnad, als wie wir vom Heindl zu erwarten haben, find ich überall. Arbeiten kann ich und zum Leben brauch ich nicht viel. Da werd ich schon anderswo unter-kommen.“
Der Mutter wurde ein wenig angst, wenn sie ihren Buben so reden hörte. Er sprach wie ein Revolutionär und nicht wie ein Halbwüchsiger. Ihr war es, als stünde die ganze Welt plötzlich Kopf. Und der Vater, der vielleicht eine andere Lösung für sie alle gefunden hätte, der war unter der Erde. Agathe fühlte sich ausgeliefert. Was konnte sie noch tun?
Bartl war aufgestanden und nahm seinen Janker vom Haken hinter der Tür. Agathe lief hinter ihm her, als er die Tür zum Gang öffnete, der die Küche und die gute Stube vom Stall trennte.
Agathe sagte leise: „Alleine kann ich den Hof doch auch ned bewirtschaften.“
„Mit uns zusammen kannst du es auch nicht. Und der Heindl wird uns sowieso nicht lassen. Der will unsern Grund und Boden und billige Arbeitskräfte, das ist alles, was den interessiert.“ Bartl ließ seine Mutter im Hausgang stehen und öffnete die Tür hinüber zum Stall, wo noch eine Kuh und der alte Ochse standen. Mit dem Fuß scheuchte er ein Huhn fort, das sich daraufhin gackernd und flatternd durch die angelehnte Haustür einen Weg ins Freie suchte.
Agathe nahm den Beutel mit dem alten Brot vom Haken an der Wand und folgte dem Federvieh in den Hof hinaus. Es marterte sie, dass sie ihren Kindern keine gesichertere Zukunft bieten konnte. Im Grunde ihres Herzens verstand sie die Haltung ihres Sohnes sogar, doch sie wollte nicht noch ein Kind ins Ungewisse schicken müssen. Und was würde dann erst mit dem Loisl werden, wenn der ältere Bruder fortging?