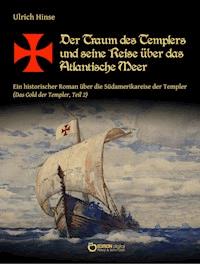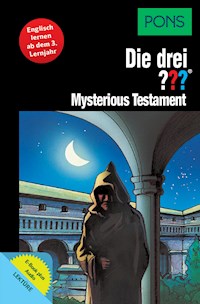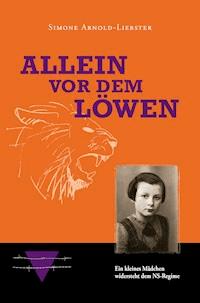Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Sprache: Deutsch
Was macht es mit uns, wenn einem das Liebste genommen wird? Robert Thys war schon vielen Menschen an der Schwelle zum Tod begegnet, aber mit Jessica Morton-Ehrenberg sollte dem Komaspezialisten aus Lüttich die wohl bizarrste Patientin in seiner Laufbahn begegnen. Dabei hatte alles so wundervoll angefangen, damals am Obst- und Gemüsestand auf dem wöchentlichen Markt in Heidelberg, als die gerade 19-jährige Jessica Morton zum ersten Mal in die lebenshungrigen Augen des Studenten Lucas Ehrenberg geblickt hatte - das Leben schien nur darauf gewartet zu haben, von ihnen erobert zu werden ... Jahre später stellt das Schicksal ihr gemeinsames Glück auf eine harte Probe, und Jessica - zunehmend depressiv - steigt immer öfter zu den Gespenstern im Keller ihrer Seele hinab. Dann die Nachricht eines schrecklichen Unfalls ... und Jessica fasst einen folgenschweren Entschluss - das Drama nimmt seinen Lauf ... Da erinnert sich Psychiater und Freund der Familie Noah Wildmann an das Fläschchen Glitzerstaub, das seit Jahren an einer Kette um Jessicas Hals hängt. Zusammen mit Professor Thys stemmt Noah sich gegen ihre Wahnvorstellung, dass sie 'tot' sei. Doch die Wahrheit ist weit verstörender ... Eine leise Geschichte über Liebe, Verlust, Glaube und Hoffnung. Tragisch, tief berührend und jenseits des Erklärbaren ... und nicht zuletzt ein Tauchgang in das Verletzlichste im Menschen - die Seele ... 'Glitzerminuten' ist ein weiterer Roman vom Autor des 2015 erschienenen 'Hahnenschrei'.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Euch,
die ihr in meinem Herzen wohnt …
Ich denke, also bin ich
René Descartes
Würden wir WISSEN -,
wie sollten wir dann GLAUBEN können?
Frank Hajo Hauswald
Das Cotard-Syndrom bezeichnet ein Krankheitsbild, bei dem die betroffene Person irrtümlich davon überzeugt ist, dass sie tot sei.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
KAPITEL 1
Restaurant 'Ô de vie', Chaussée de Tongres 98 Lüttich (Belgien)
Dienstag, 17. Januar 2017, 19:25 Uhr
»Ist der Seeteufel frisch?«
Piet van Dyck, der junge Kellner im 'Ô de vie', hob beide Augenbrauen. Gerechtfertigt wäre die Frage nach der Region des edlen Fisches gewesen, nach der Fangmethode oder dem Transportweg aus Übersee. Hier, im mit fünf Sternen ausgezeichneten Restaurant 'Ô de vie' am nordwestlichen Rand von Lüttich, erschien ihm die Frage des Herrn im mittleren Alter so deplatziert wie jene nach dem Gewicht einer Frau. Was nicht verwunderte, schon am ersten Tag seiner praktischen Ausbildung hatte Piet – was den Wareneinkauf betraf – an den Lippen des Chefkochs vom 'Ô de vie' gehangen und gelernt, welche Details man mit Schleifchen an den Gast weitergab und welche man besser für sich behielt.
»Selbstverständlich, mein Herr«, überspielte Piet sein Erstaunen in charmantem Flämisch, »alles im Morgengrauen hereingekommen -, vieles davon lebte noch -, wenn ich das so formulieren darf.« Kaum ausgesprochen, warf er mit über den Mund gelegter Hand einen entschuldigenden Blick in Richtung der Frau, die gegenüber des fragenden Herrn Platz genommen hatte – ihr Mitleid mit Fischen und anderen Krustentieren hing wie Blei an ihren Mundwinkeln.
Robert Thys, der mit dem Hochkrempeln seiner Hemdsärmel beschäftigt war, schmunzelte: »Ausgezeichnet! Ausgezeichnet, junger Mann!« Selten war die Chemie zwischen Gast und Bedienung so schnell stimmig zusammengemischt. Auch die assoziierten Bilder noch zappelnder Meerestiere schien die ganz in schwarz gekleidete, attraktive Frau, verarbeitet zu haben.
»Für die Dauer ihres Aufenthalts in unserem Hause sagen sie gerne Piet, wenn ihnen das recht ist«, versuchte der junge Kellner jeden Anschein von Aufdringlichkeit aus seinem Angebot zu eliminieren.
Thys nickte zufrieden.
»Also dann, für mich die Trilogie von Edelfischen an Safransauce und für meine Frau – äh – «, Thys fuhr mit dem Finger über die Speisekarte, » – die Seezungenrolle mit Fjordforellenfarce, bitte – Piet!«
Professor Dr. Robert Thys, Neurologe und Komaspezialist aus Lüttich, konnte nicht verbergen, nicht jener Freund der exquisiten Küche zu sein, nicht der Gourmet, den er vorgab. Für ihn zählten im Wesentlichen zwei Dinge was die Nahrungsaufnahme betraf: Die Zutaten mussten deftig, die Mahlzeit auf dem Teller von ausreichender Menge sein. Ging es um ein gemeinsames Abendessen mit seiner Gemahlin Lilly, lag der Maßstab höher. Eine selbstauferlegte Bürde, der er sich verpflichtet fühlte. Wie oft schon hatten berufliche Zwänge die Kerzen beim romantischen Dinner bereits in der Idee ausgeblasen. Es galt, das schmale Zeitfenster für solche Anlässe gebührend zu würdigen! Und war Thys ehrlich zu sich selbst, hatte er jene Abende so nötig, wie die Forellen das Wasser für ihre letzten Runden im Schaubecken gegenüber nötig hatten.
Piet aber, der schlaksig smarte Bursche, der erst seit Anfang der Woche für die Tische im Kaminzimmer zuständig war und dessen weißes Hemd und schwarze Weste noch nicht die kleinste 'Kriegsverletzung' vorzuweisen hatten, woher hätte er all das wissen sollen?
»Sehr wohl mein Herr! Einmal die Trilogie – und für die werte Gattin – die Seezunge!« Ein letztes Mal ließ er den Blick über das Arrangement an Besteck und Gläsern schweifen und zückte sogleich sein über den Arm gelegtes weißes Tuch. Ob notwendig oder nicht, pflichtbewusst wischte er über den Rand vom Weinglas und prüfte mit zugekniffenen Augen das Ergebnis im Schein des Kronleuchters. Zufrieden platzierte er die Speisekarte zurück auf das silberne Tablett, das über seinen mit weißen Handschuhen bemäntelten Fingern zu schweben schien und empfahl sich mit einem nur angedeuteten Diener. Noch im Herumdrehen rückte er seine Fliege zurecht – Kellner im 'Ô de vie' zu sein, hieß mehr als Gläser spülen und angesehenen Gästen nach dem Mund zu reden. Es ging um Perfektion, den guten Ruf des Hauses, und nicht zuletzt um das Trinkgeld, das fester Bestandteil im mageren Gehalt war.
»Entschuldigung -, und die Weinkarte, bitte!«, traf die Stimme des Professors ihn wie ein geschleuderter Speer im Rücken.
»Verdammt!« Piet schickte einen Gedankenfluch über das silberne Tablett. Wie hatte ihm dieser Fauxpas passieren können? Sofort steuerte sein im ersten Lehrjahr eingemeißeltes Lächeln den Sommelier im Schatten der Weinregale an. Sich nur nichts anmerken lassen, war jetzt das Mittel der Wahl. Zudem eine gute Gelegenheit, sich im Vorbeilaufen der Zufriedenheit der anderen Gäste zu vergewissern.
»Ich bitte vielmals um Entschuldigung!«, kehrte Piet mit der Weinkarte Sekunden später an Tisch 17 – den unter den Gästen beliebtesten Tisch im kleinen runden Erker in Nähe des Kamins – zurück.
»Was? – Wie bitte?« Professor Thys schaute noch immer in Richtung der Flugbahn des geworfenen Speeres, schien geistig entrückt.
»Die Weinkarte, mein Herr.«
»Ach ja, vielen Dank … Piet …«
Lilly Thys drehte die schneeweißen Perlen ihrer Halskette zwischen Daumen und Zeigefinger. Die schmalen, dezent rot gefärbten Lippen himmelten ihr Gegenüber – den fast Fünfziger mit den grau melierten Schläfen – an, als stünde der Verlust ihrer Jungfräulichkeit an diesem Abend auf dem Spiel. Ohne ein Wort zu sagen, hatte sie sich mit der Wahl ihres Gatten auf die Seezunge einverstanden erklärt gehabt. Ihre Augen leuchteten, und das Flackern der Kerzen darin, verriet den Hauch von Romantik, der durchs Kaminzimmer des 'Ô de vie' wehte.
Sie kannte ihren Robert mehr als irgendeinen Menschen auf der Welt – am selben Ort hatten sie vor fünfundzwanzig Jahren ihr erstes Rendezvous während einer Studienreise gehabt – und es waren dies jene seltenen Stunden, die die abgebrochenen Gespräche, die flüchtigen Küsse im Türrahmen, die Floskel, 'schlaf weiter, Schatz', vergessen machten. Diese Stunden gehörten allein ihr und ihrem Ehemann. Sie liebte ihn dafür, wie er dann stets versuchte, den galanten Gourmet zu spielen. Dabei wusste sie, wie viel lieber er einen deftigen Pfälzer Saumagen bestellt, dazu ein kühles Bier genossen hätte. Aber diese Abende hatten Tradition. Eine überaus wichtige Tradition! Eine Tradition, die nötig war für den Mann, der für die Wissenschaft brannte. Ein Ritual, das es dem charismatischen Spezialisten erst möglich machte, Ballast abzuwerfen, Erlebtes hinter sich zu lassen, die eigene Seele vor Schaden zu schützen. Verbunden damit die Hoffnung, gemeinsam mit seiner Frau Lilly jenen noch fehlenden Stein zu finden, der das Bild im Puzzle einer leidenden Seele erst würde sichtbar machen.
»Alles in Ordnung?« Lilly Thys wusste kleinste Muskelkontraktionen im Gesicht ihres Mannes zu deuten, sicher den Zeitpunkt zwischen Abwarten und direkter Attacke abzuwägen. Den ganzen Tag über hatte sie dieses Gefühl gehabt, dass die Zeit reif war, dass der in Fachkreisen geachtete Forscher höchstpersönlich einer Seelenmassage bedurfte. Eines Beistands, wie kein qualifizierter Kollege, keine fachlich versierte Mitarbeiterin ihn zu leisten im Stande gewesen wäre. Er war es, der sie heute Morgen ins 'Ô de vie' zum traditionellen Dinner eingeladen hatte; das allein sprach Bände. Heute würde sie dem angesehenen Spezialisten auf dem Gebiet der Hirnforschung zur Seite stehen, ihm Halt geben müssen, weil ein Fall ihn zu sehr belastete, ihm den Boden unter den Füßen wegzureißen drohte.
Lilly Thys hatte längst entschieden, die Vorspeise zugunsten einer sofortigen Attacke nicht einmal mehr abzuwarten.
»Was ist los, Robert? – So schlimm?«, streichelte sie seinen Handrücken …
KAPITEL 2
Zwei Monate vorher
Auf dem Weg nach Lüttich, Belgien
Mittwoch, 23. November 2016, 15:15 Uhr
Noah Wildmann umklammerte das Lenkrad so fest, dass seine Fingerknochen weiß anliefen. Den Blick stoisch nach vorn gerichtet, wollte ihm ein Gedanke nicht aus dem Kopf gehen.
Teil des Gedanken war Robert Thys. Robert Thys war schon vielen Menschen an der Schwelle zum Tod begegnet, aber mit Jessica Morton-Ehrenberg würde dem Spezialisten aus Lüttich die wohl bizarrste Patientin in seiner Laufbahn begegnen.
»Herr Professor, könnten sie bitte schnell nach unten kommen«, würde die Dame von der Anmeldung mit brüchiger Stimme sagen, »hier ist eine junge Frau, die behauptet, sie sei tot!«
Ja! – Genau so würde es sich abspielen!
Noah nickte unbewusst. Er spähte über den Rand seiner Brille hinweg, sah sich im Rückspiegel den rechten Mundwinkel nach oben ziehen, wie einst Norman Bates im Film Psycho, als wollte er die Richtigkeit seiner These damit unterstreichen. Wie zu gemeinsamen Studienzeiten würden er – der promovierte Psychiater Dr. Noah Wildmann und der berühmte Komaspezialist aus Lüttich, Professor Dr. Robert Thys – sich in den ungewöhnlichen Fall verbeißen, um anschließend im Pub bei Bier und Wein das weitere Vorgehen zu besprechen. Welche arme Seele könnte so kaputt sein, als dass ihre kongeniale Zusammenarbeit das Problem nicht würde lösen können?!
Wieder nickte Noah – diesmal die Lippen bestätigend nach vorn gewölbt.
An diesem Vormittag im November, hatte sich der Psychiater mit seiner Patientin Jessica Morton-Ehrenberg auf den Weg nach Lüttich gemacht. Der Frost hatte in der Nacht ungewöhnlich hart zugeschlagen, und Noah hatte aufgehört, die orange-blinkenden Warnlampen der Streufahrzeuge zu zählen. Der in die Jahre gekommene BMW schnurrte wie ein Schweizer Uhrwerk seit nunmehr vierhundert Kilometern über die A61 entlang Koblenz und Bonn, und weiter auf belgischer Seite über die E40. Meter für Meter fraß sich der weiche Kautschuk in die weiße Kruste tonnenweise ausgebrachten Streusalzes, und jetzt, da das Ziel ihrer Reise in greifbare Nähe rückte, muteten die breiten Reifen wie mit Kreide überzogen an.
Noah genoss die Bequemlichkeit des betagten BMW der 7er-Reihe, Baujahr 2001, auch wenn das gelegentliche minutenlange Orgeln und Krächzen des Anlassers belächelt wurde. Irgendwann würde er sich schweren Herzens von diesem treuen Gefährt trennen müssen und spätestens dann würde er den stechenden Schmerz in seiner Brust spüren. Andererseits, was bedeutete diese Leidenschaft für Oldtimer schon gegen den Schmerz und die Tragik der vergangenen Tage? Hatte er vergessen, wie er erst wenige Stunden zuvor innerlich aufgewühlt, als hätte er einen Tornado zum Frühstück gehabt, von der Hauseinfahrt der Ehrenbergs auf die Straße eingebogen war - entschlossen, die ungewisse und gleichfalls alternativlose Reise nach Lüttich anzutreten?
Zweifel schwirrten um seinen Kopf, wie Schmeißfliegen um die Schädel wehrlosen Viehs. Mit einer Hand lockerte er den viel zu engen Kragen um seinen Hals. Vielleicht würde das Radio Zerstreuung bringen? Nervös hämmerte er das Stakkato von Phil Collins' In the air tonight ins Wurzelholz der veredelten Konsole …
»In tausend Metern verlassen sie die Autobahn«, mischte sich das Navi ein. Noah verzog das Gesicht. Hatte die junge weibliche Stimme am Wochenende noch sympathisch und sexy geklungen, kroch sie jetzt wie Ungeziefer in seine Ohren. »Keine zehn Kilometer mehr bis Lüttich«, so die hässliche Übersetzung. Verdammt, jetzt galt es wirklich!
Noah biss sich auf die Unterlippe, überschüssiges Adrenalin ließ ihn keinerlei Schmerzen spüren. Und nicht zum ersten Mal an diesem Tag schmeckte seine Zungenspitze Blut. Sollte er besser umkehren? Alles noch einmal überdenken? – Fort mit den Gedanken! Er schüttelte seine Zweifel aus dem Rückspiegel wie der Boxer die nicht erwartete harte Linke. Konzentriert ging er den bevorstehenden Fahrspurwechsel an: Rück- und Seitenspiegel, Einscheren, Abgleich der vorgeschriebenen Geschwindigkeit mit der Tachonadel … – entspanntes Fahren sah anders aus. Er war sich sicher, wer ihn jetzt würde sehen können, den langjährigerfahrenen Psychiater 'Noah Wildmann', wüsste spätestens jetzt, dass nicht allein die fremde Wegführung ihn derart herausforderte; Gedanken ganz anderer Natur würden ihn beschäftigen müssen.
Flüchtig warf er einen Blick nach rechts zu seiner Beifahrerin. Sofort rann Schweiß an seiner Schläfe herab. Jessica Morton-Ehrenberg, die seit Stunden regungslos neben ihm gesessen hatte und geistig entrückt schien, drehte wie in Zeitlupe ihren Oberkörper in Richtung Seitenscheibe. Emotionslos blieb ihr Blick daran kleben –, weder nahm sie Notiz vom Verkehr um sie herum, noch zeigte sie Interesse an der für sie fremden Umgebung. Einzig ihr rot-gesprenkeltes Kleid und die schwarzen Nylonstrümpfe im Kontrast zum weißen Leder des BMW sorgten entfernt für einen Hauch von pulsierendem Leben auf der Beifahrerseite. Wer jedoch auf dem Gebiet der Psychologie unterwegs war, brauchte keine Fantasie, die Lage einzuschätzen. Vertraut wären jene leeren Blicke, die nicht einmal Fensterglas zu durchdringen vermochten.
Tief holte er Luft, schnaubte hörbar durch. Was zum Teufel war zu erwarten, von einer Frau, die sich tot glaubte?!
Endlich, nach dreieinhalb Stunden Fahrt, setzte er an der Ausfahrt Cheratte den Blinker. Ein erneuter Blick in Rück- und Seitenspiegel, runter vom Gas, und sanft wie ein Kahn auf ruhiger See glitt die schwere Limousine hinüber auf die rechte Spur – weg von der Monotonie der Autobahn. Zehn Minuten später manövrierten hundertfünfzig Pferdestärken in die soeben freigewordene Parklücke am Lütticher Universitätskrankenhaus präzise ein.
Zündschlüssel nach links.
Die zwölf Zylinder verstummten augenblicklich.
Geschafft!
Noahs linke Hand krallte sich im Türrahmen fest, hievte stattliche 110 Kilo schnaufend aus dem seit Stunden durchgesessenen Polster. Er brauchte einen Moment, lehnte sich über die Fahrertür. Mit geschlossenen Augen sog er die eisige Luft durch die Nase ein, blies sie sogleich mit spitzen Lippen wieder aus. Eine mächtige Wolke kondensierten Atems stieg auf, hüllte seinen Oberkörper ein. Dann stemmte er seine Fäuste in die Seite, bog den Rücken mit schmerzverzerrtem Gesicht ausladend durch und klopfte sich den Krampf aus der rechten Wade.
Noch während er nach seiner Aktentasche auf dem Rücksitz fingerte, schlüpfte er mit dem anderen Arm in seinen Trenchcoat – einen speckigen Fetzen Stoff, wie Inspector Columbo ihn geliebt hätte. So ausgerüstet wirbelten ausgefranste Mantelzipfel um das Heck der schwarzen Limousine herum. Flüchtig wischte er mit dem Handrücken unter seiner Nase weg und fischte auf der anderen Seite der Rückbank nach dem Mantel seiner Beifahrerin, die heute Begleitung, beste Freundin und Patientin in einer Person war. Galant öffnete er Jessica Morton-Ehrenberg die Beifahrertür, schob seinen Arm in ihren Rücken und legte ihr besorgt den cremefarbenen Tweed Mantel über die Schultern. Ein Stich ins Herz, wie sie – mit dem Rücken am Wagen gelehnt – nicht einmal den Versuch unternahm, die Knöpfe bis hoch zum Hals in die Schlitze zu fummeln – jeder würde sehen können, wie sehr sie seiner Hilfe bedurfte.
Wehmut kroch in ihm hoch, als er die Hochzeit seines Freundes Lucas an der Seite dieser wunderschönen Frau erinnerte. Jener wunderbarer Augenblick, als dieses zarte Wesen eine Schulter zum Anlehnen gebraucht hatte. Eigenartig, wie er plötzlich ihr Parfüm von damals wieder in der Nase hatte, ihr weiches Haar zwischen den Fingern spürte, ihre Lippen … Merkwürdig vertraut kam ihm die Nähe zu ihr vor -, dieses Gespür für den Schmerz, der in ihr zu wohnen schien …
Aber woher plötzlich diese Wucht von tiefen Erinnerungen? Und warum blieben sie nicht? – Stattdessen waren da jetzt diese traurig leeren Rehaugen, die das Strahlen einstiger Lebensfreude schmerzlich vermissen ließen.
Er rieb sich den Schwindel aus den Schläfen.
Wieder nichts als ein Berg von Fragen.
Warum nur hatten sich diese wunderbaren Erinnerungen wie Schatten aus einem geheimnisvollen Nebel geschält, einzig, um sogleich wieder aufs Meer des Vergessens hinauszutreiben?
Genug der Suche nach den Momenten vergangenen Glücks. Er drückte den Knopf der Fernbedienung: Klack, Klack, alle vier Blinker des BMW blitzten in der hereinbrechenden Dämmerung gelb auf. Sofort spürte er das Unbehagen in seiner Magengegend. Ein letztes Mal sog er die frostige Luft gierig ein, so wie der Perlentaucher vor dem Sprung in die Tiefe seine Lungen bis zum Bersten füllt …
Noah spürte das hagere Fleisch Jessicas an Schulter und Arm, wie es sich beinahe leblos über die Knochen ihres hageren Oberkörpers spannte. Mehr stützend, als ineinander gehakt, navigierte er ihren willenlos trägen Körper dem Haupteingang zu. Einen Kopf kleiner als er, und zierlich, als könnte jeder ungewollte Rempler eines Passanten sie in tausend Stücke zerbersten lassen, vermochte die fremde Umgebung nicht den Hauch einer Emotion in ihr anzuregen. Weder der Trupp hungriger Krähen, die mit ihrem Gezeter herumliegende Müllsäcke mit Versuch und Irrtum zu knacken versuchten, noch die exotischen Nummernschilder der geparkten PKW aus aller Herren Länder vermochten ihre Neugierde zu wecken. Nicht einmal ein flüchtiges Zucken ihrer Mundwinkel, das vitale Funktionen in ihrem Körper hätte vermuten lassen können, konnte er ausmachen – eine Teilnahmslosigkeit, wie sie jedem Spezialisten seiner beruflichen Qualifikation schlaflose Nächte bereiten würde.
Abrupt hielt er inne, als sein Handy klingelte. Ohne zu überlegen, drückte er das Gespräch weg – seine Aufmerksamkeit an diesem Nachmittag galt ausschließlich dem zerbrechlichen Wesen an seiner Seite, seiner Patientin Jessica Morton-Ehrenberg, Ehefrau seines besten Freundes Lucas Ehrenberg, die – was er sich längst hatte eingestehen müssen – viel mehr als nur seine Patientin war. Reglos, die Arme schlaff herunterhängend, stand sie als der Grund seiner Besorgnis zitternd im scharfen Ostwind … fragend ohne Fragen … weinend ohne Tränen.
Eine Windbö frischte auf, fuhr mit eisiger Kralle durch ihr dunkles, fast schwarzes Haar, das im Haaransatz naturblond herauswuchs. Wirr wehten die langen Strähnen bis weit über ihre Schultern hinweg. Aber anders, wie ihm selbst – nach vorn gebeugt und mit der Hand am Kragen des Trenchcoats mit zugekniffenen Augen einen Schritt vor den anderen setzend – schien ihr die Eiseskälte nicht das Geringste auszumachen, ja gleichgültig zu sein.
Er fädelte ins Karussell vom Eingangsportal ein, das unermüdlich seine Runden drehte – ein permanentes Kommen und Gehen trauriger, schmerzverzerrter, hoffnungsvoller und manchmal auch glücklicher Gesichter. Im Tempo der Drehtür setzte er mit weiteren Besuchern wie siamesisch verbunden einen Fuß vor den anderen. Vermutlich würden sie die winzigen Schweißperlen auf ihrem bleichen Gesicht nicht einmal sehen, in denen vereinzelt schwarze Strähnen wie rituelle Zeichen festklebten. Besorgt griff er nach ihrer Hand, tätschelte ihren Handrücken, lächelte ihr zu. Aber natürlich wusste er, dass das kaum wahrnehmbare Zucken um ihre Mundwinkel ein vermeintliches Lächeln zwar andeutete, letztlich aber nur seiner Wunschvorstellung entsprang. Er hoffte darauf, dass es ein Fünkchen emotionaler Erregung gewesen sein möge, wurde aber enttäuscht, als sie ihren Blick kraftlos vor ihre Füße fallen ließ. Sie tat ihm unendlich leid. Wer von den im Drehkreuz mitgeführten Personen hätte das Leid dieser armen Seele auch ahnen können? Es musste an seiner jahrelangen Erfahrung liegen, dass allein er die stummen Schreie dieser bedauernswerten Frau im Karussell hören konnte.
Eine halbe Umdrehung weiter strömte warme, von Chemikalien geschwängerte Luft herein. Mit geschlossenen Augen würden selbst Laien wissen, wo sie sich befänden. Heilanstalten welcher Art auch immer konnten es sich leisten, ihre 'Kunden' nach immer gleichem Muster zu ängstigen … zu verstören – sie würden dennoch wiederkommen, nicht selten bleiben. – Bleiben müssen!
Hunderte in den Decken installierte LED–Lampen tauchten den Eingangsbereich – so groß wie eine Bahnhofshalle – in kaltes, weißes Licht. Gleißend hell, dass es in den Augen schmerzte. Auch die Kakofonie der kreuz und quer durcheinander hastenden Menschen, ob Patienten, Schwestern, Pfleger, Besucher oder überforderte Weißkittel, sie alle taten ihr ungewollt Übriges dazu, dass man diesen Ort so schnell als möglich wieder verlassen wollte. Kein Wunder, dass Noah instinktiv das zerbrechliche Wesen in seinem Arm noch fester an sich drückte.
Nur noch zwei Schritte bis zur Rezeption.
Noah warf einen flüchtigen Blick auf seine Armbanduhr, stieß einen zufriedenen Seufzer aus. Das Wichtigste an diesem Tag war geschafft: Pünktlich um 16:15 Uhr hatte er das Universitätskrankenhaus in Lüttich erreicht, bereit, den herbeigesehnten Termin bei Professor Robert Thys anzugehen …
KAPITEL 3
Universitätskrankenhaus Lüttich
Mittwoch, 23. November 2016, 16:20 Uhr
Routiniert schlängelte sich Noahs Kugelschreiber durch die Fragen des Anmeldeformulars, bis hin zur letzten Zeile, wo er durch seine Unterschrift sämtliche Kreuze und Anmerkungen zur Person seiner noch immer von ihm im Arm gehaltenen Patientin bestätigte. Die weiß gekleideten Kollegen hinter dem Tresen würden sich schon melden, sollte etwas nicht in Ordnung sein.
Dann geschah etwas, was seit Antritt der Fahrt nach Lüttich nicht mehr eingetreten war, und Noah war hellwach: Jessica hatte sich unvermittelt über den Tresen gebeugt … ruhig, weder aufgeregt, noch verstört dabei wirkend. »Ich bin tot, wissen sie«, hörte er sie mit leiser Stimme zu der Dame am Empfang sagen, so als sei die Anamnese damit abgeschlossen. »Ich habe den Schlüssel gesehen …«.
Fürsorglich drückte Noah sie vom Tresen weg und so behutsam, wie es ihm mit seinen für seinen Berufsstand eher groben Händen nur möglich war, stützte er ihren Körper, als müsste sie sich von dieser Anstrengung erst wieder erholen. Ein wohliges Gefühl – als sei die zarte Knospe einer still genährten Hoffnung endlich aufgegangen – durchflutete ihn. Gleichzeitig aber sah er dieses Glück wie ein Gummiband zurückschnellen und brachial gegen die Mauer der Realität prallen. Selbst für ihn hatte es etwas Bizarres an sich, sie im Zustand vollständiger Apathie mit Mund und Gliedmaßen plappernd agieren zu sehen, so als hätte man den Schalter am Rücken eines Spielzeugroboters gedrückt. Erst recht, da sie nach scheinbar abermaligem Drücken des Schalters zu leblosem Blech zurückerstarrte. Was um alles in der Welt ging in ihrem Kopf nur vor sich? Was sahen diese zu Stein erstarrten Augen, was andere Menschen um sie herum nicht zu sehen im Stande waren?
Noah sparte sich weitere Erklärungen und warf stattdessen ein unmerkliches Nicken über den Tresen hinweg. Die Dame vom Empfang, die nur einen Moment in die hilflos traurigen Augen seiner Begleitung geblickt hatte, schaltete sofort und griff zum Hörer.
»Hier ist eine junge Frau, die behauptet, sie sei tot!«, hörte er sie in die mit ihrer Hand abgeschirmte Muschel sagen. Und wieder spürte er, wie sich sein rechter Mundwinkel wie von selbst zufrieden nach oben zog …
Nur wenige Schritte weiter wies Noah seiner Patientin einen Stuhl in Nähe der Rezeption zu, setzte sich dann selbst, und versuchte, ihre immer noch wirr durcheinanderliegenden Haare mit der flachen Hand weniger durchgedreht aussehen zu lassen. Niemand sollte denken, dass sie verrückt sei! Was aber sollten die ebenfalls Wartenden schon denken? Wahrscheinlich würden sie nicht einmal Notiz von ihnen beiden nehmen, beruhigte er sich. Dennoch fühlte er sich unwohl. Auf eigenartige Art unwohl. Wie vergangenen Sommer, als er einen Vortrag hatte halten müssen: Die Wörter auf seinem Manuskript waren wie in einer Buchstabensuppe wild durcheinandergeschwommen, weil er seine Brille vergessen hatte. Und jetzt? Jetzt wollte ihm partout nicht einmal mehr das Thema seines Vortrags einfallen …
Er begann wieder zu schwitzen. Er fragte sich, was die Neugierigen unter ihnen – diejenigen, die im Rund der Wartezone über den Rand der Illustrierten würden hinweg linsen, diejenigen, die ihrem Smartphone für einen Moment keine Beachtung würden schenken, die dazu die Fantasie besäßen, sich ihren Teint frisch gepudert, ihre Haare glatt herunter gebürstet vorzustellen …, wen oder was würden sie wohl sehen? Er war sich sicher, eine junge Frau von außerordentlicher Schönheit und Eleganz! Langweilig in ihrer Observation dagegen vermutlich er selbst: Knittriger Trenchcoat, braune Lederschuhe, lässig umgelegter Schal eines Midlife– Crislers, der, mit ein paar sympathischen Kilos zu viel und mit nur einer Pobacke auf seinem Stuhl sitzend, ununterbrochen ein Auge auf die neben ihm sitzende Schönheit hat.
Kaum, dass sie sich gesetzt hatten, hallten ihre Namen, Noah Wildmann, und der von Jessica Morton-Ehrenberg, durch das Rund der Wartezone. Seite an Seite steuerten sie auf den Fahrstuhl zu. Spätestens jetzt würden alle hersehen. Noah fühlte die Augen sämtlicher Besucher, Pfleger, Schwestern, Ärzte und Patienten wie Leim im Rücken auf sich haften. Zugegeben, er hatte seine Patientin bis hierher stützen müssen, sie war mit rot-gesprenkeltem Kleid und edlen Pumps auffällig gekleidet, wurde ohne lange Wartezeit aufgerufen, aber stellte sie deswegen eine Bedrohung ihnen gegenüber dar? Einfach töricht, wer so etwas denken würde! Man brauchte sie sich doch nur anzuschauen: Ihre Lippen schmal und blass, ihr Körper zerbrechlich, so wie man fürchtete, einem alten Menschen beim Händeschütteln die Knochen zu brechen. Brav, wie ein Messdiener auf dem Weg zum Altar, trottete sie schließlich neben ihm her …
Schweigend drückte er den Knopf zum dritten Stock.
Sanft und nahezu geräuschlos schoben sich die metallisch glänzenden Fahrstuhltüren zur Seite. Der Flur rollte sich weniger hell und mit zahllosen Türen rechts und links vor ihm aus.
Jessica hatte seinem aufmunternden Blick während der Fahrt auch weiterhin keine Beachtung geschenkt.
Er verschnaufte einen Moment.
In seinem Rücken schlossen sich die Türen ebenso sanft, wie sie sich geöffnet hatten, und er fragte sich, welches Schicksal die sterile Blechkabine als nächstes würde befördern müssen.
Stille.
Diese unerträgliche Stille auf einmal.
Er spürte das Blut wild in seinen Adern pulsieren.
Mit eingefrorenem Blick steuerte er die Tür am Ende des schier endlos scheinenden Flures an …
KAPITEL 4
Sekunden später …
Universitätskrankenhaus Lüttich, Büro Professor Thys
Der Professor hatte einmal schlucken müssen …
Jetzt saßen dem Neurologen und Komaspezialisten der sich aus Heidelberg angekündigte Psychiater Noah Wildmann und die mit bleicher Gesichtsfarbe gezeichnete Patientin Jessica Morton-Ehrenberg in seinem Büro gegenüber. Es war dies Thys 'spezielles' Büro, wie es der Mediziner im Kollegenkreis gern selbst bezeichnete. In gemütlicher Atmosphäre und ohne das typisch strahlende Weiß steriler Einrichtungsgegenstände ließen sich die Probleme in den Köpfen seiner Patienten schlicht besser angehen, so jedenfalls seine Argumentation gegenüber den knausrigen Angestellten in der Verwaltung hinsichtlich seiner mitunter unorthodox anmutenden Anschaffungswünsche.
Zum einen hatte er diesen intimen Ort gewählt, weil es nicht jeden Tag 'Tote' zu behandeln gab, zum anderen, weil dieses Gesicht das ein oder andere Bier in den Kolloquien der dunklen, verräucherten Studentenkneipen wieder präsent gemacht hatte. Und wie sonst hätte er einen Menschen angemessen behandeln sollen, mit dem er zwei Semester in gemeinsamer Wohngemeinschaft so manche Schublade gemeinsamer Erinnerungen gefüllt hatte – es kam ihm vor, als sei das alles erst gestern passiert. Schrie ein solches Gesicht nach Hilfe, musste es ernst sein!
Wildmann, im Halbrund des von der Verwaltung abgesegneten brombeerfarbenen barocken Versailles-Sofas, stützte seine Patientin mit der Schulter, und – zwei Armlängen vor ihnen – saß der Professor in einem mit verschnörkelten Armlehnen verwöhnten gleichfarbigen Sessel. Auf einem Beistelltisch züngelte sich die Flamme einer Kerze ihrem baldigen Ende entgegen. Die Atmosphäre im Raum stand im krassen Gegensatz zum übrigen Gebäudekomplex. Löste jener mit seinen grellen Lichtern und weiß getünchten Wänden bei den meisten Beklemmung aus, legten sich hier warme, mediterrane Farben und edle Hölzer wie eine flauschige Decke über die Ängste der hier nach Hilfe Suchenden. Fast wäre man geneigt gewesen, den Grund des Herkommens zu vergessen, hätte bei Kaffee und Cognac gerne noch länger verweilt, wenn nur nicht der Grund des Herkommens ein gänzlich anderer gewesen wäre.
Stille herrschte im Raum.
Die schmale Säule der soeben erloschenen Kerze stieg auf.
Die Worte des Professors mischten sich ein.
»Schön, dich zu sehen«, fiel seine Begrüßung – der Sache dienlich – spärlich aus; notwendige Details hatten sie am Telefon geklärt. Die Frage, wie würde eine 'Tote' reagieren, wenn jemand Fremdes sie würde ansprechen, spukte seit dem ersten Anruf im Kopf des Professors herum. Er schlug die Beine übereinander, faltete die Hände über seinem Knie und suchte einen ersten Augenkontakt zu der jungen, zweifellos noch immer bildhübschen Frau, ohne fordernd zu wirken. Obwohl er diesen Schritt schon hunderte Male in seiner Laufbahn getan hatte, fiel ihm dieser besonders schwer!
»Wie heißen sie?«, wagte er einen ersten Versuch, in einer Stimmlage, deren daran beteiligte Töne sich gefühlt haben müssen, wie wenn Finger durchs Fell eines Plüschbären strichen. Eine Stimme, wie sie zu den Ärzten aus einer Fernsehserie passte. Selbst sein Äußeres gehorchte diesem Bild: groß, schlank, krauses graumeliertes Haar, Dreitagebart, die Hemdsärmel aufgekrempelt. Genau so ein Arzt war Robert Thys.
»Jjj … Jessica … Jessica Morton-Ehrenberg«, bekam er zur Antwort und schon die ersten Buchstaben schlugen wie Blitze in seine langjährige neuropsychiatrische Erfahrung ein.
Jene arme Seele galt es also in seine Obhut zu nehmen. Und er hatte nicht die Spur einer Ahnung, wie dieser bizarre Fall würde ausgehen …
Es klopfte an der Tür.
Ruhig und betont gelassen drückte sich der Professor aus dem Sessel. Ohne sein Herein abgewartet zu haben, lugte Oberschwester Luisa durch den Spalt. Mit einer Hand winkte sie den Professor zu sich. Im Türrahmen stehend, lenkte sie seine Aufmerksamkeit mit kaum wahrnehmbarer Kopfbewegung zum Ende des Gangs hin, wo zwei Männer und eine Frau tuschelnd in Nähe des Fahrstuhls zusammenstanden. Etwas abseits davon warteten zwei in weiß gekleidete Pfleger auf weitere Instruktionen.
Mehrere Minuten vergingen.
Worte wurden gewechselt. Plätze wurden getauscht, Anweisungen erteilt und weitergegeben. Für den Neurologen die Gelegenheit, erste Entscheidungen zu treffen und Oberschwester Luisa in Abläufe einzuweisen, die jetzt unmittelbar bevorstanden. Unabdingbare Voraussetzung und für den Erfolg einer erfolgreichen Therapie unumgänglich waren stets allein geführte Sitzungen mit Jessica Morton-Ehrenberg, genauso wie Gespräche ausschließlich unter vier Augen mit Noah Wildmann – Beeinflussungen untereinander mussten für den Anfang ausgeschlossen, nichts durfte dem Zufall überlassen sein. Die Therapie, für die es keine Routinen gab, würde Tage, Wochen, vielleicht Monate in Anspruch nehmen. Und das alles ohne die Gewähr dafür, dass sie am Ende Erfolg haben würden …
* * *
Am nächsten Morgen, 9:00 Uhr
Büro Professor Thys
Patientenakte: 'J.M.E.02'
– Erste Sitzung mit Jessica –
Unsicher, sie könnte den Erwartungen nicht entsprechen, und ängstlich, wie fern ab der schützenden Hand der Mutter, erwiderte Jessica Morton-Ehrenberg den wachen Blick des Professors. Sie hatte sich auf dem Sofa bis ganz nach vorn geschoben, saß in weißer Klinikkleidung streng genommen mit ihrem Gesäß nur auf der Kante des edlen Möbels. Glaubte sie sich unbeobachtet, fuhr sie mit beiden Händen über ihre Oberschenkel, als streiche sie die Falten aus ihrem imaginären Rock – jeweils mehrmals hintereinander. In den Momenten dazwischen hielt sie ihre Beine mit den Armen über den Knien fest umschlungen. Bitte, tut mir nicht weh, schien allein dieses Bild sagen zu wollen – nichts Außergewöhnliches für die Augen des Spezialisten, der schon in Tausende Köpfe seiner Patienten vorgedrungen war.
»Wie alt bist du, Jessica? – Ich darf doch Jessica sagen?«, streichelte seine Stimme an diesem Morgen zum ersten Mal durchs imaginäre Fell.
Vorsichtig hob sie ihren Kopf. »Sss … sechsund … sechsunddreißig.«
Der Professor rückte mit dem Oberkörper ein Stück näher. Die Hände zwischen seinen Knien lose aneinandergelegt, beugte er sich vor.
»Mein Name ist Robert«, lächelte er in traurig dunkle Augen hinein. »Wann wurdest du geboren, Jessica?«
Es faszinierte, wie allein die Stimme des auf dem Gebiet der Neurologie führenden Wissenschaftlers wirken konnte: beruhigend, fast schon hypnotisierend.
»Am 3. August 1980 … da bin ich geboren«, antwortete sie kaum hörbar. Dafür umso so lauter: »Gestorben bin ich am 21. November 2016!«
Die Selbstverständlichkeit, mit der sie dieses sagte, hatte zuvor weder Dr. Wildmann irritiert – der mit dieser abstrusen Überzeugung seiner Patientin schon seit den letzten drei Tagen konfrontiert gewesen war –, noch brachte sie den Professor aus der Fassung, zu dessen Vorgehensweise es gehörte, die Ticks seiner Gegenüber als das Normalste der Welt anzusehen. Es waren dies jene Momente, für die das Herz des Forschers schlug. Was ging vor in den Gehirnen seiner Patienten, wie gehörten Erfahrungen, Emotionen, Erinnerungen zusammen? Wo ruht das Selbst, wo wohnt die Seele? Was stirbt im Tod? Fragen, wie sie undurchdringlicher nicht hätten sein können. Thys verkaufte seinen Studenten diese Sicht gern als Perlen-Perspektive; ein Bild, in dem der Körper die Muschelschale, das Gehirn das Muschelfleisch und die Perle den eigentlichen Ich-Kern darstellte.
»Woran kannst du dich als Letztes erinnern?«, war die Frage, mit der er seinen 'Tauchgang' nach den Perlen begann.
Jessica blickte vom Sofa hoch, überlegte einen Moment, ließ ihren Blick über das Muster im Teppich treiben.
»Ich sitze in einem Zimmer … im Wartezimmer eines Krankenhauses … in Heidelberg … wo wir wohnen …«
»Wen meinst du mit – wir?«
»Lucas – Lucas ist mein Ehemann …«, schwang ein Hauch von Stolz in ihrer Stimme mit.
»Welcher Tag ist es, an dem du in diesem Wartezimmer sitzt?«, beugte sich der Neurologe noch weiter zu ihr vor – es war ihm von der ersten Sekunde an gelungen, eine Atmosphäre wie unter Freunden zu schaffen. Er nahm sich Zeit. Obwohl sein Wissen auf den Stationen, in den Hörsälen und über die Grenzen hinaus gefragt war, hatte er diese Patientin mit einem Sternchen in seinem Kalender vermerkt.
Wieder strichen Jessicas Hände über ihre Oberschenkel bis weit über die Knie – einmal, zweimal, wischte sie darüber hinweg.
»Welcher Tag ist es, an dem du in diesem Wartezimmer sitzt?«, wiederholte der Professor seine Frage.
Jessica wirkte abwesend. Sie schien in ihren Gedanken an einem anderen Ort zu sein.
Vielleicht wäre eine Pause hilfreich?
Thys ertappte sich, wie er sich Jessica Morton-Ehrenberg als elegant gekleidete, junge hübsche Frau vorstellte, lebenshungrig, weltoffen, liebenswert. Umso schmerzhafter zu sehen, wie sich das Leben langsam aus diesem vor ihm sitzenden Körper schlich. Kein Mittel zu haben gegen ihre felsenfeste Überzeugung, dass sie tot sei. Was umso bizarrer war, dachte er nur daran, dass …
Er wollte -, er durfte nicht weiter darüber nachdenken! Hier und jetzt war es Jessica, die seiner Hilfe bedurfte! Und die würde er dieser armen Seele geben, wie auch immer die Sache am Ende ausgehen würde.
»Es ist Montag – Montag der 21. November«, war Jessica aus ihrer geistigen Abwesenheit erwacht. »Ich erkenne die Digitalanzeige über der Tür – es ist der Tag, an dem ich sterbe.«
Wieder hatten sich Thys Gedanken wie der Kahn vom Steg losgemacht. Er sah sich im voll besetzten Auditorium der Münchener Ludwig Maximilians Universität inmitten der letzten Reihe sitzen, Augen und Ohren auf maximalen Empfang gestellt; sogar Vorlesungen, für die er nicht eingeschrieben war, hörte er sich an, ging es denn entfernt um das Mysterium des menschlichen Gehirns. Vorn am Pult referierte ein emeritierter Professor über den seltenen Fall des Cotard-Syndroms – spannend und gänsehauterzeugend zugleich. Hier und jetzt aber saß ihm eine arme Seele gegenüber, die seiner realen Hilfe bedurfte. Einer Hilfe, die nicht im Zurechtschneiden eines passenden Pflasters bestand. Er wusste, dass seine Patientin soeben einen großen Schritt nach vorne gemacht hatte, indem sie Vertrauen zu ihm gefasst hatte. Er wusste aber auch, dass es noch vieler solcher Sitzungen bedürfen würde, um sich ein vollständiges Bild vom Leben der Jessica Morton-Ehrenberg machen zu können -, so wie sie zu 'Lebzeiten' war.
Und natürlich wusste er, dass die an ihn herangetragenen Fälle nur ganz selten ein Happy End hatten!
KAPITEL 5
Wenig später …
Universitätskrankenhaus Lüttich, Zimmer 412a
Noah betrachtete sich im Spiegel, der über dem Waschbecken in Zimmer 412a hing; ein gemütliches kleines Zimmer im Westflügel, hell, mit Blick nach Süden raus. Professor Thys hatte seinem Wunsch ohne wenn und aber entsprochen und ihm das Zimmer ganz in der Nähe seiner Patientin Jessica zugewiesen. Für wenigstens zwei Tage hatte er das Nötigste eingepackt, Zahnbürste, Rasierzeug, Unterwäsche, Schlafanzug …