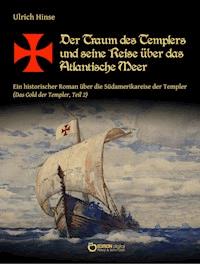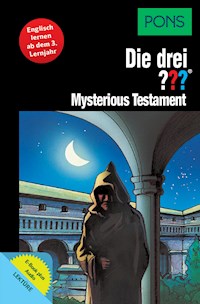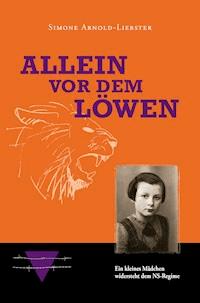Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Sprache: Deutsch
NEUAUSGABE der 2015 im AAVAA-Verlag erschienenen Erstausgabe. Februar 1978. Was ist plötzlich so anders am fahlen Licht des Mondes, am frischen Grün des Frühlings? Was ist das für ein wohliges Kribbeln unter der Haut? Ist es möglich, dass man plötzlich fühlen und träumen kann? Und darf dies Rechtfertigung dafür sein, sich gegen jedwede Moralvorstellung aufzulehnen? Herz oder Kopf? Es ist die alte Frage, die sich demjenigen stellt, der sich unsterblich verliebt hat - eine Liebe, die nicht sein darf. Februar 1993. Henry steht am Fenster und sieht den Schneeflocken zu. »Wird heute passieren, was ich mir so sehr wünsche, wovor ich mich so sehr fürchte?« Fragen, die sich der Anfang 30-Jährige immer dann stellt, wenn er sich an die Geschichte von Stefan Köhler erinnert, einem ebenso alten Landstreicher, dessen Bekanntschaft er einige Monate zuvor zufällig auf dem Friedhof gemacht hatte. Dessen fünfzehn Jahre zurückliegende Jugendliebe zur bildhübschen 16-jährigen Shari, scheint untrennbar auch mit seinem Leben verwoben zu sein. Aber die Vergangenheit bringt noch mehr ans Licht, was nur in einer Katastrophe hatte enden können. Herzentscheidungen dürfen manchmal nicht zu lange warten! Es ist die Geschichte einer zarten Verbundenheit zwischen zwei Außenseitern und heute aktueller denn je. Eine Reise in die menschliche Seele und nicht zuletzt eine Hommage an die großen Dichter der Romantik, allen voran Friedrich von Hardenberg, bekannt als Novalis. Eine Reise ins Innere ..., in die Psyche der Protagonisten. Die Suche nach der "Blauen Blume". Schwelgen im Zeichen der Romantik, mit dem besonderen Clou am Ende. Grafschafter Nachrichten
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Silvia, Katja und Niklas
Die blaue Blume ist aber das,
was jeder sucht, ohne es selbst zu wissen,
nenne man es nun Gott, Ewigkeit oder Liebe.
Ricarda Huch
Inhaltsverzeichnis
PROLOG
ERSTER TEIL
KAPITEL 1
KAPITEL 2
ZWEITER TEIL
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
DRITTER TEIL
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
EPILOG
PROLOG
Mag sein, ein frisches Grün wie im Mai, ein tiefer Atemzug inmitten eines gefiederten Konzerts fröhlichen Trällerns und Zeterns, das sich mit Sonnenaufgang über die Felder und Wiesen würde erhoben haben, die flirrende Mittagsglut im August über den Ähren reifen Getreides, eingebettet im Schoße monotonen Zirpens der Grillen –, vielleicht hätte all das die Katastrophe an jenem Tage verhindern können. So aber brach die Dämmerung über diesen 19. November 1978 herein, und es regnete, als klaffte im wolkenschweren Himmelsleib eine tiefe Wunde. Der scharfe Wind aus Osten zog mit eisiger Klinge durch die Gesichter der am Fuße der Klippe stehenden gut ein Dutzend Uniformierten, und während sich einige von ihnen im Aufstellen von Scheinwerfern und Ziehen von Absperrbändern nützlich machten, traten andere befehlsabwartend auf der Stelle – ihr Atem, den sie sich in die Handflächen hauchten, stieb wie Dampf aus einem Wasserkessel auseinander. Jeder Schritt drückte lehmfarbenen Brei unter den groben Profilen ihrer Einsatzstiefel wie Schallblasen schmatzend an den Seiten heraus, und nasser, erdiger Dunst, stieg bis hoch in ihre Nasenhöhlen.
Wenige routinierte Handgriffe später, hatte sich der Schleier der Dunkelheit vollends über die grausige Szenerie gelegt und alles Darunterliegende zu einem unwirtlichen Ort miteinander verschmolzen.
Der nüchterne Blick aus den Augen von Hauptkommissar Stauffer wanderte an der mächtig aufragenden Felswand empor. Zentimeter für Zentimeter tastete sich seine jahrelange Erfahrung am nassen und von Moosen und Flechten überzogenen Gestein langsam aufwärts, entlang an Rissen und Spalten, fein verästelten Adern folgend, als führten sie unweigerlich zu einem noch unbekannten, pochenden Herzen. Ein abgebrochener Zweig, ein Stofffetzen im Geäst, erste Puzzleteile eines soeben begonnenen Geduldspiels.
»Fünfzehn, vielleicht zwanzig Meter?«, erreichte den Hauptkommissar die kühne Schätzung seines hinter ihm stehenden Kollegen, Polizeimeister Bärtke, der seinen Schirm in Aussicht baldiger Beförderung noch weiter schützend in Richtung seines Vorgesetzten schob. Stauffer grummelte zustimmend, zog die Schultern hoch und stellte den Kragen seines triefendnassen Trenchcoats in den Nacken. »Schon wieder einer dieser gemütlichen Sonntage!«, zermalmten seine Kiefer diese zur Gewohnheit gewordene Unsitte. Obwohl der Dialog zwischen den beiden routinemäßig kalt und wortkarg ausgefallen war, schienen Frage und Antwort auf ganz besondere Art miteinander verwoben zu sein; wie eigentlich immer, wenn ein junger Mensch ums Leben gekommen war. Stauffer trat einen Schritt aus der Reichweite des Schirms heraus, fokussierte mit zugekniffenen Augen den höchsten Punkt der Klippe und ließ die eisigen Tropfen scheinbar unbeirrt auf seine Wangen klatschen. Mahnend und erschreckend zugleich trieb die Silhouette vom Rande des Abgrunds einen Schauer über seinen vom Alter gebeugten Rücken. Langsam wanderte sein Blick an der Felswand wieder abwärts, bis hinab auf den traurigen Grund seiner Alarmierung.
»Armes Ding! Armes kleines, dummes Ding!«, seufzte er und kniete sich neben den noch warmen Körper des Mädchens, das leblos in der rot gefärbten Erde lag. In seiner Brusttasche fingerte er nach einem Kugelschreiber und strich damit die verklebten Haare aus ihrem Gesicht. Nacktes Entsetzen – Zeuge ihres letzten Atemzuges – starrte ihn aus dunklen Höhlen eingefroren an. Stauffer schluckte, presste die Lippen aufeinander und zog seine Hand wie ein Laken endlicher Ruhe über ihr Gesicht. Währenddessen fochten blaue Lichtschwerter von den Dächern der Streifenwagen ihren mitleidslosen Kampf um ihn herum. Gespenstisch still lag die noch junge Nacht im Kessel des alten Steinbruchs, lediglich unterbrochen von den pausenlos knarzenden Stimmen aus den Funkgeräten.
Polizeimeister Bärtke ließ den fahlgelben Schein der Taschenlampe mit geschulter Verweildauer am leblosen Körper entlang wandern. Erst jetzt wurden die zahlreichen Verletzungen und die in Fetzen zerrissene Kleidung sichtbar. »Sie muss mehrmals gegen die Felswand geschlagen sein«, sagte er und schien auf die Bestätigung seines Vorgesetzten zu warten.
Stauffer griff ungeduldig selbst nach der Lampe.
»Sehen sie die sauberen, kurzen Schnitte? Nicht tief, nur angedeutet, als sollte uns das etwas sagen müssen. Und hier, an Oberkörper und Kleidung, das gleiche Bild. Sehen sie sich nur ihre Haare an, merkwürdig!« Stauffer deutete auf das pechschwarze und trotz des Regens noch immer lockig fallende Haar des Mädchens, das – wie im Wahn – an einigen Stellen regellos abgeschnitten war.
Bärtke folgte interessiert dem Schein der Lampe.
»Sie meinen, vielleicht ein Psychopath?«
»Möglich, Bärtke, alles möglich. – Die Kollegen haben nichts?«, schielte Stauffer, noch immer kniend, über seine Schulter hinweg. »Ein Messer, Glasscherben ...? Bringen sie mir irgendwas!«
Bärtke schüttelte hilflos den Kopf.
Der Hauptkommissar richtete sich gemächlich wieder auf. Seine Knie knackten in den Gelenken, und von Stöhnen begleitet, fasste er sich mit einer Hand ins Kreuz. Mit der anderen rieb er sich nachdenklich unter dem Kinn, Zeichen dafür, dass erste Schubladen in seinem Polizistenhirn mit Eindrücken, Fakten und Beweismitteln gefüllt waren. Durch Öffnen, Verschieben, Stapeln und Ausschütten der Laden, wich die Spannung aus seinem Körper, und er überließ den Ärzten und Speziallisten alles Weitere, bis ein markerschütternder Schrei, oben vom Rande der Klippe, die Anwesenden zusammenzucken ließ:
»Nein! Nein! Neiiiiin!«, trieb der verzweifelte Ruf eines jungen Mannes blankes Entsetzen durch die vom Verbrechen geschwängerte dunkle Nacht …
Neuer Stadtanzeiger, 20. November 1978
Grausiger Fund im alten Steinbruch
Ein grausiger Fund erschüttert die Menschen im beschaulichen Städtchen […], im Nordwesten Deutschlands. Am Abend des 19. November 1978 wurde dort im alten Steinbruch die Leiche der erst 17-jährigen Shari N. aufgefunden. Nähere Angaben zum Tathergang wollen die Beamten aus ermittlungstechnischer Sicht gegenüber unserer Zeitung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht machen; ein Kapitalverbrechen wird nicht ausgeschlossen. Seite 15, Neuer Stadtanzeiger
ERSTER TEIL
– HENRY –
KAPITEL 1
Fünfzehn Jahre später
Februar 1993
Und wieder stehe ich am Fenster, blicke durch die Sprossen in die noch dunkle, bald sterbende Nacht hinein, warte, bis der Mond die Sonnenscheibe vollends über den Horizont gezogen hat; jene kosmische Gemächlichkeit, der ich – wie so oft – meine Zeit, meine Erinnerung schenke. Wie fühlt es sich an, wenn es die goldenen Strahlen sind, die einen aus dem Schlafe wecken? Jene lebendige Wärme, die – während sich Arme und Beine strecken – ein erstes Lächeln auf Lippen und Wangen zu zaubern vermag?
Fröstelnd hauche ich gegen die Scheibe, reibe mit dem Ärmel meiner Strickjacke ein Guckloch ins trübe Glas und staune wie ein Kind über die fallenden Kristalle, die im Morgenlicht wie in einer Schneekugel durcheinanderwirbeln. Und auch jetzt überlege ich, was dagegen spräche – gleich, wenn sich die Tür öffnet –, nur von dieser einen Geschichte zu erzählen, losgelöst von allen anderen Geschehnissen. Von nur jener einen Geschichte eben, die im Februar des Jahres 1978 inmitten des für Schulgebäude typischen Miefs begonnen und nur wenige Monate später unaufhaltsam an einem Tage im November an den Klippen ihr jähes Ende gefunden hatte. Aber auch stille Tragödien sollten irgendwann einmal sterben dürfen! Und so frage ich mich, ob heute passieren wird, was ich mir so sehr wünsche, und wovor ich mich so sehr fürchte –, wie immer in den stillen Minuten kurz nach dem Hahnenschrei.
Ich bin Henry!
Was nicht mein richtiger Name ist, aber da war einer, der mich während einer Nacht Henry nannte. Einer, der mir vermeintlich seelenverwandt von seiner tragischen Lebensgeschichte erzählte. Einer, der mir seither nicht mehr aus dem Kopf gehen will, der mich begleitet, wie ein Schatten, ganz gleich, ob ich wache oder träume.
Und so sitze ich hier, verloren, inmitten einem Käfig geduldig lauschender Wände, lächle, den Rücken gerade, die Hände auf rot karierter Tischdecke brav übereinandergelegt. Meine Beine zittern, und ich rücke verlegen die frischen Blumen in der Tischmitte zurecht, freue mich über diese kleine Geste meines gewohnt pünktlich erschienenen Gegenübers.
Dann beginne ich zu erzählen, von diesem Schatten, von jener Begegnung, die alles veränderte. Nie werde ich diesen nebelverhangenen Tag im November des letzten Jahres vergessen …
Vielleicht gehörte schon die unruhige Nacht, eine gute Woche zuvor, als es an der Haustür geklingelt hatte, als ein erstes Zeichen dazu. Nicht jenes vom Klingelnden erwartete glasklare Brriiing auf der anderen Seite der Haustür, wenn ein gesunder Klöppel gegen die Glocke hämmert. Nein, dieses müde Rasseln baumelte an einem rostigen Nagel, der mit Kopf und Schwanenhals lustlos aus der Wand lehnte, so als müsse er sich übergeben. Ein Teilzeit-Stillleben auf verblichener Tapete, das sich seinen besonderen Sound über die Jahre erarbeitet hatte – ich lebte bescheiden in meiner Einzimmerwohnung und ehemaligen Studentenbude. Rusty, mein treuer Mischlings-Vierbeiner, reagierte als erster, war urplötzlich wieder hellwach und schaute mit forderndem Blick zu mir herauf: »Mach doch endlich auf«, sollte das heißen. Seine buschige Rute wedelte vor Freude hin und her. Für mich die Gewissheit, dass es sich nur um jemand Bekannten handeln konnte. Dennoch lief mir ein Schauer über den Rücken, wer mich so spät noch aufsuchte, es war kurz nach Mitternacht und das Wochenende gerade vorbei.
Ich warf mir den Morgenmantel über, strich mir ein paar Strähnen in die mit zweiunddreißig Jahren großzügig angelegte Stirn und redete beruhigend auf Rusty ein, so als wüsste ich mehr über unseren nächtlichen Besucher. Ungeduldig drückte er sich zwischen meine Beine, während meine Hand die Klinke zögernd nach unten drückte. Schüchtern blinzelte Licht vom Hausflur durch den Spalt, bis schließlich mein Kopf hindurchpasste.
Niemand war zu sehen!
Ein kurzer Blickkontakt mit Rustys treuen Augen, ein Schulterzucken, und zurück ins warme Bett. Sicher hatte ich nur schlecht geträumt.
Ein ganz normaler Arbeitstag folgte.
Wie es sich für einen Montag gehörte, hatte ich früh Feierabend gemacht, und gedankenverloren suchten sich meine Beine wie von selbst ihren Weg nach Hause – Rusty wartete ja auf mich. Immer wieder hatte ich mir vorgenommen, etwas zu ändern, damit er nicht immer so lang alleine blieb. In Gedanken war ich noch mit diesem Gedanken beschäftigt, als dieses Café vor mir auftauchte, oder wie auch immer man diese Mischung aus Eisdiele, Spielhölle und Schnellimbiss bezeichnen konnte. Jeden Tag war ich daran vorbeigekommen, aber an diesem Tag war alles anders. Warum sollte ich mir nicht noch einen wärmenden Kaffee gönnen? Zumal nicht viel los war, was selten genug passierte.
Ein Geruchscocktail von Frittenfett, verschüttetem Bier und Nikotin schlug mir entgegen. Die ersehnt duftende Kaffeenote gesellte sich erst dazu, als ich meine Tasse direkt unter die Nase hielt. In einer Ecke, neben den Spielautomaten, fiel mir ein Mann mittleren Alters auf, der an einem der Tische wie lebendes Inventar anmutete. Ich kümmerte mich nicht weiter darum und nahm einen ersten Schluck. Das Gebräu war lauwarm, und so bestellte ich noch einen Cognac dazu, in der Hoffnung, dieser würde seine wärmende Wirkung tun.
Mehr aus Verlegenheit griff ich nach der Speisekarte und studierte das spärliche Angebot. Dabei lugte ich hin und wieder über den oberen Rand der Karte hinweg und inspizierte mein weiter entferntes Gegenüber, immer darauf bedacht, nicht ertappt zu werden. Das ungepflegte Äußere des Mannes war mir schon beim Hereinkommen aufgefallen. Jetzt, aus sicherer Entfernung betrachtet, gab es keinen Zweifel mehr, dass es sich um einen dieser gescheiterten Existenzen handelte, im Volksmund Penner oder Landstreicher genannt. Aufreizend lächelnd saß er da, die Augen in seinen Tabaksbeutel vertieft. Sein schulterlanges, braungelocktes Haar schüttelte er dabei immer wieder mit ruckartigen Kopfbewegungen zur Seite. Die Kleidung passte zu ihm: ein abgenutzter olivfarbener Parka, darunter ein blauer Seemannspullover, verwaschene blaue Jeans und diese typischen Siebenmeilenstiefel.
Seine Zigarette war fertiggestellt und anscheinend vergeblich kramte er nach seinem Feuerzeug. Der gerade am Nebentisch beschäftigten Bedienung bedeutete er mit einer Handbewegung, ihm ein paar Streichhölzer bringen zu wollen.
»Zehn Pfennig macht das!«, konnte ich weiter verstehen.
Der Langhaarige dankte kopfschüttelnd ab und ließ die Kippe enttäuscht in die Tasche seines Parkas gleiten. Er lächelte noch immer.
Ich ertappte mich dabei, wie mein Erstaunen über dieses scheinbar grundlose Lächeln noch immer auf ihm klebte, mich auf merkwürdige Weise berührte – er tat mir leid. Ich trat an seinen Tisch heran und streckte ihm die Flamme meines Feuerzeugs entgegen. Überrascht und dankbar zückte er sein Werk wieder hervor, hielt die Spitze in die Flamme und zog kräftig daran. Für Sekunden blickte ich in seine rot unterlaufenen Augen, die so gar nicht zu seinem ansonsten positiv gestimmten Gesichtsausdruck passen wollten. Ohne ein Wort zu sagen, machte ich kehrt und setzte mich wieder auf meinen Platz, nippte an meinem inzwischen kalten Kaffee. Hatte ich eben noch den Penner in meinem Gegenüber gesehen, sah ich jetzt einen Menschen dort am Tisch sitzen, der einfach nur eine Zigarette rauchte. Eigentlich genauso wie ich es tat, nachdem auch ich mir eine angesteckt hatte. Nur allzu leicht hatte ich vergessen, dass ich ja selber mit mir und der Welt unzufrieden war. Irrte ich nicht selber ziellos umher und führte meine Probleme lediglich spazieren? Ich schämte mich dafür, jemanden so voreilig in eine passende Schublade gesteckt zu haben, und wer weiß, vielleicht würde man mit mir irgendwann das gleiche tun, wenn sich in meinem Leben nicht bald etwas würde ändern, dachte ich.
Am Tisch meines Gegenübers sammelte das Mädchen mit den Streichhölzern die passend abgezählten Münzen ein. Flüchtig wischte sie mit einem Tuch über die Tischplatte, was wohl eher symbolisch zu verstehen war. Er bedankte sich höflich und wollte anscheinend noch etwas sagen, was sein plötzlicher Hustenanfall jedoch verhinderte. Es war ein durchdringendes, übles Husten und stand sinnbildlich für all die kalten Nächte, die er anscheinend im Freien verbracht haben musste. Ohne sich noch einmal nach mir umgedreht zu haben, verließ er das Café. Ich hatte dennoch das unbestimmte Gefühl, bis ins Kleinste von ihm gemustert worden zu sein.
Ich zahlte ebenfalls und passierte den Tisch, an dem er gesessen hatte. Ein kleines Buch erregte meine Aufmerksamkeit, das er anscheinend versehentlich dort liegengelassen hatte: Grundlagen der Relativitätstheorie lautete der Titel des Buches und würde somit zweifelsohne wohl doch nicht zu ihm gehört haben. Vielleicht würde es jemand anders vermissen, und so nahm ich es und gab es bei der Kassiererin ab.
Dann verließ ich das Café.
Eine gute Woche später, an einem Freitag – jenem nebelverhangenen Tag – hatte ich verschlafen, war ohne zu frühstücken ins Büro gehastet, hatte mich wie immer über Kollegen ärgern müssen und fieberte dem Feierabend entgegen – ein Tag, an dem man wohl besser im Bett geblieben wäre. Wie verdammt Unrecht ich damit hatte! Als ich nämlich abends wieder mit Rusty auf dem Sofa lag, resümierte ich – wie so oft in jener Zeit – den abgelaufenen Tag. Keine Idee, kein Vorhaben war mir begegnet, mit dessen Hilfe ich diesen monotonen Rhythmus hätte aufgeben können. So langsam setzte sich der Gedanke in mir fest, dass ich unmerklich auf die Standspur des Lebens geraten war, auf der keiner der Vorbeirasenden mir Platz zum Wiedereinscheren machte. Ich befürchtete, irgendwann neben den Anhaltern stehen, und mein Schnäpschen im Café mit zehn Groschen bezahlen zu müssen.
Dann bemerkte ich Rusty unterhalb vom Schlüsselboard sitzen, den Blick auf seine Leine fixiert; Gott sei Dank Schluss mit den Gedanken in der Endlosschleife. Ein mit Cognac gefüllter Flachmann rutschte routiniert in meine Manteltasche, was mich nicht störte, ganz im Gegenteil. Es war die einzige Möglichkeit, um in meinem Innern einen – wenn auch künstlich erzeugten – Gesprächspartner, einen Verbündeten zu haben, den ich halbwegs tolerierte.
Rustys Schnauze ging voraus.
Direkt in eine Suppe hinein, wie sie nur der November zubereiten konnte.
Ungemütlich!
Der Weg vor uns, nur eine Ahnung, eine milchig trübe Ungewissheit, die wie ein Vorhang vom Himmel hing. Dampfende Nebelschwaden rollten wie Wolken über einem Meer feuchtglitzernden Asphalts. Eine Nacht, in der die überschwere Luft alles Vertraute zu geheimnisumwobenen Stätten erhob.
Wir entschieden uns für den Weg entlang am Südfriedhof.
Schon bald ragten erste Grabsteine aus dem Totenacker wie Bergspitzen aus einem Wolkenteppich heraus. Es roch nach torfiger Erde, und mit Moosen überwucherte Steinplatten zeugten von Jahre währender, ungestörter Ruhe. Vereinzelt flackerten Grableuchten in ihren roten Zylindern, und ich lauschte dem Kuwitt des Waldkauzes. Rusty sicherte die Umgebung, indem er seine empfindliche Nase schräg gegen den Wind stellte.
Wir verließen die sichere Wegbefestigung, und grober Kies walkte sich knirschend unter meinen Füßen hinweg. Weitere mit Inschriften versehene Felsbrocken und Kreuze tauchten auf. Die innere Spannung kribbelte wie Ameisen unter meiner Haut. Auch Rusty schien nicht unbeeindruckt, was mir die locker durchhängende Leine verriet.
Der Wind hatte deutlich zugenommen. Gespenstisch anmutend trieb er Nebelfetzen zusammen, bis seine Herde diesen unheimlichen Ort vollständig vereinnahmt hatte. Aus dem heiligen Grund war eine Theaterbühne geworden, auf der jeder Strauch, jeder Baum, jedes Kreuz, seine Rolle zu spielen hatte.
Mir fiel das fehlende Knirschen auf! Erdklumpen klebten nun unter meinen Schuhen, bestätigten mich in meinem Glauben, an diesem Ort, zu dieser Zeit, wohl keiner Menschen Seele zu begegnen. Vielleicht mochte ich gerade deshalb diesen Weg, entlang am Friedhof. Ich war schon immer gern allein mit mir und meinen Gedanken gewesen, und über das Leben konnte ich hier, wo sich mehrere tausend Jahre Lebenserfahrung versammelt hatten, mehr erfahren, als in mancher noch so belebten Straße. Man musste nur zuhören können.
Ich ging weiter, saugte die märchenhafte Umgebung mit allen Sinnen in mich auf. Neue Bilder mit Bäumen und Büschen, Steinen und Kreuzen zeichneten sich auf der aus Wassertröpfchen bestehenden Leinwand ab. Äste krachten gegeneinander, Grabsteine pfiffen an brüchigen Kanten, und jeder meiner Schritte schmatzte, als verzehrte der geweihte Boden hungrig jeden Bissen Leben.
Ich wollte gerade einen Schluck meiner Wegzehrung nehmen, als mich Rusty mit einem kräftigen Ruck an der Leine aus dem Gleichgewicht brachte und in ein mannshohes Gebüsch stolpern ließ – auf seiner Höhe erinnerte sein heißer Atem an das dampfende Maul eines Urzeitmonsters. Aufgespritzte Erde brannte in meinen Augen, und dunkelbraune Brühe saugte sich gierig durch meine Kleidung, wie ein Egel, der nach nackter Haut lechzte.
Auf einen Ellbogen gestützt, versuchte ich schnellstmöglich wieder auf die Beine zu kommen, aber meine ungestümen Bemühungen fanden keinen Halt.
Rustys Muskeln und Sehnen spannten sich, seine Flanken zitterten, sein tiefes Knurren machte mir Angst. Irgendetwas atmete in unmittelbarer Nähe, das röchelnde Geräusch musste direkt vor uns seinen Ursprung haben …
KAPITEL 2
Das Röcheln kam aus der Grabstelle. Merkwürdig vertraut kam es mir vor. Ich war mir sicher, ich kannte dieses Geräusch, das sich anhörte, als würde jemand um seinen nächsten Atemzug kämpfen müssen.
Vorsichtig drückte ich einige Zweige zur Seite. Ein Grabstein tauchte auf, blendend, wie ein Kreidefelsen. Leider verbarg der dichte Nebel weitere Einzelheiten, ich musste näher heran. Mit Händen und Füßen sezierte ich mich weitere Zentimeter vor und erkannte die schemenhaften Umrisse einer am Stein sitzenden Gestalt. Wieder dieses vertraute üble Husten. Niemand anders als der Penner lehnte da am Grabstein, der Landstreicher und Leidensgenosse aus dem Café. Mein Freund!
Im Mondlicht, das schwach durch Wolken und Nebel hindurchschimmerte, blitzte ein einsames Augenpaar auf, tiefste Traurigkeit und unauslöschlichen Lebenswillen seltsam in sich vereinend. Triefendnasse und im Gesicht klebende, lange Haare, zeugten davon, dass mein neuer Freund schon länger an diesem Ort ausgeharrt haben musste – von seiner ehemaligen Lockenpracht war jedenfalls nichts mehr zu sehen gewesen. Dafür zierte ihn nun ein Dreitagebart. Ich wollte ihn nicht verängstigen und fragte mit seichter Stimme, ob ich etwas für ihn tun könne. Seine Mundwinkel schoben sich nach oben, aber er antwortete nicht. Stattdessen röhrten seine Lungen, erstickten sich in lang gezogenem Ächzen, ohne, dass sich Schleim löste – die feuchtschwere Luft war alles andere als zuträglich für ihn. Ich hockte mich hin, um ihm ein Stückchen näher sein zu können, während Rusty sich an meine Seite drückte.
»Ein treues Tier«, vernahm ich zum ersten Mal bewusst seine Stimme, und für wenige Sekunden vergaßen wir die uns umgebenden widrigen Umstände.
»Magst du Hunde?«, gab ich der winzig kleinen Flamme Nährstoff.
»Ich mag alle Tiere, Shari liebte Tiere über alles!«
Während er das sagte, lag ein zufriedenes Lächeln auf seinem Gesicht.
»Shari? Wer ist Shari?«, fragte ich.
Anstatt zu antworten, wandte er seinen Kopf langsam zur Seite. Seine Finger fuhren zärtlich die Inschrift des ihn stützenden Grabsteins entlang. Ich musste mich ein Stück weit nach vorne beugen, um die eingravierten Buchstaben lesen zu können …
Die blaue Blume ist aber das,
was jeder sucht, ohne es selbst zu wissen,
nenne man es nun Gott, Ewigkeit oder Liebe!
Ricarda Huch
… stand darauf geschrieben.
Und weiter las ich …
Hier ruhen
die Sehnsüchte, Wünsche und Träume
von
SHARI NANDIR
Geboren am 3. August 1961
Gestorben am 19. November 1978
In Liebe
Dein Stefan
Minuten ehrfürchtiger Stille vergingen.
»Du bist Stefan, nicht wahr?« Die Frage war mir schwergefallen.
»Shari kommt auch heute noch zu meinem Geburtstag!«, antwortete er stattdessen, so als wollte er jeden Zweifel daran von vornherein ausräumen.
»Du hast heute Geburtstag?«, hakte ich nach.
»Ja, ich glaub schon, oder welchen Tag haben wir heute?«
Ich überlegte kurz.
»Den Zwanzigsten, ja, den 20. November 1992.«
»Also habe ich heute Geburtstag!«
Innerlich triumphierend zog er die Beine noch näher an seinen Körper heran, schloss die Arme noch fester darum zu – eine uneinnehmbare Festung, wie ich fand. Die Art und Weise, wie er seine scheinbare Zufriedenheit untermauerte, beeindruckte, ja sie faszinierte mich.
»Dann gratuliere ich dir«, beteuerte ich aufrichtig und kramte nach meiner Wegzehrung. »Es ist Cognac, möchtest du?«
Er wollte. Er führte die Flasche, ohne den Flaschenhals vorher abgewischt zu haben, dankend an seinen Mund, nahm einen Schluck und fuhr sich anschließend mit dem Handrücken über die Lippen. Das Muskelspiel in seinem Gesicht war Spiegelbild davon, wie sich das hochprozentige Gesöff seine Speiseröhre hinunterarbeitete – der Cognac tat ihm offenbar gut.
Wieder sagten wir eine Weile nichts.
Es war eigenartig, mit welcher Selbstverständlichkeit ich ihn schließlich fragen durfte, wie alt er denn geworden sei.
»Ich bin 1960 geboren, also bin ich jetzt wohl zweiunddreißig. Und ich heiße Stefan, ja, da hast du recht«, arbeitete und grübelte es hinter seiner in Falten gelegten Stirn. Sein wieder einsetzender Husten verschluckte weitere Einzelheiten. Mit Händen und Füßen kämpfte er gegen den Anfall an, und auch ein medizinischer Laie hätte schnell bemerkt, dass diese Geräusche nicht das Ergebnis eines bloßen Reizes waren. In dieser unwirtlichen Umgebung durfte ich meinen Freund nicht länger belassen. Ich beschloss, ihn mit in meine Wohnung zu nehmen, in der Hoffnung, er würde zustimmen.
Zu meiner Überraschung willigte er sofort ein.
»Wenn du meinst, Shari wird es sicher verstehen, Henry!«
»Henry? Wieso Henry?«, stutzte ich.
»Henry ist ein schöner Name, findest du nicht?«
Während er das sagte, fiel mir ein, dass ich ihn gar nicht nach seiner Bleibe gefragt hatte, ob es überhaupt ein Zuhause für ihn gab. Ich würde ihn das alles später fragen können, redete ich mir ein und reichte ihm meine Hand – warum nicht auch als Henry?! Aber kaum, dass er sich aufgerichtet hatte, hielt er noch einmal inne und verabschiedete sich zärtlich vom weißen Grabstein, seinem unantastbaren Heiligtum, von Shari.
Ich ertappte mich, wie auch ich dieser verstorbenen Seele gedachte, die da im kalten Grund vor uns begraben lag. Und obwohl ich dieses, mit siebzehn Jahren viel zu früh verstorbene Mädchen gar nicht gekannt hatte, spürte ich doch eine seltsame Verbundenheit.
Der Nebel hatte sich aufgelöst, und ich konnte den Weg erkennen, von wo aus ich mit Rusty gekommen war. So machten wir uns auf den Heimweg – zu dritt!
Stefans durchnässte Kleidung hatte ich über die Heizung gelegt. Dafür trug er jetzt einen ausrangierten Trainingsanzug, von dem ich mich bei der nächsten Altkleidersammlung ohnehin hatte trennen wollen. Ein paar Wollsocken hatte ich ihm ebenfalls überlassen. Sichtlich amüsiert über sein neues Aussehen, drang schallendes Lachen aus dem Badezimmer herüber.
Überhaupt wirkte mein neuer Freund weder in sich gekehrt noch deprimiert, im Gegenteil, er machte einen fröhlichen und optimistischen Eindruck. Fast ein wenig neidisch beobachtete ich ihn, wie er seine Haare trocken rubbelte. Seine vermeintlich schlechtere Situation schien ihm nur halb so viel auszumachen, wie die meinige mir zu schaffen machte. »Ein merkwürdiger Geselle ist dieser Stefan«, dachte ich, nahm ihm sein Handtuch ab und legte es ebenfalls zum Trocknen auf die Heizung. Auf dem Weg ins Wohnzimmer schüttelte ihn ein neuerlicher Hustenanfall, und schnell kramte ich im Arzneischrank nach etwas Brauchbarem, was helfen konnte. Einen bereits abgelaufenen Rest Hustensaft hatte ich ihm jedoch nicht antun wollen. Stattdessen goss ich einen heißen Grog auf und hatte damit wohl auch die richtige Wahl getroffen. Schon nach dem ersten Schluck nahm sein Gesicht eine gesunde Rötung an, was natürlich auch von aufkommendem Fieber herrühren konnte.
Ich ließ ihn allein im Sofa zurück, um eine Kleinigkeit zu essen vorzubereiten, als mich seine Frage in der Küche kalt erwischte.
»Dir geht’s auch nicht sonderlich gut, nicht wahr, Henry?«, hatte er gefragt. »Ist doch so?«
Baff, das hatte gesessen! Schließlich war er doch der vom Friedhof aufgelesene Landstreicher. Und nun sollte plötzlich ich es sein, der auf der viel zitierten Couch Platz genommen hatte. Was um alles in der Welt steckte dahinter? Und warum nannte er mich Henry? Ich hatte mir geschworen, das herauszufinden, und kam mit ein paar belegten Broten aus der Küche zurück. Erst jetzt fiel mir die Unordnung meiner Wohnung auf: herumliegende Kleidungsstücke, halb verweste Essensreste, leere Tassen und Gläser, längst veraltete Zeitungen und eine Unmenge leerer Flaschen, zumeist alkoholischer Natur. Kein Wunder also, dass mein neuer Freund, dass Stefan, gefragt hatte. Anderseits mangelte es mir aber am Bedürfnis, ihm meine ganze Lebensgeschichte mit all dem Frust und den Enttäuschungen über unerreichte Ziele beichten zu wollen. Vielmehr interessierte mich sein Lebensweg, wie er in diese Lage geraten war und wie er sich seine Zukunft vorstellte.
Der Trainingsanzug stand ihm immer besser, wie ich fand. Auch seine langen Haare, die mittlerweile wieder vollständig getrocknet und lockig geworden waren, wirkten längst nicht mehr so ungepflegt und passten irgendwie zu seinem gesamten Erscheinungsbild.
Eine Zeit lang schauten wir uns einfach nur an, bis mir das kleine Büchlein wieder in den Sinn kam.
»Gehörte das Buch auf deinem Tisch, im Café, eigentlich dir? Grundlagen der Relativitätstheorie, so hieß es wohl?«, fragte ich.
»Ja genau, das vermisse ich seit ein paar Tagen. Hast du’s für mich mitgenommen?«
»Leider nein, ich war mir nicht sicher, ob es dir gehören würde«, antwortete ich diplomatisch, schließlich wollte ich meinen neuen Freund keineswegs kränken mit dem, was mich dazu bewogen hatte, das Buch liegenzulassen. Obwohl er mir das vermutlich nicht einmal übel genommen hätte, so schätzte ich ihn jedenfalls mittlerweile ein. Überhaupt hatte ich mit meinem ersten Eindruck, was sein Auftreten und sein Wesen betraf, gewaltig danebengelegen. Als ich ihn das erste Mal im Café gesehen hatte, schätzte ich sein Alter auf Mitte vierzig, Anfang fünfzig, und ein Buch über die Relativitätstheorie hatte ich bei seinen Habseligkeiten ebenso wenig erwartet, wie die Bild Zeitung bei Marcel Reich-Ranicki. Und dann diese positive Ausstrahlung, sie stimmte so gar nicht mit der landläufigen Meinung über Penner und Landstreicher überein. Die Freiheit dieser Leute in allen Ehren, aber sollte nicht jeder von ihnen stets ein gehöriges Maß an Enttäuschung und Verbitterung in seinem Herzen tragen? Und nun saß dieser Stefan in meiner Wohnung und vermittelte mir eine diesbezüglich völlig andere Weltanschauung.
Sein abermaliges Husten riss mich aus meinen Gedanken. Ich war mittlerweile überzeugt davon, dass heftiges Fieber in seinem Körper tobte, das verantwortlich für seine glühend roten Wangen war. Obwohl die Heizung ihr Bestes gab, zitterte er am ganzen Körper. »Ein Arzt muss her«, schoss es mir in den Kopf, aber was wusste ich schon von diesem Fremden? Bis auf seinen Namen und sein Alter war er mir ja völlig unbekannt gewesen.
Ich musste Näheres erfahren.
»Wohnst du hier in der Gegend oder bist du quasi auf der Durchreise?«, fragte ich bewusst salopp daher.
Entrüstet schüttelte er den Kopf.
»Nein, nein, ich bin von hier«, brachte er kurzatmig heraus.
»Du hast eine feste Bleibe, einen Ort, wo du hingehörst?«, bohrte ich weiter.
»Natürlich, ich habe Eltern, aber wohnen tue ich da nicht.«
Der Schleim schien sich langsam zu lösen.
»Wo schläfst du denn in solchen kalten Nächten wie heute?«
»Mal hier, mal dort.«
»Und wovon lebst du?«
Sofort merkte ich, mit dieser Frage wohl etwas zu weit gegangen zu sein, und ich mäßigte die Situation, indem ich unvermittelt aufstand, um nach seiner ausgelegten Kleidung zu sehen. Auch er hatte meinen Fauxpas offenbar registriert.
»Du meinst, ob ich derjenige bin, der dir das Geld aus den Taschen zieht?«, konterte er. »Das musst du für dich selber entscheiden.«
Er drehte sich zu mir herum, legte einen Arm über die Rückenlehne vom Sofa und schaute zu, wie ich seine Sachen auseinanderzupfte, damit sie schneller würden trocknen.
»Ich bin kein Sozialhilfeempfänger, wenn du das meinst«, schien er mich aufklären zu wollen. »Sollte es mir wirklich einmal an einem Groschen fehlen, bräuchte ich nur zur Bank zu gehen, mehrere tausend Mark sind da für mich deponiert; aber ich brauche sie nicht, will sie nicht! Und so wahr mir Gott jetzt zuhört, Shari wäre stolz auf mich, dass ich sie nicht nehme!«
»Heißt das, dass du dieses Leben freiwillig führst?«, fragte ich über meine Schulter hinweg.
»Warum fragst du das so verwundert, so vorwurfsvoll? Gibt es denn so eine Art Ur-Glück, welches jeden Menschen gleichermaßen zufriedenstellen sollte?«
Mit dieser tief gehenden Frage hatte er mich auf dem falschen Fuß erwischt. Wie hätte ich überzeugend argumentieren können, wenn nicht aus dem Gefühl eigener innerer Ausgeglichenheit heraus? Damit konnte ich zum damaligen Zeitpunkt nun wahrlich nicht dienen.
»Ich hatte ja auch nur gedacht, dass du vielleicht nicht so ganz glücklich wärst, keine feste Bleibe zu haben, und bei diesem Wetter frieren zu müssen«, verteidigte ich mich zaghaft.
»Nein!«
Seine Antwort stand wie ein Fels, ohne weiteren Kommentar.
»Tut mir leid, wenn ich dir mit meinen Fragen auf die Nerven gehe, aber –«
»Aber du willst wissen, warum ich so bin wie ich bin, hab ich recht?«, fuhr er mir ins Wort. »Du willst wissen, warum ich auf der Straße herumlungere, wo ich doch erst zweiunddreißig bin? Warum ich mir die Streichhölzer nicht leisten kann, wo doch mehrere tausend Mark auf meinem Sparkonto liegen? Warum ich nachts auf dem Friedhof hocke und nicht bei meinen Eltern in der warmen Wohnstube? Warum ich wissenschaftliche Bücher lese und nicht stumpfsinnig – wie es sich für einen Penner gehört – dahinvegetiere? Und du willst wissen, warum ich in meiner Lage scheinbar glücklicher bin als du! Ist es nicht so?«
Sein Gesichtsausdruck drückte dabei weniger einen Vorwurf, als vielmehr eine Art von Genugtuung aus. Ich war überrascht, auf welchem Niveau dieser Landstreicher – der er ja nun einmal war – ein ernstes Gespräch zu führen im Stande war; aber ich mochte diesen Stil: Klar und direkt, womit meine Weltanschauung ein weiteres Mal ins Wanken geriet.
»Ja!«, bestätigte ich selbstsicher, womit nun auch ich meinen Felsen hatte.
Sein Blick wanderte von meinem Kopf, zu meinen Füßen und wieder zurück.
»Sind das die Fragen, die dir dein Leben stellt?«, philosophierte er. »Sind das die Fragen, die in dir brennen, die du für so wichtig hältst, als dass man eine Antwort dafür nötig hätte? Wo willst du die unbekannten Vokabeln finden, wann den unberührten Raum in deiner Seele betreten, wenn du dich nicht nach rechts und links in den vermeintlich todbringenden Morast begibst, in dem du womöglich auf ewig gefangen bleibst, wo du untergehst?!«
Seine Augen wurden groß und starr, und sein Herzschlag pochte rhythmisch von innen gegen seine Schläfen, getrieben vom Druck der zum Bersten gespannten Ader an seinem Hals. Hatte er bis hierhin den Eindruck erweckt, die Situation unter Kontrolle zu haben, hatte ich anscheinend eine Tür im Keller seines Innern geöffnet, einen Raum, in dem noch alte Wunden auf ihre Entsorgung warteten.
Sein Kopf fiel kraftlos nach vorn, die ›Wunden‹ darin schmerzten anscheinend noch immer.
Ich ließ ihm ein paar Sekunden.
Er beruhigte sich.
Sein Atem ging wieder ruhig und gleichmäßig.
Sein Blick suchte nach mir – einer dieser Blicke, die einem sagen sollten: »Hör genau zu, was ich dir jetzt sage«!
Mit weicher Stimme, die gleichsam vertraut, wie ungewohnt auf mich wirkte, sagte er: »Aber ich verstehe dich, glaube mir, ich verstehe dich nur allzu gut, Henry!«
Es war einer dieser Momente, in denen man auf seltsame Weise genau spürt, dass da irgendetwas auf einen zukommt. Etwas, dem man nicht mehr ausweichen kann ..., nicht ausweichen will. Dieser Landstreicher, den ich zufällig aufgelesen hatte, und der Stefan hieß, der mich schlicht Henry nannte, und der in nur einer Nacht mein Freund geworden war, musste viel durchgemacht haben, das spürte ich von Anfang an.
In jener Nacht erzählte er mir seine Geschichte, von seinem Leben und von seinem Schicksal. Von jener Geschichte, die auf seltsame Weise – wie ein feines, unsichtbares Geflecht – mit meinem eigenen Leben verbunden zu sein schien –, es womöglich noch immer ist!
ZWEITER TEIL
– STEFANS GESCHICHTE –
KAPITEL 3
Stefans Wohnort im Nordwesten Deutschlands
Städtisches Gymnasium
Stefans Geschichte beginnt inmitten des typischen Miefs von Bohnerwachs, vergilbtem Papier und dem Schweiß Hunderter von Gymnasiasten. Wie eine riesige, klebrige Spinnwebe hing dieser penetrante Geruch in den Fluren des inzwischen baufällig gewordenen Schulgebäudes. Ein ausgeblichener Kalender am Mauerwerk des Südflügels zeigte mittels verstellbarer Rädchen den 10. Februar 1978 an. Gleich darunter genoss das im Sommer von lärmenden Sextanern umlagerte Thermometer die ungewohnte Ruhe knapp über dem Gefrierpunkt. Die Zeiger der in den maroden Ziegel genagelten Uhr sprangen auf Viertel vor zwölf, und der Vierklang der Pausenglocke mahnte in erst fallender und dann in wieder steigender Tonhöhe zur nächsten Stunde. Chemie bei Dr. Römmler – von den Schülern wegen seiner Steckdosenfrisur liebevoll nur der Professor genannt – stand auf dem Programm.
Stefan kaute gerade gelangweilt auf seinem Bleistift herum, als der Professor, unter Zuhilfenahme seiner Hände und Füße das Orbitalmodell vor der versammelten Klasse zu erklären versuchte. Angeblich sei dieses grundlegende Prinzip in der Chemie nur zu verstehen gewesen, wenn man sich in Räume hätte hineindenken können, die tatsächlich aber gar nicht existierten – so jedenfalls Dr. Römmler. Zumindest wusste Stefan jetzt, warum er und die Chemie wohl nie eine Liebesbeziehung würden eingehen können. Imaginäre Räume. Elektronen, die mal hier, mal dort seien. Kugel- oder Keulenformen, sogar Doppelkeulenformen seien möglich. Nur das sie eben nicht wirklich existent waren, es gab sie also eigentlich gar nicht. »Wozu dann das Ganze«, fragte er sich. Entweder Oder! Schwarz oder weiß! Arm oder Reich! Das war es doch, worauf es ankam. Nicht eventuell, beinahe oder vielleicht. Sein Vater und auch Adolf hatten schon recht mit dem, was sie immer sagten: Vertraue nur dem, was du siehst, was du weißt, und stets dir selber! Nicht umsonst hatte sein Vater, Carl Köhler, als ehemaliges Vorstandsmitglied mit Prokura die Intermobil AG übernommen, und auch Adolf, sein langjähriger Freund, hatte als promovierter Elektroingenieur finanziell mehr als ausgesorgt.
Genau so wollte es Stefan auch machen: ein akzeptables Abitur mit sich anschließendem Wirtschaftsstudium, Promotion und dann ab ins Management. Die Hänseleien seiner Freunde wie Moni, Michael und Bea würden schon verstummen, sollte er erst einmal Mitentscheidender über das Fortbestehen Hunderter von Arbeitsplätzen sein, dachte er. Sollten sie nur alle mit ihren Freunden und Freundinnen protzen, seinen Vater hatte man seinerzeit ebenso belächelt. Und heute? Gedanklich war er sich sicher, in seinem Vater das ideale Vorbild gefunden zu haben!
Die Pausenglocke ertönte abermals.
Gott sei Dank, die Stunde war geschafft, zum Henker mit den imaginären Räumen. Schnell, aber gewissenhaft, verstaute er Bücher und Notizen in seiner aus Büffelleder gefertigten Schultasche, in der Hefte, Mappen und Stifte mit jeweils eigenem Verschluss gesichert werden konnten. Einzig die Funktionalität und das edle Design konnten seiner Meinung nach aber über den animalischen Geruch hinweghelfen. Er schlenderte in Richtung Klassenraum 8a, wo Gemeinschaftskunde auf ihn wartete – sein Lieblingsfach.
»Was läuft heut Abend?«, brüllte ihm sein hoch aufgeschossener und bester Freund Benny auf dem Weg dorthin in den Nacken. »Woll‘n doch mal sehen, ob heut Abend was für dich dabei ist!«
Stefan mochte diese Art der Anmache nicht, selbst dann nicht, wenn sie von Benny kam.
»Das lass mal meine Sorge sein«, gab er genervt zurück, »abgerechnet wird zum Schluss!«
»Nun hab dich nicht gleich so, war ja nur ‘ne Frage, entschuldigen sie die Störung!«
Jetzt schien Benny genervt.
»Ich ruf dich heut Abend an«, warf Stefan – immer noch leicht angesäuert – Bennys schnellen Schritten hinter her.
Für den Rest der Stunde redeten sie kein Wort mehr miteinander, aber schließlich hatte ja nicht er Benny, sondern Benny hatte ihn provoziert, was sollte er sich also unnötig Gedanken machen? Es war schließlich nicht sein Problem, wenn er nicht in die mit amourösen Abenteuern vollgestopfte Schublade seines Freundes passte. Diesmal würde man ihm seinen gelegentlichen Jähzorn also nicht vorwerfen können, verzog er zufrieden sein Gesicht.
Der Vormittag hatte sich mal wieder unendlich lang hingezogen, und Stefan war froh, endlich den Heimweg antreten zu können. Schnell überprüfte er sein Büffelleder, ob auch alles am richtigen Platz war. Dann hastete er aus dem Schulgebäude, schließlich wurde pünktlich um Viertel nach eins gegessen. Und wenn sein Vater eines hasste, dann war es Unpünktlichkeit. Termine kennt man vorher, und unerwartete Vorkommnisse sind dazu da, sie in den gewohnten Tagesablauf zu integrieren, hatte sein Vater stets gesagt. Aus welchem Grund hätte er dessen These infrage stellen sollen, er brauchte ja nur an die vielen Nachmittage denken, an denen Benny ihn versetzt hatte.
Dennoch konnte er es sich nicht verkneifen, beim Autohändler einen kurzen Blick durchs Schaufenster zu riskieren, denn hier stand es: sein Geburtstagsgeschenk! Zwar wurde er ja erst im November achtzehn, aber das hatte seinen Vater nicht daran hindern können, sein Geheimnis bereits beim letzten Besuch Adolfs preiszugeben. Schließlich hatte Adolfs Tochter Melanie zu ihrem Geburtstag eine Reise nach Amerika geschenkt bekommen, und Stefan konnte den Stolz seines Vaters nur allzu gut verstehen.
Dieser rote BMW 316 würde also bald sein Eigen sein. Stolz hockte er sich hin, um eine andere Perspektive genießen zu können, blickte direkt auf das Typenschild im Kühlergrill und die runden Scheinwerferpaare links und rechts. Im Geiste sah er sich hinter dem Lenkrad sitzen, mit einem Arm zum Fenster hinausgelehnt, die Musikanlage voll aufgedreht und mit dem Gesichtsausdruck eines Mannes, für den es das Normalste der Welt war, einen BMW zu fahren. Er genoss diese Vorstellung, glaubte das präzise Schnurren der sechs Zylinder bereits hören zu können, beeilte sich dann aber schleunigst, um einer längeren Diskussion mit seinem Vater aus dem Wege zu gehen.
Fast wäre er mit diesem alten Mann zusammengestoßen, der plötzlich seinen Weg kreuzte und mit aufreizendem Lächeln im Gesicht genau auf seiner Höhe plump stehen blieb. Nur mit Mühe konnte er ihm ausweichen. Er hasste diese Typen in ihren dreckigen Klamotten, wie sie mit einer Flasche Rotwein unter den Arm geklemmt, dem Staat auf der Tasche lagen. Mochten die Sprüche seines Vaters, wie Jeder ist seines Glückes Schmied oder Jeder hat seinen Marschallstab im Tornister auch abgedroschen und längst überholt gewesen sein, so hatte er dennoch recht damit, wie wenig manche Menschen aus ihrem Leben machten.
Nur noch zwei Seitenstraßen bis zur Birkenallee.
Trotz strammen Anstiegs die schmale Allee hinauf, lag Stefan gut in der Zeit, er würde pünktlich sein. Das makellose Weiß der wunderschön gelegenen Villa tauchte am höchsten Punkt der Kuppe auf. Als erstes der mit Wind- und Wetterhahn verzierte Mast auf dem schiefergedeckten Kuppeldach über der Bibliothek, dann die vier mannshohen Kaminabzüge in der Mitte vom Dach, und zuletzt die Mastspitzen zweier runder, mit Kegeldach versehener Erker. Noch höher gelegen, verteilten sich nur noch die Gebäude von Krankenhaus, Altenheim und Psychiatrie am Horizont. Wie Stehlen zeichneten sich die grauen, tristen Ideen der Architekten gegen das Kornblumenblau des Himmels ab.
Kaum, dass Stefan die ersten Stufen der schweren Sandsteintreppe betreten hatte, öffnete sich die Tür, und ein exzellent gekleideter Herr mit grauen Schläfen tauchte in imposanter Größe vor ihm auf. Sein Vater!
»Fünf Minuten vor der Zeit, sind des braven Mannes Pünktlichkeit! Bravo, mein Junge!«
Mit diesen Worten voll des Lobes wurde er stets begrüßt; jedenfalls dann, wenn es verdient war, aber das war meistens der Fall gewesen.
»Was gibt es denn heute zu essen?«, fragte er, mit einem Auge in die Küche schielend.
»Lass dich überraschen Junge, deine Mutter hat sich mal wieder selber übertroffen!«
Stefan hatte seine Frage mehr aus Verlegenheit gestellt, denn wäre sein knurrender Magen tatsächlich an einer Antwort interessiert gewesen, ein Blick auf den im Flur ausgehängten Menüplan hätte ausgereicht – eine Idee seines Vaters, die nicht nur vor unnötigen Ausgaben schützte, sondern zudem den Vorteil besaß, dass man seine außerhäuslichen Essgewohnheiten darauf abstellen konnte.
Der erlösende Gongschlag, der das Essen ankündigte, schepperte durch die hohen, ebenfalls weiß getünchten Räume.
»Carl, Stefan, kommt ihr zu Tisch?«, mischte sich die Aufforderung der Hausherrin dazwischen. Ihre Stimme klang dabei ähnlich bestimmend, wie die ihres Mannes, dennoch hätte man dieser Stimme noch eine Gegenfrage zugetraut.
Das Esszimmer zeigte einen nüchternen, funktionell durchdachten Aufbau, auch ein Fremder hätte seinen zugedachten Stuhl am Tisch ohne Schwierigkeiten gefunden. Die rote Linie, wie sie in größeren Städten üblich ist, um bestimmte Gebäude leichter ausfindig machen zu können, konnte man beinahe ›sehen‹. Wie auf ein geheimes Kommando nahmen die Köhlers ihren Platz ein: Vater Köhler am Kopfende, Mutter und Sohn sich gegenübersitzend. Wortlos streckte das Familienoberhaupt seinen Teller in die Tischmitte, und eine Kelle der köstlich duftenden Rindfleischsuppe ergoss sich ins teure Porzellan. Stefan kümmerte sich derweil um den Wein und achtete peinlichst darauf, jedes Glas mit der gleichen Menge zu beschicken. Dann reichte auch er seinen Teller zur Tischmitte. Eva, seine Mutter, kannte das Prozedere, und sie agierte äußerst geschickt darin, die winzige Bevorteilung nicht auffallen zu lassen, denn besonders viele Fleisch- und Markklößchen lagen eingerahmt von springenden Hirschen und anderen Motiven aus der Jagd auf seinem Teller.
Andächtige Stille vermischte sich mit kulinarischer Erwartungshaltung. Dann folgte die obligatorische Frage von Herrn Köhler, wie es in der Schule gewesen sei, was von den übrigen Familienmitgliedern als Synonym für Guten Appetit aufgefasst werden konnte.
»Das Orbitalmodell werde ich nie begreifen!«, antwortete Stefan genervt. »Wusstest du, dass es im Atom Räume gibt, die es aber eigentlich doch wieder nicht gibt? Gemeinschaftskunde und Geschichte liegen mir mehr, aber das weißt du ja.«
»Hauptsache du machst dein Abitur! Das Wie interessiert später keinen mehr. Du willst doch noch in Richtung Wirtschaft studieren?«, schielte ein gestrenges Augenpaar über den silbernen Brillenrand hinweg, wohl keine verneinende Antwort zulassend.
»Natürlich!«
Er schien beruhigt.
»Wenn du Probleme in Chemie hast, kann ich mir Dr. Römmler ja noch mal zur Seite nehmen, der ist in meinen Augen sowieso ein Spinner. Der machte früher schon die verrücktesten Dinge und stand nie so recht auf dem Boden der Tatsachen. Was hätte der aus sich machen können? – Träumer!«
Stefan merkte, wie sich die Erregung seines Vaters langsam steigerte.
»Schmeckt es euch?«, mogelte sich seine Mutter dazwischen, wohl schon ahnend, wie sich das Gespräch würde weiterentwickeln.
Beide nickten, und die anfängliche Ruhe kehrte wieder ein.
»Politisch faselt der Römmler neuerdings immer von so einer neuen ›grünen‹ ökologischen Bewegung«, griff Stefan das Gespräch wieder auf.
»Pah, gerade der muss in Politik machen?«, zischte sein Vater. »Immer nur dagegen, das ist alles, was dahintersteckt. Hauptsache dagegen! Sieh dich doch mal um, wo das hinführt, wenn jeder machen kann, wozu er lustig ist. Sieh sie dir doch an, diese ziellosen Nichtstuer. Zu fein, um sich die Hände schmutzig zu machen. Und wo führt das hin? Immer nur her mit den Gastarbeitern, kommt ruhig alle in Scharen zu uns, wir haben ja Platz genug, wir haben ja schließlich noch was gut zu machen! Aber es gibt für alles eine Rechnung, ihr werdet –«
»Es gibt noch Nachtisch!«, suchte die Stimme Eva Köhlers Schlimmeres zu verhindern.
»Oh ja, gern, mmh, Eis mit Kirschen«, fing Stefan den Ball auf.
Für den Moment ruhten die Schwerter in ihren Scheiden, und es war nur mehr das Klappern der Löffel in den gläsernen Schüsseln zu hören. Der Eindruck unendlicher Harmonie, so als würde vom selben Blatt gespielt, stellte sich ein.
»Wenn ihr nichts dagegen habt, werde ich mich jetzt in die Kaminecke zurückziehen«, sagte das Familienoberhaupt mit immer noch hochrotem Kopf und eher feststellend als fragend, denn es war stets die gleiche Zeremonie, mit der er das Esszimmer verließ. Dies waren dann auch die Momente, in denen sich Stefan in sein Zimmer zurückziehen konnte, ohne dass es weiterer Begründungen bedurft hätte. Mit dem Gedanken, Benny noch anrufen zu wollen, schlenderte er die Treppe hinauf.
Stefans Bett knarrte wie ausgedörrte Dielenbretter. Ein antikes Knarzen, so als wenn der schlurfend wuchtige Gang eines Drei-Zentner-Mannes deren rostige Nägel aus ihren Löchern treibt. Dabei werden sich die im eichenen Bettgestell bohrenden Holzwürmer die Bäuche unter den schmächtigen zweiundsiebzig Kilo gehalten haben, als Stefan sich auf die Seite rollte. Todmüde war er in dieses Monstrum von Schlafstätte gefallen – ein vom Dachboden gerettetes Erinnerungsstück an seine geliebten Großeltern väterlicherseits. Vom Großvater in eigener Werkstatt getischlert, genoss es einen Ehrenplatz unter der Dachschräge. Nur noch verschwommene Bilder aus den Augen eines Vierjährigen vermochte Stefan mit der warmen Stimme und dem weichen Rauschebart zu verknüpfen – die einzige und letzte Beziehung zu seinem Großvater; und dazu totgeschwiegenes Thema der Köhlers.
Erschrocken wachte Stefan auf. Mit halb geöffneten Augen schielte er auf den Wecker und erschrak: Viertel nach fünf, später Nachmittag! Verdammt! Benny!
Er schleuderte die Wolldecke zur Seite, sprang auf und lugte zum Fenster hinaus. Der Blick führte über die Allee und schiefergedeckte Walmdächer hinweg, stadtauswärts in den Süden hinein. Es blieb schon deutlich länger hell, unaufhörlich knabberte sich der Tagbogen der Sonne mit jedem Aufgang ein Stückchen weiter am Horizont voran. Und anders, als die Tage zuvor um diese Zeit, fieberten die Straßenlaternen ungeduldig ihrer Schicht erst noch entgegen. Die Luft lag für die Jahreszeit viel zu warm wie ein Schleier verbrauchten Atems auf der Haut, und ein mutiges Zizibäh, Zizibäh der emsigen Kohlmeisen erfüllte die noble Wohngegend mit erstem, zaghaftem Leben. Vereinzelt schlendernde Menschen trugen ihre Mäntel zumeist offen, und wie in jedem nahenden Frühjahr würde es nicht mehr lange dauern, bis die ersten Sonnenanbeter in Scharen und mit einem Eis in der Hand entlang der Birkenallee in den nahegelegenen Stadtpark würden strömen. Noch aber standen nackte Bäume rechts und links mit hängenden Köpfen traurig Spalier über einer Promenade, die unberührt und tot wie ein straßengrauer Gletscher zwischen den Häuserzeilen lag. »Eine merkwürdige Einrichtung sind diese Jahreszeiten«, fluchte er stumm durchs Sprossenfenster der wenigstens temperaturunabhängigen Doppelverglasung hindurch.
Der Wind hatte leicht zugenommen, und die Zweige des mächtigen Baumes, der stolz direkt vor seinem Fenster in die Höhe ragte, klatschten wie nasse Handtücher gegen die Scheiben. Benny hatte ihn des Öfteren danach gefragt, was es denn für eine Art Baum sei, wegen seiner so riesig gewachsenen Blätter und den merkwürdig langen Stängeln, die daran hingen, aber Stefan hatte dieses Problem nie wirklich interessiert, ihn nervte einzig das Klatschen gegen die Scheibe.
Seine Hand griff zum Telefon, das Freizeichen ertönte, und sein Zeigefinger drehte die Wählscheibe: 4-2-2-5-3
»Jaaa?«, stöhnte es verschlafen am anderen Ende der Leitung.
»Hi Benny, ich bin’s, Stefan.«
»Hi! War blöd heute Morgen –«, kam Benny sofort auf den Streit vom Vormittag zu sprechen.
»Was soll’s«, fuhr Stefan dazwischen.
»Hast du schon einen Plan für heute Abend?«, fragte Benny, nun wohl endgültig wach geworden.
»Eigentlich nicht, ich muss noch Chemie und Englisch pauken. Du weißt ja, ich –«
Diesmal ließ Benny ihn nicht ausreden.
»Schade, ich dachte wir könnten vorher noch deine Tischtennisplatte malträtieren, die anderen maulen auch schon.«
»Nee, lass mal. Außerdem musst du dich ja sicher um Moni kümmern?!«
Stefans Sarkasmus war unüberhörbar.
»Hör mal zu, Kumpel, Moni ist zwar meine Freundin, das heißt aber noch lange nicht, dass wir Tag und Nacht zusammenhocken. Und wegen Englisch und Chemie mach dir mal keine Sorgen, du hast bisher immer alles gepackt!«
Benny hatte Stefans heimlichen Neid in Bezug auf seine hübsche Freundin anscheinend nicht bemerkt, sonst hätte er seine ›höhere Rangstellung‹, was die Eroberung von Mädchen anging, ohne Zweifel weidlich ausgekostet.
»Okay, dann lass uns heute Abend ins SKY gehen, viel mehr Möglichkeiten haben wir ja eh nicht.«
»Alles klar, Alter. Dann bis später.«
»Bis später. Und grüß Moni von mir.«
Benny hatte längst aufgelegt. Wie so oft fühlte Stefan sich und seinen Standpunkt nicht richtig verstanden. Obwohl Benny sein bester Freund war, kam er mit dessen flapsiger Lebenseinstellung oft nicht zurecht. Sein Blick fiel in den Spiegel über der Kommode, in deren Schubladen frische Socken und Unterwäsche sinnvoll von hinten nach vorne durchrückten. Was sollte falsch daran sein, lohnendere Ziele vor Augen zu haben? Genervt legte er den Hörer auf die Gabel zurück, kramte nach seinem Englischbuch, wenigstens ein paar Vokabeln wollte er noch durchgehen – ein holpriges Pflaster auf der Zielgeraden, wo es durchaus noch Löcher zu stopfen gab. Und die Geschichte um Jekyll and Hyde war ja nicht einmal uninteressant, musste er zugeben – wenn nicht jetzt, wann also dann?
»Wir sind wieder da … aa … a …!«, echote die Stimme seiner Mutter aus Richtung Foyer die Treppe herauf, schrill, nur langsam verebbend. Erst kürzlich hatte ein eigens zu diesem Problem bestellter Innenarchitekt seinen Eltern geraten, die kahlen, nackten Wände mit Bildern, am besten mit Vorhängen oder Wandteppichen zu schmücken, um überlagerten Hall zu vermeiden und damit für eine angenehmere Raumatmosphäre zu sorgen.
»Kommst du zum Essen?«, machte nun auch die Stimme seines Vaters auf diesen für die Bewohner des Hauses aus innenarchitektonischer Sicht nicht tragbaren Zustand aufmerksam.
Stefan gehorchte.
*
Die rote, mit Chromteilen verzierte Kreidler Florett, bog knatternd in die schlecht beleuchtete Seitenstraße ein. Etwa hundert Meter weiter verriet das pulsierende Licht blauer Neonröhren den Treffpunkt der meisten Jugendlichen der Umgebung: SKY schrieben sie in meterhohen Buchstaben an die Wand der alten Fabrikhalle.
Dutzende von Motorrädern, Mopeds, Mofas und Fahrrädern reihten sich im Eingangsbereich der Diskothek aneinander, aber Stefan hatte es stets vorgezogen, noch ein Stückchen weiter zu fahren, um sein Moped auf einem der Privatparkplätze Adolfs zu parken. Dessen Grundstück war elektronisch gesichert, und außerdem hatte es Adolf immer besonders gefreut, wenn Stefan auf diese Weise außer der Reihe bei ihm vorbeischaute. Zufällig hatte er einmal mitbekommen, wie Adolf und sein Vater sich über dessen Tochter Melanie und über ihn selbst unterhalten hatten. Was für ein schönes Paar sie doch wären und wie gut sie zueinander passen würden, hatte er bruchstückhaft mitbekommen. Nun ja, Stefans halbherzige Suche nach einem ›Rahmen‹ für dieses Bild, versprach da weniger Erfolg.
Es war kurz vor zehn, als Stefan drei glänzende Markstücke für den Eintritt auf den Tisch des Kassierers chippte. Dieses Geld hatte ihm stets leidgetan, zumal sich der Preis exklusive eines Getränks verstand. Moni, Michael, Bea und die anderen aus seiner Clique waren schnell ausgemacht, und er trottete in ihre Richtung.
»Du kommst gerade rechtzeitig!«, spritzte Michaels feuchte Aussprache ihm direkt ins Gesicht, so als wenn ein Auto durch die im Bordstein liegende Pfütze prescht. »Siehst du die kleine Blonde da drüben an der Box? Die ist allein hier! Hab ich alles schon abgecheckt! Man, die ist heiß!«
Alle aus der Clique hatten manchmal Schwierigkeiten mit der vulgären und ungehobelten Ausdrucksweise Michaels, aber Stefan war mit der Zeit ein wahrer Meister darin geworden, sich mit dem aufgesetzten Lächeln eines vorgetäuschten potenziellen Testosteron-Kumpels aus seiner Umklammerung zu lösen.
»Wo ist Benny eigentlich?«, half ihm seine ernst gemeinte Frage aus den Fängen noch kommender verbaler Entgleisungen heraus.
»Wo soll der schon sein?«, leierte Michael, seine für Stefan bestimmte Blondine wohl abgehakt zu haben, »der kommt doch immer zu spät!«
»Na, ich werd mir dann mal erst was zu trinken besorgen«, beendete Stefan das Gespräch mit dem sicheren Gefühl, dieses Duell für sich entschieden zu haben, rollte im Herumdrehen noch einmal mit den Augen, um sich dann durch den Klumpen Jugendlicher bis hin zum Tresen zu wühlen. Hälse von Bierflaschen und bis zum Rand gefüllte Gläser tanzten wie Bojen auf einem Meer sich anschreiender und schwitzender Körper. Sein Gesichtsausdruck verfinsterte sich zusehends.
»Wer ist dir denn quer gekommen«, stolperte Benny ihm in den Rücken, als dieser sichtlich erleichtert ebenfalls sein Ziel erreicht hatte. »Lass mich raten, Michael, stimmt’s?«
Stefan zog den rechten Mundwinkel hoch.
»Welche war’s denn diesmal?«
»Die Blonde da drüben an der Lautsprecherbox«, warf er seinen Kopf unauffällig über die Schulter, ließ sich seine Verlegenheit aber nicht anmerken.
»Na, die ist aber auch ein Geschoss!«, witzelte Benny, während er seine Hand auf Stefans Schulter legte. »Aber lass mal, du machst das schon, auf deine Art.«
Diesmal war der linke Mundwinkel an der Reihe – die Hand seines Freundes schmerzte irgendwie, drückte ihn nieder zu dem Gedanken, noch keine Freundin gefunden zu haben. Dabei hatte er vor jedem Diskothekenbesuch in den Spiegel geschaut und seine dunkelbraunen Locken mit Haarspray gebändigt: gepflegt und ordentlich, dazu gut gekleidet, was sich von selbst verstand. Was sollte daran falsch sein? Obwohl er sich mittlerweile sicher war, dass die meisten der gepuderten und bemalten Mädchen inmitten der Pulks der Jungen anscheinend genau das Gegenteil zu favorisieren schienen. Aber sie würden schon Interesse an ihm zeigen, wenn er nur erst Leitender einer kleinen Firma wäre, dann würden sie schon kommen; in Sachen Geld sind sie dann doch wieder alle gleich. Warum also Gedanken daran verschwenden? Und schon liefen wieder ruhigere Wellen eines genugtuenden Lächelns über seine Lippen.
Das junge Mädchen hinter der Theke arbeitete schnell und an mehreren Baustellen gleichzeitig. Sie servierte, sprach mit dem Kollegen in ihrem Rücken und nahm schräg gegenüber eine Bestellung auf; ein Bier für Benny und eine Cola stellte sie Stefan direkt vor die Nase. Stefan bezahlte, nahm Glas und Flasche und wandte sich ab, ohne auf das freundliche Pferdeschwanzlächeln reagiert zu haben. Schließlich wurde das Mädchen dafür bezahlt, und jede Form von Mitleid wäre fehl am Platz gewesen. Mit den Getränken in der Hand watete er durch einen am Boden wabernden Nebel aus Trockeneis, und für die gefühlte Dauer einer Expedition im nebelverhangenen Regenwald, erinnerte er einen Abend im Athena, wohin er zusammen mit seinen Eltern an Adolfs Geburtstag eingeladen worden war. Sein Vater hatte einen längeren Disput über den Sinn und Unsinn von Trinkgeldern mit seinem Onkel gehabt, brachte es seinen Vater doch regelmäßig auf die Palme, wenn Bedienstete und Kellner bedauert wurden, obwohl sie doch lediglich ihrer Arbeit nachgingen; genau dafür waren sie schließlich eingestellt worden.
Und genauso sah Stefan es auch!
Benny riss ihm das Bier förmlich aus der Hand, so als habe er den Gärungsprozess in Echtzeit abwarten müssen. Er leerte die Flasche in einem Zuge. Bea und Moni waren derweil mit ihren Freunden beschäftigt, und ein Presslufthammer hätte die vier wahrscheinlich genauso in Stimmung gebracht, wie es die stampfenden Bässe aus den von den Decken abgehängten Lautsprecherboxen zu tun vermochten. Michael hatte – in Gott sei Dank ausreichendem Abstand – alle Hände voll damit zu tun, die Prärie nach Frischfleisch abzusuchen, während Benny seine leere Flasche mit aufgeblasenen Augen entgeistert mehrfach auf den Kopf und wieder zurückdrehte. Stefan wäre am liebsten wieder nach Hause gefahren. Stattdessen kämpfte er sich mehr aus Langeweile nochmals durch Meer und Regenwald bis an den Tresen heran – ein noch beschwerlicherer Weg als zuvor. Dicht gedrängt standen die Schaulustigen am sicheren Ufer der Tanzfläche, und notenvergebende Augenpaare starrten in die hüpfende Menge aus Schminke und Schweiß. Er ertappte sich dabei, es für den Bruchteil einer Sekunde ihnen gleich getan zu haben, insgeheim mit der Erwartung, vom sprichwörtlichen Blitz aus den Augen eines Mädchens getroffen zu werden. Nur so hätte er es sich vorstellen können, bereits zu jenem Zeitpunkt eine Freundin zu haben – schließlich standen zunächst wichtigere Aufgaben an. Nur so wäre er bereit gewesen, seinen Gefühlen den Vorrang zu geben, aber bestimmt nicht aus Neid, oder gar, weil es chic zu sein schien.
»Was darf’s denn sein?«, riss ihn das Pferdeschwanzlächeln hinter dem Tresen aus seinen Gedanken.
»Äh, geben sie mir zwei Bier, zwei Pernod-Cola, einen CC und eine Cola pur bitte«, brüllte seine Stimme gegen das Gekreische, Dröhnen und rhythmische Hämmern der Umgebung an. Im Gegenzug wurde seine exakt mittig gefaltete Verzehrkarte vom Kugelschreiber der netten Bedienung – und in scharfem Kontrast zu ihrem freundlichen Lächeln – erbarmungslos bis zum Ende hin durchgestrichen. Mit den Flaschen zwischen Mittel- und Zeigefinger geklemmt, und zwei Gläsern gegeneinander gedrückt, drehte er sich mit angewinkelten Armen in Richtung Benny herum.
Ein strahlend blaues Augenpaar funkelte ihm entgegen!
Nicht etwa das von Benny, nein! Dieses, wie Sternschnuppen in alle Richtungen gehende, kobaltblaue Funkeln, gehörte einem Mädchen, das sichtlich Schwierigkeiten hatte, sich hier am Tresen zu behaupten. Wie zur Salzsäule erstarrt, hielt Stefan seine Fracht noch immer eisern in Händen, fühlte aber sein Kinn wie mit Blei beladen nach unten hängen.
»Soll ich die Bestellung noch mal bei dir aufgeben?«, blökte ihn Benny von der Seite an.
»Was, nein, ich bestell schon«, faselte Stefan, gar nicht merkend, wie ihm sein Freund Flaschen und Gläser vorzeitig aus den Händen nahm.
»Bringst du den Rest, oder soll ich nach deinem Butler läuten?«, fügte er spöttisch hinzu und trabte los in Richtung seiner Freunde.
Stefan hatte seine Worte nur im Unterbewusstsein registriert und starrte immer noch in das leuchtend blaue Augenpaar. Fast mechanisch führte er seinen Arm nach hinten und fingerte nach dem Rest der Bestellung. Auch sein Gegenüber schien wie gefesselt, bis das Klirren der Gläser ihn augenblicklich aus dem tranceähnlichen Zustand riss. Erschreckt fuhr er herum und sah die Bescherung:
»Mist!«, entwich es seinen Lippen. Er bekam ein Tuch gereicht und wischte sich notdürftig über die Hände. Sekunden vergingen, bis er seine Gedanken geordnet hatte, und schnellte dann erwartungsvoll um hundertachtzig Grad herum.
Er traute seinen Augen nicht, das strahlend blaue Funkeln, das Mädchen, zu dem es gehörte, war nicht mehr da!
Enttäuscht zückten seine Fingerspitzen zum zweiten Male die Verzehrkarte. Angewidert verzog er sein Gesicht, weil Cola und Pernod wie Leim auf seinen Händen klebten. Mit der neuen Ladung schlängelte er sich hinüber zu seinen Leuten, die ihn mit großem Hallo bereits sehnsüchtig erwarteten. »Jetzt bloß kein dummer Spruch von Benny oder Michael«, dachte er im Stillen und reichte die Gläser in die Runde. Gott sei Dank war David Bowies neue LP Heroes hitziges Thema.
Die Musik um ihn herum wurde automatisch leiser in seinem Kopf, als er die Szene von zuvor zu resümieren versuchte.
Er stockte!
Seine gewohnt flüssige Gedankenkette geriet ins Stottern, so wie der Motor sich beim letzten Tropfen Benzin zu verschlucken scheint. Was war anders gewesen als sonst? Er hatte sich doch schon öfter Auge in Auge mit einem Mädchen befunden. Aber noch nie war er derart beeindruckt gewesen. Waren es ihre leuchtend blauen Augen? Ihr schulterlanges, schwarzes Haar? Ihre Kleidung? Oder vielleicht ihr unbeholfenes und zurückhaltendes Auftreten? Unruhig lehnte er an der von innen beleuchteten Säule aus fingerdickem Plexiglas. Mit leerem Blick beobachtete er das Farbenspiel der darin stetig emporsteigenden Wasserblasen. Abwechselnd winkelte er mal das eine, mal das andere Bein gegen die Säule an. Der Gedanke, das Mädchen noch in seiner Nähe zu wähnen, ließ ihn nicht mehr los. Dann sah er in ausreichender Entfernung seinen Freund Benny ein volles Tablett in die Runde reichen – das war die Gelegenheit, um unbemerkt an den Ort des Geschehens zurückkehren zu können. Dennoch schaute er mehrere Male hinter sich, um sicherzugehen, dass ihm auch niemand folgte; jede Erklärung seines Vorhabens hätte unweigerlich dumme Ratschläge und peinliche Späße auf seine Kosten bedeutet.
Vor der Theke war inzwischen Ruhe eingekehrt, der erste Durst war bei Dränglern und den ganz Eiligen gestillt. Stefan fixierte den Tresen, musterte das nähere Umfeld. Aufgesetzt gelassen schob er sich auf einen der freien Barhocker und fuchtelte mehr aus Alibigründen mit seiner Karte herum, was das freundliche Lächeln hinter der Theke sofort registrierte. Spontan entschied er sich für ein Pils vom Fass, dachte im selben Moment aber an sein Moped – in Sachen Alkohol war er stets stolz auf seine Prinzipien gewesen. Entscheidungen aus dem Bauch heraus waren seine Sache nicht. Hatte er sich vorher noch die Anonymität des Gedränges zunutze machen können, fühlte er sich jetzt wie das scheue Reh auf der Lichtung. Verunsichert rutschte er auf seinem Hocker vor und zurück, steckte abwechselnd mal eine, mal beide Hände in